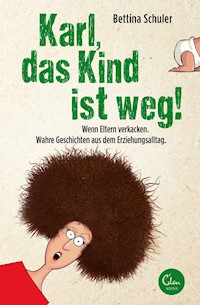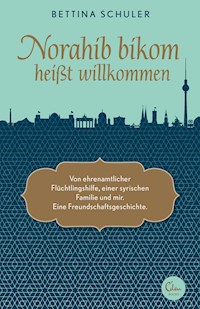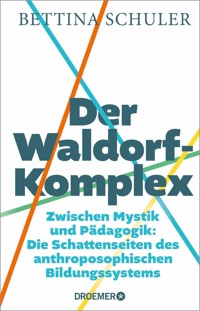
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine gefährliche alternative Lehre: Was in Waldorfschulen wirklich auf dem Lehrplan steht. Lehrermangel, belastete Schulen und Frontalunterricht – beim Blick auf das staatliche Schulsystem scheinen die freien Schulformen eine gute Alternative. Viele Menschen in Deutschland haben ein sehr positives Bild von Waldorfschulen, die wenigsten kennen jedoch die weltanschauliche Basis der anthroposophischen Pädagogik. Die ehemalige Waldorf-Schülerin und Journalistin Bettina Schuler zeigt: Aufgrund ihrer oft antiwissenschaftlichen und autoritären Grundierung birgt die vorgeblich weltoffene Erziehungsmethode der Waldorfschulen Gefahren für die freie Entwicklung der Kinder – und in letzter Konsequenz für die Demokratie. In ihrem klugen Debattenbuch plädiert sie für einen konstruktiv-kritischen Blick auf Waldorfschulen, der das wichtigste Ziel nicht aus den Augen verliert: bessere Bildung für unsere Kinder. Mit Expert*innenbeiträgen von Düzen Tekkal, Katharina Nocun, Ciani-Sophia Hoeder uvm.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Bettina Schuler
Der Waldorf-Komplex
Zwischen Mystik und Pädagogik: Die Schattenseiten des anthroposophischen Bildungssystems
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine gefährliche alternative Lehre: Was in Waldorfschulen wirklich auf dem Lehrplan steht.
Lehrermangel, belastete Schulen und Frontalunterricht – beim Blick auf das staatliche Schulsystem scheinen die freien Schulformen eine gute Alternative. Viele Menschen in Deutschland haben ein sehr positives Bild von Waldorfschulen, die wenigsten kennen jedoch die weltanschauliche Basis der anthroposophischen Pädagogik. Die ehemalige Waldorf-Schülerin und Journalistin Bettina Schuler zeigt: Aufgrund ihrer oft antiwissenschaftlichen und autoritären Grundierung birgt die vorgeblich weltoffene Erziehungsmethode der Waldorfschulen Gefahren für die freie Entwicklung der Kinder – und in letzter Konsequenz für die Demokratie. In ihrem klugen Debattenbuch plädiert sie für einen konstruktiv-kritischen Blick auf Waldorfschulen, der das wichtigste Ziel nicht aus den Augen verliert: bessere Bildung für unsere Kinder.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Ein Blick hinter die bunten Fassaden der Waldorfschulen
Das Versprechen: Hier wird Ihr Kind gesehen!
Warum Eltern ihre Kinder auf eine Waldorfschule schicken
Was Waldorfschulen anders machen
Die Realität
Ätherleib, Reinkarnation und Karmalehre
Die Lehre von den Jahrsiebten und ihr Einfluss auf die Waldorfpädagogik
Das Klassenlehrer*innen-Prinzip
Die Temperamentenlehre
Und alle malen das gleiche Bild
Die Waldorflehrer*innen
Das Frauenbild
Die Schulgemeinschaft und ihre Organisation
Die Folgen
Freiheit im Übermaß
Wir gegen den Rest
Natur und geistige Welt als oberste Prinzipien
Esoterik, Naturverbundenheit und Spiritualität
Paternalismus, Elitarismus und Conspirituality
Was ist die Waldorfschule wirklich?
Dank
Für meine Tochter
Ein Blick hinter die bunten Fassaden der Waldorfschulen
Zusammenfassend kann man sagen: Eine Schule ist dann eine Waldorf/Rudolf Steiner Schule, wenn eine Majorität der Lehrer vom zündenden Geist lebt.
Dieser macht Schweres leicht,
Unmögliches möglich und erhellt das Dunkel.
Internationale Konferenz der Waldorfpädagogischen Bewegung1
Wenn ich jemandem erzähle, dass ich auf einer Waldorfschule war, gibt es in der Regel zwei Reaktionen. Erstens: »Dann kannst du ja deinen Namen tanzen.« Zweitens: »Deshalb bist du so kreativ.« Beides trifft nicht zu.
Ich habe keine Ahnung vom Eurythmie-Alphabet. So heißt die anthroposophische »Bewegungskunst«, die unter dem Wort »Namentanzen« bekannt ist. Der Eurythmie-Unterricht war für mich nur ein lästiges Fach auf dem Stundenplan. Mein Engagement ist dementsprechend gering ausgefallen.
Auch meine Kreativität ist nicht auf die Waldorfschule zurückzuführen. Denn ich durfte mich an der Waldorfschule nur im Rahmen der anthroposophischen Vorgaben und Konzepte künstlerisch ausprobieren. Als Kind, das mit Neuer Deutscher Welle, E.T. und Graffiti sozialisiert wurde, hatte ich jedoch kein Interesse an Wachsmalkreide und lautmalerischen Gedichten. Meine Begeisterung an den kreativen Fächern war dementsprechend beschränkt.
Trotzdem hat die Waldorfschule mich stark geprägt. Denn sie war mein zweites Zuhause.
Adventsgärtlein, Michaeli, Jahreszeitentisch – diese Feste und Riten waren ein fester Bestandteil meines Lebens. Und auch wenn es mir peinlich ist: Der Anblick von Engel-Aquarellpostkarten berührt mich immer noch. Denn sie gehören ebenso wie der Duft von Honigkerzen und Lavendelöl zu meiner Zeit an der Waldorfschule. Ein Ort, der für mich mehr eine Gemeinschaft als eine Schule war und an dem traditionelle Werte wie Familie, Moral und gegenseitiger Respekt hochgehalten wurden. Hinzu kam eine Rückbesinnung auf die Natur und ihre Ressourcen, die damals viele Eltern angesichts des Waldsterbens und der Atomkatastrophe von Tschernobyl ebenso sehr ansprach wie heute, in Zeiten des Klimawandels.
Meine Eltern, die während des Zweiten Weltkriegs groß geworden sind, sahen in der Waldorfschule vor allem einen Ort, der ihren Kindern die Geborgenheit und Wärme geben sollte, die sie als Kinder selbst vermisst hatten. Ein Safe Space, an dem die Schüler*innen so sein konnten, wie sie wollten.
Meine Freund*innen, die auf eine öffentliche Schule gingen, sahen das ganz anders. Die Entscheidung meiner Eltern war für sie ein Zeichen dafür, dass ich für die normale Grundschule nicht intelligent genug war. Die Tatsache, dass ich keine Noten bekam und meine ersten Buchstaben mit dicken Wachsmalkreideblöcken in ein A4-Blankoheft schrieb, bestärkte sie in ihrer Ansicht. Sie behandelten mich dementsprechend herablassend.
Ich war neidisch auf ihre Adidas-Turnbeutel, ihre Füller und die linierten Schulhefte. Sie wunderten sich über meinen Eurythmiekittel, meine eckige pentatonische Flöte und den Unterricht auf der Leier.
Wir lebten in zwei unterschiedlichen Welten, und es stand für meine Klassenkamerad*innen und mich außer Frage, dass wir in der besseren lebten. Eine Ansicht, in der uns unsere Lehrer*innen mit ihren herablassenden Sprüchen über die »Staatsschule« bestärkten. Wenn uns die »Staatsschüler*innen« im Bus als zurückgebliebene Ökos beschimpften, lächelten wir nur nachsichtig. Sie wussten eben nicht, wie gut wir es auf unserer Schule hatten. Selbst die spöttische Abwertung, die ich im Sportverein, in der katholischen Kirche und im größeren familiären Umfeld über die Waldorfschule zu hören bekam, führte nur dazu, dass ich mich noch stärker mit meiner Schule identifizierte. Ich war Waldorfschülerin. Und ich war stolz darauf. Denn ich fühlte mich trotz oder gerade wegen der Hänseleien als etwas Besonderes. Weil ich zu den wenigen handverlesenen Kindern gehörte, die für diese Schule ausgesucht worden waren.
Wie gefährlich dieser Elitarismus für unsere Gesellschaft ist, das wurde mir erst während der Corona-Pandemie bewusst. Diese Einsicht war für mich ein schmerzhafter Prozess. Denn sie bedeutete auch den Abschied von einer Gemeinschaft, die mich lange begleitet hat, in der ich sehr viele gute Erinnerungen gesammelt und großartige Menschen kennengelernt habe. Menschen, mit denen ich immer noch verbunden bin und es auch weiterhin bleiben möchte.
Trotzdem ist dieses Buch, auch wenn und weil es kritisch ist, für mich ein Herzensprojekt. Das wissen alle, die mich bei diesem Schreibprozess begleitet haben.
Wir leben in einer Zeit, in der wir mit multiplen Krisen konfrontiert sind. Das bringt viele Menschen an den Rand ihrer Kapazitäten. Sie haben das Gefühl, die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren. Das schürt Ängste, Unsicherheit und den Wunsch nach schnellen Lösungen: der ideale Nährboden für Populist*innen mit einfachen Antworten und Erklärungen.
Wie gefährlich das für unsere Demokratie und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt ist, sahen wir während der Corona-Pandemie. Weder der Staat noch die Wissenschaftler*innen konnten zu Beginn der Pandemie eine Antwort darauf geben, wie sich der Virus entwickeln wird, wann die Hygieneschutzmaßnahmen zurückgenommen werden und ob wir uns jemals wieder die Hände schütteln würden.
Viele Menschen suchten in dieser Zeit Halt in Verschwörungserzählungen, die den Virus verharmlosten und die staatlichen Maßnahmen als Versuch sahen, eine Diktatur zu etablieren.2 Der Glaube an diese Erzählungen und an Fake News führte zu einem starken Vertrauensverlust in die Wissenschaft, traditionelle Parteien und staatliche Institutionen. Ein Misstrauen, das noch immer deutlich zu spüren ist und von Populist*innen ausgenutzt wird, um eine breitere Unterstützung für ihre anti-demokratischen Ideen zu gewinnen.
Die Soziolog*innen Nadine Frei und Oliver Nachtwey führten im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg eine Studie zu den Querdenker-Protesten in Baden-Württemberg durch und stellten fest, dass sie eine starke Verbindung zur alternativen Szene und der anthroposophischen Bewegung aufwiesen.3
Das ist nicht weiter verwunderlich angesichts der Rolle, die die Mystik in den Waldorfschulen spielt. Denn deren Pädagogik beruht auf einer »Geheimwissenschaft«, der Anthroposophie. Diese fördert mit ihrer Wissenschaftsskepsis Misstrauen gegenüber staatlichen Institutionen und, durch die Lehre von geheimen Welten, den Glauben an »alternative Fakten« und verborgene Mächte.
Viele Eltern, die ihre Kinder auf eine Waldorfschule schicken, sind sich dieser Verbindungen nicht bewusst. Für sie sind die Geschichten von Zwergen, heilenden Edelsteinen und schützenden Engeln nur ein unwichtiges, lästiges Nebenprodukt, das sie für das Wohl ihres Kindes bereit sind, in Kauf zu nehmen.4Das bisschen Esoterik wird ihrem Kind schon nicht schaden. Für andere sind die Geschichten über Engel und Gnome nur niedliche Märchen, die den Kindern im Unterricht von den Lehrer*innen erzählt werden. Das dachte ich auch.
Bis Corona ausbrach und mir Bekannte aus dem anthroposophischen Umfeld ohne medizinischen Hintergrund erklärten, dass meine Tochter durch die Impfung unfruchtbar werden würde. Andere wiederum warnten mich vor einer Genmanipulation, die durch die Impfung entstehe und Spätfolgen wie Leukämie und Brustkrebs mit sich bringe. Wenn ich es wagte, zu widersprechen, oder einwarf, dass es in schwierigen Zeiten wie diesen besser ist, sich auf die Einschätzung von Expert*innen zu verlassen, wurde ich in diesem Freundeskreis verwundert angeblickt. Und nach einer kurzen Pause sagten viele von ihnen: »Du bist doch auf einer Waldorfschule gewesen. Wie kannst du dich da nur impfen lassen?«
Und tatsächlich ist das Thema Impfen in meinem Leben schon immer ein heikles Thema gewesen. Gerade während meiner Schulzeit in den 1980er-Jahren war es schick, sein Kind nicht zu impfen und ihm, wenn es krank war, nasskalte Tücher um die Waden zu wickeln, statt ihm Fiebersaft zu geben.
Ich habe meine Tochter trotzdem gegen alles geimpft und mich bei dieser Entscheidung auf den Rat meines Kinderarztes verlassen. Das Thema Impfen war für mich damit erledigt. Bis Corona ausbrach und alle Vorurteile, Ängste und Bedenken in meinem anthroposophischen Umfeld wieder hochkochten. So extrem, dass Freundschaften daran zerbrachen.
Ich fragte mich: Warum ist das Impfen bei den Anthroposoph*innen eigentlich so verpönt? Und ist das Durchleben von Krankheiten wirklich ein Booster für die Entwicklung des Kindes? So hatte ich es in meinem Kopf abgespeichert. Stimmt es, dass durch das Erlernen der russischen Sprache die Willensbildung angeregt wird?
Oder sind das alles nur Märchen, die ich in der Waldorfschule gelernt habe?
Um mehr zu erfahren, begann ich, Rudolf Steiner zu lesen, und war entsetzt. Denn das Welt- und Menschenbild, das Steiner in seinen Texten beschrieb, korrespondierte in keiner Weise mit meinem.
Mehr noch: Viele Lehrinhalte und Methoden, die ich in meiner Schulzeit stillschweigend hingenommen hatte, wurden durch meine Steiner-Lektüre in ein anderes Licht gerückt. Ich begann nach und nach zu verstehen, inwieweit die Anthroposophie den Glauben an Verschwörungserzählungen fördert, und welche Ängste und psychologische Erklärungsmuster dahinter liegen. Ich begriff, was der Grund dafür sein könnte, dass viele meiner anthroposophischen Freund*innen in einer Zeit, in der alles Gewohnte aus den Fugen geriet, Halt in Verschwörungserzählungen suchten. Und ich erkannte, dass sehr viele Annahmen über die Welt und mich selbst auf das anthroposophische Welt- und Menschenbild und dessen Vorstellungen und Werte zurückzuführen sind.
Meine eigene Ahnungslosigkeit erschreckte mich. Ich fragte mich, ob ich die einzige Ex-Waldorfschülerin bin, die so wenig über Rudolf Steiner und die Anthroposophie wusste. Ich war es nicht. Die meisten ehemaligen Waldorfschüler*innen, mit denen ich im Verlauf meiner Recherche sprach, hatten ähnlich wie ich nur eine diffuse Ahnung von der Anthroposophie. Wenn ich konkret nachfragte, warum der Zahnwechsel bei der Einschulung an der Waldorfschule eine Rolle spielt, weshalb Waldorfschüler*innen mit Wachsmalkreide statt mit Füller schreiben lernen und warum so viele Märchen und Fabeln in der Schule erzählt werden, hatten sie keine Antwort. Fast niemand von ihnen hat jemals einen Text von Rudolf Steiner gelesen oder sich ausführlich mit der Anthroposophie und deren Welt- und Menschenbild beschäftigt.
Eine Beobachtung, die kein Zufall ist. Denn obwohl die Anthroposophie die Grundlage für die Waldorfpädagogik und damit auch für alle Unterrichtsfächer ist, wird sie an der Waldorfschule nicht gelehrt. Die wenigsten Eltern, die ihre Kinder an einer Waldorfschule anmelden, wissen, dass sich hinter der ganzheitlichen Erziehung ein ganz spezielles Menschenbild verbirgt, das Karma und Reinkarnation als Fakt ansieht.
Auch mir selbst ist das erst während meiner Beschäftigung mit der Anthroposophie bewusst geworden.
Fast niemand, mit dem ich während meiner Recherchen sprach, wusste, was hinter der Waldorfpädagogik steht. Viel Kunstunterricht, keine Noten und Eurythmie, das waren die Assoziationen, die den meisten als Erstes einfielen. Viele hatten ein positives Bild von den Waldorfschulen. Sie hielten Waldorfschulen für reformpädagogische Schulen, die viel Wert auf Kreativität und Naturverbundenheit legen und in denen die Kinder ohne Leistungsdruck lernen können. Eine Privatschule, die mit ihrem Versprechen einer freiheitlichen und individuellen Erziehung, bei der das Kind im Mittelpunkt steht, vor allem ein linksliberales Bürgertum anspricht.
Kaum jemand wusste, dass Rudolf Steiner ein selbst ernannter »Hellseher« war, der die Anthroposophie »gesehen« hat. Karma, Reinkarnation und »Menschen-Heuschrecken«,5 niemand von ihnen brachte diese Begriffe mit der Anthroposophie in Verbindung. Den wenigsten war bekannt, dass die Waldorfschulen einen eigenen Lehrplan haben oder dass an der Waldorfschule die Klassenlehrer*innen ihre Schüler*innen bis zur achten Klasse in fast allen Fächern – von Mathematik über Deutsch bis zu Physik – unterrichten.
Die Grundeinschätzung meiner Gesprächspartner*innen war: Waldorfschulen weichen in Teilen von der Norm ab, sind mitunter sogar seltsam, aber am Ende sind diese Besonderheiten doch harmlos.
Eine Einschätzung, die vielleicht anders ausgefallen wäre, wenn sie das anthroposophische Welt- und Menschenbild und die Waldorfpädagogik besser gekannt hätten.
Dieses Buch soll diese Wissenslücken schließen.
Es wird hinter die bunten Fassaden der Waldorfschulen blicken und das öffentliche Bild mit der Realität abgleichen.
Dafür soll das Welt- und Menschenbild Rudolf Steiners und dessen Einfluss auf die Waldorfpädagogik erklärt werden. Ein Einblick, der nicht nur für Außenstehende, sondern auch für ehemalige und jetzige Waldorfeltern- und schüler*innen spannend ist.
Für mich ist dieses Buch etwas ganz Besonderes. Es ist nicht nur eine Reise in meine Kindheit, sondern auch eine Auseinandersetzung mit einer Weltanschauung, die mir als moralischer Kompass beigebracht wurde, die aber in vielerlei Hinsicht gegen meine eigene innere Überzeugung verstößt. Das war mir jahrelang nicht bewusst. Dieses Buch soll nicht nur aufklären, sondern auch anderen (ehemaligen) Waldorfschüler*innen aufzeigen, wie sehr ihr Verhalten und Denken von der anthroposophischen Erziehung geprägt wurden. Damit sie sich danach selbst wirklich frei entscheiden können, ob diese mit ihrer eigenen Denkweise und Überzeugung korrespondieren.
Schule sollte ein Ort sein, der Kinder zum kritischen Denken erzieht und sie als mündige Bürger*innen in die Gesellschaft entlässt. Dafür müssen den Schüler*innen unterschiedliche Sichtweisen und Ansätze präsentiert werden. Eine Schule, deren Pädagogik darauf angelegt ist, den Schüler*innen durch Didaktik, Methodik und Lehrinhalte implizit und ausschließlich ein bestimmtes Welt- und Menschenbild zu vermitteln, widerspricht meiner Ansicht nach diesem Ansinnen.
Es wird in diesem Buch natürlich nicht nur um die Konzepte gehen, die hinter der Waldorfpädagogik stehen.
Es soll vielmehr gefragt werden, was wirklich in den Waldorfschulen geschieht und was an den vielen – positiven wie negativen – Urteilen über die Waldorfschulen richtig ist und was falsch.
Wird an den Waldorfschulen die Kreativität, so wie es das Klischee will, wirklich mehr gefördert?
Was steckt hinter der freiheitlichen Erziehung, von der in der Waldorfpädagogik immer gesprochen wird?
Und werden die Kinder, wie es die Waldorfpädagogik verspricht, individuell nach ihren Begabungen gefördert?
Wie viel Mitbestimmung haben die Eltern tatsächlich?
Welche Gefahren birgt die schulische Selbstverwaltung?
Gibt es eine Nähe zwischen Querdenker*innen und Anthroposoph*innen?
Und wenn ja, wie lässt sich diese Nähe erklären?
Wie schnell kann sich daraus eine Anschlussfähigkeit an den rechten Rand entwickeln?
Und welche Rolle spielt dabei die Waldorfpädagogik?
Ich habe, um diese Fragen zu klären, zahlreiche Interviews mit ehemaligen Lehrer*innen, Eltern und Schüler*innen geführt. Einige Berichte waren erhellend, andere erschreckend. Viele deckten sich mit meinen persönlichen Erfahrungen. Ich habe mit Erziehungswissenschaftler*innen, Journalist*innen, Religionswissenschaftler*innen und zahlreichen weiteren Expert*innen gesprochen und sie um ihre Einschätzung des Systems Waldorfschule gebeten, um mir ein besseres und objektives Bild davon zu machen.
Ein Aspekt, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist das anthroposophische Frauenbild, über das bisher nur sehr wenig publiziert wurde. Dieses Bild, geprägt von traditionellen Rollenverständnissen und einem überhöhten Mutterideal, kann ebenso wie die anthroposophische Lehre von der Esoterik und der geheimen Welt rasch eine Nähe zum rechten Rand herstellen.
»Die« Waldorfeltern, Waldorfschüler*innen und Waldorflehrer*innen gibt es nicht. Jede und jeder ist anders und macht seine ganz eigenen Erfahrungen.
Es geht in diesem Buch nicht um Pauschalurteile, sondern um das Anstoßen einer grundsätzlichen Debatte über die Grundlagen des Waldorf-Systems, die vor dem Hintergrund meiner Recherchen an vielen Stellen kritisch ausfällt. Denn ganz gleich, wie Sie selbst zu dem System Waldorfschule stehen: Es ist immer lohnend, die strukturellen Hintergründe eines Systems zu hinterfragen. Auch oder gerade dann, wenn der Prozess schmerzhaft ist, weil er alte Sicherheiten infrage stellt und den Schutzraum »Schule« unsicher werden lässt. Doch wir sollten die Grundlagen eines Systems kennen, dem wir die Erziehung unserer Kinder anvertrauen. Auch die der Waldorfschulen.
Keine Waldorfschule ist wie die andere. Die einen Schulen sind mehr, die anderen weniger von der Anthroposophie geprägt. Die Grundlage aller Waldorfschulen ist und bleibt jedoch Rudolf Steiners Gedankenwelt.6
Und diese kann für unsere Kinder und die Gesellschaft gefährlich werden.
Das Versprechen: Hier wird Ihr Kind gesehen!
Waldorfschulen als freigeistige Alternative zur maroden öffentlichen Schule
Man gewinnt dabei, wenn man nicht gleich zankt
oder mit herrischen Gesten auftrumpft.
Stillschweigen ist das sicherste Mittel,
wenn man seine Auffassung ohne Bittergesicht
und Verärgerung vorgebracht hat.
Persönlicher Zeugnisspruch für ein Mädchen der 6. Klasse
Lehrermangel, überlastete Schulen und Frontalunterricht: Das staatliche Bildungssystem steckt in einer Krise, die kurz- oder mittelfristig nicht zu beheben ist. Die Waldorfschule erscheint vielen Eltern angesichts dieser Mängel als eine sinnvolle Alternative zur maroden Regelschule. Gerade in Zeiten, in denen der Druck auf die Kinder immer größer wird und viele Jugendliche sich in der Gesellschaft isoliert fühlen, wirkt eine Schule, an der die Kinder vom Anfang bis zum Ende der Schulzeit in der gleichen Klasse sind und erst spät Noten bekommen, wie eine Oase der Glückseligen.
Dieser Eindruck wird verstärkt durch ein ansprechendes Erscheinungsbild, das im Gegensatz zu dem Zustand steht, in dem sich viel zu viele öffentliche Schulen befinden. Gut ausgestattete Werk- und Kunsträume, Klassenzimmer mit Holzmobiliar und ein Schulhof mit Schulgarten vermitteln ein Gefühl von Geborgenheit, nach dem sich viele Eltern für ihre Kinder sehnen. Der streng reglementierte Gebrauch von digitalen Medien ist für viele Mütter und Väter, die es nicht schaffen, den Medienkonsum ihrer Kinder zu steuern, ein weiterer Pluspunkt, der für die Waldorfschule spricht.
Warum Eltern ihre Kinder auf eine Waldorfschule schicken
Die Rolle der eigenen Schulzeit
Ein weiterer Grund ist oft die eigene, belastende Schulzeit. Ihr Kind, so der Wunsch der Eltern, soll es an der Schule besser haben als sie. Mit mehr Freiräumen und Lehrer*innen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Die Waldorfschule, an der die Schulgemeinschaft eine große Rolle spielt, die künstlerisch-musischen Fächern einen hohen Stellenwert einräumt und an der die Beziehung zwischen den Lehrkräften und den Schüler*innen eng ist, suggeriert den Eltern, dass ihre Wünsche erfüllt werden.
»Meine Mutter ist in der DDR zur Schule gegangen, in einem sehr autoritären Schul- und Gesellschaftssystem«, so Elena Lustig, die in den 1970er- und 1980er-Jahren eine Waldorfschule besuchte. »Sie glaubte, dass mir in der Waldorfschule die kreativen Freiräume und Entfaltungsmöglichkeiten gegeben werden, die sie in der DDR nicht hatte.«
Auch die heute über achtzigjährige Christel1 blickt mit Grauen auf ihre eigene Schulzeit zurück. Sie ging im Nachkriegsdeutschland auf ein katholisches Mädchengymnasium, auf dem sie zum Großteil von Nonnen unterrichtet wurde, die das Pensionsalter schon lange überschritten hatten. Als sie in ihrem Lehramtsstudium das erste Mal mit einer Waldorfschule in Kontakt kam, war sie von der einladenden Optik und Fröhlichkeit der Kinder sofort begeistert. Alexander*, ihr erstes Kind, ging zunächst trotzdem auf eine öffentliche Schule. Am Ende der Grundschulzeit bekam er von seiner Lehrerin eine Empfehlung für die Hauptschule. Christel und ihr Mann teilten diese Einschätzung nicht. »Dann kam uns die Waldorfschule wieder in den Sinn.« Alexander wurde daraufhin dort angemeldet. Die Tatsache, dass es erst ab der 9. Klasse Noten gab, war für sie einer der ausschlaggebenden Gründe. »Mein Sohn war ein Spätzünder. Für ihn ist es gut gewesen, dass er so spät Noten bekam«, erklärt Christel. Praktische Unterrichtsfächer wie Werken, Handarbeiten und Gartenbau seien ein weiteres Argument für die Waldorfschule gewesen. Ihre Tochter, die damals noch in den Kindergarten ging, meldeten sie deshalb direkt an der Waldorfschule an. »Wir sind davon ausgegangen, dass Alexander das Abitur nicht schaffen wird.« Christel und ihr Mann waren deshalb sehr froh darüber, dass ihr Sohn auf der Waldorfschule bereits während seiner Schulzeit einen Einblick in unterschiedliche handwerkliche Berufe bekam. »Ich dachte, dass er später Schreiner wird, denn er hat selbst in seiner Freizeit immer an einem Holzstück gewerkelt.« Christels Kinder wechselten später auf ein Gymnasium. Alexander bestand dort sein Abitur mit einem Durchschnitt von 1,5. Eine Erfolgsgeschichte made by Waldorf.
Geschichten wie die von Christel und ihrem Sohn Alexander sind keine Einzelfälle. Bei vielen Schüler*innen sind Probleme an der öffentlichen Schule der ausschlaggebende Grund für den Wechsel auf eine Waldorfschule. So auch bei den Kindern von Stephanie S. Ihre Töchter Mia und Cara waren bis zum Frühjahr 2023 auf der Freien Waldorfschule Everswinkel. Davor besuchten sie eine öffentliche Schule. Als es dort zu massiven Problemen kam, begann ihre Mutter, sich nach Alternativen umzusehen. Dabei wurde sie sehr schnell auf die Waldorfschule Everswinkel aufmerksam.
»Unser Wunsch war, dass unsere beiden Töchter in einer geschützten Umgebung wachsen und lernen können.« Auf der Waldorfschule, so schien es ihr, war das möglich. »Uns wurde versichert, dass jedes Kind sich dort frei entwickeln kann.« Eine Aussage, die S. positiven Eindruck von der Waldorfschule bestärkte. Die Anthroposophie war für S. kein Grund für die Waldorfschule. »Ich bin davon ausgegangen, dass die Anthroposophie im Unterricht keine Rolle spielt.« Das habe man ihrem Mann und ihr auch im Vorstellungsgespräch suggeriert. »Wir stellten sehr deutlich klar, dass wir keine anthroposophische Vorbildung haben und auch keine wünschen.« Für die Schule sei das kein Problem gewesen.
Bei Christel und ihrem Mann war es ähnlich. Auch für sie spielte die Anthroposophie bei der Wahl der Schule keine Rolle. »Mich hat vor allem die Optik angesprochen«, so Christel, »die bunten Klassenzimmer, das Mobiliar aus Holz und die begrünten Pausenhöfe.« Eine Atmosphäre, in der sie sich von Anfang an wohlfühlte. Dass in jedem Klassenzimmer ein schwarz-weißes Foto von Rudolf Steiner hing, habe sie schulterzuckend hingenommen. Ebenso wie die Elternabende, an denen die Klassenlehrerin ihnen erklärte, in welchem anthroposophischen Entwicklungsstadium sich ihr Kind aktuell befindet. »Mir war einfach nur wichtig, dass meine Kinder gerne in die Schule gehen.« Alles andere sei für sie nebensächlich gewesen.
Für den gebürtigen Engländer Jack* und seine Frau war das Hauptargument für die Waldorfschule vor allem der hohe Stellenwert von Kreativität. Zudem wollten sie ein Umfeld vermeiden, das zu stark auf Leistungsdruck und starre akademische Strukturen setzt. Deshalb schickten sie ihre Kinder nach ihrem Umzug nach Deutschland auf eine Waldorfschule.
Mit ihren Gründen für die Schulwahl stehen Christel, Jack und Stephanie S. nicht allein da: In einer Fragebogenerhebung, die 2012 veröffentlicht wurde, gaben 57,9 Prozent der Schüler*innen an, dass sie sich gemeinsam mit ihren Eltern für die Waldorfschule entschieden haben, weil dort mehr auf die Schüler*innen eingegangen werde. 38,1 Prozent gaben den hohen Stellenwert von Kunst und Musik als Grund für die Wahl der Waldorfschule an. Für 31,8 Prozent war der geringere Leistungsdruck ausschlaggebend. 29,1 Prozent nannten den Aspekt »mehr Freiheit« als Beweggrund. Bei den Quereinsteiger*innen nannten 45,5 Prozent die schlechten Erfahrungen an einer öffentlichen Schule als Begründung. Der Anteil von Quereinsteiger*innen beträgt laut einer aktuellen Studie mindestens 36,6 Prozent. Das heißt, dass etwa jede*r dritte Waldorfschüler*in zuvor eine andere Schulform kennengelernt hat.7 Die Studie wurde unter anderem von dem mittlerweile verstorbenen Erziehungs- und Sozialwissenschaftler Dirk Randoll, der Professor an der anthroposophienahen privaten Alanus Hochschule war, durchgeführt und von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen und der Software AG Stiftung unterstützt. Die Software AG ist unter anderem auch ein bedeutender Förderer der anthroposophischen Medizin.
Was Waldorfschulen anders machen
Kreativität, Schulgemeinschaft, Mitbestimmung der Eltern
Freiheit, Kreativität und Individualität sind also Werte, die für viele Eltern, die ihre Kinder auf eine Waldorfschule schicken, einen hohen Stellenwert einnehmen. Sie haben offenbar das Gefühl, dass die Kinder an der öffentlichen Schule darauf »dressiert« werden, sich innerhalb kürzester Zeit so viel Wissen wie möglich anzueignen, das vor allem leicht abrufbar sein soll. Den Kindern, so die Befürchtung der Eltern, wird dadurch die Möglichkeit genommen, ihre individuellen Begabungen, vor allem diejenigen, die über das übliche Schulwissen hinausgehen, zu entdecken und zu entwickeln.
An der Waldorfschule, so der Eindruck der Eltern, ist das genau umgekehrt. Menschliche Entwicklung und das Erlernen handwerklicher Kompetenz, so scheint es, sind wichtiger als Leistung und das Abfragen von erlerntem Wissen. »Bürokratische, hierarchisch verwaltete Pädagogik« wird dort per se abgelehnt und »als berechtigte Autorität nur das Wesen des Kindes selbst« anerkannt.8 Aussagen, die suggerieren, dass die Kinder individuell betrachtet und entsprechend gefördert werden, damit sie ihr Potenzial bestmöglich ausschöpfen.
Eine Beobachtung, die die Erziehungswissenschaftlerin Ann-Kathrin Hoffmann bestätigt. »Das Image der Waldorfschulen lebt von pädagogischen Pathosformeln wie der ›Erziehung zur Freiheit‹, der vermeintlichen individuellen Förderung der natürlichen, kindlichen Entwicklung und einem Schutzraum vor Noten, Sitzenbleiben und Leistungsdruck«, so die Wissenschaftlerin im Interview für dieses Buch. »Das pädagogische Konzept, gefolgt von der Unzufriedenheit mit der staatlichen Schule«, so Hoffmann, »sind die wesentlichen Pullfaktoren.«
Die Waldorfschule mit ihrem Versprechen, einen Ort zu schaffen, an dem die Schüler*innen ohne Zwang und aus einer intrinsischen Motivation heraus für das Leben lernen können, dockt zudem an das Humboldt’sche Bildungsideal an. Ein Bildungskonzept, mit dem sich die Waldorfeltern, die klassischerweise einen hohen Bildungsgrad haben, sehr gut identifizieren können.9
»Goethe, Herder und Schiller, Theaterstücke, der trojanische Krieg und die Aeneis, die große Faust-Epoche im 12. Schuljahr«, so der Religionswissenschaftler und Anthroposophie-Experte Ansgar Martins im Interview mit mir, »das ist klassische bildungsbürgerliche Kultur, auch wenn sie in Wolle, Filz und lasierte Wandfarben verpackt wird. Man kann sich an der Waldorfästhetik stören, aber die Inhalte knüpfen an Bildungsgut an.«
Ein weiterer Aspekt, mit dem die Waldorfschule an das Humboldt’sche Bildungsideal anknüpft, ist die Betonung einer freiheitlichen Erziehung. Gerade Eltern, die während ihrer eigenen Schulzeit gelitten haben, hoffen darauf, dass ihre Kinder an der Waldorfschule eine bessere und schönere Schulzeit haben werden als sie. Mit mehr Freiheit und weniger Zwängen und Repressionen. Das bestätigten auch die Gespräche mit meinen Interviewpartner*innen.
Der Freiheitsaspekt spielt für die Eltern jedoch nicht nur hinsichtlich der Erziehung der Kinder, sondern auch in Bezug auf die konkrete Ausgestaltung der Schule eine zentrale Rolle. Viele Eltern haben das Bedürfnis, sich aktiv daran zu beteiligen, wie die Schule ihrer Kinder aussehen soll. Die Waldorfschule bietet diese Möglichkeit. Mehr noch: Sie ist sogar gewünscht! Denn die Waldorfschule wird nicht als bloße Lehranstalt, sondern »als Lebensort für Schüler*innen, Eltern und Lehrer*innen verstanden und gestaltet«.10 Waldorfschulen sind entsprechend dieses Prinzips selbstverwaltete Schulen in freier Trägerschaft, die von Eltern und Lehrer*innen strukturell organisiert und geleitet werden.
Jeder Elternteil entscheidet selbst, wie stark er sich in die Schule einbringt. Ob er Kuchen backt, beim Bau des neuen Gartenzauns hilft oder als Vertreter*in in die Bundeselternkonferenz geht. Eine klassische hierarchische Schulstruktur mit einer Schuldirektor*in an der Spitze, die für alles verantwortlich ist, existiert nicht. Stattdessen gibt es eine Vielzahl von Entscheidungsebenen, die unter den Lehrer*innen und der Elternschaft verteilt sind.
Viele Eltern empfinden das als einen Vorteil. Die Eltern haben das Gefühl, an der schulischen Erziehung ihres Kindes teilhaben zu können und der Schule und ihren Entscheidungen nicht »ausgeliefert« zu sein.
Die künstlerisch-handwerklich-musische Erziehung, die an der Waldorfschule einen hohen Stellenwert einnimmt, ist für viele ein weiterer Pluspunkt. Gerade Eltern, die selbst einen kreativen und/oder künstlerischen Beruf ausüben, scheinen von der Waldorfschule angesprochen zu werden. Dementsprechend ist der Prozentsatz solcher Eltern wesentlich höher als an öffentlichen Schulen.11
Das ist nicht weiter verwunderlich, denn im Gegensatz zu den öffentlichen Schulen, an denen außer den beiden Unterrichtsfächern Musik und Kunst in diesem Bereich meist nicht viel mehr geschieht, bietet die Waldorfschule eine Vielzahl an weiteren Fächern wie Handarbeiten, Werken oder Gartenbau. Und natürlich den Eurythmieunterricht. Das berühmt-berüchtigte »Namentanzen«, das in der Anthroposophie als eigene Kunstform verstanden wird. Wobei das Wort »Tanz« schon in die falsche Richtung weist. Denn die Eurythmie hat mit dem üblichen Verständnis von Tanz als Ausdrucksform von Emotionen nur wenig zu tun. Vielmehr geht es nach Auffassung ihrer Fürsprecher*innen in der Eurythmie darum, der Sprache durch unterschiedliche Gebärden die Lebendigkeit wiederzugeben, die durch den bloßen Sprechvorgang verloren geht. Denn »Wo sonst Mund und Kehlkopf sprechen, spricht in der Eurythmie der ganze Mensch«.12 Das Gleiche gilt auch für die Musik.
In der 8. und 12. Klasse wird neben diesen speziellen handwerklich-künstlerischen Fächern zudem noch ein Theaterstück aufgeführt und von jedem/jeder einzelnen Schüler*in eine Jahresarbeit angefertigt.
Die Jahresarbeiten sind ein weiteres Waldorfspezifikum. Die Schüler*innen wählen dafür ein Thema aus, mit dem sie sich über mehrere Monate theoretisch, praktisch und künstlerisch auseinandersetzen. Der Fantasie der Schüler*innen sind dabei keine Grenzen gesetzt, und die Bandbreite der Themen reicht von Demenz über den Bau eines Go-Karts bis zur Analyse der Protestbewegung und ihrer Musik. Die Ergebnisse werden später öffentlich ausgestellt und sind oft wirklich beeindruckend.
Die Schulgemeinschaft an den Waldorfschulen ist für viele Eltern ein weiterer Pluspunkt. Während die Mütter und Väter an herkömmlichen Schulen die Schulräume höchstens zu besonderen Anlässen wie Sommerfesten oder Elternabenden von innen sehen, bietet die Waldorfschule eine enge und familiäre Gemeinschaft, in der Eltern, Schüler*innen und Lehrer*innen aktiv miteinander interagieren und gemeinsam das Schulleben gestalten. Eine besondere Rolle nehmen dabei die waldorftypischen Feste ein, die häufig mit der ganzen Schulgemeinschaft geplant und begangen werden. Einige Feste, wie der Adventsbasar, sind öffentlich und bieten damit interessierten Eltern die Möglichkeit, einen ersten Eindruck von der Waldorfschule zu bekommen.