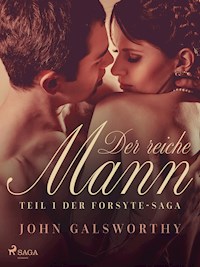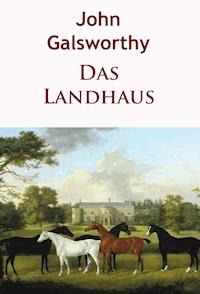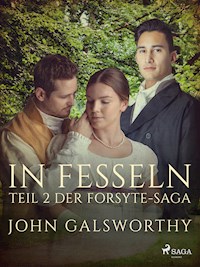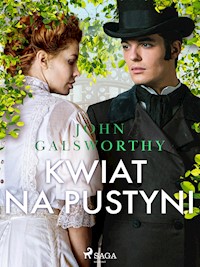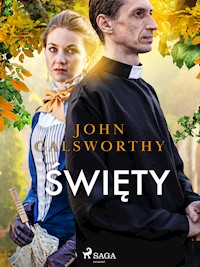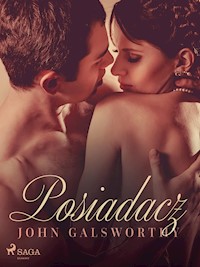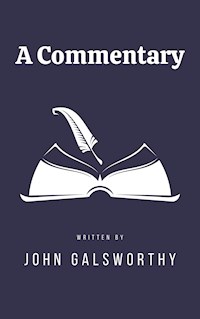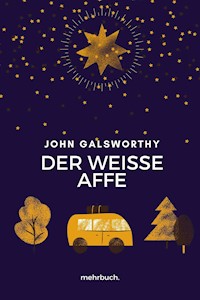
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
mehrbuch-Weltliteratur! eBooks, die nie in Vergessenheit geraten sollten. Das Romanwerk thematisiert das Leben der fiktiven Familie Forsyte in ihren verschiedenen Schattierungen. Im Mittelpunkt steht Soames Forsyte, der als Prototyp seiner ökonomisch erstarkten bürgerlichen Klasse die vom viktorianischen Lebensgefühl geprägten Familienideale und sein Vermögen zu wahren versucht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 522
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der weiße Affe
John Galsworthy
Vorwort
Wenn ich den zweiten Teil der Forsyte-Chronik ›Moderne Komödie‹ nenne, so ist der Ausdruck Komödie in seinem weitesten Sinn zu verstehen, genau so wie das Wort Saga im Titel des ersten Teils. Und dennoch: muß man nicht eine so aufrührerische Zeit wie die Nachkriegsperiode mit den Augen des Komödiendichters betrachten, muß man nicht ihre komödienhaften Elemente herausfühlen? Muß eine Epoche, die nicht weiß, was sie will, und sich dennoch mit ganzer Kraft für die Erreichung ihres Zieles einsetzt, nicht ein Lächeln hervorrufen, wenn auch nur ein trauriges Lächeln?
Ein Zeitalter in allen seinen Farben und Formen künstlerisch darzustellen, übersteigt die Kraft jedes Schriftstellers und geht darum auch weit über die Kraft des Autors dieses Buches. Aber zweifellos wirkte ein gewisses Bestreben, etwas von dem Geist dieser Zeit einzufangen und zu gestalten, dabei mit, als er diese Trilogie zu Papier brachte. Es ist eine unmögliche Aufgabe, durcheinander rennende Küchlein zu zählen, und ebenso unmöglich, die rasch abrollenden Ereignisse der Gegenwart in ihrer Gesamtheit zu erfassen; im besten Fall gelingt eine Momentaufnahme all dieses Drängens und Hastens, dieses Hastens einer Zukunft entgegen, ohne jede Vorstellung davon, wo sie zu suchen und zu finden ist und welcher Art sie sein wird.
Das England von 1886 – das Jahr, in dem ›Die Forsyte Saga‹ beginnt – besaß ebensowenig eine Zukunft wie das von heute, denn das damalige England erwartete die Fortdauer seiner Gegenwart. England fuhr gemächlich auf seinem Zweirad wie in einem Traum, den nur zwei Schreckgespenster störten: Mr. Gladstone und die irischen Parlamentsmitglieder.
Das England von 1926 – das Jahr, mit dem die ›Moderne Komödie‹ schließt – steht mit einem Bein in der Luft und mit dem andern in einem Auto neuester Konstruktion. Es rennt im Kreis herum wie ein Katzenjunges, das nach seinem Schwanz hascht, und brummt vor sich hin: ›Wenn ich nur wüßte, wo ich halt machen möchte!‹
Da heutzutage alles relativ ist, kann man sich nicht mehr vollkommen auf Gott verlassen, ebensowenig wie auf den Freihandel, die Ehe, auf Konsols, Kohle, oder auf seine Stellung in der Gesellschaft. Und da ganz England übervölkert ist, kann niemand lange an einem Ort bleiben, ausgenommen in entvölkerten ländlichen Gegenden, die – wie man gestehen muß – allzu öde sind und zweifellos ihre Bewohner nicht ernähren können.
Jedem, der dieses vier Jahre währende Erdbeben erlebt hat, ist die Gewohnheit, still zu stehen, abhanden gekommen.
Und dennoch hat sich der englische Charakter vielleicht überhaupt nicht oder doch nur sehr wenig geändert. Das bewies der Generalstreik im Jahre 1926, mit dem der letzte Teil dieser Trilogie beginnt. Wir sind noch immer ein Volk, das sich nicht drängen läßt, jedem Extrem mißtraut, mit der Verteidigungswaffe eines gesunden Humors ausgestattet ist, wir sind temperamentvoll mit Maß, voll Abneigung gegen jedwede Einmischung, sorglos und verschwenderisch, und mit einer gewissen genialen Fähigkeit begabt, uns wieder aufzuraffen. Wenn wir auch sonst fast an gar nichts glauben, so glauben wir doch immer noch an uns selbst. Diese hervorstechende Eigenschaft des Engländers ist wohl einer näheren Betrachtung wert. Warum, zum Beispiel, setzen wir uns beständig selbst herab? Einfach darum, weil wir keinen Minderwertigkeitskomplex haben und es uns gleichgültig ist, was andere von uns denken. Kein Volk der Welt scheint äußerlich weniger selbstsicher zu sein; und doch besitzt kein anderes Volk mehr innere Sicherheit. Im übrigen könnten diejenigen Persönlichkeiten, die sich der Dienste gewisser öffentlicher Fanfarenbläser der Nation versichert haben, daran denken, daß es schon einen versteckten Minderwertigkeitskomplex verrät, wenn man selbst seine Taten in allen Gassen ausposaunt. Nur wer stark genug ist, über sich selbst zu schweigen, wird stark genug sein, sich innerlich sicher zu fühlen. Die Epoche, in der wir leben, begünstigt eine falsche Beurteilung des englischen Charakters und der Stellung Englands. In keinem andern Land ist die Entartung der Rasse so wenig wahrscheinlich wie auf dieser Insel, weil kein anderes Land ein so wechselvolles, das Temperament mäßigendes Klima hat, das die Grundlage für ein mutiges und gesundes Leben bildet. Was hier weiter folgt, sollte von diesem Gesichtspunkt aus gelesen werden.
Im gegenwärtigen Zeitalter ist nichts mehr zu finden, das an den Früh-Viktorianismus gemahnt. Unter Früh-Viktorianismus verstehe ich die Epoche der alten Forsytes, die im Jahre 1886 schon im Schwinden begriffen war; was sich als lebensfähig erwiesen hat, ist der selbstbewußtere Viktorianismus Soames' und seiner Generation, der jedoch nicht selbstbewußt genug ist, um entweder selbstzerstörend oder selbstvergessend zu wirken. Vom Hintergrund dieses mehr oder minder feststehenden Ausmaßes von Selbstbewußtsein heben sich am klarsten Farbe und Gestalt der gegenwärtigen, außerordentlich selbstbewußten und alles in Frage stellenden Generation ab. Den alten Forsytes: dem alten Jolyon, Swithin und James, Roger, Nicholas und Timothy kam es nie in den Sinn zu fragen, ob das Leben auch lebenswert sei. Sie fanden es interessant, waren Tag für Tag vollständig davon in Anspruch genommen, und wenn sie auch nicht gerade an ein zukünftiges Leben glaubten, so glaubten sie doch felsenfest an die fortschreitende Besserung ihrer Position im Leben und an die Anhäufung von Schätzen für ihre Kinder. Dann kamen der junge Jolyon, Soames und ihre Zeitgenossen, und obzwar sie mit dem Darwinismus und dem Universitätsstudium auch bestimmte Zweifel an einem zukünftigen Leben eingesogen hatten und genügend Einsicht, sich zu fragen, ob sie selbst sich fortschrittlich entwickelten, so bewahrten sie sich doch den Sinn für Eigentum und den Wunsch, ihre Nachkommen zu versorgen und in ihnen weiterzuleben. Als das Viktorianische Zeitalter mit dem Tode der Königin zu Ende ging, kam eine neue Generation ans Ruder, mit neuen Ideen über Kindererziehung, eine Generation, die infolge der neuen Verkehrsmittel und des Weltkriegs sich für die Umwertung aller Werte entschied. Und da, wie es scheint, das persönliche Eigentum sehr wenig Zukunft hat und das Leben noch weniger, ist man um jeden Preis entschlossen zu leben, ohne sich viel um das Schicksal etwaiger Nachkommen zu kümmern. Nicht daß die gegenwärtige Generation ihre Kinder weniger liebte als die frühere – in so elementaren Dingen ändert die menschliche Natur sich nicht –, sondern es scheint ganz einfach nicht mehr der Mühe wert, die Zukunft auf Kosten der Gegenwart zu sichern, wenn nirgends in der Welt mehr absolute Sicherheit zu finden ist.
Hierin liegt eigentlich der fundamentale Unterschied zwischen der jetzigen und den früheren Generationen. Die Menschen wollen nicht mehr für etwas vorsorgen, was sie nicht voraussehn können.
All das bezieht sich natürlich nur auf jenes Zehntel der Bevölkerung, das die besitzende Klasse ausmacht; unter den übrigen neun Zehnteln gibt es keine Forsytes und es besteht daher kein Anlaß, sich in diesem Vorwort mit ihnen abzugeben. Und überdies, welcher Durchschnittsengländer mit einem Jahreseinkommen von weniger als dreihundert Pfund hat sich je über die Zukunft den Kopf zerbrochen, das Früh-Viktorianische Zeitalter mitinbegriffen?
Diese ›Moderne Komödie‹ spielt sich also vor dem Hintergrund eines mehr oder minder ausgeprägten Selbstbewußtseins ab, das vor allem durch Soames und Sir Lawrence Mont, den Leichtgewichtler und neunten Baronet, und an zweiter Stelle durch einige Neu-Viktorianer, wie den selbstgerechten Mr. Danby, Elderson, Mr. Blythe, Sir James Foskisson, Wilfred Bentworth und Hilary Cherrell, verkörpert wird. Wenn man alles in allem nimmt, ihre Neigungen und Abneigungen, ihre Eigenschaften und Charaktere, so erhält man ein ziemlich feststehendes und umfassendes Bild der Vergangenheit, von der sich die Gestalten der Gegenwart: Fleur und Michael, Wilfrid Desert, Aubrey Greene, Marjorie Ferrar, Norah Curfew, Jon, der ›Raffaelit‹ und andere Nebengestalten abheben. Selbst in der besitzenden Klasse ist die Mannigfaltigkeit der Menschentypen so groß, daß sie sich nicht einmal in zwanzig Romanen schildern ließe, so daß diese ›Moderne Komödie‹ notwendigerweise eine arge Unterschätzung der gegenwärtigen Generation sein muß, aber vielleicht nicht unbedingt eine Verleumdung. Da Symbolismus langweilt, hoffe ich, daß eine gewisse Ähnlichkeit zwischen dem Schicksal Fleurs und dem ihrer Generation – die einem Glück nachjagt, dessen man sie beraubt hat – der Aufmerksamkeit des Lesers entgeht. Tatsache bleibt, daß wenigstens für den Augenblick die Jugend sich balancierend auf den Fußspitzen der Unsicherheit dreht. Wohin wird das führen? Wird man endlich doch das Glück erjagen? Wie wird sich alles klären? Werden sich die Dinge überhaupt jemals wieder klären, wer weiß es? Werden neue Kriege und neue Erfindungen kommen, brühheiß auf die früheren, die noch nicht verarbeitet und gemeistert sind? Oder wird das Schicksal ein zweites Intervall eintreten lassen, gleich der Viktorianischen Ära, währenddessen das Leben, in seinem ganzen Werte neuerkannt, feste Formen annehmen und der Sinn für Besitz mit allen damit zusammenhängenden Dogmen eine Wiedergeburt erleben wird?
Unabhängig davon, ob nun die ›Moderne Komödie‹ den Geist dieses Zeitalters mehr oder weniger widerspiegelt, führt sie doch in der Hauptsache die Geschichte von Soames und Irene weiter, die mit ihrer ersten Begegnung in einer Gesellschaft zu Bournemouth im Jahre 1881 beginnt und nicht eher enden kann, bis Soames sechsundvierzig Jahre später von dieser Erde Abschied nimmt.
Wenn man den Autor, wie dies oft geschieht, über Soames befragt, so weiß er nicht genau zu sagen, wo er mit ihm hinauswollte. Alles in allem war Soames zweifellos ein ehrlicher Mann. Er lebte und handelte nach seiner besondern Art, nun ist er tot. Man wird seinem Schöpfer verzeihen, wenn er das Ende Soames' für berechtigt hält. Denn so weit wir uns auch von griechischer Kultur und Philosophie entfernt haben mögen, so gilt doch noch immer die Wahrheit des griechischen Spruches: ›Was ein Mensch am meisten liebt, das wird ihn am Ende vernichten.‹
John Galsworthy
Max Beerbohm zugeeignet
Erster Teil
1. Spaziergang
An jenem denkwürdigen Nachmittag Mitte Oktober des Jahres 1922 stieg Sir Lawrence Mont, neunter Baronet, die von den Verfechtern des Bestehenden so gründlich ausgetretenen Stufen des konservativen Snooks-Klubs hinunter. Auf seinen dünnen Beinen schritt er eilig dahin, den Kopf mit der feinen Nase dem Ostwind zugekehrt. Mehr durch seine Geburt als von Natur aus zur Politik bestimmt, beurteilte er die Umwälzung, die seine Partei wieder ans Ruder gebracht hatte, mit leidenschaftslosem Interesse und nicht ohne Humor. Als er am liberalen Remove-Klub vorbeiging, dachte er: ›Die werden jetzt schwitzen da drinnen – die guten Zeiten sind vorüber! Keine komplizierten Speisen mehr. Zur Abwechslung einmal Schnepfe ohne Garnierung!‹
Die führenden Größen waren schon aus dem Snooks-Klub ausgetreten, ehe er Mitglied wurde. Er gehörte nicht ›zu jenen Konjunkturrittern, die ihr Schäfchen bereits geschoren hatten, o nein – diese Kerle, die im Augenblick, da der Krieg vorüber war, der Landwirtschaft den Rücken gekehrt hatten. Pah!‹ Eine Stunde lang hatte er sich verschiedene Meinungen angehört und sein beweglicher Geist, der in den Anschauungen der Vergangenheit wurzelte und der Gegenwart und allen politischen Beteuerungen und Verkündigungen skeptisch gegenüberstand, hatte amüsiert bemerkt, welche Verwirrung die schicksalsschwere Versammlung in allen Köpfen, patriotischen und andern, angerichtet hatte. Wie die meisten Grundbesitzer mißtraute er rein theoretischen Lehrsätzen. Seine politische Überzeugung, wenn er überhaupt eine hatte, lautete: Einfuhrzoll auf Weizen, und soweit er sehen konnte, stand er damit jetzt allein – aber er wollte ja auch gar nicht ins Parlament kommen. Mit andern Worten: er hatte nicht zu fürchten, daß seine politischen Grundsätze von den Stimmzetteln derjenigen, die das Brot bezahlen mußten, erschüttert würden. Grundsätze, überlegte er, waren im Grunde gleichbedeutend mit Profit; warum zum Kuckuck taten die Leute immer so, als wäre es anders! Profit, im tiefsten Sinne des Wortes natürlich, war nichts anderes als Selbsterhaltungstrieb für Mitglieder einer bestimmten Gemeinschaft. Und wie zum Kuckuck sollte diese bestimmte Gemeinschaft, die englische Nation, weiter existieren, wenn das ganze Land nicht mehr bebaut würde und alle Schiffe und Häfen Gefahr liefen, von Aeroplanen zerstört zu werden? Im Klub hatte er eine Stunde lang darauf gewartet, daß einer die Bodenfrage anschneiden würde. Kein einziger! Sie trieben keine praktische Politik! Verwünschte Kerle! Die wetzten wohl nur ihre Hosen durch bei dem ewigen Sitzeerobern und Sitzebehalten! Kein Zusammenhang zwischen ihrem Sitzfleisch und ihrer Politik, die noch künftigen Generationen in den Knochen sitzen sollte. Wahrhaftig keiner! Während seine Gedanken so bei der künftigen Generation angelangt waren, fiel ihm plötzlich ein, daß die Frau seines Sohnes noch gar keine Anzeichen aufwies. Zwei Jahre! Es war schon Zeit, daß sie an Kinder dachten. Es war gefährlich, sich an Kinderlosigkeit zu gewöhnen, wenn ein Titel und ein Landsitz davon abhingen. Die Lippen und buschigen Brauen zogen sich zu einem Lächeln zusammen, so daß zwei dunkle Runen über seinen Augen eingegraben schienen. Ein hübsches, junges Geschöpf, so anziehend; und sie wußte es auch! Wen lernte sie nicht alles kennen? Löwen und Tiger, Affen und Katzen – ihr Haus wurde nachgerade eine förmliche Menagerie von mehr oder weniger gefeierten Zelebritäten. Es lag etwas Phantastisches in ihrem Vorgehen. Und vor einem der vier britischen Löwen auf dem Trafalgar Square stehenbleibend, dachte er: ›Nächstens holt sie die da in ihr Haus! Sie hat die Sammelwut. Michael soll sich vorsehen. Im Hause einer Sammlerin gibt es immer ein Zimmer für das ausrangierte Gerümpel, und auch der Ehemann kann am Ende dort hineingesteckt werden. Da fällt mir ein: Ich habe ihr einen chinesischen Minister versprochen. Na, sie muß jetzt bis nach den allgemeinen Wahlen warten.‹
Am Ende von Whitehall erschienen einen Augenblick lang die Türme von Westminster unter dem grauen östlichen Himmel. ›Auch in diesem Bild liegt etwas Phantastisches‹, dachte er. ›Michael mit seinen fixen Ideen! Na, es ist halt Mode – sozialistische Prinzipien und eine reiche Frau. Selbstaufopferung gegen Sicherstellung! Frieden mit Wohlleben! Quacksalber-Medizinen – zehn für einen Penny!‹ In Charing Croß schritt er mitten durch das Gewühl der schreienden Zeitungsverkäufer, die die politische Krise närrisch gemacht hatte, und wandte sich nach links zum Haus der Verleger Danby & Winter, wo sein Sohn jüngerer Teilhaber war. Ein Thema zu einem neuen Buch beschäftigte seinen Geist, der schon eine Montrose-Biographie und ›Im fernen China‹, jenes orientalische Reisebuch, hervorgebracht hatte; ferner eine phantastische Konversation zwischen den Geistern Gladstones und Disraelis, ›Duett‹ betitelt. Mit jedem Schritt, den er vom Klub ostwärts tat, stach seine aufrechte magere Gestalt stets mehr von den übrigen ab, sein Mantel mit Astrachankragen, sein hageres Gesicht mit dem grauen Schnurrbart und dem schildkrotumrandeten Monokel unter der beweglichen dunklen Braue. Er wirkte fast auffallend in dieser düsteren Seitengasse, wo Karren herumstanden, wie Winterfliegen an der Wand kleben, und die Leute Bücher unterm Arm trugen, als wollten sie für Gebildete gelten.
Knapp vor der Tür von Danby begegnete er zwei jungen Männern. Einer von ihnen war offenbar sein Sohn, besser gekleidet seit seiner Heirat, und eine Zigarre im Mund – Gott sei Dank! – anstatt dieser ewigen Zigaretten. Und der andere – aha! der von Michael protegierte emporkommende Poet und sein Brautführer, die Nase in der Luft und einen Velourhut auf dem glatten Kopf. Sir Lawrence sagte: »Ha, Michael!«
»Hallo, Bart ›Bart‹ ist die englische Abkürzung von ›Baronet‹, hier als Spitzname gebraucht.! Du kennst doch meinen alten Herrn, Wilfrid? Wilfrid Desert. ›Kleine Münze‹ – es steckt ein echter Dichter drin, das sag ich Ihnen, Bart. Sie müssen ihn lesen. Wir gehen nach Hause. Kommen Sie mit!«
Sir Lawrence ging mit.
»Was war im Klub los?«
»Le roi est mort! Die Arbeiterpartei kann wieder anfangen zu lügen – nächsten Monat sind die Wahlen.«
»Bart ist in einer Zeit aufgewachsen, Wilfrid, die Demos noch nicht kannte.«
»Na, Mr. Desert, finden Sie etwas Reales in der heutigen Politik?«
»Finden Sie Realität in irgend etwas, Sir?«
»Vielleicht in der Einkommensteuer.«
Michael grinste. »Vom Adeligen aufwärts«, sagte er, »gibt es so etwas wie einfachen Glauben nicht mehr.«
»Angenommen, Michael, deine Freunde kämen ans Ruder – es wäre ja in mancher Beziehung gar nicht so schlecht, würde ihnen ja nur dazu verhelfen, reifer zu werden – was könnten sie tun, eh? Könnten sie den englischen Geschmack verbessern? Das Kino abschaffen? Die Engländer das Kochen lehren? Andere Staaten verhindern, mit Krieg zu drohen? Uns dazu bringen, alle Nahrungsmittel im Inland zu produzieren? Das Anwachsen des Lebens in den Städten verhindern? Würden sie die Erfinder der Giftgase aufknüpfen? Könnten sie die Fliegergefahr während des Krieges verhindern? Könnten sie irgendwo den Besitzinstinkt schwächen? Oder in Wirklichkeit irgend etwas anderes tun, als die zufälligen Besitzrechte ein wenig ändern? Alle Parteipolitik bleibt an der Oberfläche. Wir werden von den Erfindern beherrscht und von der menschlichen Natur; und dabei sind wir auf einen Holzweg geraten, Mr. Desert.«
»Ganz meine Meinung, Sir.«
Michael schwenkte seine Zigarre.
»Was für Pessimisten ihr seid, ihr beiden!«
Und die Hüte abnehmend, gingen sie an dem Kriegerdenkmal vorbei.
»Seltsam bezeichnend, dieses Ding da«, sagte Sir Lawrence, »eine Warnung vor allem Pomp – recht charakteristisch. Und die Warnung vor dem Pomp –«
»Nur weiter, Bart!« sagte Michael.
»Das Schöne, das Große und Ornamentale – alles dahin. Keine weitreichenden Ansichten mehr, keine großen Pläne, keine großen Grundsätze, keine große Religion oder große Kunst, ästhetisierendes Treiben von Cliquen in Hinterzimmern, kleine Menschen in kleinen Hütten.«
»Was sagst du dazu, Wilfrid?«
»Ja, Mr. Desert, was sagen Sie dazu?«
Deserts finsteres Gesicht nahm einen konzentrierten Ausdruck an. »Es ist ein Zeitalter der Widersprüche«, erklärte er. »Wir treten alle für die Freiheit in die Schranken, und die einzigen Institutionen, die mächtig werden, sind der Sozialismus und die römisch-katholische Kirche. Wir bilden uns schrecklich viel auf unsere Kunst ein – und die einzige Kunst, die vorwärts kommt, ist das Kino. Wir sind ganz versessen auf den Frieden, und das einzige, was wir dazu beitragen, ist die Vervollkommnung der Giftgase.«
Sir Lawrence warf einen Seitenblick auf den jungen Mann, der so bitter sprach. »Und macht sich das Verlagsgeschäft, Michael?«
»Na, ›Kleine Münze‹ geht wie frische Semmeln, und ›Ein Duett‹ läßt sich auch nicht übel an. Was halten Sie von folgender neuen Anzeige: EinDuett‹ von Sir Lawrence Mont, Bart. Das hervorragendste Zwiegespräch, das zwei Tote je geführt haben.‹ Das sollte eigentlich die Spiritisten packen. Wilfrid hat vorgeschlagen: ›Gladstone und Disraeli. Eine Radiobotschaft aus der Hölle.‹ Welcher Titel gefällt Ihnen besser?«
Sie waren indessen bis zu einem Schutzmann gekommen, der seinen Arm hochhielt, gerade vor der Nase eines Lastpferdes, so daß alles stillstehen mußte. Die Motore der Autos liefen leer, die Gesichter der Lenker waren geradeaus auf die abgesperrte Straßenkreuzung gerichtet; ein Mädchen auf einem Fahrrad schaute müßig umher, wobei es sich hinten an einem Lastwagen festhielt, auf dem seitwärts ein Bursche saß und die Beine zu dem Mädchen herunterbaumeln ließ. Sir Lawrence blickte wieder zu dem jungen Desert hinüber. Ein mageres bleiches Gesicht mit feinen, wenn auch nicht ganz harmonischen Zügen; nichts Auffallendes in Kleidung oder Benehmen, dabei gesellschaftlich ganz unbefangen; weniger lebhaft als dieser temperamentvolle Schlingel, sein eigener Sohn, doch genau so steuerlos und noch skeptischer – Erlebnisse gingen ihm wahrscheinlich recht nahe. Der Schutzmann ließ den Arm sinken.
»Sie waren im Krieg, Mr. Desert?«
»Jawohl.«
»Luftdienst?«
»Und Infanterie. Von jedem ein bißchen.«
»Das ist schwer für einen Dichter.«
»Durchaus nicht. Poesie kann überhaupt nur entstehen, wenn man jeden Augenblick in die Luft fliegen kann, oder wenn man in einer typischen Londoner Vorstadt lebt.«
Sir Lawrence zog die Augenbraue hoch. »Meinen Sie?«
»Tennyson, Browning, Wordsworth, Swinburne – die konnten schaffen; ils vivaient, mais si peu.«
»Gibt es nicht noch eine dritte günstige Situation?«
»Und die wäre, Sir?«
»Wie soll ich mich ausdrücken – so eine Art geistiger Erregung im Zusammenhang mit Frauen?«
Deserts Gesicht zuckte und ein Schatten flog darüber.
Michael steckte den Schlüssel in seine Haustür.
2. Daheim
Das Haus auf dem South Square, Westminster, das die jungen Monts vor zwei Jahren nach ihrer spanischen Hochzeitsreise bezogen hatten, konnte man ein ›emanzipiertes‹ Heim nennen. Es war das Werk eines Architekten, dessen Ideal ein neues, vollkommen altmodisches Haus war. und ein altes, vollkommen modernes Haus. Deshalb vermochte man auch keinen anerkannten Stil oder ›Anklänge an Herkömmliches‹ zu entdecken. Aber die Steine saugten den Schmutz der Großstadt so rasch auf, daß das Material schon ganz beträchtlich dem der St. Paulskathedrale glich. Die Fenster und Türen hatten sanft gerundete Bogen. Das steile Dach von schöner, rußiger rosa Farbe erinnerte fast an dänischen Stil und zwei putzige, kleine Fensterchen darin machten den Eindruck, als ob sehr großgewachsene Dienstboten dort oben wohnen müßten. Die Zimmer lagen zu beiden Seiten der breiten Haustür, die mit Lorbeerbäumen in schwarzgoldenen Kübeln geschmückt war. Das Haus war von beträchtlicher Tiefe und breit und einfach stieg die Treppe am andern Ende der Halle empor, in der Raum für eine ganze Anzahl von Hüten, Mänteln und Visitenkarten war. Es gab vier Badezimmer, aber nicht einmal einen Keller. Der Forsyte-Instinkt für Häuser hatte bei diesem Ankauf mitgewirkt. Soames hatte es für seine Tochter erstanden, ohne Innendekoration, in jenem psychologischen Augenblick, als die Inflationsseifenblase zerplatzte und aus dem Ballon des Welthandels das Gas entwich. Fleur hatte sich damals sofort mit einem Architekten in Verbindung gesetzt – eine Berufsatmosphäre, die Soames nie ganz verwinden konnte – und sich dafür entschieden, nicht mehr als drei Stilarten in ihrem Hause zu dulden: die chinesische, spanische und ihre eigene. Das Zimmer links von der Eingangstür, das die halbe Hausfront zur Gänze einnahm, war chinesisch, mit Elfenbeintäfelung, einem Kupferfußboden, Zentralheizung und gläsernem Kronleuchter. Es enthielt vier Bilder, die alle chinesisch waren, die einzige Schule, in der ihr Vater noch nicht spekuliert hatte. Neben dem großen, offenen Kamin standen chinesische Hunde auf besondern chinesischen Kacheln. Die Seide war vorwiegend von jadegrüner Farbe. Zwei herrliche alte schwarze Teetruhen standen dort, die man mit Soames' Geld bei Jobson erstanden hatte – nicht gerade ein Gelegenheitskauf. Ein Klavier stand nicht darin, zum Teil deshalb, weil Klaviere so herausfordernd europäisch waren, und dann auch, weil es zu viel Raum weggenommen hätte. Fleur brauchte ein geräumiges Gemach, da sie eher Menschen sammelte als Möbel und Nippsachen. Zwei Fenster an beiden Enden ließen ein Licht einströmen, das leider nicht chinesisch war. Manchmal stand sie ganz still inmitten dieses Zimmers und dachte darüber nach, wie sie ihre Gäste in Gruppen placieren, wie sie ihr Zimmer noch chinesischer machen könnte, ohne daß es unbequem würde; wie sie den Eindruck erwecken könnte, als ob sie ganz genau in Literatur und Politik beschlagen wäre; wie sie alle Geschenke ihres Vaters annehmen könnte, ohne ihn merken zu lassen, daß sein Geschmack doch etwas antiquiert war; wie sie Sibley Swan, den neuen literarischen Stern, festhalten könnte und gleichzeitig Gurdon Minho, den alten, dazu gewinnen; wie Wilfrid Desert anfing, sie zu lieb zu haben; welchen Stil sie eigentlich für ihre Kleider vorzog; warum Michael so komische Ohren hatte; und manchmal stand sie da und dachte überhaupt nichts – spürte nur ein leises Sehnen.
Als die drei eintraten, saß sie vor einem roten chinesischen Lack-Teetisch und beendete einen sehr ausgiebigen Tee. Sie nahm den Tee immer zeitig, so daß sie sich in aller Ruhe ganz allein tüchtig füttern konnte, ehe Besuch kam, denn sie war noch nicht ganz einundzwanzig und dies war die Stunde, in der sie sich ihrer Jugend erinnerte. Neben ihr stand Ting-a-ling auf den Hinterbeinen, seine braunen Vorderpfoten auf einem chinesischen Fußbänkchen, die schwarzbraune stumpfe Schnauze nach oben, den guten Dingen zugekehrt.
»Jetzt hast du genug, Ting. Nichts mehr, mein Liebstes, Schluß!«
Der Ausdruck Ting-a-lings schien zu sagen: ›Na, dann hör du aber auch auf! Und laß mich nicht Höllenqualen leiden!‹
Ein Jahr und drei Monate war er alt, als ihn Michael aus einem Schaufenster in der Bond Street heraus gekauft hatte, vor elf Monaten, an Fleurs zwanzigstem Geburtstag.
Zwei Jahre Ehe hatten ihr kurzes, dunkles, kastanienbraunes Haar nicht länger gemacht; hatten ihren beweglichen Lippen ein wenig mehr Entschlossenheit verliehen, ein wenig mehr Verlockung in ihre haselnußbraunen Augen gelegt unter den dunklen Wimpern und weißen Lidern, ihrer Haltung ein wenig mehr Balance und Schwung gegeben und Brust und Hüften ein wenig mehr gerundet, Taille und Waden waren ein wenig schlanker geworden, die etwas schmäleren Wangen zeigten etwas weniger Farbe, und die Stimme klang etwas weniger lieblich, aber ein wenig einschmeichelnder.
Sie erhob sich hinter dem Teetisch und streckte, ohne ein Wort zu sagen, ihren weißen runden Arm aus. Überflüssige Worte beim Begrüßen und Abschiednehmen vermied sie. Sie käme so oft in die Lage, sie zu sagen und diente ihrer Absicht besser durch einen Blick, einen Händedruck und ein leichtes Neigen des Kopfes nach der Seite.
Mit derselben Hand machte sie eine einladende Bewegung im Kreis und sagte: »Rückt näher! Sahne, Sir? Zucker, Wilfrid? Ting hat schon zu viel bekommen – gebt ihm nichts mehr! Reich die Sachen herum, Michael. Ich hab alles über das Meeting im Klub erfahren. Du wirst doch kein Wahlagent für die Arbeiterpartei werden, Michael – Propagandaarbeit ist so blödsinnig. Wenn irgend jemand mich überreden wollte, würde ich sofort den Kandidaten der Gegenpartei wählen.«
»Gewiß, mein Herz, aber du bist auch nicht der Durchschnittswähler.«
Fleur blickte ihn an. Sehr hübsch gesagt! Sie beobachtete gleichzeitig, wie Wilfrid sich auf die Lippen biß; wie Sir Lawrence es bemerkte; wie weit sie ihr seidenes Bein zeigte; sie bemerkte ihre schwarz- und cremefarbenen Teetassen, und brachte gleichzeitig alles in Ordnung. Ein leises Zucken ihrer weißen Lider – und Wilfrid hörte auf, sich auf die Lippen zu beißen; eine Bewegung ihrer seidenen Beine – und Sir Lawrence hörte auf, ihn anzublicken. Ihre Tassen anbietend, sagte sie: »Ich bin wohl nicht modern genug?«
Desert, der mit einem glänzenden kleinen Löffel in seiner schwarz-weißen Tasse rührte, erklärte, ohne aufzusehen: »Du bist um so viel moderner als die Modernen, als du altmodischer bist als sie.«
»Nur nicht so pathetisch!« sagte Michael.
Aber als er mit seinem Vater hinausgegangen war, um ihm die neuen Karikaturen von Aubrey Greene zu zeigen, sagte sie: »Bitte, erkläre mir, wie du das gemeint hast, Wilfrid.«
Aus Deserts Stimme war alle Zurückhaltung gewichen.
»Was liegt daran! Damit will ich mich nicht aufhalten.«
»Aber ich will es wissen. Es klang wie Hohn.«
»Hohn? Von mir? Fleur!«
»Dann erkläre es mir.«
»Ich habe gemeint, daß du ihre ganze Rastlosigkeit und Zielstrebigkeit hast, aber du hast, was sie nicht haben, Fleur: die Macht, einem den Kopf zu verdrehen. Und mir hast du ihn verdreht, das weißt du.«
»Wenn Michael dies hörte – von dir, seinem Brautführer?«
Desert trat rasch zum Fenster.
Fleur nahm Ting-a-ling auf den Schoß. Es hatten schon andere so zu ihr gesprochen, aber bei Wilfrid war es ernsthaft. Es war natürlich sehr nett zu wissen, daß sie sein Herz besaß. Nur, wo um alles in der Welt sollte sie es verwahren, wo es niemand anderer sehen würde außer ihr? Er war so unberechenbar – tat so seltsame Dinge! Sie fürchtete sich ein wenig – nicht vor ihm, aber vor diesem Unberechenbaren. Er kam zum Kamin zurück und sagte: »Abscheulich, nicht wahr? Tu den verdammten Hund fort, Fleur; ich kann dein Gesicht nicht sehn. Wenn du Michael wirklich liebtest, würde ich nicht so sprechen – ich schwör es dir; aber du liebst ihn nicht, du weißt es.«
Fleur erwiderte kalt: »Da weißt du sehr wenig; ich liebe Michael.«
Desert stieß sein gewohntes stoßweises Lachen aus.
»Ja, schon, aber nicht stark genug.«
Fleur blickte auf.
»Stark genug, daß ich mich sicher fühle.«
»Also eine Blume, die ich nicht pflücken kann.«
Fleur nickte.
»Bist du ganz sicher, Fleur? Ganz, ganz sicher?«
Fleur starrte ihn an; ihr Blick wurde etwas sanfter und die auffallend weißen Lider senkten sich, sie nickte; Desert sagte langsam: »In dem Augenblick, wo ich davon fest überzeugt bin, geh ich nach dem Osten.«
»Nach dem Osten?«
»Der ist nicht so mörderisch wie der Westen, der Kriegsschauplatz, nur eines bleibt sich gleich dabei: man kommt nicht mehr zurück.«
Fleur dachte: ›Der Osten! Wie gern möcht ich den Orient kennenlernen! Schade, daß sich das nicht auch machen läßt. Schade!‹
»Mich wirst du nicht in deiner Menagerie halten, liebe Fleur. Ich werde mich nicht hier herumtreiben und von Abfällen leben. Du weißt, was ich fühle – zu irgendeinem Krach muß es kommen.«
»Es war doch nicht meine Schuld, nicht wahr?«
»O doch, du hast mich gesammelt, wie du jeden sammelst, der in deine Nähe kommt.«
»Ich verstehe dich nicht.«
Desert beugte sich nieder und riß ihre Hand an seine Lippen.
»Sei nicht böse über mich; ich bin zu unglücklich.«
Fleur ließ ihre Hand an seinen Lippen ruhen.
»Es tut mir leid, Wilfrid.«
»Laß nur, Liebe. Ich werd gehen.«
»Aber du kommst doch morgen zum Dinner?«
Desert entgegnete heftig: » Morgen? Barmherziger Gott – nein! Wie glaubst du, soll ich das aushalten?«
Er stieß ihre Hand weg.
»Heftigkeit ist mir sehr zuwider, Wilfrid.«
»Also leb wohl; es ist besser, daß ich gehe.«
Auf ihren Lippen zitterten die Worte: ›Und es wäre auch besser, wenn du nicht wiederkämest‹, aber kein Laut wurde hörbar. Wenn Wilfrid nicht mehr da war, würde ihr Leben etwas von seiner Wärme verlieren! Sie winkte mit der Hand. Er war fort. Sie hörte die Tür zufallen. Armer Wilfrid! Wie nett, von dieser Flamme zu wissen, an der sie ihre Hände wärmen konnte! Angenehm, aber ein wenig gefährlich. Und plötzlich ließ sie Ting-a-ling vom Schoß gleiten, stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Morgen war ja ihr zweiter Hochzeitstag! Es schmerzte sie noch immer, wenn sie daran dachte, was er hätte sein können. Aber es gab wenig Zeit zum Nachdenken, und diese wenige Zeit benützte sie schlecht. Wozu überhaupt nachdenken? Es gab nur ein Leben, das war voll von Menschen, von Dingen, die man tun und haben konnte, von Dingen, die man sich wünschte, ein Leben, dem nur – eines fehlte, und wenn die Menschen dies eine besaßen, so dauerte es niemals lang! An ihren Lidern hingen zwei Tränen, die trockneten, ohne herunterzufallen. Sentimentalität! Nein! Das wäre das Letzte – ein unverzeihliches Vergehen! Wie sollte sie ihre Gäste morgen placieren? Und wen sollte sie an Wilfrids Stelle einladen, wenn Wilfrid nicht käme – der dumme Junge! Ein Tag – eine Nacht, was macht es für einen Unterschied? Wer sollte zu ihrer Rechten sitzen, wer zu ihrer Linken? War Aubrey Greene berühmter oder Sibley Swan? Waren beide vielleicht nicht so berühmt wie Walter Nazing und Charles Upshire? Ein Dinner für zwölf, ganz exklusiv literarisch und künstlerisch bis auf Michael und Alison Cherrell. Ah! Wenn Alison ihr nur Gurdon Minho bringen könnte, gerade nur einen Schriftsteller der alten Schule, ein Glas alten Weins, um das Aufbrausen zu mildern. Er veröffentlichte seine Werke nicht bei Danby & Winter, aber er fraß Alison aus der Hand. Rasch ging sie zu einer der alten Teetruhen und öffnete sie. Innen befand sich ein Telephon.
»Kann ich Lady Alison sprechen? Mrs. Michael Mont …Ja …Du, Alison? …hier Fleur. Wilfrid läßt uns morgen abend im Stich … Wäre es dir möglich, Gurdon Minho mitzubringen? Ich kenne ihn natürlich gar nicht, aber vielleicht interessiert er sich. Du wirst es versuchen? …Das wäre ja herrlich! Ist die Versammlung im Klub nicht aufregend gewesen? Bart sagt, sie werden einander auffressen, nun da sie sich gespalten haben …Was Mr. Minho anbetrifft – könntest du mir heute abend Bescheid sagen? Ausgezeichnet! …Ich bin dir schrecklich dankbar! … Leb wohl!«
Wenn Minho nun nicht käme, wer dann? In Gedanken durchflog sie die Namen in ihrem Adressenverzeichnis. Zu so später Stunde mußte es jemand sein, der auf Zeremoniell keinen Wert legte; aber außer Alison wäre keiner von Michaels Verwandten sicher vor Sibley Swan oder Nesta Gorse und ihren treffsichern Lästerungen. Was die Forsytes anbelangte – gänzlich außer Frage, die hatten wohl ihren versteckten bissigen Humor, wenigstens einige von ihnen, aber sie waren nicht modern, nicht wirklich modern. Übrigens sah sie gern so wenig als möglich von ihnen – sie waren etwas antiquiert, sie gehörten einer vergangenen Epoche an, konnten sich ein Leben ohne Anfang und Ende nicht vorstellen. Nein! Wenn Gurdon Minho sie aufsitzen ließe, dann müßte es ein Musiker sein, einer, dessen Werke hieroglyphisch waren und ein wenig an Chirurgie gemahnten, oder vielleicht noch besser ein Psychoanalytiker. Sie blätterte in dem Verzeichnis, bis sie auf jene beiden Kategorien stieß. Hugo Solstis? Das wäre eine Möglichkeit; aber wenn es ihm einfiele, eine seiner letzten Kompositionen vorzuspielen? Dafür hätte nur Michaels Flügel getaugt und da hätte man in sein Arbeitszimmer gehen müssen. Lieber Gerald Hanks – er würde sich zwar mit Nesta Gorse in Diskussionen über Träume verlieren, aber selbst das wäre kein tatsächlicher Verlust für die Unterhaltung. Ja, wenn Gurdon Minho nicht käme, dann Gerald Hanks; der hatte bestimmt Zeit und er sollte zwischen Alison und Nesta sitzen. Sie klappte das Verzeichnis zu, ging zu ihrem mit grau-grüner Seide bespannten kleinen Sofa, ließ sich nieder und starrte Ting-a-ling an. Der kleine Hund starrte sie mit seinen runden Glotzaugen ebenfalls an, sie waren glänzend, schwarz und uralt. Fleur dachte: ›Wilfrid darf nicht davonlaufen.‹ Unter der Menge von Menschen, die kamen und gingen bei ihr, bei andern und überall, war keiner, an dem ihr wirklich etwas lag. Man mußte alle kennen, mit allen Schritt halten, selbstverständlich! Es war alles so schrecklich amüsant und so schrecklich notwendig! Nur – nur wozu?
Stimmen! Michael und Bart kamen zurück. Bart hatte bei Wilfrid etwas gemerkt. Er war aber auch einer, der alles merkte! Sie fühlte sich niemals ganz behaglich, wenn er in der Nähe war – immer lebhaft und beweglich, und doch war etwas so Gesetztes und Aristokratisches in seinem Wesen; ein wenig wie Ting-a-ling, so wie ein kritischer Beurteiler, der ihr immer vorhielt, daß sie modern und flatterhaft sei. Er lag gewissermaßen fest vor Anker, konnte sich nur bewegen, so weit seine altmodische Kette es erlaubte, aber er konnte einen etwas plötzlich aus der Fassung bringen. Dennoch bewunderte er sie – das fühlte sie – o gewiß!
Nun, wie hatten ihm die Karikaturen gefallen? Sollte Michael sie in Buchform veröffentlichen und mit oder ohne Text? Und ob er nicht auch die kubistische Zeichnung, die Regierung darstellend und ›Stilleben‹ genannt, so entsetzlich komisch fände – besonders die ›Vertrocknete Bohne‹, mit der der Premierminister gemeint war? Sir Lawrences Antwort hörte sich an wie ein rasches, surrendes Geräusch, er erzählte ihr von seines Vaters Sammlung von Wahlkarikaturen. Sie wünschte so sehr, Bart würde aufhören, ihr von seinem Vater zu erzählen; er war so vornehm, aber er mußte auch so langweilig gewesen sein, Besuche machte er grundsätzlich nur zu Pferde, die Hosen mit einem Riemen unter dem Schuh befestigt. Er und Lord Charles Cariboo und der Marquis of Forfar waren die letzten drei ›Besucher‹ dieser Art gewesen. Wenn sie das nicht gewesen wären, dann hätte man sie schon vollständig vergessen. Sie mußte noch ihr neues Kleid anprobieren und ein Dutzend Dinge erledigen und Hugos Konzert begann um acht Uhr fünfzehn. Warum hatten die Leute der vorigen Generation immer so viel Zeit? Plötzlich blickte sie zu Boden und sah, wie Ting-a-ling den kupfernen Fußboden ableckte. Sie hob ihn in die Höhe: »Nicht, Liebling, pfui!« Ah, nun war der Zauber gebrochen. Bart empfahl sich, bis zum letzten Augenblick in seinen Erinnerungen schwelgend. Am Fuß der Treppe wartete sie, bis Michael die Haustür hinter ihm geschlossen hatte, dann flog sie hinauf. In ihrem Zimmer drehte sie alle Lichter an. Hier herrschte ihr eigener Stil: ein Bett, das einem Bett durchaus nicht ähnlich sah, und viele Spiegel. Das Lager Ting-a-lings nahm eine ganze Ecke ein, von wo aus er sich in drei Spiegeln sehen konnte. Sie setzte ihn nieder und sagte: »Nun gib Ruh!« Schon längst war er gegen die andern Hunde im Zimmer vollkommen gleichgültig geworden. Obwohl sie von seiner Rasse und ganz genau von der gleichen Farbe waren, so hatten sie doch keinen Geruch und konnten nicht mit den Zungen lecken – es war nichts mit ihnen anzufangen, nachäffende Geschöpfe, unglaublich blöd.
Ihr Kleid abstreifend, hielt Fleur die neue Toilette unter das Kinn.
»Darf ich dich küssen?« fragte eine Stimme, und hinter ihrem eigenen Bild erschien das Michaels im Spiegel.
»Mein lieber Junge, dazu ist jetzt wirklich keine Zeit! Hilf mir lieber.« Sie zog das Kleid über den Kopf. »Mach die drei obersten Haken zu. Wie gefällt es dir? Oh! Und hör nur, Michael! Gurdon Minho wird vielleicht morgen zum Dinner kommen – Wilfrid hat abgesagt. Hast du Minhos Sachen gelesen? Setz dich hin und erzähl mir etwas davon. Lauter Romane, nicht wahr? Von welcher Art?«
»Na, er hat immer etwas zu sagen gehabt. Und seine Katzen sind gut geschildert. Er ist natürlich ein bißchen romantisch.«
»Ach! Hab ich da am Ende einen Bock geschossen?«
»Nein, durchaus nicht, ein ganz guter Fang. Das Gemeine an unserer ganzen Gesellschaft ist, daß die Leute alles ganz hübsch sagen, daß sie aber gar nichts zu sagen haben. Sie werden nicht dauern.«
»Aber gerade darum werden sie dauern. Sie werden nicht veralten.«
»Glaubst du? Herrje!«
»Wilfrid wird dauern.«
»Ah! Wilfrid kennt Gefühl, Haß, Mitleid und Sehnsucht – wenigstens manchmal; wenn er echt ist, kommt ein verdammt gutes Zeug dabei heraus. Sonst dichtet er gerade nur ein Lied über nichts – wie alle übrigen.«
Fleur zog ihr Unterkleid zurecht.
»Aber, Michael, wenn das wirklich so ist, dann haben wir – dann hab ich ja die ganz verkehrte Gesellschaft eingeladen.«
Michael grinste. »Mein liebes Kind – die, die zur Stunde oben sind, sind immer die Richtigen; man muß nur gut aufpassen, damit man sie rasch genug wechseln kann.«
»Aber glaubst du wirklich, daß Sibley nicht dauern wird?«
»Sib? Du lieber Gott, keine Spur!«
»Aber er weiß doch so todsicher, daß fast jeder andere im Sterben liegt oder schon gestorben ist. Zumindest ist er doch ein kritisches Genie!«
»Wenn ich nicht mehr kritischen Verstand besäße als Sib, würd ich morgen das Verlagsgeschäft an den Nagel hängen.«
»Du – mehr als Sibley Swan?«
»Selbstverständlich hab ich mehr kritischen Verstand als Sib. Na, Sibs kritische Meinung ist gerade nur seine Meinung von Sib, das heißt einfach Intoleranz gegen irgendeinen andern. Er liest die Leute nicht einmal. Von jedem Autor liest er eine einzige Arbeit und sagt dann: ›Ach, dieser Kerl! Er ist fad, oder er ist moralisch, oder er ist sentimental, oder er ist antiquiert, oder ein Faselhans› – hundertmal hab ich ihn schon so reden hören. So urteilt er, wenn es sich um Lebende handelt. Wenn sie schon tot sind, ist es natürlich etwas anderes. Die Toten gräbt er immer aus und spricht sie heilig; auf diese Art hat er sich einen Namen gemacht. So einen Sib gibt es immer in der Literatur. Er ist ein lebendiges Beispiel dafür, wie Leute es verstehen, ihre eigene gute Meinung von sich der ganzen Welt beizubringen. Aber was das Dauern betrifft – natürlich wird er nicht bleiben; er hat nie eine eigene Idee, nicht einmal zufällig.«
Fleur dachte schon längst an etwas anderes. Ja! Es stand ihr gut, machte eine hübsche Linie! Herunter damit! Ehe sie sich ankleiden konnte, mußte sie ja noch die drei kurzen Briefe schreiben!
Michael hatte wieder zu reden begonnen. »Ich will dir einen Tip geben, Fleur. Die wirklich großen Leute schwätzen nicht und bilden keine Cliquen; sie paddeln in ihren eigenen Booten in Gewässern, die uns wie kleine Nebenflüsse vorkommen. Aber es sind die Nebenflüsse, aus denen der Strom gespeist wird. Donnerwetter, da hab ich sogar ein bon mot gesagt, oder ist es ein Paradoxon? Und sind Paradoxe bon mots oder bon mots Paradoxe?«
»Michael, wenn du an meiner Stelle wärst, würdest du Frederic Wilmer sagen, daß er Hubert Marsland nächste Woche beim Lunch hier treffen wird? Wird das ein Anreiz für ihn sein oder wird es ihn abschrecken?«
»Marsland ist ein liebes altes Schaf und Wilmer ist ein störrischer Bock – ich weiß nicht.«
»O bitte, Michael, sei doch ernst – du hilfst mir nie beim Arrangieren – niemals! Malträtier nicht immer meine Schultern, bitte?«
»Aber, Liebstes, ich weiß es wirklich nicht. Ich bin für solche Dinge nicht so begabt wie du. Marsland malt Windmühlen, Klippen und dergleichen – ich zweifle sehr daran, daß er schon vom Futurismus hat reden hören. Er ist fast wie Mathieu Maris, schwimmt nicht mit dem Strom. Wenn du meinst, daß er gern einen ›Rotorist‹ treffen möchte –«
»Ich hab dich nicht gefragt, ob er gern Wilmer treffen möchte, ich habe dich gefragt, ob Wilmer ihn treffen möchte.«
»Wilmer wird einfach sagen: ›Die kleine Mrs. Mont gefällt mir, man kriegt bei ihr verteufelt gut zu fressen‹, und er hat recht, mein Schätzchen. Ein ›Rotorist‹ muß gut genährt werden, sonst steigt es ihm nicht zu Kopf.«
Fleurs Feder flog wieder über das Papier; ihre Schrift fing schon an, ein wenig unleserlich zu werden. Sie murmelte:
»Ich glaube, Wilfrid würde die Situation retten – du wirst nicht da sein; eins – zwei – drei. Was für Frauen?«
»Für Maler – hübsch und mollig, ohne Verstand.«
Fleur entgegnete ungehalten: »Mollige Frauen kann ich nicht auftreiben, die gibt es jetzt nicht!« Und sie schrieb eifrig weiter:
›Lieber Wilfrid! Mittwoch – Lunch, Wilmer, Hubert Marsland, noch zwei Frauen. Hilf mir, damit fertig zu werden.
Stets Deine Fleur.‹
»Michael, dein Kinn kratzt wie eine Schuhbürste.«
»Tut mir leid, liebes Herz, deine Schultern sind eben zu zart. Bart hat Wilfrid einen Tip gegeben, als wir hierherkamen.«
Fleur hielt im Schreiben inne. »Ah?«
»Er hat ihn daran erinnert, daß Verliebtsein Dichtern förderlich ist.«
»Wie kamt ihr darauf?«
»Wilfrid hat sich beklagt, daß ihm jetzt nichts gelingen will.«
»Unsinn! Seine letzten Sachen sind die besten!«
»Ganz meine Meinung. Vielleicht war dieser Tip gar nicht so neu für ihn. Weißt du es vielleicht?«
Fleur wandte den Kopf und blickte in das Gesicht über ihrer Schulter. Nein, es sah ganz so aus wie sonst, offen, sorglos, fast faunartig, mit den spitzen Ohren und den beweglichen Lippen und Nasenlöchern.
Langsam sagte sie: »Wenn du es nicht weißt, dann weiß es wohl niemand.«
Michaels Antwort wurde von einem Schnüffeln unterbrochen. Ting-a-ling stand zwischen ihnen, langgestreckt, sein gesenkter Körper berührte fast den Boden und seine schwarzbraune Schnauze war emporgewandt. ›Mein Stammbaum ist lang‹, schien er zu sagen, ›aber meine Beine sind kurz – was läßt sich da machen!‹
3: Musik
Weil Fleur und Michael Mont sich von dem bedeutenden und gültigen Gesetz gesellschaftlicher Beziehungen leiten ließen, nicht etwa weil sie sich ein Vergnügen erwarteten, besuchten sie das Konzert von Hugo Solstis. Außerdem waren sie der Meinung, daß Solstis, ein Engländer von russisch-holländischer Herkunft, zu den Erneuerern der englischen Musik gehörte: er befreite sie vom Zwang der Melodie und des Rhythmus und gab ihr so ungehemmte Möglichkeiten der Entwicklung, und zugleich stattete er sie mit literarischen und mathematischen Reizen aus. Niemals konnte man einem Konzert eines Künstlers dieser Schule beiwohnen, ohne beim Weggehen das Wort ›interessant‹ im Munde zu führen. Bei dieser erneuerten englischen Musik einzuschlafen, war ebenfalls ganz unmöglich. Fleur, die einen gesunden Schlaf hatte, hatte es nicht einmal versucht. Michael dagegen hatte es getan und sich danach beklagt, er habe so ungefähr das Gefühl gehabt, auf dem Bahnhof von Lüttich eingenickt zu sein. An diesem Abend hatten sie wieder die Sitze am Mittelgang in der ersten Reihe des Balkons, für die Fleur eine Art selbstverständliches Monopol besaß. Dort konnten Hugo und die übrigen sie sehen, wie sie ihren Platz in der englischen Erneuerungsbewegung einnahm. Von dort konnte man auch leicht in den Korridor entwischen, um mit den Herren Kunstkennern in Koteletten das Wort ›interessant‹ zu tauschen; oder man konnte rasch eine Zigarette dem kleinen goldenen Etui entnehmen, einem Hochzeitsgeschenk der Kusine Imogen Cardigan, um ein oder zwei Züge lang auszuruhen. Ehrlich gesagt, Fleur besaß ein natürliches Gefühl für Rhythmus, das peinlich berührt war während der langen und ›interessanten‹ Stücke, die gewissermaßen des Komponisten Aufstieg und Fall von seinem Dornenbett symbolisierten. Ganz im geheimen liebte sie Melodien, und die Unmöglichkeit, dies jemals zu beichten, ohne Solstis, Baff, Birdigal, Mac Lewis, Clorane und all die andern englischen Erneuerungskomponisten zu verlieren, heischte von ihrer Natur, die ihre spartanischen Züge hatte, manchmal die äußerste Selbstüberwindung. Nicht einmal Michael wollte sie ›beichten‹ und es war obendrein noch eine Qual, wenn er mit seiner angeborenen Respektlosigkeit vor Persönlichkeiten, die das Leben im Schützengraben und im Bureau eines Verlegers noch verstärkt hatte, manchmal murmelte: ›Herrgott! Komm doch endlich zur Sache!‹ oder ›Donnerwetter, dem ist aber übel!‹ Und dabei wußte sie ganz genau, daß Michael die Sache viel besser ertragen konnte als sie selber, da er wissenschaftlich gebildeter war und ihn der Trieb zu tanzen nicht so in den Fußspitzen juckte.
Das erste Thema der neuen Komposition von Solstis, ›Phantasmagoria Piemontesque‹, derenthalben sie eigens gekommen waren, begann mit einigen langgezogenen Akkorden.
»Au weh!« flüsterte ihr Michael ins Ohr. »Drei Möbelstücke werden gleichzeitig über einen Parkettboden geschleift!«
In Fleurs unwillkürlichem Lächeln lag das ganze Geheimnis, warum ihre Ehe doch erträglich war. Schließlich war Michael so ein lieber Kerl! Tiefes Gefühl und quecksilbriger Geist – Spaßmacher und treuer Liebhaber – alles zusammen reizte und rührte sogar ein Herz, das schon vergeben war, ehe es ihm geschenkt wurde. ‹›Gefühl‹ ohne ‹›Reiz‹ hätte sie gelangweilt, ‹›Reiz‹ ohne ‹›Gefühl‹ hätte sie irritiert. In diesem Augenblick kam er ihr höchst anziehend vor! Er hörte jenem Eröffnungsthema in einer Art und Weise zu, die Fleurs Bewunderung erzwang; die Hände hielten die Knie umklammert, seine Ohren standen ab, die Augen waren ganz glasig vor lauter Loyalität zu Hugo und seine Zunge spielte in der Wange. Das Stück war wohl ‹›interessant‹ – während sie scheinbar aufmerksam zuhörte, hing sie innerlich ihren Gedanken nach, wie das jetzt oft bei ihr vorkam. Da drüben saß L. S. D., der ‹›Über-Dramatiker‹; sie kannte ihn nicht – noch nicht. Er sah eigentlich erschreckend aus, sein Haar war so kerzengerade in die Höhe gebürstet. Und sie stellte sich vor, wie er sich gegen den Hintergrund eines chinesischen Bildes und auf ihrem kupfernen Fußboden ausnehmen würde. Und dort – ja! Gurdon Minho! Wie merkwürdig, daß er zu so etwas Modernem ging! Sein Profil sah wirklich etwas römisch aus, Zeitalter des Mark Aurel! Mit dem angenehmen Gedanken, daß morgen um diese Zeit diese Antiquität wahrscheinlich schon ihrer Sammlung angehören würde, ließ sie ihre Blicke weitergleiten und sortierte gewissermaßen die Versammlung, Gesicht um Gesicht, denn sie wollte keine einzige Größe übersehen haben.
Die ‹›Möbelstücke‹ waren ganz plötzlich zur Ruhe gekommen.
»Interessant!« sagte eine Stimme über ihrer Schulter. Aubrey Greene! Ungreifbar, wie mondbestrahlt, mit dem seidenen blonden Haar, das er glatt zurückgestrichen trug, und den grünlichen Augen; wenn er lächelte, wurde sie nie das Gefühl los, daß er sich über sie lustig mache. Aber er war ja auch ein Karikaturenzeichner!
»Ja, nicht wahr?«
Er schlängelte sich davon. Er hätte schon ein wenig länger bleiben können – für irgend einen andern war keine Zeit mehr, ehe Birdigal mit seinen Liedern anfing. Da kam auch schon der Sänger Charles Powls! Wie dick und brav er aussah, wie er so den kleinen Birdigal zum Klavier schleppte.
Eine reizende Begleitung – anmutig plätschernd, melodiös!
Der dicke brave Mann fing an zu singen. Er sang so anders als die Begleitung war! Der Gesang hämmerte mit jeder Note derart auf ihren plexus solaris los, daß ihr mit mathematischer Sicherheit Hören und Sehen verging. Birdigal mußte beim Komponieren in ständiger Angst gelebt haben, daß jemand sein Lied ‹›sangbar‹ finden könnte. Sangbar! Fleur wußte, wie ansteckend das Wort war; wie Masern würde es sich durch die ganze Gesellschaft ausbreiten, und dann war es um Birdigal geschehen! Der arme Birdigal! Aber ‹›interessant‹ war es auf jeden Fall. Nur, wie Michael sagte: »Herrgott noch einmal!«
Drei Lieder! Powls war wundervoll – so loyal! Niemals traf er einen Ton so, daß es wie Musik klang! Ihre Gedanken flatterten zu Wilfrid. Ihm allein von allen jüngeren Dichtern gestand man das Recht zu, etwas zu sagen; das gab ihm eine so eigene Position – er schien aus dem Leben zu kommen und nicht aus der Literatur. Außerdem hatte er allerhand im Krieg geleistet, war ein Sohn von Lord Mullyon, würde wahrscheinlich den Mercer-Preis, eine hohe Auszeichnung, für seine ›Kleine Münze‹ erhalten. Wenn Wilfrid sie verließ, so fiel ein Stern vom Firmament über ihrem Kupferfußboden. Er hatte kein Recht, sie im Stich zu lassen. Er mußte lernen, nicht so heftig zu sein, nicht so – körperlich zu denken. Nein, sie konnte sich Wilfrid nicht entschlüpfen lassen. Sie konnte aber auch keine Sentimentalität mehr in ihrem Leben dulden, keine verzehrende Leidenschaft mehr, die zu nichts führte und nur einen bitteren Nachgeschmack zurückließ. Davon hatte sie genug gekostet. Noch immer spürte sie einen dumpfen, warnenden Schmerz.
Birdigal verbeugte sich, Michael sagte: »Gehn wir hinaus auf eine Zigarette! Das nächste Stück ist eine Niete.« Oh! Ah! Beethoven. Der arme alte Beethoven! So antiquiert – und doch hörte man ihn ganz gern!
Im Korridor und Buffetraum wimmelte es von Anhängern der Restaurationsbewegung. Junge Männer und Frauen mit Gesichtern und Köpfen von lebhaftem und verschrobenem Charakter tauschten untereinander das Wort ›interessant‹. Männer von mehr massivem Typus, die Matadoren mit sitzender Lebensweise glichen, behinderten die Bewegungsfreiheit. Fleur und Michael gingen ein kurzes Stück, lehnten sich dann an die Wand und zündeten ihre Zigaretten an. Fleur rauchte sehr zierlich – eine ganz winzige Zigarette in einer winzigen Bernsteinspitze. Es hatte den Anschein, als ob sie den blauen Rauch viel lieber bewunderte als hervorbrächte. Sie mußte auch an Sphären denken, die jenseits dieser Menge lagen – man konnte nie wissen, wer hier war! – die Sphäre zum Beispiel, in der Alison Cherrell lebte: politisch-literarisch, vorurteilslos im Geschmack, aber wie Michael sich immer ausdrückte, ›so überzeugt davon, daß sie die einzige Gesellschaftssphäre überhaupt sind, ebenso wie ein Gesundheitsapostel von seinem System durchdrungen ist; man muß sich nur ansehn, wie sie fortwährend einer über den andern Memoiren schreiben!‹ Sie fürchtete immer, daß Leute dieser Sphäre das Rauchen der Frauen in öffentlichen Gebäuden vielleicht nicht billigen würden. Auf eine vorsichtige Weise den Bilderstürmern sich anschließend, vergaß sie doch nie, daß sie mit ihren beiden Beinen zumindest in zwei ganz verschiedenen Welten stand. Während sie beobachtete, was links und rechts von ihr vorging, bemerkte sie an die Wand gelehnt einen, dessen Gesicht hinter dem Programm verborgen war. ›Wilfrid‹, dachte sie, ›und er tut so, als sähe er mich nicht!‹ Gekränkt wie ein Kind, dem man einen Sixpence stibitzt hat, sagte sie: »Dort ist Wilfrid! Hol' ihn her, Michael!«
Michael ging zu seinem Brautführer hinüber und berührte seinen Arm. Desert blickte stirnrunzelnd von seinem Programm auf. Sie sah, wie er die Achseln zuckte, sich umwandte und in der Menge verschwand. Michael kam zurück.
»Wilfrid hat heute abend einen Rappel; er sagt, er paßt heute nicht in menschliche Gesellschaft – sonderbarer Kauz!«
Wie blind die Männer doch waren! Michael bemerkte nichts, weil Desert sein Freund war, und das war ein Glück! So war Wilfrid fest entschlossen, sie zu meiden! Na, man würde ja sehen! Und sie sagte: »Ich bin müde, Michael, gehen wir nach Hause.«
Er ließ die Hand durch ihren Arm gleiten.
»Das tut mir leid, mein Herz, gehn wir!«
Einen Augenblick blieben sie in einer Seitentür stehen, um Woomans, den Dirigenten, zu beobachten, der zum Orchester hinaufstürzte.
»Da schau ihn an«, sagte Michael, »wie eine Vogelscheuche, die man aus einem venetianischen Fenster hinausgehängt hat und deren ausgestopfte Arme und Beine im Winde flattern! Und schau die Frapka und ihren Flügel an – welch turbulentes Paar!«
Ein seltsamer Ton erklang.
»Himmel, eine Melodie!« sagte Michael.
Ein Diener murmelte leise: »Jetzt muß ich die Tür schließen.« Fleur sah noch einmal flüchtig L. S. D., der mit geschlossenen Augen, aufrecht wie seine Frisur, dasaß. Die Tür wurde geschlossen – sie standen draußen im Vestibül
»Wart hier, mein Schatz, ich werd ein Wägelchen auftreiben.«
Fleur vergrub ihr Kinn im Pelz. Es herrschte östlicher Wind und Kälte. Da sagte eine Stimme hinter ihr: »Nun, Fleur, soll ich ostwärts gehn?«
Wilfrid! Den Kragen bis zu den Ohren hochgestellt, die Zigarette zwischen den Lippen und die Hände in den Taschen, so verschlang er sie mit dem Blick.
»Wilfrid, du bist wirklich albern!«
»Alles was du willst. Soll ich ostwärts gehn?«
»Nein, Sonntag vormittag – elf Uhr in der Tate-Galerie. Wir wollen alles durchsprechen.«
»Abgemacht!« Und fort war er.
Wie sie so plötzlich wieder allein war, fühlte Fleur zum ersten Mal die erschreckende Wirklichkeit. Würde Wilfrid sich wirklich nicht zur Vernunft bringen lassen? Ein Taxi fuhr vor, Michael winkte, Fleur stieg ein.
Als sie an einer grell beleuchteten Gruppe junger Damen vorbeifuhren, die den interessierten Londonern die höchste Vollendung Pariser Unangezogenheit vorführten, fühlte sie, wie Michael sich zu ihr neigte. Wenn sie Wilfrid behalten wollte, mußte sie nett zu Michael sein. Nur: »Du brauchst mich nicht gerade in Piccadilly Circus zu küssen, Michael!«
»Tut mir leid, Kätzchen! Es war ein bißchen verfrüht – ich wollte dich gerade gegenüber dem ›Partheneum‹ erwischen.«
Fleur erinnerte sich, wie er die ersten vierzehn Tage ihrer Flitterwochen auf einem unbequemen spanischen Sofa geschlafen hatte; wie er immer darauf bestand, daß sie kein Geld für ihn ausgeben solle, und daß sie sich immer noch von ihm schenken lassen mußte, was ihm gefiel, obgleich sie dreitausend Pfund im Jahr erhielt und er nur zwölfhundert; wie er aus dem Häuschen geriet, wenn sie nur einen Schnupfen hatte, und wie er immer zum Tee nach Hause kam. Ja, er war wirklich ein lieber Kerl! Aber würde ihr das Herz brechen, wenn er morgen nach dem Osten oder Westen ginge?
Während sie an ihn geschmiegt dasaß, war sie überrascht von ihrem eigenen Zynismus.
In der Halle lag ein Zettel mit einer telephonischen Mitteilung: ›Bitte, sagen Sie Mrs. Mont, daß Mr. Gurdon Minho kommt. Lady Alison.‹
Das war eine Beruhigung. Eine wirkliche Antiquität! Sie drehte die Lichter an und stand einen Augenblick in Bewunderung ihres Zimmers versunken. Wirklich hübsch! Ein leichtes Schnaufen kam aus der Ecke. Ting-a-ling lag goldbraun auf seinem schwarzen Kissen wie ein kleiner chinesischer Löwe da, fremd und erhaben, er hatte gerade seine Abendunterhaltung an den Gittern des Platzes beendet.
»Ja, du bist auch da!« sagte Fleur.
Ting-a-ling rührte sich nicht. Seine runden, schwarzen Augen beobachteten, wie seine Herrin sich entkleidete. Als sie aus dem Badezimmer zurückkam, war er schon zu einer Kugel zusammengerollt. Fleur dachte: ‹›Sonderbar! Woher weiß er, daß Michael heute abend nicht zu mir kommt?‹ Und in ihr gut gewärmtes Bett schlüpfend, rollte auch sie sich zusammen und schlief ein.
Aber ganz gegen ihre Gewohnheit erwachte sie während der Nacht. Ein langer, unheimlich gedehnter Ruf erklang – von irgendwoher – von der Themse – von den Elendsvierteln in der Nähe; Erinnerungen stiegen auf – heftig, schmerzhaft – an ihre Flitterwochen – Granada, seine Dächer tief unten, Jet, Elfenbein, Gold; des Wächters Ruf, die Verse in Jons Brief:
›Ruf in der Nacht! Tief unten im Dunkel der alten Schlafenden spanischen Stadt, unter den weißen Sternen! Was will der Ruf? – Sein angstvoll dauernd Klagen? Ist's der des Wächters, der sein zeitlos Lied der Ruhe singt? Ist's nur ein Wandersmann, der Lieder singt dem Mond? Nein! Ein Beraubter ist's, des liebend Herz der Klage voll. Es ist sein Schrei: Wie lang noch?‹
Ein Ruf, oder hatte sie es nur geträumt? Jon, Wilfrid, Michael! Vergeblich, ein Herz zu haben!
4. Dinner
Lady Alison Cherrell, geborene Heathfield, die Tochter des ersten Earl of Campden und die Gemahlin des Königlichen Rates Lionel Cherrell, Michaels jungen Onkels, war eine entzückende Engländerin, unter Menschen aufgewachsen, die man für die Seele der Gesellschaft hielt. Diese Gesellschaft, die eine Fülle von Geist, Energie, Geschmack und Geld besaß, entstammte Generationen von Politikern und Rechtsgelehrten, deren Blut durch Verbindungen mit Aristokraten blau gefärbt war, hatte aber nichts mit dem Snooks-Klub und den langweiligen Zufluchtsstätten der durch Geburt und Privilegien Begünstigten zu tun. Die Gesellschaft war reizend und lustig, frisch und frei und nach Michaels Meinung ›snobistisch und altmodisch in ästhetischer und intellektueller Hinsicht, aber einsehen werden sie's nie. Sie halten sich für die Krone der Schöpfung, für aufgeweckt, gesund, modern, vornehm und intelligent. Sie können sich einfach nicht vorstellen, daß es noch ihresgleichen gibt. Aber sie haben zu wenig Phantasie. Ihre wirklich schöpferischen Taten kann man an den fünf Fingern abzählen. Man muß sich nur ihre Bücher ansehen: immer schreiben sie über irgend etwas – über Philosophie, Spiritualismus, Poesie, Fischerei, oder über sich selbst. Sogar ihre Sonette versiegen, ehe sie fünfundzwanzig Jahre alt sind. Alles kennen sie, nur die Menschen außerhalb ihrer Gesellschaftsschicht nicht. Ja, arbeiten – das tun sie schon – sind Hans Dampf in allen Gassen; das müssen sie ja sein, denn niemand hat so viel Verstand, Energie und Geschmack wie sie. Aber sie drehen sich fortwährend in ihrem eigenen verwünschten Kreis herum. Der ist ihre Welt – und die könnte noch schlechter sein. Sie haben auf ihr eigenes Goldenes Zeitalter ein Patent genommen; aber seit dem Krieg zeigt sich schon ein wenig Fliegenschiß darauf.‹
Alison Cherrell, Gesellschaftsdame durch und durch, so energisch-seelenvoll, so freundlich, ungezwungen und gemütlich, wohnte in fast unmittelbarer Nähe von Fleur, in einem Hause, das so hübsch gebaut war wie nur irgend eines in London. Mit vierzig Jahren besaß sie drei Kinder und war von ansehnlicher Schönheit, die ganz leise Spuren ihrer geistigen und körperlichen Tätigkeit aufwies. Da sie sich leicht begeisterte, hatte sie Michael gern, trotz seiner seltsamen Art zu kritisieren, so daß sein Eheabenteuer ihr Interesse von Anfang an erregt hatte. Fleur besaß feinen Geschmack und eine rasche, natürliche Auffassungsgabe – es lohnte sich wohl, diese neue Verwandtschaft zu kultivieren. Aber obgleich Fleur aufnahms- und anpassungsfähig war, so paßte sie sich merkwürdigerweise durchaus nicht an; sie erregte noch immer die Neugier Lady Alisons, die an den engen Kreis auserwählter Geister gewöhnt war und nun einen gewissen Reiz im Kontakt mit Leuchten der Neuen Zeit fand, die sich auf Fleurs Kupferfußboden trafen. Dort stieß sie auf eine Respektlosigkeit, die, obwohl nicht allzu ernst genommen, sie doch stark aufmunterte. Auf jenem Boden kam sie sich fast altmodisch vor. Das gerade, stachelte ihren Ehrgeiz an.
Nach Fleurs telephonischer Anfrage wegen Gurdon Minho hatte sie den Schriftsteller angerufen. Sie kannte ihn, wenngleich nicht sehr gut. Niemand schien ihn gut zu kennen – er war liebenswürdig, höflich, schweigsam, ziemlich zurückhaltend und langweilig. Sein Lächeln, das manchmal ironisch, manchmal freundlich war, konnte einen aus der Fassung bringen. Seine Bücher waren bald beißend spöttisch, bald sentimental. Auf jeden Fall war es beinahe Mode, ihn abzukanzeln, obgleich er noch immer zu existieren schien!
Sie rief ihn an: Ob er morgen zum Dinner zu ihrem jungen Neffen, Michael Mont, kommen wolle, um dort die jüngere Generation zu treffen? Seine Antwort kam mit ziemlich hoher Stimme: »Herzlich gern! In voller Gala oder Smoking?«
»Das ist wirklich reizend von Ihnen! Man wird sich so freuen. Volle Gala, glaub ich. Es ist ihr zweiter Hochzeitstag.« Als sie das Hörrohr zurückhängte, dachte sie: ›Wahrscheinlich schreibt er ein Buch über die Leute!‹
Da sie sich ihrer Verantwortung bewußt war, ging sie früh hin.
Ihr Gatte hatte eine große Versammlung in der Advokatenkammer, so daß sie allein kam und das Gefühl hatte, ein Abenteuer zu erleben. Das war sehr angenehm nach einem Tag, den sie in unschlüssiger Erregung über das Ergebnis im Snooks-Klub verbracht hatte. Sie wurde nur von Ting-a-ling empfangen, der mit dem Rücken zum Feuer lag, sie anstarrte und weiter keine Notiz von ihr nahm. Sie ließ sich auf dem graugrünen Sofa nieder und sagte: »Na, du komischer kleiner Kauz, kennst du mich nach so langer Zeit noch immer nicht?«
Ting-a-lings glänzende schwarze Augen schienen zu sagen: ›Ich weiß, daß du immer wiederkehrst; die meisten Dinge kehren immer wieder. Es gibt nichts Neues in der Welt.‹
Lady Alison verfiel in Sinnen: Die neue Generation! Wünschte sie denn, daß ihre eigenen Töchter dazugehörten? Sie würde gern einmal mit Mr. Minho darüber sprechen – vor dem Krieg hatte sie einmal dort in Beechgroves ein sehr nettes Gespräch mit ihm geführt. Das war vor neun Jahren gewesen. So verging die Zeit, und alles änderte sich. Eine neue Generation! Und worin lag denn der Unterschied? »Ich glaube, wir besaßen mehr Tradition«, sagte sie leise zu sich.