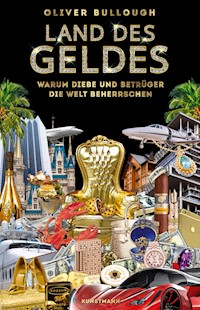20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kunstmann, A
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Ein Buch, das Oligarchen nicht lesen wollen: wie Großbritannien der Diener von Milliardären, Finanzbetrügern, Kleptokraten und Kriminellen wurde. Die Suezkrise von 1956 gilt als der Tiefpunkt der britischen Geschichte im 20. Jahrhundert, der Moment, in dem eine globale Supermacht in die Knie gezwungen wurde. In den berühmten Worten des US-Außenministers Dean Acheson: »Großbritannien hat sein Reich verloren, aber noch keine neue Rolle gefunden.« Das entsprach nur der halben Wahrheit, denn Großbritannien hatte schon eine neue Rolle gefunden und das Kostüm dazu lag auch schon bereit. Die Welt hatte es nur noch nicht bemerkt. Oliver Bullough enthüllt in diesem Buch, wie Großbritannien zu einem der zentralen Orte der globalen Offshore-Ökonomie und zum Handlanger der Oligarchen, Kleptokraten und Kriminellen dieser Welt wurde. Denn während Großbritannien nach außen gerne die Werte des Fairplay und der Rechtsstaatlichkeit betont, gibt es wenige Länder, die die globale Anti-Korruptions-Anstrengung mehr behindern und von einem unregulierten Finanzmarkt mehr profitieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Oliver Bullough
DER WELT ZU DIENSTEN
Wie Großbritannien zum Butler von Oligarchen, Kleptokraten, Steuerhinterziehern und Verbrechern wurde
Aus dem Englischen vonRita Gravert und Sigrid Schmid
Verlag Antje Kunstmann
INHALTSVERZEICHNIS
1Das Butlergeschäft
2Sonne, Sand, Kanal
3Ein praktisch denkendes Völkchen
4Postkolonialer Schock
5Fels in der Brandung
6Der schottische Waschsalon
7In die Röhre geschaut
8Zeugenaussage
9»Gerechtigkeit«
10Das Ende?
Quellen
Danksagung
Register
KAPITEL 1
DAS BUTLERGESCHÄFT
VOR EIN PAAR JAHREN fragte ein US-amerikanischer Akademiker an, ob ich mich mit ihm auf einen Kaffee treffen wolle. Sein Name war Andrew. Er recherchierte chinesische Geldanlagen und wollte von mir etwas über Vermögenswerte von Chinesen in London wissen und darüber, wie die britische Regierung sicherstellte, dass die Eigentümer ihren Besitz legal erworben hatten. Ich bekomme gelegentlich derartige Anfragen, weil ich Stadtführer bei den London Kleptocracy Tours bin, einer Rundfahrt zu den Immobilien in den Londoner Stadtteilen Knightsbridge und Belgravia, die Oligarchen gehören, und ich helfe gern, wenn ich kann.
Wir trafen uns in einem Café im ersten Stock einer Buchhandlung in einem recht stattlichen Gebäude am Trafalgar Square. Um einen Streit beizulegen, hatten ukrainische Oligarchen das Gebäude im Jahr 2016 untereinander getauscht, so wie mein Sohn nach einem Streit auf dem Spielplatz einem Freund eine seltene Fußballkarte gibt. Ein witziger Zufall angesichts des Themas, das Andrew und ich besprechen wollten.
Andrew kam gut vorbereitet zu unserem Treffen und hatte eine Checkliste, die er abarbeiten wollte. Offensichtlich wollte er von mir Namen hören von Leuten, mit denen er sonst noch reden konnte. Welche Strafverfolgungsbehörde ging in erster Linie gegen chinesische Geldwäsche vor? Mit wem konnte er bei dieser Behörde am besten sprechen? Welche Staatsanwälte hatten die besten Fälle vor Gericht gebracht? Wer hatte die effektivsten Nachforschungen dazu durchgeführt, wie viel chinesisches Geld im Vereinigten Königreich kursierte und in was dieses Geld vor allem angelegt wurde? Welche Politiker wussten am besten über dieses Thema Bescheid, und wie organisierten sie sich?
Wegen der gemeinsamen Sprache glauben US-Amerikaner und Briten oft, ihre Länder seien sich ähnlicher, als sie es in Wirklichkeit sind. Das geht mir leider genauso. Wenn ich in den USA recherchiere, bin ich immer erstaunt, wie bereitwillig Amtsträger sich mit mir treffen und über ihre Arbeit sprechen. Ich rufe sie ohne Empfehlung an, und doch vertrauen sie mir, dass ich die Details unserer Gespräche vertraulich behandle. Gerichtsakten sind leicht zugänglich und Staatsanwälte bereit, darüber zu reden. Den Politikern scheint es tatsächlich wichtig zu sein, ihre Arbeit einer breiteren Öffentlichkeit nahezubringen, was dazu führt, dass sie sich gerne mit Autoren wie mir unterhalten. US-amerikanische Journalisten beschweren sich über ihre Arbeitsbedingungen wie alle Journalisten überall, aber wenn man als Europäer in den USA über Wirtschaftskriminalität recherchiert, fühlt man sich wie ein Kind im Spielwarenladen.
Andrew musste jedoch feststellen, dass die Überraschung in umgekehrter Richtung nicht ganz so erfreulich war. Er hatte wohl gehofft, dass ich ihm ein paar Kontakte vermitteln würde zu den entsprechenden Leuten in Großbritannien, wie ich sie bei meinen Besuchen in Miami, Washington, San Francisco und New York ohne große Probleme gefunden hatte. Vielleicht befürchtete er auch, dass ich ihm keinen Einblick in mein Adressbuch gewähren würde, aber er schien gar nicht auf die Idee gekommen zu sein, dass ich gar kein Adressbuch hatte, in das er hätte schauen können; dass die Kontaktleute, die er suchte, gar nicht existierten.
Es gab keine konzertierten Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden gegen chinesische Geldwäsche. Ich sagte Andrew, es gäbe im Grunde keine Ermittler, die mit ihm sprechen könnten. Es gab praktisch keine Strafverfolgung, sodass er sich auch nicht über deren Stand informieren konnte, und es wurde auch so gut wie nicht nachgeforscht, wohin die Gelder fließen, wie sie dorthin gelangen, oder auch nur, wie viel Geld überhaupt im Umlauf ist.
Er probierte es mit immer neuen Fragen aus verschiedenen Richtungen, als glaube er, er müsse nur das richtige Passwort finden, um die Tür öffnen zu können, hinter der sich die britischen Vollzugsorgane verbargen. Wo war die Entsprechung der International Corruption Squad des FBI? Wer machte die Arbeit der Kleptokratie-Taskforce im US-Justizministerium? Was war mit den Homeland Security Investigations; gab es in Großbritannien etwas Entsprechendes? Trugen britische Staatsanwälte Beweismaterial zusammen, wie man es im Southern District in New York tat? Konnte es für jemanden zum Karrieresprungbrett werden, wenn er einen großen chinesischen Geldwäschering zu Fall brachte? Welche parlamentarische Untersuchungskommission beschäftigte sich mit dem Thema? Irgendjemand musste es doch wohl tun! Während er sprach, sah ich die Situation zunehmend mit seinen Augen und gewann so eine Perspektive, die mir völlig neu war.
Das Problem war, dass er immer neue Passwörter ausprobieren konnte, bis die Felswände von selbst zusammenfielen, ohne dass es das Geringste brachte: Es gab keine Schatzhöhle, die sich ihm hätte öffnen können. Wenn er herausfinden wollte, wie viel chinesisches Geld nach Großbritannien floss, wer es bewegte und was damit gekauft wurde, musste er die Arbeit selbst machen und dabei ganz von vorn anfangen. Andrew war nach London gekommen, um herauszufinden, wie Großbritannien illegale Finanzgeschäfte bekämpfte, und musste feststellen, dass es gar nicht geschah. Ganz im Gegenteil.
Natürlich hilft nicht nur Großbritannien chinesischen Kleptokraten und Kriminellen bei der Geldwäsche. Das Schattenbanksystem, dessen sich chinesische Kriminelle bedienen, ist von Natur aus grenzübergreifend. Es überschreitet Ländergrenzen und erhält seine Macht und seine Widerstandsfähigkeit gerade dadurch, dass es nicht auf einen bestimmten Ort angewiesen ist: Wenn es in einem Land zu ungemütlich wird, dann zieht das Geld mühelos in ein anderes Land weiter, das toleranter ist. Und das System wächst pausenlos, weil Anwälte, Buchhalter und andere Akteure Politiker überreden, ihnen zu ermöglichen, an Geldbewegungen zu verdienen. Entsprechendes findet man in Dubai, Sydney, Liechtenstein und Curaçao ebenso wie in der Schweiz oder in New York. Vor allem aber gibt es das in London.
Im Gespräch mit Andrew fiel mir außerdem auf, dass Großbritannien sehr viel stärker in diese Art von Geschäften eingebunden ist als all diese anderen Orte. Finanzbetrug geschieht im Vereinigten Königreich nicht einfach; er wurde hier jahrzehntelang durch konzertierte Bemühungen gefördert. Das ist nur schwer zu begreifen, weil es dem öffentlichen Image Großbritanniens so sehr widerspricht: als das Land von Harry Potter, Königin Elizabeth II. und Downton Abbey; als Ort, der durch Ironie, Tradition und ein gehaltvolles Frühstück definiert wird. Kriminelle Banker sind vulgär, und wenn Großbritannien eines bekanntermaßen nicht ist, dann vulgär. Aber die Fakten sprechen eine andere Sprache. So schlimm die anderen Länder auch sein mögen, Großbritannien ist seit Jahrzehnten schlimmer. Es fungiert als gigantisches Schlupfloch, das die Regelungen anderer Länder unterläuft, Steuersätze drückt, Regulierungen außer Kraft setzt und das Geld ausländischer Krimineller wäscht.
Großbritannien stellt nicht nur keine Untersuchungen gegen die Gauner an, es hilft ihnen sogar noch. Vor allem bewegt und investiert das Land das Geld dieser Gauner natürlich, aber das ist nur der Anfang: Großbritannien bildet ihre Kinder aus, kümmert sich um ihre Rechtsstreitigkeiten, erleichtert ihnen den Eintritt in die High Society der Welt, verbirgt ihre Verbrechen und vermeidet grundsätzlich, dass sie die Konsequenzen ihres Handelns tragen müssen. All das wusste ich auch vorher schon, aber ich hatte es nie als ein zusammengehöriges Phänomen betrachtet. Erst durch Andrews Fragen kristallisierte sich das Bild heraus.
»Großbritannien ist wie ein Butler«, versuchte ich schließlich für uns beide zu erklären, was geschah. »Wenn jemand reich ist, ganz egal, ob er Chinese, Russe oder was auch immer ist, und er will, dass etwas getan oder versteckt oder gekauft wird, dann kümmert sich Großbritannien für ihn darum. Wir sind keine Polizisten, wie ihr drüben in Amerika, wir sind Butler, der Welt zu Diensten. Deswegen werden die Probleme, über die wir gesprochen haben, hier nicht untersucht – das gehört nicht zu den Aufgaben eines Butlers.«
Er sah mich einige Augenblicke lang an, als überlege er, ob ich das ernst meinte.
»Wie lange geht das schon so?«, fragte er schließlich, und ich musste über die Antwort nicht lange nachdenken. Sie war plötzlich offensichtlich.
»Es begann in den 1950er-Jahren. Wir brauchten ein neues Geschäftsmodell, nachdem die Vereinigten Staaten die Rolle als Supermacht der Welt übernommen hatte, und das ist dabei rausgekommen.«
Danach war unser Gespräch rasch beendet, und Andrew ging in Richtung Parlamentsgebäude, wahrscheinlich in der Hoffnung, dort mit jemandem sprechen zu können, der weniger deprimierende Informationen hatte, aber ich blieb sitzen und bestellte noch einen Kaffee. Großbritannien als Butler zu sehen war mir noch nicht in den Sinn gekommen, aber je länger ich darüber nachdachte, umso passender erschien es mir. Butler zeichnen sich durch alles aus, was in Großbritannien besonders geschätzt wird – gute Manieren, Einfallsreichtum, Zurückhaltung –, aber in Form der Unterwürfigkeit eines Dieners, nicht als Noblesse eines Herrn.
Nachdem ich diese Theorie aufgestellt hatte, wollte ich sie in der realen Welt überprüfen, stieß dabei aber sofort auf ein Problem: Ich war noch nie einem Butler begegnet; ich musste also erst einmal einen suchen, was mir nicht besonders schwierig erschien. Britische Butler sind der Goldstandard weltweit, und in Großbritannien boomte die Ausbildung von Menschen als Butler für die Oligarchen der Welt. Ich vereinbarte also einen Gesprächstermin in einer Butlerschule. Wenige Tage später saß ich in einem Kurs für Blumenarrangement in einem Keller nahe Covent Garden. Eine Blumenexpertin mittleren Alters mit Pferdegesicht brachte einer Gruppe zukünftiger Butler aus vier Kontinenten bei, wie man ein Landhaus mit den Früchten eines englischen Gartens dekoriert. Unterstützt wurde sie von einer Anzahl jüngerer Pendants ihrer selbst, die mit Gartenscheren herumwieselten.
Jede Woche durchlief eine neue Gruppe diesen Keller; wie war es möglich, dass nach ihrem Abschluss Nachfrage nach den Diensten all dieser Menschen bestand? »Das ist doch wohl offensichtlich«, antwortete eine dunkelhaarige Kanadierin, die langstielige Blumen zu einem Gitter verwob. »Jeder, der es sich leisten kann, will seinen eigenen Jeeves.« Wenn ich eine Cartoonfigur gewesen wäre, dann hätte in diesem Moment eine Glühbirne über meinem Kopf aufgeleuchtet. Diese Branche, in der Großbritannien weltweit führend war, existierte, um Probleme für ihre Kunden diskret und profitabel zu lösen, so wie der Butler Jeeves es in den Geschichten von P. G. Wodehouse für Bertie Wooster tat. Ich wollte mehr von diesen Auszubildenden wissen und beschloss, ihnen zu folgen, wenn sie in die Häuser der Superreichen einzogen, um herauszufinden, was als Nächstes geschah.
Leider kam es anders. Der Leiter des Ausbildungszentrums hatte mich wohl gegoogelt und herausgefunden, dass ich über Wirtschaftskriminalität schrieb und nicht etwa über die Arbeit von Hausangestellten. Daraufhin war er deutlich weniger bereit, mir bei Recherchen über sein Gewerbe zu helfen, und ich verlor den Zugang zu echten Butlern. Ich ließ mich daher von den Worten der kanadischen Butlerin in spe inspirieren und wandte mich dem Werk von P. G. Wodehouse zu, der die vielen Geschichten über den Gentleman Bertie Wooster und seinen treuen Diener Reginald Jeeves verfasst hatte.
Wodehouse beschreibt Jeeves als beruhigende Präsenz, einen Mann mit unendlichem Scharfsinn, der Wooster und seinen Freunden aus so mancher Bredouille hilft, ob es um eine törichte Verlobung mit einem unpassenden Mädchen geht, eine ältliche Verwandte ihre finanzielle Unterstützung zurückzieht, eine rivalisierende Familie einen Koch abwerben will oder einer der Herren ein Diamantcollier gestohlen hat, um Spielschulden zu begleichen, die er als illegaler Buchmacher angehäuft hat. Dank Wodehouse’ einzigartiger, federleichter Prosa kommt alles sehr amüsant daher, kann aber auch überraschend gemein sein.
In Without the Option wird beispielsweise einer von Berties Freunden verhaftet, weil er einen Polizisten geschlagen hat, und es besteht die Gefahr, dass seine wohlhabende Tante sich von ihm abwendet, wenn sie es herausfindet. Nach einigen Turbulenzen gelingt es Jeeves, der Zugriff auf Geheiminformationen der Polizei hat, alles zum Guten zu wenden. So wie Wodehouse es schreibt, ist alles furchtbar witzig, aber man könnte es problemlos so umformulieren, dass Bertie Woosters Butler in einem völlig anderen Licht erscheint. Wenn man sich auf Jeeves’ Taten statt auf sein schmeichelndes, sanftes Auftreten konzentriert, bekommt man das äußerst düstere Bild eines Söldners, jemand, der gegen Bezahlung die Probleme anderer löst.
»Um Himmels willen, Jeeves! Sie haben ihn doch nicht etwa bestochen?«
»O nein, Sir. Aber er hatte letzte Woche Geburtstag, und da habe ich ihm ein kleines Geschenk überreicht.«
Das ist natürlich sehr amüsant, aber ich habe ukrainische Anwälte darüber reden hören, wie sie knifflige Rechtsstreitigkeiten mithilfe eines »kleinen Geschenks« beigelegt haben, und so wie sie es sagten, klang es nie witzig. Wenn man hinter Jeeves’ makellose Erscheinung, seinen gebildeten Akzent und die Mark-Aurel-Zitate blickt, sieht man keinen Butler mehr, sondern einen Consigliere, einen hochrangigen Ratgeber in einer Mafia-Familie. Die Bestechung von Polizeibeamten ist noch das geringste seiner Talente; bei einer Gelegenheit schlägt er einen Polizisten k.o., bei einer anderen bringt er einen Faschisten zum Schweigen, indem er ihm androht, die Quelle seines geheimen Reichtums zu enthüllen. Mit seiner Intelligenz könnte Jeeves in fast jedem Bereich erfolgreich sein, aber er beschränkt sich darauf, den Superreichen dabei zu helfen, den Konsequenzen für ihr Handeln zu entgehen, und verdient dabei – über sein eigentliches Gehalt hinaus – ganz ordentlich an ihren Trinkgeldern.
In den letzten Jahren wurde in Großbritannien darüber gestritten, wer uns repräsentieren soll und, als Konsequenz daraus, auf wen wir stolz sein sollten. Dank einer Statue in Oxford hat der Imperialist Cecil Rhodes die größte Aufmerksamkeit auf sich gezogen, aber er war nur der Erste. Nachdem Black-Lives-Matter-Aktivisten eine Statue des Sklavenhändlers Edward Colston in den Hafen von Bristol geworfen hatten, stellten rechtsextreme Aktivisten Wachen an den Statuen von Winston Churchill, Robert Peel und anderen lange verstorbenen Politikern auf. Die BBC hat eine Statue von George Orwell vor der Senderzentrale aufgestellt, um an ein anderes Großbritannien zu erinnern, ein Land des Skeptizismus und der modernen Werte, obwohl das einen Streit darüber auslöste, ob Orwell nicht zu linkspolitisch gewesen sei. Ganz ähnlich stritten Kolumnisten von konkurrierenden Zeitungen, nachdem die Frauenrechtlerin Millicent Fawcett als erste Frau im Parliament Square verewigt worden war, ob sie diese Auszeichnung verdiente. Und das geht nicht nur bei Statuen so. Alle paar Jahre druckt die Bank of England ein neues Gesicht auf ihre Banknoten, und jedes Mal löst das eine Diskussion darüber aus, wer wir sind. Bei den Personen, für die Gedenkbriefmarken aufgelegt werden, ist es genauso. Das alles ist ziemlich anstrengend.
Augenscheinlich sind die Briten sehr geteilter Meinung darüber, welcher ihrer Vorfahren man gedenken sollte, aber in einer Sache sind sie sich offensichtlich einig: welche Art Mensch es wert ist, dass man sich an ihn erinnert. All diese Menschen – ob Frauenrechtlerin, Imperialist oder Sozialist – hinterließen ihre Spuren in der Welt, ob sie nun Südafrika eroberten oder für die Abschaffung der Sklaverei kämpften. Großbritannien sieht sich gern als Ort, der weiß, was er will, und der sich nicht fürchtet, auch allein dafür zu kämpfen.
Doch dieses Selbstbild passt immer weniger zum Verhalten Großbritanniens in den letzten Jahrzehnten, in denen es sich sehr viel mehr darauf konzentriert hat, für andere zu erreichen, was sie wollten, und dabei gut zu verdienen, als seine eigene Vision einer besseren Welt zu präsentieren. Wenn Diktatoren irgendwo auf der Welt ihr Geld verstecken wollen, wenden sie sich an Großbritannien. Wenn Oligarchen ihre Weste weißwaschen wollen, kommen sie nach Großbritannien.
Das meine ich, wenn ich sage, dass sich Großbritannien wie ein Butler verhält: jemand, der gegen Geld alles ermöglicht, ein Vollstrecker gegen Barzahlung, der die Realität dessen, was er tut, hinter kauzigen Traditionen, literarischen Anspielungen, makellos geschneiderten Anzügen, Verweisen auf den Zweiten Weltkrieg und Arroganz versteckt. Aber wenn Großbritannien ein Butler ist, für wen arbeitet es dann? Wer sind die heutigen Entsprechungen der Flaneure und Salonlöwen, in deren Namen Jeeves Polizisten angriff, silberne Raritäten stahl und die perfekte Dinnerbekleidung bereitlegte? Diese Frage möchte ich in diesem Buch beantworten.
Eines lässt sich auf jeden Fall jetzt schon feststellen: Während Jeeves’ Kunden dümmliche Herren der Gesellschaft waren, gehören die Kunden Großbritanniens zu den übelsten Menschen, die es gibt; und die Schwierigkeiten, aus denen sie befreit werden müssen, sind alles andere als amüsant. Ihre Opfer im echten Leben verlieren weit mehr, als Großbritannien gewinnt. Folglich wird die Geschichte, die ich zu erzählen habe, nicht annähernd so witzig wie die von Mr. Wodehouse. Tatsächlich könnte diese Angelegenheit nicht ernster sein.
Ich werde in den folgenden Kapiteln einige sehr große Zahlen nennen. Hunderte von Milliarden Pfund werden jedes Jahr über das britische Bankensystem gewaschen. Dabei handelt es sich um Geld, das Menschen gestohlen wurde, die es dringend brauchen, mit dem die Gehälter von Krankenpfleger*innen oder Lehrer*innen bezahlt oder Straßen und Stromleitungen gebaut werden sollten. Stattdessen landete das Geld dank der Diskretion und der Fertigkeiten des Butlers Großbritannien auf den Offshore-Konten von korrupten Politikern oder betrügerischen Geschäftsleuten. Wenn man von 1 auf 100 Milliarden Pfund zählen wollte, würde man, bei einem Pfund pro Sekunde, mehr als 3000 Jahre dafür brauchen. Man hätte um die Zeit des Trojanischen Krieges anfangen müssen, um jetzt ungefähr bei 100 Milliarden angelangt zu sein.
Aber Großbritannien hilft Kleptokraten nicht nur dabei, das Geld beiseitezuschaffen, sondern es bietet ihnen auch gleich einen Ort, an dem sie es ausgeben können. Zu Beginn der COVID-Krise, als alle internationalen Reisen gestoppt wurden, standen wohlhabende Nigerianer plötzlich vor dem Problem, dass sie nicht mehr zu ihren Ärzten konnten, die alle in London ihre Praxen hatten. Dass die nigerianische Elite Zugang zur weltbesten Gesundheitsversorgung hat, sorgt schon lange für Wut bei ihren ärmeren Landsleuten, die keine andere Wahl haben, als unterfinanzierte und überlastete Kliniken aufzusuchen, wenn sie krank sind. Vor der Wahl versprechen Politiker regelmäßig, daran etwas zu ändern, tun dann aber nichts, sondern fliegen selbst lieber ins Ausland. Im Jahr 2019 beliefen sich die Gesundheitsausgaben der nigerianischen Regierung auf gerade einmal elf US-Dollar pro Person, was etwa einem Achtel dessen entspricht, was die Weltbank empfiehlt, um den grundlegenden Bedarf zu decken. Die medizinischen Einrichtungen in Nigeria verfallen, Medikamente sind nicht verfügbar und viele junge Ärzte wandern nach ihrem Abschluss einfach aus. Großbritannien bietet in der Gesundheitsversorgung ebenso wie bei Rechtsangelegenheiten, im Bankwesen und vielem anderen eine Luxusalternative für die Eliten anderer Länder, die die Systeme in ihren eigenen Ländern ruinieren und sich an ihnen bereichern, statt zu regieren.
»In Nigeria gibt es zwei Gesundheitssysteme. Wer kein Geld hat, geht zu Priestern und Imamen und betet dort um ein Wunder«, berichtete mir der nigerianische Romanautor und Essayist Okey Ndibe. »Wer einen Haufen Geld hat und politisch gut vernetzt ist, fliegt ins Ausland und erhält dort eine gute Behandlung. Wenn die Reichen krank werden, lassen sie sich gern per Flugzeug nach Großbritannien bringen.«
Mit Großbritannien meine ich nicht nur das Vereinigte Königreich, sondern auch die Überseegebiete, die eigene Parlamente haben, denen aber die Regierung in London politisch übergeordnet ist. Dank ihnen kann Großbritannien nicht nur wohlhabenden Ausländern seine Butlerdienste anbieten, sondern auch reichen Briten und ihren Unternehmen. Mit demselben Trick, mit dem vermögende Nigerianer ihre Landsleute ausbeuten, können auch britische Glücksspielanbieter ihr Unternehmen in Gibraltar anmelden und Geld aus dem Vereinigten Königreich absaugen. In Großbritannien gibt es also auch Opfer, unter ihnen Hunderte junger Männer und Frauen, die nach Angeboten dieser problematischen Unternehmen süchtig wurden und sich in der Folge das Leben nahmen.
Wenn man als Butler denkt, schließt das Mitgefühl für jene, die weniger Glück haben als man selbst, aus. Solidarität gibt es in der Welt von P. G. Wodehouse nicht; Jeeves hilft jenen, die sich seine Dienste leisten können; alle anderen müssen allein klarkommen. Wodehouse ist sich dieser Ironie durchaus bewusst und macht sich in einer Szene sogar darüber lustig, in der Jeeves einer Familie von Revolutionären – die durch eine Reihe unwahrscheinlicher Wendungen in der Handlung in Woosters luxuriösem Apartment zu Abend essen – ein reichliches Mahl serviert.
»Wissen Sie, was Sie sind, mein Junge? Sie sind ein Relikt eines explodierten Feudalsystems«, sagt ein Revolutionär zu Jeeves.
»Sehr wohl, Sir«, antwortet dieser.
Das ist erst der Anfang. Es gibt noch viele wohlhabende Klienten da draußen, denen Großbritannien mit Rat und Tat zur Seite stehen kann, und noch viele junge Universitätsabsolventen, die in ihre Dienste gelockt werden können, was unweigerlich dazu führt, dass sich die Qualität der Dienstleistungen für alle anderen im Land verschlechtert. Inzwischen ist es für intelligente und gut vernetzte Briten so profitabel, als Butler zu fungieren, dass immer mehr begabte Landeskinder lieber das Familiengeschäft übernehmen, als etwas Konstruktiveres oder Selbstloseres zu tun.
Schon jetzt leiden die britischen Gerichte darunter, warnen Richter, dass die besten Juristen ungern auf die hohen Honorare von Oligarchen verzichten und Richter werden. »Wenn es unserer Profession nicht mehr gelingt, die klügsten und besten Juristen als Richter zu gewinnen, dann wird der Ruf unserer Rechtsprechung, die für ihre äußerst hochwertige Entscheidungsfindung bekannt ist, bald darunter leiden. Es wird eine sich selbst erfüllende Prophezeiung werden«, sagte ein Richter in einer Rede 2018. Das ist ein starkes Argument, aber es trifft nur zu, wenn Juristen sich selbst als Teil einer größeren Gemeinschaft begreifen. Wenn sie sich selbst als Individuen sehen, die das Beste für die Menschen erreichen wollen, die sie bezahlen – also als Butler –, dann gibt es keinen Grund, warum sie sich um die langfristigen Aussichten der Institutionen des Landes kümmern sollten. Sie sind noch nicht einmal für einen Job auf Großbritannien angewiesen. Rührige Anwälte haben in Dubai und Kasachstan Schiedsgerichte eingerichtet, an denen englisches Recht angewendet und britische Anwälte beschäftigt werden, um die Bemühungen der lokalen Regierungen zu unterstützen, die ihr eigenes Finanzsystem aufbauen wollen.
Briten ärgern sich vielleicht, wenn sie diese Kritik lesen. Natürlich ist nicht alles an Großbritannien verdorben – walisisches Rugby, schottische Literatur, englische Universitäten machen die Welt definitiv zu einem besseren Ort. Das Land, das die Pubs erfunden hat, kann nicht völlig schlecht sein. Nicht alle Einwohner des Landes sind so amoralisch, dass sie Geld von jedem annehmen würden, und natürlich spricht vieles mehr für das Land als nur seine Butlerbranche. Aber in den folgenden Kapiteln werden zwei Punkte hoffentlich deutlich: Erstens, dass der Trend erschreckend weit verbreitet ist, sehr viel weiter, als man vielleicht denkt; und zweitens, dass ein Großteil der nationalen Elite sich dem Dienst für die Interessen der Reichen und Mächtigen verschrieben hat, völlig unabhängig davon, wer diese Leute sind und was für Interessen sie haben. So viel typisch Britisches an Großbritannien, auf das die Briten so stolz sind – die Geschichte, die Traditionen, der Humor und die Institutionen –, sind für die Eliten des Landes zu einem Kostüm geworden, das sie tragen, wenn sie die Welt nach neuen Klienten absuchen.
Für ein einziges Buch ist es ein riesiges Thema; ein umfassender Bericht würde Dutzende Bände dieser Größe füllen. Auch die Recherche zu diesem Thema war während des Lockdowns kompliziert. Normalerweise reise ich viel, wenn ich für ein Buch recherchiere, was zu vielen glücklichen Zufällen führt. Allerdings haben sich neue Recherchemethoden als überraschend fruchtbar erwiesen und mich zu Skandalen geführt, von deren Existenz ich nichts geahnt hatte. Bei meiner Geschichte über den Butler Britannien habe ich mich auf bestimmte Details konzentriert und sie ausführlich besprochen. Einzelne Aspekte des Verhaltens Großbritanniens in den letzten 70 Jahren stehen für ein sehr viel größeres Ganzes.
In den Monaten und Jahren nach der Entscheidung des Vereinigten Königreichs im Jahr 2016, die Europäische Union zu verlassen, gab es große Sorge darüber, welche Art von Land Großbritannien sein sollte, ohne dass – soweit ich sehen konnte – groß darüber diskutiert wurde, welche Art von Land es tatsächlich war. Das war einer der Gründe für mich, dieses Buch zu schreiben. Damals fühlte sich der Brexit wie eine Krise an, auf die man reagieren musste, aber seither wurde sie von der sehr viel schwerwiegenderen COVID-19-Krise überschattet. Die Pandemie hat in vielen Ländern Spannungen offengelegt, aber das Vereinigte Königreich – mit seiner überproportional hohen Sterberate und holpernden Reaktion der Regierung – besonders hart getroffen. Das verstärkte noch die Notwendigkeit einer Diagnose, was in Großbritannien schiefläuft. Ich hoffe, dass britische Politiker, nachdem diese Krise vorüber ist, daraus ihre Lehren ziehen und daran arbeiten werden, ein neues Land zu formen, das nicht in jeder Situation eine Gelegenheit zum Geldverdienen sieht und sich nicht so bereitwillig dafür hergibt, die Aktivitäten, die ich in diesem Buch beschreibe, zu ermöglichen, sondern das sich mehr wie das Land der Helden benimmt, die es angeblich so bewundert.
Das ist keine unrealistische Hoffnung. In manchen Jahren beschleunigt sich der Lauf der Geschichte, und Gesellschaften erleben Transformationen, für die es normalerweise Jahrzehnte braucht. Das ist bekannt, weil eine ebensolche Krise die Butlerkarriere Großbritanniens begründet hat, als meine Eltern noch jung waren und ich noch nicht einmal als Gedanke existierte.
KAPITEL 2
SONNE, SAND, KANAL
IM FRÜHJAHR 2020 wollte ich eine Reise auf keinen Fall absagen – und ich war besonders traurig, dass sie nicht stattfinden konnte, nachdem COVID-19 sich zu einem Problem ausgewachsen hatte, das man nicht länger ignorieren konnte. Diese Reise war für den 29. März angesetzt und hätte mich in den Nordosten Englands führen sollen, nach Sunderland.
An dem Tag sollte die Suez Veterans’ Association ihre Vereinsflagge feierlich außer Dienst stellen – also die Fahne ein letztes Mal niederholen, weil zu wenige Veteranen übrig waren, um sie weiterhin zu benutzen – und ihre Tätigkeit für immer beenden. Es wäre der letzte Akt in der Geschichte dieser wenig beachteten, ziemlich übellaunigen und spendablen Gruppe von Veteranen gewesen, die alle in britischen Militärbasen am Suezkanal gedient hatten. Leider machte zwei Wochen vor dem Termin die rasche Ausbreitung von COVID-19 einen totalen Lockdown unvermeidbar, und die Geschäftsführung des Vereins musste den wenigen überlebenden Veteranen (und mir) mitteilen, dass die Veranstaltung wegen des Risikos für die Teilnehmer durch das Coronavirus auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Außerhalb der SVA fiel das kaum jemandem auf, was durchaus passend war, denn die Gruppe war auch vorher kaum von irgendjemandem, der etwas zu sagen hatte, beachtet worden.
Die allgemeine Gleichgültigkeit gegenüber dem Ende der Organisation ist schon verwunderlich, wenn man bedenkt, wie wichtig diese Truppen einmal für das Vereinigte Königreich waren und für wie lange. Die Ingenieure, die Mitte des 19. Jahrhunderts den Suezkanal angelegt hatten, waren Franzosen gewesen, aber dieser dünne Wasserstreifen zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer war für die Briten immer schon bedeutsam gewesen, weil er das Mutterland mit Indien und anderen Besitzungen in Asien verband. Als der ägyptischen Regierung im Jahr 1875 das Geld ausging, kaufte der britische Staat deren Anteile auf und wurde so zum größten Anteilseigner des Kanals. Der britische Einfluss nahm zu, was den Ägyptern verständlicherweise missfiel und dazu führte, dass ein Jahrzehnt später eine Revolte ausbrach. Britische Truppen schlugen den Aufstand nieder und besetzten am Ende das ganze Land. Ägypten war formal nie eine Kolonie, aber es war das Hinterland des Kanals, daher konnten die Verwalter des Empire nicht zulassen, dass es sich selbst regierte. Das Land hatte immer noch einen Khedive – der Ägypten theoretisch im Namen des osmanischen Sultans regierte – und Minister, aber in Wirklichkeit lag die Macht in den Händen des britischen Generalkonsuls Evelyn Baring, erster Earl von Cromer und Spross der Bankierdynastie. Seine Macht und die seines Nachfolgers wurde durch die Präsenz von Hunderttausenden Soldaten, Seeleuten und Piloten garantiert, die dem Empire in den folgenden 80 Jahren in Ägypten dienten.
Die Suez Veterans’ Association repräsentierte die letzte Generation dieser Männer und Frauen, jene, die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Militärdienst geleistet hatten. Als die Mitglieder noch jung genug waren, hatte der Verein Reisen nach Ägypten organisiert und er gab einmal im Quartal einen Newsletter heraus, dem man den bösen Humor anmerkte, mit dem sich die Squaddies und Erks – wie ihre Pendants bei der Royal Air Force (RAF) genannt werden – die langen Abende auf den abgelegenen Militärbasen vertrieben. (»Dieser Offizier könnte weit kommen – je früher er losgeht, umso besser.«)
Vor mir auf dem Schreibtisch liegt ein Stapel dieser Newsletter. Die Schwarz-Weiß-Bilder darin wurden in den 1940ern aufgenommen und zeigen schlanke junge Männer, umgeben von Sand und Stacheldraht, die in die Kamera grinsen, selbstsicher und sorglos. Es gibt aber auch Farbfotos derselben Männer Jahrzehnte später: weißhaarig, untersetzt, in blauen Jacketts, marschieren sie oder werden in Rollstühlen geschoben, legen Mohnblumen an Gedenkstätten nieder, gebeugt von Alter und Erinnerungen. In einem der ersten Rundbriefe ruft der Herausgeber die Veteranen auf, ihm ihre Erinnerungen zu schreiben: »Über das Leben der gewöhnlichen Soldaten in der Kanalzone wurde nur sehr wenig geschrieben. Jetzt ist eure Chance, das zu ändern. Ich bin sicher, dass wir alle lebhafte Erinnerungen an einzelne Ereignisse in der Kanalzone haben – witzige, erschreckende, unglaubliche. Feldverpflegung, die erste Wache, Paraden, ein typischer Arbeitstag und so weiter. Nehmt Stift und Papier zur Hand und erzählt uns davon.«
Manche Geschichten der Veteranen waren witzig – ein Mann hatte seinen Kommandeur festgenommen, weil der aus dem Fenster geklettert war, um »dem Ruf der Natur zu folgen«, und ihn in Unterhosen abgeführt. Manche waren berührend – ein anderer Mann hatte auf einer Militärbasis geheiratet und fragte nun, ob sich jemand an die Zeremonie erinnerte. Andere Briefe riefen unerbittlich in Erinnerung, warum die Soldaten tatsächlich dort gewesen waren, wobei es bei manchen Themen jahrelange Briefwechsel gab, bei denen immer mehr Details an kaum erinnerte Ereignisse zutage kamen – der Mord an einer Nonne; ein Zusammenstoß mit der Zivilbevölkerung; einem Soldaten, der Torwart im Regimentsteam war, wurden die Hoden weggeschossen; ein Wachtposten eröffnete das Feuer auf ein Ruderboot, das nicht anhielt, als es dazu aufgefordert wurde, und erschoss dann die Ruderer, als diese bereits über Bord gegangen waren.
Ein Name, der in den Newslettern regelmäßig auftaucht, ist Jeff Malone, ein Mann aus Yorkshire, der die Rundbriefe herausgab und oft über die 31 Monate schrieb, die er als Mechaniker für die RAF in Ägypten verbracht hatte. Zusammen ergeben seine Artikel eine Mini-Autobiografie, die mit seiner Abreise von den Docks in Liverpool im Jahr 1953 beginnt. »Ich habe oft Filmaufnahmen von den Truppen gesehen, die zum Burenkrieg oder in andere Krisengebiete aufbrachen. Dort spielt immer eine Blaskapelle, Flaggen werden geschwenkt und die Menge jubelt ihnen zu. An jenem trüben Oktobertag waren die einzigen Menschen, die uns vorbeifahren sahen, jene, die auf den Bus warteten«, schrieb er. Den Soldaten in der Kanalzone war von Anfang an klar, dass sich keiner in der Heimat um sie scherte.
Über Politik – etwa die Frage, ob die Briten überhaupt in Ägypten hätten sein sollen – wurde in den Newslettern nur wenig diskutiert, aber das ständige Elend mit den kleineren Unruhen ist Anzeichen genug, dass die Situation mehr als unbefriedigend war. Das britische Empire hätte auf der Höhe seiner Macht niemals Demütigungen toleriert, wie Malone sie in seinen Artikeln beschreibt – ständig wurden Vorräte geklaut, ägyptische Zivilisten warfen mit Ziegelsteinen nach patrouillierenden Soldaten, die Infrastruktur brach zusammen. Das Ende des Empires nahte, und die Soldaten hatten den Auftrag, dieses Ende so würdevoll wie möglich aussehen zu lassen. Malone erlebte aus erster Hand den Fall des mächtigsten Reiches, das die Welt je gesehen hatte, und er verabscheute diese Erfahrung vom ersten bis zum letzten Tag. Er hätte Urlaub zu Hause machen können, aber er tat es nie, weil er wusste, dass er es nicht ertragen hätte, zurückzukehren, wenn er Ägypten einmal verlassen hätte.
»Ich habe fast drei Jahre in Ägypten verbracht und ich hatte es satt. Die gesamte britische Militärpräsenz in der Kanalzone brach zusammen«, schrieb er über seine letzte Abreise aus Ägypten per Truppenschiff. »Als die Lichter des Hafens hinter uns verschwanden, fühlte ich Euphorie in mir aufsteigen. Ich fühlte mich federleicht. Etwas Ähnliches habe ich nur drei oder vier Mal in meinem ganzen Leben gespürt.«
Seine Berichte faszinierten mich, weil ich vorher kaum etwas über die britische Militärpräsenz in Ägypten gehört hatte. Ich habe einen Universitätsabschluss in Geschichte, aber die einzige Kolonie, mit der ich mich dort je beschäftigt habe, war Irland – und das auch nur, weil ich einen irischen Dozenten hatte. Ich bezweifle, dass auch nur einer von zehn Briten überhaupt weiß, dass ihr Land Ägypten beherrscht oder den Suezkanal besessen hat, oder was das britische Militär den Ägyptern angetan hat, damit es so blieb.
Die jüngsten Debatten über die Statue von Cecil Rhodes an der Universität Oxford haben zwar einige Diskussionen über das frühere Vorgehen des Empire ausgelöst, aber dennoch scheint der Eindruck recht verbreitet zu sein, dass es sich dabei um ein mehr oder weniger mildtätiges viktorianisches Eingreifen gehandelt hatte, bei dem es darum ging, anderen Völkern die englische Sprache beizubringen, die Sklaverei abzuschaffen und dafür zu sorgen, dass die Züge pünktlich fuhren. Die Wahrheit sieht anders aus: Beim Empire ging es um Profit und darum, alles auszuradieren, was dem Profit im Weg stand. Im Gegensatz zu den Kolonialreichen anderer europäischer Länder verdienten die Briten ihr Geld dabei durch Handel statt durch Steuern von Kleinbauern, sodass die Briten weiter und schneller expandieren konnten als alle anderen, ohne in den eroberten Ländern komplexe Verwaltungsstrukturen aufbauen zu müssen. Dadurch wurde das Empire so riesig.
Auf seinem Höhepunkt kontrollierte das britische Empire fast ein Viertel der Landmasse der Erde und einen ähnlichen Anteil der Weltbevölkerung. Die »weißen Dominions« Australien, Neuseeland und Kanada, mit ihrem erheblichen Anteil an Siedlern in der Bevölkerung, waren selbstverwaltet, aber zutiefst loyal gegenüber dem Mutterland und jederzeit bereit, ihm auszuhelfen, wenn nötig. Das diktatorisch regierte Indien war die bedeutendste Kolonie, weil es Soldaten und einen riesigen Markt für britische Waren stellte. Kleinere Kolonien waren über alle Kontinente verteilt: Kenia, Guyana, Malaya, Zypern. Irgendwo im britischen Empire war immer gerade Teatime. Und das ist immer noch untertrieben, was das Ausmaß britischer Dominanz auf dem Globus betrifft. Großbritannien war der größte Raufbold der Klasse, und was es anordnete, galt. Die Mechanismen in Recht, Handel und Finanzen, die für dieses Empire geschaffen wurden – das Sterling-System –, wurden bald von der ganzen Welt eingesetzt. Viele Teile Chinas und Südamerikas wurden so stark von britischen Investitionen beherrscht, dass sie nur dem Namen nach keine Kolonien waren; alle anderen nutzten britische Schiffe für den Handel untereinander, britische Banken, um ihre geschäftlichen Aktivitäten zu finanzieren, und britische Versicherungen für das Risikomanagement.
Durch all das wurde Großbritannien außergewöhnlich reich. Unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg übertraf der Wert der überseeischen Vermögenswerte britischer Investoren die gesamte inländische Wirtschaftsleistung. Doch dann kamen die Weltkriege, in denen das Land seine gesamten Investitionen für Waffen, Uniformen und Soldatensold ausgab. Anfang der 1950er-Jahre war Großbritanniens Nettovermögen in Übersee in den negativen Bereich gerutscht, und das Land war praktisch pleite. London schuldete den Kolonien, ehemaligen Kolonien und Dominions so viel Geld, dass es genau darauf achten musste, wofür Mittel ausgegeben wurden, damit die Währung nicht vollständig kollabierte. Das Blatt wendete sich erstaunlich schnell: In Jahrhunderten sorgsam angesammelte Reserven waren in wenigen Jahren ausgegeben. Aus dem Bankier der Welt war ein Bettler geworden; die Weltwährung schleppte sich von einer Krise zur nächsten.
»Wir haben ein altes Familienunternehmen geerbt, das profitabel und solide war«, schrieb der Finanzminister Harold Macmillan in einem Brief an Premierminister Anthony Eden auf dem Höhepunkt der Krise. »Das Problem ist nur, dass die Verbindlichkeiten viermal so hoch sind wie die Vermögenswerte.«
Indien erklärte im Jahr 1947 seine Unabhängigkeit, und mit einem Federstrich war die dominante Machtposition der Briten in Asien ausgelöscht. Burma, Ceylon und Malaya folgten innerhalb von zehn Jahren. Auch in den afrikanischen Kolonien gab es Unabhängigkeitsbestrebungen. Regierungsvertreter in Whitehall mussten einsehen, dass sie keine andere Wahl hatten, als das Empire so würdevoll wie möglich zu liquidieren, doch die britische Regierung wollte auf keinen Fall den Eindruck erwecken, Großbritannien mache sich fluchtartig aus den verbliebenen Besitzungen davon. In den Jahren nach der Unabhängigkeit Indiens bedeutete das, dass sie das einzig ihnen verbleibende geopolitische Pfund unbedingt halten musste: den Suezkanal.
Solange die Briten die Wasserstraße kontrollierten, konnten britische Strategen davon träumen, ihre Macht nach Süden in den Indischen Ozean, in den Nahen Osten und gen Norden in die Sowjetunion projizieren, ihren Feinden den Kanal verweigern und so deren Handel stören zu können. So konnte Großbritannien nicht als einfache europäische Macht abgetan werden, wenn es einen solchen Schatz im Portfolio hatte. »Wenn wir den Suezkanal, die Schlagader der Schifffahrtswege der Welt und des Empires, nicht halten können, was können wir dann überhaupt noch halten?«, fragte der Verfasser eines Berichts für die Regierung über die Zukunft des Kanals. Als das Parlament mit der Aussicht konfrontiert wurde, dass man die Kontrolle über den Kanal an die Ägypter würde abtreten müssen, murmelten Abgeordnete etwas von »Appeasement«, ein verpöntes Wort seit dem unrühmlichen und katastrophalen Versuch, Adolf Hitler in München 1938 zu beschwichtigen, indem man ihm einen Teil der Tschechoslowakei anbot. Winston Churchill soll daraufhin gesagt haben: »Ich wusste gar nicht, dass München am Nil liegt.«
Diese Parallele war in mehrfacher Hinsicht problematisch, nicht zuletzt deswegen, weil es zwischen dem Anliegen der Ägypter, ihr Land von einer Fremdherrschaft zu befreien, und Hitlers Annexion des Sudetenlands keinerlei Ähnlichkeiten gab. Wenn jemand in dieser Geschichte der Aggressor war, dann Großbritannien. Aus militärischer Sicht war der größte Denkfehler der Regierung jedoch eher praktischer Natur und lag im Kanal selbst begründet, der lang und dünn ist und somit die längste Verteidigungslinie hat, die physikalisch möglich ist.
Britische Militärbasen zogen sich das Westufer des Kanals entlang, oft umgeben von Wüste, mit verwundbaren Kommunikationslinien und demoralisierter Besatzung. Wenn die Ägypter die Briten nicht dort haben wollten, was so war, dann hatten sie reichlich Möglichkeiten, dies zum Ausdruck zu bringen. Deswegen erzählen viele Briefe an den SVA-Newsletter von Scharmützeln, Aufständen und Problemen. Alle 80 000 dort stationierten Soldaten – das sind etwas mehr als in der gesamten britischen Armee heute dienen – waren vor allem mit Selbstverteidigung beschäftigt. (»Ihre Anwesenheit dort macht es erst notwendig, dass sie da sind«, witzelte ein Vertreter des Außenministeriums.) Und nach dem Militärputsch in Ägypten 1952, der durch die Wut der Bevölkerung über das Verhalten der Briten ausgelöst worden war, weigerten sich Zivilisten, weiterhin für die Militärbasen zu arbeiten, was die Aufgabe der Soldaten zusätzlich erschwerte.
»Es war furchtbar. Die Ägypter warfen alle Jobs im Lager hin, und jetzt mussten britische Militärangehörige, von denen es ohnehin zu wenige gab und die auch so schon am Limit waren, diese Arbeiten verrichten. So grässliche Sachen wie die Latrinen zu reinigen, Schweinefutter wegzubringen, in der Wäscherei oder in der Kantine zu arbeiten, machten nun Leute, die solche Örtlichkeiten bisher bestenfalls als Nutzer kannten«, schrieb ein Ex-Pilot, der von 1951 bis 1952 in der Kanalzone gedient hatte. »Suez war ein schrecklicher Ort, und die Ägypter bereiteten uns dort unten die Hölle.«
Nach zwei Jahren dieser Hölle vereinbarten die beiden Länder 1954, dass die Briten die Kanalzone innerhalb von 20 Monaten verlassen würden. Formell behielt sich Großbritannien das Recht vor, im Falle »eines Angriffs durch eine dritte Macht« auf die Militärbasen zurückzukehren, aber das war eine höfliche Fiktion, damit die Briten bei ihrem Rückzug aus einer weiteren Besitzung ihr Gesicht wahren konnten. Ein SVA-Korrespondent schrieb: »Auch dem dümmsten Soldaten war klar, dass die Ägypter die Basen plündern würden, sobald wir abgezogen waren, und dass wir nur mit dem Gewehr in der Hand zurückkehren konnten.« Und tatsächlich verstaatlichte der selbstbewusste neue Staatsführer Ägyptens – Gamal Abdel Nasser – den Suezkanal, sobald die Evakuierung abgeschlossen war und ihn niemand mehr davon abhalten konnte. Großbritanniens großes strategisches Pfund gehörte nun den Menschen, durch deren Land es verlief.
Das war ein schwerer Schlag für das Prestige Großbritanniens, aber erst die Reaktion der Regierung in London machte aus der Niederlage eine Katastrophe. Das Problem war, dass Nasser nichts wirklich Illegales getan hatte: die Suez Canal Company war ein ägyptisches Unternehmen, das die Regierung in Kairo verstaatlichen konnte, wenn sie das wollte, nachdem sie den Anteilseignern, die – neben der britischen Regierung – vor allem Franzosen waren, einen umfassenden finanziellen Ausgleich zugesagt hatte. Das war nichts Neues. Großbritannien hatte in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg alles Mögliche verstaatlicht, von der Bank of England bis zu den Kohleminen. Auch in Frankreich waren die wichtigsten französischen Unternehmen in dieser Zeit in Staatsbesitz übergegangen. Mit der Verstaatlichung einer wichtigen strategischen Ressource bewegte sich Nasser genau in der Mitte des ökonomischen Mainstreams. Aber die Regierungen von Großbritannien und Frankreich waren entsetzt und suchten nach einem Vorwand für eine Intervention. Sie zogen ihre Lotsen vom Kanal ab in der Hoffnung, so den Betrieb sabotieren zu können. Sie sandten Dutzende Schiffe gleichzeitig zum Kanal, um so lange Warteschlangen zu erzeugen. Aber die Ägypter waren schlauer als gedacht und hielten den Kanal offen. Der britische Premierminister Anthony Eden steckte in der Klemme.
Eden verlor angesichts der Bedrohung für Großbritannien durch Nasser immer mehr die Nerven, so wirkt es zumindest im Rückblick. »Entweder er oder wir, das dürfen wir nicht vergessen«, sagte er. Sein Kabinettsmitglied Harold Macmillan sah das genauso. »Es ist unerlässlich, dass Nasser gedemütigt wird«, meinte er. »Wir müssen uns damit beeilen oder wir werden selbst ruiniert sein.« Nasser war zugegebenermaßen stark und populär, aber er führte ein armes Land an, das militärisch keine Bedrohung für Großbritannien darstellte. Doch für Großbritannien bestand die Gefahr nicht in einer militärischen Niederlage, sondern in der strategischen Bedeutungslosigkeit. Nasser repräsentierte einen neuen Typ des kraftvollen arabischen Anführers, der die Fantasie der Völker in den Ländern anregte, die Großbritannien immer noch beherrschte, wie Jordanien, Kuwait und dem Irak. Wenn er die Araber gegen ihre Kolonialherren aufbringen konnte, dann müssten sich die Briten noch schneller zurückziehen. Der würdevolle Niedergang des Empire würde so zur peinlichen Flucht verkommen. Auch die Franzosen, die in Algerien mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten, hassten Nasser, und so heckten die beiden niedergehenden Mächte zusammen einen geheimen Plan aus, um ihn loszuwerden, indem sie die Israelis zu Hilfe riefen.
Es war ein komplexer Plan, aber im Grundsatz sah er vor, dass Israel in die Sinai-Insel einmarschierte – den Wüstenstreifen zwischen Israel und dem Kanal. Englisch-französische Truppen würden dann einschreiten, um die beiden Seiten voneinander zu trennen, als hätten sie nicht vorher schon von dem geplanten Einmarsch gewusst, und dann rein zufällig Kairo besetzen und dort eine ihnen freundlicher gesinnte Regierung einsetzen. Es war eine groteske Intrige (die vor den US-Amerikanern geheim gehalten wurde), zumal die Briten gleichzeitig einen weiteren Coup in Syrien planten (den sie den Franzosen verschwiegen), obwohl dieser Teil in sich zusammenfiel, bevor er richtig begonnen hatte. Eine Taskforce der Marine brachte britische Truppen an der ägyptischen Nordküste an Land, und damit ging es los.
»Wir landeten in Port Said. Es war chaotisch. Unser Regiment sollte einen Teil der Stadt einnehmen. Leider fehlten an unseren Gewehren die Schlagbolzen. Wir hatten Zypern überhastet verlassen. Die Gewehre waren in der Waffenkammer aus Sicherheitsgründen mit entfernten Schlagbolzen gelagert worden«, schrieb ein Korrespondent der SVA über die amphibische Operation, die im November 1956 begann. »Ich habe nie auch nur einen einzigen Schuss abgefeuert, und ich bin froh, dass es so war.«
Aus militärischer Sicht war die Aktion, trotz vieler weiterer Patzer, ein Durchmarsch. Die ägyptischen Truppen wurden aufgerieben, Hunderte Zivilisten starben, während die israelischen, französischen und britischen Invasoren nur eine Handvoll Verluste hinnehmen mussten. Politisch war sie allerdings eine Katastrophe. »Anthony, sind Sie völlig verrückt geworden?«, fragte US-Präsident Eisenhower Eden, als er von der Invasion hörte. So sahen es die meisten Verbündeten der Briten, die kaum ihren Augen trauten. Wie konnte Großbritannien für sich beanspruchen, auf der Seite der Guten zu stehen, wenn es bereit war, in einen souveränen Staat einzumarschieren, der einfach nur seine Angelegenheiten selbst regeln wollte?
Die Finanzmärkte spürten die Schwäche in der Isolierung Londons und die Spekulanten schlugen zu, verkauften britische Pfund und setzten so den Wechselkurs erheblich unter Druck. Die britische Währung wurde nicht mehr durch die Besitztümer in den überseeischen Gebieten gepuffert und die Amerikaner verweigerten ihre Hilfe und verhinderten auch, dass der Internationale Währungsfonds einschritt. Das britische Pfund stand vor dem Zusammenbruch, und die Briten zogen sich zurück.
Es war so, als hätte Bertie Wooster versucht, unabhängig von seiner Tante zu handeln, wäre dann aber zur Aufgabe gezwungen worden, als sie drohte, ihm seinen Unterhalt zu streichen. Großbritannien zog aus Ägypten ab, erniedrigt und gedemütigt, und seine Position in der Welt war peinlich deutlich geworden – es war kein Empire mehr, sondern nur noch eine Regionalmacht, die von seinen US-amerikanischen Zahlmeistern abhängig war. Historiker diskutieren heute, ob die Suezkrise als Katalysator für den britischen Niedergang fungierte oder nur ein Anzeichen dafür war, aber für die Soldaten dort machte es keinen Unterschied. Der Feldzug wurde zum Synonym für Fiasko und gilt heute immer noch als Tiefpunkt des internationalen Prestiges Großbritanniens. Die Mitglieder der SVA verstehen sehr gut, warum sich niemand an sie erinnern will: Sie wurden besiegt, und jede Niederlage ist ein Waisenkind.
Jeff Malone, der regelmäßig für den SVA-Newsletter schrieb und langjähriger Herausgeber war, sollte bei der feierlichen Außerdienststellung der Flagge in Sunderland eine Rede halten. (»Es war der einzige Ort, der unsere Flagge haben wollte«, antwortete er auf die Frage, warum sie sich für den Nordosten für diesen Anlass entschieden hatten. »Wir haben es an ein paar schickeren Orten versucht, Canterbury etwa, aber daraus wurde nichts.«) Doch all diese Pläne mussten wegen der Pandemie auf Eis gelegt werden. Stattdessen besuchte ich ihn in seinem hübschen Bungalow in einem Vorort der Stadt Bridgnorth in Shropshire. Dort blätterte ich durch seine Newsletter-Sammlung und trank tassenweise Kaffee, den er mir servierte. Wir unterhielten uns stundenlang. Malone ist heute 85 Jahre alt, nachdenklich und witzig. In seinen Bücherregalen stapeln sich Grammatiken der Sprachen, die er gelernt hat, und an den Wänden hängen zahlreiche Fotos von seinen Kindern. Sie sind Ingenieure, wie er, und er konnte nicht verbergen, wie stolz er auf sie ist.
Wenn er über seine Zeit in Ägypten sprach, hörte man ihm aber auch nach all den Jahren immer noch die Verbitterung über das politische Versagen an, das ihn in Lebensgefahr gebracht hatte. Die Veteranen hatten die SVA zu einem Forum für jene gemacht, die diese Tortur überlebt hatten, eine Möglichkeit, um zusammenzukommen und sich gegenseitig zu unterstützen. Und der Verein hatte seinen Zweck gut erfüllt, hatte ihnen geholfen, sich ein paar besonders verstörende Erinnerungen von der Seele zu reden, schöne Erinnerungen miteinander zu teilen und dabei viel zu lachen. Malone hatte auch die Reisen in die Kanalzone organisiert, obwohl er sich 1956 – als sein Truppenschiff, die Empire Orwell, ihn davontrug – geschworen hatte, niemals wieder auch nur in die Nähe von Ägypten zu kommen. Er lachte, als er erzählte, dass eines der Hotels genau an derselben Stelle stand wie die Mannschaftskantine der Soldaten, und dass der Getränkeladen immer noch denselben Besitzer hatte. Aber dann wurde er ernst.
»Einmal riefen zwei alte Damen bei mir an und fragten, ob sie bei der nächsten Ägyptenreise mitkommen könnten. Ich fragte, warum sie das wollten, und sie erzählten, ihr Bruder sei dort draußen getötet worden«, berichtete er. »Der Bruder war an einer Kreuzung stationiert gewesen, mit einer Panzerfaust, Sandsäcken und allem. Ein Ägypter kam mit einer Schubkarre vorbei, als ein Rad davon abfiel. Die Karre war voller Orangen, und der Ägypter sagte: ›Pass mal kurz für mich darauf auf, während ich ein neues Rad hole. Du kannst dir auch gern eine Orange nehmen.‹ Also kam der Bruder hinter seinen Sandsäcken hervor und nahm sich zwei Orangen und es war eine Sprengfalle. Ich zeigte ihnen, wo er beerdigt war. Eines muss ich sagen: Die Gräber waren schön gepflegt.«
Er schwieg danach lange und blinzelte rasch, bevor er weitersprach: »Die Männer, die im Zweiten Weltkrieg starben, ihr Tod hatte einen Grund. Aber unsere Leute starben für nichts.«
Das Prestige der Briten verbrannte in den Feuern von Port Said und Ismailia zu Asche und hinterließ Jahrzehnte voller Trauer für jene, die bei den Kämpfen Verluste zu beklagen hatten, dauerhafte Schmach für den Premierminister, der ein extremes Risiko eingegangen war, und eine radikal veränderte Welt. Doch fast unbemerkt wurde aus der Asche etwas Neues geboren, bevor die Truppen nach Hause zurückgekehrt waren. Großbritannien war nicht mehr der größte Raufbold in der Klasse, aber es wusste immer noch eine ganze Menge darüber, wie man Druck macht, und dieses Wissen erwies sich als äußerst wertvoll. Um zu verstehen, wie das funktionierte, müssen wir Ägypten hinter uns lassen und ins Herz des sterbenden Empire reisen – in die City of London.
KAPITEL 3
EIN PRAKTISCH DENKENDES VÖLKCHEN
IN DEN SIEBZIGERJAHREN blickte der Wirtschaftsredakteur des Guardian, Richard Fry, auf die Jahre um die Suezkrise zurück und konnte kaum fassen, wie viel sich seither verändert hatte. Und Fry kannte sich mit Umbrüchen aus. Er wurde in Österreich geboren und arbeitete zunächst bei einer deutschen Zeitung, verlor aber seine Arbeit nach der Machtübernahme der Nazis im Jahr 1933 – er war Jude. Er emigrierte ins Vereinigte Königreich und bekam eine Stelle beim Manchester Guardian, wo er über den Zweiten Weltkrieg und die folgenden turbulenten Jahrzehnte berichtete.
»Am Ende der Fünfzigerjahre schienen Welthandel und Weltfinanz London abgehängt zu haben«, schrieb er. »Der allgemeine Pessimismus war so stark, dass sich manche Bankierssöhne lieber zum Landwirt ausbilden ließen.«