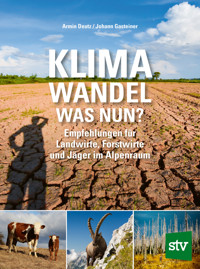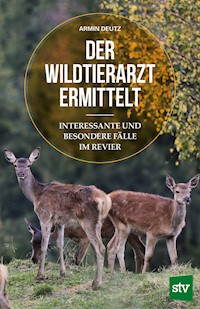
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
• Krankheiten und Parasiten erkennen • Anomalien und Abnormitäten einordnen • Gerissene Tiere: Die Täter bestimmen Als Veterinärmediziner und erfahrener Jäger hat Armin Deutz immer wieder mit verendeten Wildtieren, Seuchen und anderen außergewöhnlichen Fällen im Revier zu tun. In drei Jagdzeitschriften beantwortet er regelmäßig Fragen rund um Abnormitäten oder sichtbare Auffälligkeiten bei Wildtieren. Er befasst sich mit äußerlichen und innerlichen Anzeichen von Krankheiten, mit Fragen zu gerissenen Tieren oder mit Krankheiten, die auf Jagdhunde, Haustiere bzw. auf den Menschen übertragen werden können. Ob Perückengeweihe, Hauthörner, Geschwüre, Durchfall, Räude, Lungenwurm, Tularämie, Brucellose, Staupe, Paratuberkulose u. v. m. – der Wildtierarzt hat unzählige fragliche Fälle analysiert und erklärt im vorliegenden Ratgeber deren Ursachen, Auswirkungen bzw. Vorsichtsmaßnahmen. Die vielen Bilder zu den einzelnen Fällen veranschaulichen dem Leser das Erklärte, erleichtern eine Selbstbestimmung im Revier und machen das Büchlein im Rocktaschenformat zu einem hilfreichen Nachschlagewerk.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ARMIN DEUTZ
DERWILDTIERARZTERMITTELT
INTERESSANTE UNDBESONDERE FÄLLEIM REVIER
Leopold Stocker VerlagGraz – Stuttgart
Umschlaggestaltung:
Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz, www.rypka.at
Bildnachweis: Foto Umschlag-Vorderseite: Armin Deutz
Alle nicht mit einem Autorenvermerk gekennzeichneten Fotos stammen von Armin Deutz.
Der Inhalt dieses Buches wurde vom Autor und Verlag nach bestem Gewissen geprüft, eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Die juristische Haftung ist ausgeschlossen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Hinweis: Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Leopold Stocker Verlag GmbH
Hofgasse 5/Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-7020-1944-0
eISBN 978-3-7020-2033-0
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by Leopold Stocker Verlag, Graz 2021
Layout und Repro: Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz
INHALTSVERZEICHNIS
Vorwort
INTERESSANTE FÄLLE IM REVIER
„Kapitaler“ Perückenbock und „gehörnte“ Rehgeiß
Geweihentwicklung hormongesteuert
Perückengeweihe
„Gehörnte“ Rehgeißen
Ursachen der Mehrstangigkeit bei Rehböcken
„Blasengeweihe“
Hauthörner beim Gamswild
Hauthorn oder dritter Schlauch?
„Schalenkrankheit“
Moderhinke – zwischen Haus- und Wildtieren übertragbar?
Zahnanomalien beim Rehwild
Zusätzliche Zähne
Wie häufig sind Grandln beim Reh?
Fehlende Zähne
Zahnfleischschwund und Osteoporose
Zwitterbildung bei Wildtieren
Reh mit Gesäuge und Geweih
Zwitterbock
Kapitale Zwittergämse („Geißbock“)
Schwierigkeiten beim Setzen
Steinfrucht – schwere Störung der Trächtigkeit
„Karunkel“ in der Gebärmutter einer Rehgeiß
Rotwild-Abortus durch Hundeparasiten
Ursachen von Schädeldeformationen
Nasenbeinverkürzung – „Mopsreh“
Skelettanomalie durch Virusinfektion?
Verbogene Nasenbeine
Wildschwein mit „Schiefrüssel“
Tumoren („Krebs“) bei Wildtieren
Hodentumor (Seminom) bei einem Gamsbock
Knochentumor bei einem Rehbock
Fibrosarkome bei einem Rehbock
Massive Papillomatose bei Rehen
„Tumorhirsch“ aus Südtirol
Sarkom am Haupt und in der Leber
Pansensteine
Bauchwandbruch bei einem Hirsch
Im Elektrozaun verunglückter Hirsch
Was sind Samsonfüchse?
Fuchs mit Penisvorfall
Rote Lymphknoten beim Reh
Leberzirrhose bei einem Hirsch
Milzveränderungen
Knochenerkrankung infolge Lungenabszess
Blutungen in der Lunge
Punktförmige Blutungen
Streifenförmige Blutungen
Fettleber bei Brunfthirsch und Gamsbock
ZOONOSEN – ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN
Risiko „Fuchsbandwurm“?
Fuchsbandwurm bei anderen Tieren
Wer ist gefährdet?
Symptome
Empfohlene Vorbeugungsmaßnahmen
Klimawandel vermehrt Krankheitsrisiken
Zecken breiten sich in den Alpen aus
Neu auftretende Krankheitserreger
Handschuhe schützen auch vor Hepatitis E!
Schweine als Virusreservoir
Vorbeugungsmaßnahmen
Tularämie und Brucellose – Übertragungsrisiken beachten!
Tularämie – meist stark vergrößerte Milz
Vielfältige Infektionsmöglichkeiten und variables Krankheitsbild
Brucellose – häufig sind Geschlechtsorgane betroffen
Trichinen – Parasiten im Muskel und Darm
Unterschiedliche Häufigkeit
Interessante Biologie
Erkrankung des Menschen
Vorbeugungsmaßnahmen
Hantavirus-Infektionen – Jäger besonders gefährdet!
Infektionen steigen im Herbst
Übertragungswege und Symptome
Vorbeugungsmaßnahmen
Ist Fuchsräude auf Menschen übertragbar?
Rasche Vermehrung in der Haut
Fuchsräude bei Mensch und Hund
ALLGEMEINE JAGD- UND WILDFRAGEN
Wildereiverdacht – was tun?
Rissbegutachtung: Wer war der Täter?
Fundort und Umgebung
Riss oder kein Riss?
Wer war es?
Wundermittel Genetik?
Rund um einen Wolfrissverdacht
Fallwild: Was können Jäger selbst feststellen?
WILDSEUCHEN
Afrikanische Schweinepest (ASP)
Biosicherheit bei der Jagd
Wo und wie lange findet sich ASP-Virus?
Biosicherheit Einzeljagd
Biosicherheit Bewegungs-/Gesellschaftsjagd
Biosicherheit Jagdreisen
Biosicherheit Wildtransport, Wildkammer, Wildbret
Paratuberkulose – häufiger als vermutet!
Infektion
Krankheitsbild
Vermutete Ursachen
Übertragung Rind – Wildtier
Vorbeugungs- und Bekämpfungsmaßnahmen
Staupe breitet sich aus!
Variables Krankheitsbild
Aujeszkysche Krankheit bei Wildschweinen und Hunden
Krankheitsübertragung
Krankheit beim Wildschwein
Krankheit bei Endwirten
Schutzmaßnahmen für Jagdhunde
AUSGEWÄHLTE PARASITOSEN
Auffällige Muskelparasiten
Grüne Verfärbung der Muskelhäute beim Rotwild
Lungenwurmbefall bei Schalenwild
Große Lungenwürmer
Kleine Lungenwürmer
Großer und Kleiner Leberegel
Unterschiedliche Entwicklung
Wild entwurmen?
„Haarseuche“ bei Reh- und Gamswild
Haarlinge und Lausfliegen
Hautdasseln beim Reh
Herbstgrasmilben bei Gams- und Rehwild
Magere und „blasse“ Rehe im Mai
Parasitosen beim Auer- und Birkwild
„Milchflecken“ und Finnen auf Wildschweinelebern
„Leber- und Hirnwurm“
Befall wird häufig übersehen
Sektion eines „zahmen“ Hirsches
FÜTTERUNGSFEHLER
Akute Azidose
Gams an Sauenkirrung verendet
Apfeltrester in der Rehwildfütterung?
Erntereste und verdorbenes Futter
Verdorbener Mais als Todesurteil
WILDBRET: HYGIENE & BEURTEILUNG
Auswaschen nach dem Aufbrechen?
Ist Unfallwild verwertbar?
(JAGD)HUNDE
Impfintervalle
Entwurmen von Hunden
Warum Hunde Kot fressen
Sind Erdkröten und Feuersalamander giftig für Hunde?
WEITERFÜHRENDE HINWEISE
VERWENDETE UND WEITERFÜHRENDE LITERATUR
VORWORT
Der vorliegende Ratgeber, eine Sammlung interessanter Fälle, soll einerseits das Auge für Abweichungen schärfen und andererseits das Interesse an der Ursachenfindung wecken. Mit etwas Übung können Jägerinnen und Jäger einiges selbst diagnostizieren.
Allein in der Steiermark konnten über Fallwilduntersuchungen in den letzten Jahren wertvolle Erkenntnisse gewonnen und interessante Fälle aufgeklärt werden. So waren beispielsweise der Ausbruch von Staupe bei Dachsen, Füchsen und Mardern, ein Massensterben von über 300 Stockenten infolge Botulismus, Beiträge zur Verbreitung von Paratuberkulose bei insgesamt 11 Wildtierarten, Aufklärung von Fütterungsfehlern oder auch Parasiten in der Schädelhöhle beim Rothirsch Ergebnisse von Fallwilduntersuchungen.
Es muss davon ausgegangen werden, dass kaum ein Wildtier völlig frei von krankhaften Organveränderungen ist. So zeigen beispielsweise regional über 90 % der erlegten Rehe oder Gämsen einen Befall mit Kleinen Lungenwürmern mit entsprechenden deutlichen Lungenveränderungen. Ein Befall mit Kleinen Leberegeln wird häufig übersehen, da die Leber entweder nicht angeschnitten wird oder die verdickten Gallengänge bzw. die daraus austretende missfärbige Gallenflüssigkeit samt 2–3 mm langen Parasiten nicht erkannt werden. Unbedingt notwendig für das Erkennen selbst geringerer Abweichungen sind ein geschultes Auge und das Wissen um den „Normalzustand“, dieser erfordert ein ständiges „Training“ auch an gesunden Stücken. Die Abschätzung, ob nun z. B. ein Lungenwurmbefall zum Verenden des Stückes geführt hat, ist meist nicht einfach.
Bedanken möchte ich mich bei den vielen Interessierten, die mich von Jugend an mit Untersuchungsmaterial und Fragen beschäftigten. Großer Dank gebührt in diesem Zusammenhang den Jagdzeitschriften Der Anblick, Pirsch und Schweizer Jäger, über welche sehr viele Fragen eingegangen sind und in denen ich auch in so genannten „Tierärztekästen“ Antworten liefern durfte sowie auch Kolleginnen und Kollegen, die mir bei der Aufklärung von Fällen geholfen haben.
Größten Dank aber verdient meine Familie, die gegenüber meinen oft schrulligen Verhaltensweisen und dem Umstand, dass Sektionen häufig auch am Wochenende stattfanden, größte Toleranz aufbrachte.
Gewidmet meiner Frau Uschi und unseren Kindern Barbara, Mathias und Wenzel
St. Lambrecht, im Juli 2021
INTERESSANTE FÄLLE IM REVIER
„KAPITALER“ PERÜCKENBOCK UND „GEHÖRNTE“ REHGEISS
Hirschartige (Cervidae) sind die einzigen heute lebenden Säugetiere, deren männliche Tiere ein Geweih tragen. Ausnahmen bilden lediglich Rentiere, bei denen beide Geschlechter ein Geweih tragen und die geweihlosen Moschustiere und Wasserrehe. Diese massiven knöchernen arttypischen Gebilde, die auf den stets hautbekleideten Rosenstöcken aufsitzen, sind während ihres Wachstums von einer stark durchbluteten Haut, dem Bast, umhüllt. Zumindest in gemäßigten Klimaten folgt der Geweihzyklus infolge einer Steuerung durch die Lichtintensität dem Jahreszyklus.
Geweihentwicklung hormongesteuert
Bei Kastration junger, noch geweihloser Hirschkälber oder Bockkitze wird zeitlebens kein Geweih geschoben, bei späterer Kastration wird ein anhaltend wachsendes, wucherndes Bast-(„Perücken“-)-geweih gebildet. Das Geweihwachstum dürfte möglicherweise auch durch die Schwerkraft beeinflusst werden, nachdem Lahmheiten oft zu asymmetrischen Geweihen führen (NIETHAMMER u. KRAPP, 1986).
4–5-jähriger Perückenbock, hochgradig abgemagert, Perückengeweih von Maden befallen (Myiasis) und auffällig heiß, beide Brunftkugeln waren lediglich je ca. 2,5 cm lang und das Hodengewebe degenerativ geschädigt.
Perückengeweihe
Perückengeweihe sind ständig wachsende Geweihe mit meist hohem Bastanteil, die nicht gefegt und auch nicht abgeworfen werden. Der Hauptzuwachs erfolgt in jenen Monaten, in denen normalerweise die Geweihe geschoben werden, der Zuwachs erfolgt meist nur an den Perlen, also besonders stark an den unteren Stangenteilen und Rosen. Die unteren Stangenteile verwachsen mit zunehmender Perückenbildung, schließlich können auch die Lichter überwuchert werden. Perückengeweihe bei erwachsenen Rehböcken entstehen im Zuge hormoneller Störungen (Mangel an Testosteron, einem männlichen Geschlechtshormon, welches u. a. bei Kitzböcken das Rosenstockwachstum anregt und beim erwachsenen Bock an der Verkalkung des Bastgeweihes beteiligt ist und in der Brunft einen hohen Spiegel erreicht), nach Verletzungen, Infektionen oder einer degenerativen Erkrankung der Brunftkugeln (Hoden). Falls nur ein Hoden betroffen ist, kommt es nicht zur Perückenbildung. Geschehen diese Hodenveränderungen bereits bei Bockkitzen vor der Ausbildung der Rosenstöcke, so wird kein Geweih geschoben („Plattkopf“). Verlieren sehr junge Böcke die Brunftkugeln, so werden in der Regel nur kurze, knollige Perücken geschoben. Auch Zwitter oder Scheinzwitter können Perückengeweihe tragen oder normal schieben und verfegen (HERBST, 2001).
Die wichtigsten Perückenformen sind „Bischofsmützen“ (breite Basis und kegelig zusammenlaufend, rasch wachsend mit hohem Knorpel- und Bastanteil, wenig verkalkt, oft herunterhängende „Bastlappen“) oder „Helmperücken“ (langsam wachsend, mehr verknöchert, Wachstum besonders an der Basis). Der hier abgebildete Perückenbock trägt eine „Bischofsmütze“. Es ist davon auszugehen, dass die Perückenbildung nur rund ein Jahr gedauert hat.
Weil die Perücken stark durchblutet sind und hohe Bast- und Knorpelanteile haben, sind sie – auch ohne Verletzungen – recht anfällig gegenüber bakteriellen Infektionen und Fliegenmadenbefall. Durch den Druck der Perücke auf die Decke und die Knochenhaut des Stirnbeins kann es zu Nekrosen (Absterben von Zellen) und zum Abbau von Knochenanteilen der Schädelknochen und ebenfalls zu Infektionen kommen. BUBENIK (1966) führt an, dass kastrierte Rehböcke mit Perückenbildung innerhalb von 2 Jahren verenden.
„Gehörnte“ Rehgeißen
Bei Rehgeißen kann im hohen Alter durch die Verminderung der Tätigkeit der Eierstöcke (und damit einer geringeren Hormonproduktion) eine „Maskulinisierung“ eintreten. Dann werden vorerst die Ansätze einer Rosenstockbildung – wie bei Böcken an der äußeren Stirnbeinleiste, aber viel weiter in Richtung Augenbogenrand – unter der Decke als Wülste erkennbar. Darauf kann es auch zum Schieben von rosenlosen Kolben kommen, die aber geperlt sind und einem Perückengeweih ähneln können. Die Bildung von Rosenstöcken setzt einen länger dauernden Testosteronspiegel im Blut voraus, der jedoch beim Schieben des Geweihes einer Geiß wieder abgesenkt sein muss. „Geißengeweihe“ bleiben meist recht klein, werden auch nicht gefegt oder abgeworfen und ihnen fehlt das charakteristische, fortschreitende Wachstum der Bockperücke (HERBST, 2004). Zu unterscheiden von Geißengeweihen sind oft wuchtige Perückengeweihe bei Zwittern; Zwitter können nach den äußeren Geschlechtsorganen durchaus einer Geiß stark ähneln.
„Aufhabende“ alte Rehgeiß.
URSACHEN DER MEHRSTANGIGKEIT BEI REHBÖCKEN
Ein Kollege aus Mosnang in der Schweiz berichtete mir von einem interessanten Fall: Ihm wurde ein Bild einer seltenen Rehbockkrone mit vier Stangen vorgelegt. Der Bock war auf einer viel befahrenen Straße verendet.
Wohl keine andere Wildart bringt so viele Spielarten der Trophäe hervor wie der Rehbock. Viele Abnormitäten entstehen während der Geweihbildung meist durch Verletzungen, andere sind hormonell verursacht oder witterungsbedingt, wieder andere geben Hinweise auf einen Parasitenbefall.
Links: Echter Vierstangenbock mit vier Rosenstöcken. (Foto: © Hans Tobler) Rechts: Echter Dreistangenbock mit drei Rosenstöcken.
Bei den primitiveren kleineren Hirscharten, zu denen das Reh zählt, hat das Geweih als optisches Signal nur nachrangige Bedeutung, da Wahrnehmungen vor allem olfaktorisch (geruchlich) stattfinden. Diese primitiveren Geweihformen sind für das Durchflüchten in dichter Vegetation gut geeignet und zeigen auch eine große Variabilität im Aufbau, wohingegen bei entwicklungsgeschichtlich fortgeschritteneren Hirscharten die Geweihe in der unteren Zone sehr homogen sind und nur die obere Stangenregion zur Variabilität neigt. Zusätzlich ist beim Reh eine Reihe von Abnormitäten möglich, wobei Missbildungen (z. B. Fehlen von einem oder beiden Rosenstöcken) meist angeboren sind und Regelwidrigkeiten meist erworben sind.
Regelwidrigkeiten entstehen erst nach dem Setzen und werden durch Verletzungen des Geweihs oder Wildkörpers, durch Stoffwechselkrankheiten (z. B. auch durch Parasiten oder Infektionen) oder durch hormonelle Störungen verursacht. Verletzungen am wachsenden Geweih führen zu Deformationen und Stangenteilungen. Abgebrochene Baststangen, die noch vom Bast gehalten werden, reagieren mit Korrekturwachstum. Rosenstockbrüche können zu Pendelstangen führen und haben oft massive Kallusbildung um die Bruchstelle zur Folge. Schwere Verletzungen der Rosenstöcke führen zur Bildung zusätzlicher Enden oder Stangen, und abgesplitterte Rosenstockteile können ortsfremde Stangen hervorrufen, was im Übrigen auch durch operative Verlagerung von Rosenstockteilen bei Bockkitzen zu provozieren wäre.
„BLASENGEWEIHE“
Hohle Auftreibungen an Geweihen von Rehbock oder Hirsch wurden früher auf Insektenstiche zurückgeführt, tatsächlich werden Blasengeweihe aber durch Bastverletzungen ausgelöst.
Die abgebildete Auftreibung im Bastgeweih wird mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Verfegen zu einem sogenannten Blasengeweih führen. Da es um die Entstehung dieser seltenen Abnormitäten immer wieder Hypothese, wie „Insektenstiche“ usw. gibt, soll auf die Ursachen von Blasengeweihen eingegangen werden.
Rehbock mit Bastverletzung, die später vermutlich zu einem „Blasengeweih” führt. (Foto: © M. Felfer)
Links: Verfegtes Blasengeweih eines Rehbocks, gut zu erkennen ist der Hohlraum im Blasengeweih. Rechts: Stangenteil eines Hirsches mit „Blasengeweih”.
Blasengeweihe entstehen durch Blutergüsse (Hämatome) infolge Gefäßverletzungen (besonders bei Verletzung von Arterien) am stark durchbluteten Bastgeweih. Verletzungen durch Prellungen, Quetschungen, Stiche (Stacheldraht, Äste) oder starke Schläge können zu diesen Blutergüssen führen. Dabei sammeln sich zwischen der Basthaut und der Stange Blutmengen an, die den Bast vorwölben können. Komplikationen wären Infektionen mit darauffolgender Abszessbildung nach bakteriellen Sekundärinfektionen. Die dabei entstehenden Fistelkanäle, aus denen Eiter abrinnt, sind öfters am gefegten Geweih noch zu erkennen. Die von Bast und Geweihmaterial umschlossenen Blut- oder Eiterblasen können entweder mineralisiert werden, um nach dem Verfegen ein aufgetriebener Teil der Stange oder eines Endes zu sein, oder sie werden beim Verfegen „abgeschabt“, und es entstehen hohle Stangenoder Endenabschnitte. Aufgrund der traumatischen Ursache sind Blasengeweihe Zufallsereignisse und treten beim nächsten Schieben der Stangen nicht mehr auf.
Bei einem in Schlesien aufgefundenen Bock mit riesigem Bastgeweih wurde ein „Rekord“-Blasenumfang“ von 50 cm gemessen und ein in Sachsen erlegter Rehbock hatte 26 cm Blasenumfang.
HAUTHÖRNER BEIM GAMSWILD
Ein Hauthorn ist ein kegel- bis rübenförmiger Auswuchs der Haut, der überwiegend aus Keratin, also Hornsubstanz, besteht. Selbst beim Menschen gibt es Hauthörner, die gut- oder bösartig sein können und meist an lichtexponierten Stellen auftreten.
Hauthörner bei Tieren sind gutartig und insgesamt selten, am häufigsten noch beim Gamswild. Sie wachsen an verschiedenen Körperstellen, meist am Haupt oder Träger, seltener an anderen Körperstellen, wie am Rumpf oder an den Läufen. Ich konnte auch selbst insgesamt vier Fälle von Hauthörnern bei Rehgeißen dokumentieren, eines davon mit einer Länge von 10 cm.
Hauthörner beim Gamswild sind hohl und unterliegen dem gleichen jahreszeitlichen Wachstumsrhythmus wie die Gamskrucken. Sie können so groß werden, dass sie sogar eine Behinderung darstellen.
Links: Gamsgeiß mit einem extrem großen Hauthorn am Schlögel (Länge über 30 cm, Durchmesser 14 cm, Gewicht ca. 1,8 kg!), am Hauthorn sind sogar unscharfe „Jahresschübe“ zu erkennen. (Foto: © E. Leitner) Rechts: Hauthorn am Hinterlauf einer Gamsgeiß.
Die Hauptsubstanz des Hauthorns bildet übermäßig gewuchertes, gutartiges Plattenepithel sowie ein bindegewebigknorpeliger Kern. Sie entstehen meist entweder aus embryonal versprengten Hornanlagen oder als Folge mechanischer Reize, auf welche die Haut mit der Bildung von Hornzellen reagieren kann.
Nach NERL (1989) wurde auch beobachtet, dass sich nach leichten Streifschüssen an der getroffenen Hautstelle ein Hauthorn bildete. Ein Zusammenhang ist im Sinne eines „mechanischen Reizes“ ist also analog zum Rind durchaus denkbar.
Hauthorn oder dritter Schlauch?
Bei einem aus der Schweiz zur Beurteilung übermittelten Fall mit einem vom Jäger vermuteten Hauthorn auf dem Haupt einer 18-jährigen Gamsgeiß drängte sich die Vermutung auf, dass es sich dabei nicht um ein eigentliches Hauthorn, sondern um einen dritten Schlauch handeln könnte. Abzuklären wäre dieser Verdacht mit einer Röntgenuntersuchung des präparierten Hauptes. Falls in diesem Schlauch ein Stirnzapfen erkennbar ist, kann man von einem dritten Schlauch ausgehen, also einer sehr seltenen und interessanten Abnormität. Höchst interessant ist der Umstand, dass das Kitz an derselben Stelle eine dritte Hornanlage haben dürfte. Damit wäre auch ein Hinweis auf die Erblichkeit solcher Abnormitäten gegeben.
Gamsgeiß mit drittem Schlauch (oder Hauthorn?) und Kitz vermutlich mit Hornanlage an derselben Stelle. (Foto: © Dominik Bamatter)
„SCHALENKRANKHEIT“
Besonders Reh-, Gams- und Muffelwild hat manchmal extrem lange Schalen, die zumeist auf ein übermäßiges Schalenwachstum zurückzuführen sind. Hinweisend auf ein sehr rasches Hornwachstum ist auch das sehr dünne Wandhorn an den Schalen.
6-jähriger, abgemagerter Gamsbock (13 kg aufgebrochen) mit Schalenkrankheit.
Links: Die hochgradig ausgewachsenen Schalen des Gamsbocks messen 17–26 cm. Rechts: Schalenkrankheit beim Reh.
Ein übermäßiges Schalenwachstum („Schalenkrankheit“) ist sowohl bei Gehegewild als auch bei freilebenden Wildtieren beschrieben. Als Ursachen werden in der Literatur zu weicher Boden, Stoffwechselstörungen mit daraus resultierender Überproduktion von Horn, Knochenbrüche mit reduzierter Bewegung in der Ausheilungszeit, bei Rotwild auch Filarienbefall (Fadenwürmer) und bei Muffelwild eventuell Fütterungsfehler und genetische Einflüsse angeführt. Bei Reh- und Muffelwild ist mir ein Fall bekannt, bei dem es durch Verfüttern einer Mineralstoffmischung für Pferde (hoher Biotin-Anteil) zum extremen Auswachsen der Schalen gekommen ist. Im oben abgebildeten Fall ist von einer stoffwechselbedingten Überproduktion von Schalenhorn auszugehen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit höchstens ein Jahr angedauert hat, sonst hätte der Gamsbock vermutlich schon den vorangegangenen Winter/Nachwinter nicht überlebt.
Ausgewachsene Schalen an einzelnen Läufen treten häufig nach längerem Schonen infolge von Knochenbrüchen auf. Durch Vermeidung des Bodenkontaktes unterbleibt der Schalenabrieb und das Schalenhorn krümmt sich an den Schalenspitzen beim Auswachsen leicht nach oben. Wenn dieser Lauf auch später wieder aufgesetzt wird, kann die Schalenspitze nicht mehr abgerieben werden. Es entstehen so genannte „Schnabelschuhe“, bei denen nur mehr am Ballen aufgetreten wird und die Schalen ohne Abrieb monatlich rund 6–7 mm weiterwachsen. Bei stoffwechselbedingtem zu raschem Schalenwachstum kann der monatliche Zuwachs sogar deutlich mehr betragen. Wildtiere mit Schalenkrankheit zeigen Lahmheiten unterschiedlichen Grades, liegen viel und äsen häufig „kniend“.