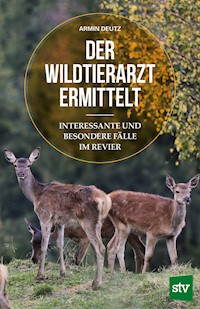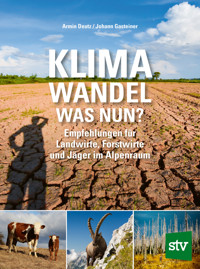
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Stocker, L
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der Klimawandel betrifft vor allem jene, die in und mit der Natur arbeiten: Landwirte, Forstwirte und Jäger. Das Buch verdeutlicht, welche Veränderungen auf Pflanzen, Nutz- und Wildtiere zukommen. Die Autoren zeigen Strategien auf, um die vorhergesagten Auswirkungen der Klimaerwärmung abzumildern. Sie informieren über innovative Grünlandbewirtschaftung ebenso wie über angepasste Fütterungsstrategien für Wildtiere oder standortangepasste Waldnutzungskonzepte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armin Deutz / Johann Gasteiner
KLIMAWANDELWas nun?
Empfehlungen für Landwirte, Forstwirte und Jäger im Alpenraum
Leopold Stocker VerlagGraz – Stuttgart
Umschlaggestaltung, Layout und Repro:
Werbeagentur Rypka GmbH, 8143 Dobl/Graz, www.rypka.at
Titelbilder: © iStock/neenawat; © Karin Ch. Taferner; © Foto Matevz Lavric / shutterstock.com; © iStock/David Schwimbeck;
Der Inhalt dieses Buches wurde von den Autoren und vom Verlag nach bestem Gewissen geprüft, eine Garantie kann jedoch nicht übernommen werden. Die juristische Haftung ist ausgeschlossen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Hinweis:
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Leopold Stocker Verlag GmbH
Hofgasse 5
Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.stocker-verlag.com
ISBN 978-3-7020-2091-0
eISBN 978-3-7020-2268-6
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright: Leopold Stocker Verlag, Graz 2024
INHALT
Ein paar Gedanken vorab
Klimaveränderungen fordern Mensch, Tier und Umwelt
Klimawandel und Extremwetter
Klimawandel und Wasserversorgung
Klimawandel und Wasserökosysteme
Phänologie: Beobachtungen über lange Zeiten
Einfluss des Klimawandels auf Futterqualität und Pflanzenarten
Wald- und Baumgrenze rücken nach oben
Bäume zunehmend unter Druck
Klimawandel und Landwirtschaft
ClimGrass – Klimafolgenforschung im Grünland
Hitzestress bei Nutz- und Wildtieren
Klimagewinner und Klimaverlierer
Klimawandel und Infektionskrankheiten
Die Autoren
Verwendete und weiterführende Literatur
© A. Deutz
EIN PAAR GEDANKEN VORAB
„Wir werden aus den Schwierigkeiten nicht herauskommen, wenn nicht einige sich an die Zusammenschau machen, selbst auf die Gefahr hin, sich lächerlich zu machen.“
(Erwin Schrödinger, 1887–1961)
Seit der Jahrtausendwende hat sich die Klimakrise zugespitzt. Die jüngsten Facetten des Klimawandels reichen von extremer Trockenheit in weiten Teilen Europas über Missernten, Waldbrände und Borkenkäferkalamitäten bis hin zu anhaltenden Temperaturrekorden und Freitagsprotesten der Jugend sowie Störaktionen der letzten Generation. Zwar lassen sich einzelne Extremereignisse nicht direkt auf den Klimawandel zurückführen, aber klar ist: Durch die Klimakrise werden Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Stürme und Hitze häufiger und intensiver. Das bedeutet, dass Niederschläge und Stürme stärker werden, Hitzewellen heißer und Dürren trockener.
Ernsthafte Bemühungen, diesen Entwicklungen entgegenzusteuern oder auch nur unterzeichnete Klimaprotokolle einzuhalten, sind weithin nicht zu erkennen. Nur allzu oft wird sogenannter „Scheinklimaschutz“ betrieben. Sowohl Politiker mit wissenschaftsresistenten Ansichten, als auch ein Großteil der Bevölkerung sind nicht bereit, effiziente Maßnahmen für den Klimaschutz zu ergreifen. Viele Gewohnheiten werden in ihrer Auswirkung oft völlig unterschätzt. Allein die tägliche Nutzung von Handys mit all ihren Funktionen verbraucht Unmengen an Energie und Flugreisen dürften sich bis 2050 voraussichtlich vervierfachen. Ganz zu schweigen von den extrem klimaschädlichen Kreuzfahrten oder den riesigen Containerschiffen, die meist mit Schweröl betrieben werden. Die Weltbank geht bis 2050 von etwa 140 Millionen Klimaflüchtlingen aus. Der Klimawandel wird somit zu einem in dieser Dimension noch nie dagewesenen Motor für Migrationen – Menschen auf der Suche nach lebenswerteren Regionen oder Orten, wo überhaupt noch ein Überleben möglich ist.
Neben weltweit beobachteten Phänomenen und Katastrophen gibt es auch Auswirkungen, die eher im Verborgenen ablaufen und nur wenig Beachtung finden. So gibt es unter den Tier- und Pflanzenarten Gewinner und Verlierer des Klimawandels. Ebenso verändern sich Verbreitungsgebiete von Krankheiten, da beispielsweise Zecken und Stechmücken, die Krankheitserreger übertragen, bereits in deutlich höheren Lagen nachweisbar sind als noch vor zwei Jahrzehnten. Auch „exotische“ Krankheitserreger und ihre Überträger wandern zunehmend in unsere Regionen ein.
In diesem Buch sollen nicht nur die Symptome des Klimawandels, sondern auch derzeit noch mögliche Wege aufgezeigt werden, um die Folgen abzuschwächen. Zu den jeweiligen Kapiteln werden auch Anpassungsstrategien und Gegenmaßnahmen vorgeschlagen. Letztendlich wird aber ein rasches und weltweites Umdenken nötig sein, um den Planeten Erde nicht großräumig für den Menschen unbewohnbar zu machen. Ob das gelingen wird, ist eine der existenziellsten Fragen der Menschheit.
Dieses Werk ist unseren Kindern und zukünftigen Enkeln gewidmet, in der Hoffnung, dass sie in einer ähnlich lebenswerten Welt leben dürfen, wie wir sie kennen.
St. Lambrecht und Irdning, im Dezember 2023
Armin Deutz und Johann Gasteiner
Die Auswirkungen des Klimawandels auf die Almen betreffen sowohl Landwirte, Forstwirte als auch Jäger. Darum muss es im Interesse aller sein, den Klimawandel zu verstehen und die Anpassungsstrategien aufeinander abzustimmen.
© Karin Ch. Taferner
KLIMAVERÄNDERUNGEN FORDERN MENSCH, TIER UND UMWELT
Die Natur hat es während ihrer Millionen Jahre dauernden Evolution geschafft, alle theoretisch verfügbaren Lebensräume auf der Erde durch Mikroorganismen, Pflanzen und Tiere zu besiedeln. Wenn man die verschiedenen Umwelt- und Lebensbedingungen betrachtet, an die sich die einzelnen Lebewesen angepasst haben und unter denen sie heute existieren können, erkennt man eine enorme Vielfalt. Diese Bedingungen reichen von extrem trocken bis extrem feucht, von extrem kalt bis extrem heiß, von extrem dunkel bis extrem hell, von extrem salzhaltig bis sehr salzarm. Die Liste der Extreme lässt sich in all ihren möglichen Kombinationen und Varianten endlos fortsetzen. Die Umweltbedingungen selbst waren niemals konstant. Sie unterlagen ständigen Veränderungen und die Natur reagierte darauf stets mit Anpassung und Weiterentwicklung. Diese Fülle von Umweltfaktoren bildet die Grundlage für die enorme Biodiversität in der Natur.
Mutation und Selektion sind die wohl bekanntesten Mechanismen der Natur, um sich anzupassen. Aber auch die Einwanderung neuer Arten, die sogenannte Bioinvasion, ist ein Werkzeug der Natur, um neue Lebensräume mit besser angepassten Arten zu besiedeln. Diese Arten können dann weniger gut angepasste Arten verdrängen und ihre Existenz bedrohen.
Veränderungen von Umweltbedingungen sind also die Voraussetzung für das grundsätzlich kreative Wesen der Natur und für die Vielfalt ihrer Arten, sie fördern das stete Bestreben der Natur, neues Leben hervorzubringen!
BEDROHLICHE GESCHWINDIGKEIT
Lebensräume verändern sich. Zunächst waren es vor allem „Naturphänomene“ wie etwa die Entstehung von Tälern und Gebirgen, der langsame Wandel zwischen Eiszeiten und Wärmeperioden oder auch Naturkatastrophen wie Vulkanausbrüche, die Veränderung auslösten. Seit dem Beginn des Zeitalters der fossilen Verbrennung ist es immer mehr auch der Mensch, der Lebensräume verändert, natürliche Kreisläufe unterbricht oder auch neue Bedingungen und Kreisläufe schafft. Der CO2-Ausstoß hat in den letzten Jahrzehnten enorm zugenommen und sein Zusammenhang mit dem Weltklima ist heute unbestritten. Bei aller Komplexität der Ursachen und Zusammenhänge können wir heute messen, dass sich das Weltklima in seiner zeitlichen Abfolge so rasch ändert wie noch selten zuvor in der Erdgeschichte. Der Natur verbleiben in dieser sehr rasch verlaufenden Veränderung der klimatischen Bedingungen zu ihrer Anpassung nur die beiden Methoden Selektion und Bioinvasion, also das Aussterben von Arten und das Einwandern von bislang nicht heimischen Arten. Eine Anpassung durch eine Veränderung der genetischen Ausstattung und damit der Merkmale und Eigenschaften einer Art gelingt in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit höchstens bei Mikroorganismen, nicht jedoch bei höher entwickelten Lebewesen. Womit wir derzeit konfrontiert sind, das sind die Ergebnisse aus diesen Entwicklungen.
Klimaveränderung ist nicht neu: Das Gemälde ‚Die Jäger im Schnee‘ wurde von Pieter Bruegel d. Ä. im Jahr 1565 während der sogenannten Kleinen Eiszeit geschaffen.
© Gemeinfrei; Quelle: Wikipedia.org
Lebensräume und damit Lebensbedingungen verändern sich sehr rasch, angestammte Lebewesen kommen mit den neuen Bedingungen nicht mehr zurecht und Neozoen und Neophyten (neu zuwandernde Tiere und Pflanzen) erobern diese Lebensräume. Auch Krankheitserreger und Überträger (Vektoren) von Krankheitserregern sind bei diesen Veränderungen zu berücksichtigen und spielen eine große Rolle, wenn man die Auswirkungen des Klimawandels genauer betrachtet.
KLIMA IST NICHT WETTER
Meteorologen sagen vereinfacht: „Klima ist das, was wir erwarten – Wetter ist das, was wir bekommen.“
Das Wetter wird durch die chaotische Struktur der Atmosphäre bestimmt und betrifft kurzfristige Geschehnisse. Daher konzentriert sich die Wetterforschung auf einzelne Wetterelemente wie Hoch- oder Tiefdruckgebiete.
Im Gegensatz dazu bezieht sich der Begriff „Klima“ normalerweise auf einen Zeitraum von etwa 30 Jahren oder mehr. Die Klimaforschung untersucht die Gesamtheit von Erscheinungen über längere Zeiträume, wie beispielsweise Trends bei Temperaturverläufen und Niederschlagsmengen.
Im Zusammenhang mit dem Klimawandel haben wir Menschen kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem!
WAS IST DER KLIMAWANDEL?
Der Klimawandel beschreibt, wie sich das Wetter im langfristigen Durchschnitt verändert.
Treibhausgase (THG), wie etwa Ozon (O3), Lachgas (N2O), Kohlendioxid (CO2) oder Methan (CH4), kommen natürlicherweise in der Erdatmosphäre vor. Sie entstehen beispielsweise bei Vulkanausbrüchen, aber auch durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, durch Abholzung und industrielle Prozesse.
Wirkung von Treibhausgasen
© istock/ b44022101
THGs verhindern zum Teil, dass Sonnenstrahlung von der Erde reflektiert wird (natürlicher Treibhauseffekt). Sind mehr THGs in der Atmosphäre, steigen die durchschnittlichen globalen Temperaturen an, denn sie nehmen die Wärmeenergie der Sonne auf und reflektieren sie zurück in die Atmosphäre. Extremwetterereignisse nehmen zu, Gletscher und Eisschilde schmelzen ab, der Meeresspiegel steigt an. Außerdem kommt es zu Verschiebungen in Ökosystemen und bei der Verteilung von Pflanzen- und Tierarten.
Mit der Industrialisierung nahm der menschgemachte (anthropogene) Treibhauseffekt zu (Abbildung). Am Beginn des Industriezeitalters waren die Emittenten von THGs sehr begrenzt (v. a. GB, F, D). Die Auswirkungen der gestiegenen Emissionen wurden global gesehen über einige Jahrzehnte gepuffert bzw. von anderen Effekten (z. B. kleine Eiszeit) überlagert.
KLIMAWANDEL UND EXTREMWETTER
Es ist weder möglich noch seriös, jedes Extremereignis direkt auf den Klimawandel zurückzuführen. Allerdings erhöht sich durch steigende Temperaturen das Risiko für ihr Auftreten und ihre Intensität. Dies geschieht allein schon deshalb, weil warme Luft mehr Wasserdampf aufnehmen kann, der beim Eintreffen einer Kaltfront oder aufsteigender Wolkentürme in kältere Luftschichten als Starkregen niedergeht.
DIE HOCHWASSERGEFAHR NIMMT ZU
Die Häufigkeit von Starkregen wird mit steigenden Temperaturen zunehmen, weil die Luft für jedes Grad Erwärmung rund 7 % mehr Wasserdampf enthalten kann (Clausius-Clapeyron-Gesetz der Physik). Wenn diese extrem feuchte Luft auf ein Gebirge oder eine Kaltfront trifft, sind in kurzer Zeit zwischen 100 und über 200 Liter Niederschlag/m2 mit entsprechenden Überflutungen und Murenabgängen zu erwarten. Verschärft wird diese Situation dadurch, dass einerseits bei hohen Temperaturen auch die Verdunstungsrate steigt und dass andererseits durch die zunehmende Versiegelung des Bodens das Abflussverhalten des Niederschlages verändert wird.
Pro Grad Erwärmung kann die Luft um 7 % mehr Wasserdampf aufnehmen.
© A. Deutz
Die durch Hochwasser verursachten Schäden sind in Österreich und Europa in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dies ist einerseits bedingt durch die Veränderungen in den Einzugsgebieten und Tälern (z. B. Verlust von Überflutungsräumen), welche das Hochwasserrisiko flussabwärts verschärfen, andererseits durch die Zunahme an höherwertigen Nutzungen auf potenziell hochwassergefährdeten Flächen. Daher fordern die österreichische Strategie zur Anpassung an den Klimawandel und die EU-Hochwasserrichtlinie, dass im Rahmen eines integrierten Hochwasserrisiko-Managements bestehende Überflutungsflächen erhalten und verloren gegangene Überflutungsflächen wiederhergestellt werden.
Nicht erst seit der Implementierung der Europäischen Hochwasserrichtlinie (HWRL) sind die Nationalstaaten gefordert, sich des Themas Hochwasser verstärkt anzunehmen. Der Siedlungsdruck vor allem im alpinen Raum und die damit einhergehende zunehmende Versiegelung und Ausweisung von Bauland in sogenannte Restrisikogebiete bedeuten für das Wasser- und Hochwassermanagement zusehends größere Herausforderungen.
Dadurch, dass wärmere Luftmassen viel mehr Wasserdampf enthalten können, steigt das Risiko von Starkregen und Unwettern.
© W. Deutz
Unwetterbedingte Schäden infolge des Klimawandels steigen stetig an.
© Erwin Spiegel
Die Folgekosten von Unwetterschäden werfen mittlerweile Fragen der zukünftigen Finanzierbarkeit auf und beschäftigen das Versicherungswesen.
© W. Deutz
Die Auswertung aktueller und historischer Luftbilder der letzten 60 Jahre zeigte anhand einer Fallstudie am Tiroler Inn eine deutliche Verschiebung von hochwasserverträglichen Nutzungen (Grünland) zu hochwassersensiblen Nutzungen (Siedlungs-, Industrie-, Gewerbe-, Sonder- und Verkehrsflächen), die heute bereits ein Drittel der Fläche einnehmen (StartClim2013). Wegen der höherwertigen Nutzung wurden Hochwasserschutzdämme errichtet, die das Land vom Fluss abtrennen. Diese beiden Umstände führen zusammen zu einer Vergrößerung des Hochwasserrisikos – nicht nur lokal für die Anrainergemeinden, sondern auch großräumig für weiter flussabwärts liegende Gebiete. Natürliche Überflutungsflächen mit hochwasserangepassten Nutzungen als Puffer zur Abminderung von Extremereignissen erhöhen das Risiko hingegen nicht. In Hinblick auf die durch den Klimawandel zeitweise erhöhten Abflüsse ist daher wichtig, zusätzliche potenzielle Überflutungsflächen freizuhalten bzw. wiederzugewinnen und in ein integriertes Hochwassermanagement einzubinden.
SO VERHALTEN SIE SICH RICHTIG IN EXTREMWETTERSITUATIONEN
Im Hochwassergebiet
Wenn Sie in einem von Hochwasser gefährdeten Gebiet leben, ist es wichtig, rechtzeitig Vorsorgemaßnahmen zu treffen und Hilfsmittel bereitzuhalten. Das Naturgefahrenportal der Schweizerischen Eidgenossenschaft hat die wichtigsten Punkte zusammengefasst, was vor, bei und nach einem Hochwasser zu beachten ist.
Wichtiges Material bereithalten, wie z. B. Abwasserpumpen, Schläuche, Sandsäcke, Plastikfolie, Dichtungsmaterial, Schalungstafeln, Holzbretter, Werkzeug, Nägel, Notstromaggregat, persönliche Notausrüstung; deren Gebrauchstauglichkeit jedes Frühjahr kontrollieren
Bauliche Maßnahmen am Gebäude vornehmen: Lichtschächte erhöhen, Schwachstellen an undichten Türen, Fenstern, Lüftungsschlitzen oder Elektrozuleitungen beheben; Schutzmauern erstellen; Rückstauklappen in der Abwasserleitung einbauen (Dachwasser- und Schmutzwasserableitung trennen)
Innenraumnutzung anpassen, z. B. im gefährdeten Bereich keine Wohn- und Arbeitsräume einrichten, Elektroanlagen überflutungssicher aufstellen und Heizöltanks gegen Aufschwimmen sichern
Gefährliche Stoffe sicher lagern: Wassergefährdende und leicht entzündbare Stoffe (Chemikalien, Dünger, Schmierund Treibstoffe, Farben, Verdünner, usw.) außerhalb der kritischen Zone lagern
Sich informieren, wo und wer in ihrer Gemeinde Sandsäcke abgibt
Bei der Gebäudeversicherung die Versicherungsdeckung im Elementarschadenfall überprüfen
In Ihrem Haushalt besprechen, wer im Falle eines Hochwassers was zu tun hat (Aufgabenverteilung)
Mögliche Fluchtwege (aus gefährdeten Räumen, aus dem Haus, der Siedlung) überlegen
Wenn sich ein Hochwasser ankündigt
Informiert bleiben: Aktuelle Wettermeldungen und Hochwasserwarnungen über Radio, Fernsehen und Internet verfolgen
mobile Sachwerte (Auto, Wohnwagen, Möbel etc.) an einen sicheren Ort bringen
Strom- und Gaszufuhr in gefährdeten Räumen unterbrechen
Leitungen, Fenster und Türen abdichten, aber sich dabei nicht unnötig in Gefahr begeben!
Versorgung hilfsbedürftiger Personen sicherstellen und Nachbarinnen und Nachbarn Hilfe anbieten
Während eines Hochwassers
Während eines Hochwassers gilt es, sich angemessen zu verhalten. So können Personen und Sachen geschützt und Schäden vermieden werden. Was man tun kann:
Bleiben Sie ruhig und überlegt. Bringen Sie sich nicht unnötig in Gefahr. Verlassen Sie das gefährdete Gebiet.
Meiden Sie bei Überschwemmungsgefahr Keller und Tiefgaragen. Fahren Sie nicht mit dem Auto/Fahrrad durch überflutete Straßen.
Halten Sie sich nicht an Gewässern, die Hochwasser führen, auf. Flutwellen könnten Sie überraschen und Ufer, die unterspült werden, könnten einstürzen.
Schalten Sie das Radio ein und befolgen Sie die Anweisungen der Einsatzkräfte.
Nach einem Hochwasser
Nach einem Hochwasser können entstandene Schäden dank angepasstem Verhalten minimiert und weitere Schäden vermieden werden. Was es zu beachten gilt:
Stromkreis und Gasanlage erst einschalten, nachdem eine Fachperson die Installationen und Geräte geprüft hat
Trinkwasserleitungen gut durchspülen, Wasser im Zweifelsfall abkochen
Aufräum-, Reinigungs- und Trocknungsarbeiten möglichst rasch beginnen
Keller erst dann auspumpen, wenn der Grundwasserspiegel unterhalb des Kellerbodens liegt
Schaden bei der Gebäudeversicherung anmelden. Beschädigte Gebäudeteile, Einrichtungen und Gegenstände erst nach der Besichtigung durch Sachverständige entsorgen.
Persönliche Erfahrungen der letzten Hochwasser auswerten und falls nötig eigene Maßnahmen treffen
Maßnahmen zur Verhinderung künftiger Schäden mit Fachpersonen besprechen
Nach einem Hochwasserereignis sollte man vor allem vor Inbetriebnahme von Stromkreis und Gasanlagen deren Sicherheit von Fachpersonal überprüfen lassen.
© jbjones27/Pixabay
An Hitzetagen und in Tropennächten
Der steirische Hitzeschutzplan empfiehlt:
Trinken Sie mindestens zwei bis drei Liter pro Tag, am besten Mineralwasser oder Fruchtsäfte.
Vermeiden Sie alkohol-, koffein- und stark zuckerhaltige Getränke.
Tragen Sie lockere Kleidung, eine Kopfbedeckung und kühlen Sie Ihren Körper.
Suchen Sie kühle Räume auf und vermeiden Sie körperliche Anstrengungen im Freien.
Medikamente können die Körpertemperatur und den Elektrolythaushalt des Körpers beeinflussen. Dazu zählen Entwässerungsmittel (Diuretika) und bestimmte Antibiotika, Beruhigungsmittel (Sedativa) sowie alle Medikamente mit Auswirkung auf die Aufmerksamkeit (Antidepressiva).
Während eines Gewitters
Bei rasch ziehenden Gewittern ist vor allem mit Sturmböen und möglicherweise auch mit Hagel zu rechnen. Dabei treten Sturmböen oftmals vor der Blitz- und Schaueraktivität auf. Langsam ziehende oder stationäre Gewitter haben ihr Gefährdungspotenzial vor allem in starker Schauertätigkeit.
Die Entfernung eines Gewitters kann durch die Zeit zwischen dem sichtbaren Blitz und dem hörbaren Donner abgeschätzt werden. Faustregel: Anzahl Sekunden zwischen Blitz und Donner durch drei geteilt, ergibt die Distanz zum Gewitter in Kilometer.
Hitzestress, Sonnenstich und Hitzeschock
Erste Warnzeichen sind: starkes Schwitzen, Leistungsverlust, Schwindel, Herzklopfen, erschwertes Atmen, pulsierender Kopfschmerz, Verwirrtheit, trockene Haut, Muskelkrämpfe, Erbrechen oder Durchfall
Ein Sonnenstich als Folge von zu langer direkter Sonneneinstrahlung kann heftige Kopfschmerzen bis hin zum Bewusstseinsverlust bewirken.
Der Hitzeschock ist lebensbedrohlich bei Körpertemperaturen über 40 °C sowie bei Störungen des Zentralnervensystems – Delirium bis hin zum Koma!
In Notfällen: Hinlegen – Körper kühlen – Flüssigkeit trinken, Notruf bzw. Ärztin/Arzt verständigen!
So meistern Sie Gewittersituationen:
Die lokale Wetterentwicklung beobachten, Informationen einholen und das Verhalten den Verhältnissen anpassen
Blitzgefährdete Kuppen, exponierte Bäume, Baumgruppen, Masten oder Türme meiden
Schutz suchen: in einem Gebäude/Auto (Faradayscher Käfig)
Wenn kein Schutz in Sicht ist: Kauerstellung einnehmen
Verzicht auf Bergtouren oder andere Outdoor-Aktivitäten
Nähe von metallischen Gegenständen oder Wasserflächen meiden
Wenn man beim Baden überrascht wird, sofort aus dem Wasser steigen
Die Gefahr von Fels- und Bergstürzen nimmt durch Witterungsextreme und den Rückgang des Permafrostbodens zu.
© A. Deutz
Überflutete Straßenabschnitte umfahren oder wenn nötig langsamer befahren
Bachbette und stark geneigte Hangzonen meiden
Anweisungen der Behörden sind in jedem Fall zu befolgen