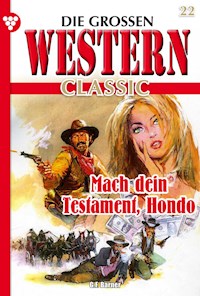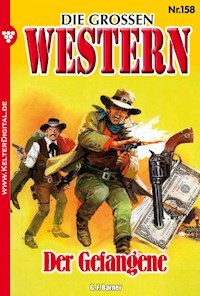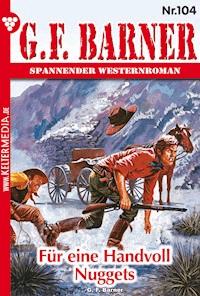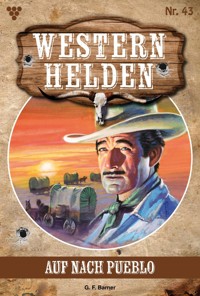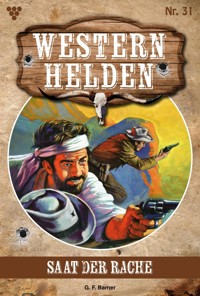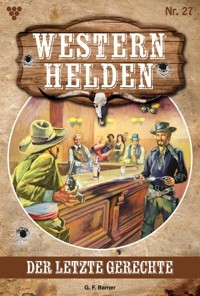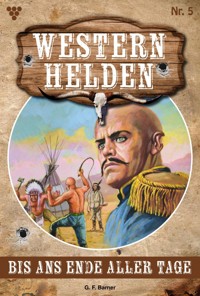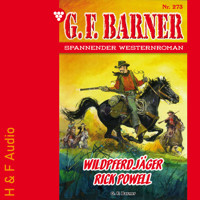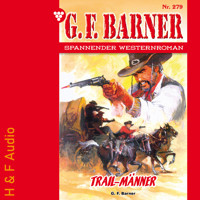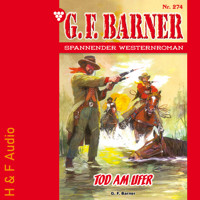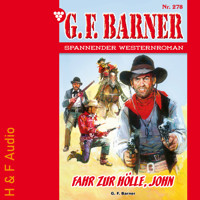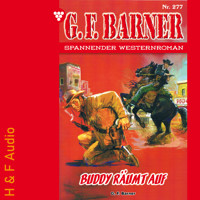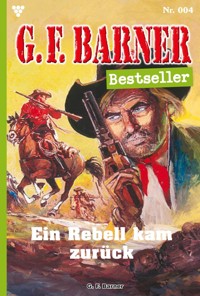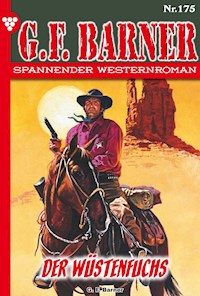
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Brents Puls hämmerte. Er sah das Genick des Mannes vor sich, einen Specknacken, der ihn beständig reizte, den Hammer zu nehmen und zuzuschlagen. Schweiß rann von seiner Stirn in seine Augen. Er sah alles verschwommen, unwirklich in der flimmernden, gnadenlosen Hitze, die jeden Mann bereits nach drei Stunden auslaugte. »Brent!« Brent Hard, der Mann mit dem fünfzehnpfündigen Hammer, zuckte zusammen. Dann fuhr seine Hand hoch und wischte über die schweißverklebten Augenlider. Plötzlich sah er wieder klar, jene Schleier waren fort, und er starrte den vor ihm knienden Mann an, während die Schritte hinter Brent Hard lauter wurden. »Brent, faß mit an, Mann!« »Ja, Sir«, sagte Brent gehorsam, »sofort, Sir.« Brent ließ den Hammer stehen, hob den Kopf und sah sich um. Dutch Hayden, den sie im Jail von Yuma »Bloody Dutch« nannten, weil er ein menschlicher Bluthund war, ein Spurenleser, wie es keinen zweiten gab, blieb stehen und stemmte die schweren Fäuste in die Seiten. »Los, mach schon, Brent!« forderte er Brent auf. »Schafft ihn in den Schatten!« Neunzehn Männer, das Außenkommando des Jails von Yuma, hatten die Arbeit einen Moment eingestellt. Es war eine Höllenarbeit im Steinbruch am Rand der Laguna Mountains, die jede Woche ein oder auch zwei Opfer forderte. Der Steinbruch war gefürchtet, war die nackte Hölle, wenn der Wind von Norden kam und die Schwüle wie ein feuchter Schwamm jedem Mann den Schweiß aus den Poren jagte, wenn die Luft voll Blei zu sein schien, das man einatmen mußte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 175 –Der Würstenfuchs
G.F. Barner
Brents Puls hämmerte. Er sah das Genick des Mannes vor sich, einen Specknacken, der ihn beständig reizte, den Hammer zu nehmen und zuzuschlagen.
Schweiß rann von seiner Stirn in seine Augen. Er sah alles verschwommen, unwirklich in der flimmernden, gnadenlosen Hitze, die jeden Mann bereits nach drei Stunden auslaugte.
»Brent!«
Brent Hard, der Mann mit dem fünfzehnpfündigen Hammer, zuckte zusammen. Dann fuhr seine Hand hoch und wischte über die schweißverklebten Augenlider.
Plötzlich sah er wieder klar, jene Schleier waren fort, und er starrte den vor ihm knienden Mann an, während die Schritte hinter Brent Hard lauter wurden.
»Brent, faß mit an, Mann!«
»Ja, Sir«, sagte Brent gehorsam, »sofort, Sir.«
Brent ließ den Hammer stehen, hob den Kopf und sah sich um.
Dutch Hayden, den sie im Jail von Yuma »Bloody Dutch« nannten, weil er ein menschlicher Bluthund war, ein Spurenleser, wie es keinen zweiten gab, blieb stehen und stemmte die schweren Fäuste in die Seiten.
»Los, mach schon, Brent!« forderte er Brent auf. »Schafft ihn in den Schatten!«
Neunzehn Männer, das Außenkommando des Jails von Yuma, hatten die Arbeit einen Moment eingestellt. Es war eine Höllenarbeit im Steinbruch am Rand der Laguna Mountains, die jede Woche ein oder auch zwei Opfer forderte.
Der Steinbruch war gefürchtet, war die nackte Hölle, wenn der Wind von Norden kam und die Schwüle wie ein feuchter Schwamm jedem Mann den Schweiß aus den Poren jagte, wenn die Luft voll Blei zu sein schien, das man einatmen mußte.
Brent stolperte los. Als er den ersten Schritt machte, begann das Rasseln der Fußkette, ein Geräusch, das ihn zu Anfang seiner Arbeit in Yuma beinahe wahnsinnig gemacht hatte. Er kam sich wie ein Tier vor – und er war auch nicht viel mehr im Jail von Yuma.
Der Mann vor Brent sah sich jetzt um, er blickte Brent ins Gesicht und blinzelte träge. Der Mann war so groß, fett und auch beinahe so glatzköpfig wie Bill Devine, der Händler aus Gila Bend. Sah man Stokes, den Aufseher aus Yuma, von hinten, konnte man ihn mit Bill Devine verwechseln. Dann dachte Brent jedesmal an Mord und Totschlag und an Devines gemeine und falsche Aussage, die ihn nach Yuma gebracht hatte.
»Was ist denn?« erkundigte sich Dutch Hayden schroff, indem er über die nicht mehr arbeitenden Sträflinge hinwegblickte und jeden ansah. »Habt ihr keine Lust mehr? Weiter, Leute!«
Es war, als hätte sich Dutch als Dirigent eines Orchesters für Kettengerassel und Schellengeklimper betätigt. Plötzlich begann dieses widerliche Geräusch wieder, denn die Männer nahmen ihre Arbeit auf, und die Fußketten und die Schellen schlugen aneinander. Dazwischen drang das Dröhnen herabsausender Hämmer, das Klingen der Steinmeißel, mit denen die Blöcke den letzten Schliff bekamen. Über all jenen Geräuschen aber erhob sich der häßlichste aller Töne: das widerliche Quietschen der Steinsäge.
»Scheißwetter!« knurrte Stokes, der Aufseher, als sie den alten Jerry in den Schatten der Hütte legten. »Es wird wohl Sturm geben. Das hat er nicht gut abgekonnt, der alte Jerry, was? Lange macht der es ohnehin nicht mehr. Was ist denn mit dir los, Brent?«
»Ich weiß nicht«, antwortete Brent keuchend. Er hatte die Luft angehalten und nun einen ganz roten Kopf. »Mein Magen, Mr. Stokes, es liegt sicher am Magen.«
Stokes sah ihn mürrisch an. Sie wußten alle, daß Brent es ab und zu mit dem Magen hatte, aber kein Aufseher und kein Mitgefangener ahnte, daß Brent in Wahrheit gar nichts fehlte. Im Gegenteil, er hätte die verfluchten Sandsteine fressen können, wenn er gewollt hätte.
Brent Hard, der Sträfling, der mit einem Messer auf Bill Devine aus Gila Bend losgegangen sein sollte und wegen Mordversuchs, Einbruchs und Diebstahls in Yuma einsaß, fehlte nur eines: die Freiheit!
Die erste Zeit in Yuma hatte Brent getobt. Danach war er immer ruhiger geworden, und wer ihn kannte, der hätte sich sofort Gedanken gemacht. Hier kannte man ihn zu wenig, und darauf baute Brent seit Monaten.
»So, dein Magen?« brummte Stokes. »Hast du denn Schmerzen, Brent?«
»So ein Ziehen, Mr. Stokes«, erwiderte Brent gepreßt. »Das hat schon heute früh angefangen.«
»Siehst wirklich nicht gut aus«, stellte Stokes fest. Manchmal hatte er gutmütige Anwandlungen. »Na, dann geh mal hinein, und trink etwas Tee, Brent!«
»Danke, Sir!« schnaufte Brent. »Vielen Dank!«
»Quatsch nicht, hau schon ab!«
Begleitet vom Kettenklirren stolperte Brent in die Hütte. Während Stokes draußen einen Lappen nahm und ihn in den vor der Tür stehenden Eimer tauchte, um Old Jerry einen feuchten Stirnumschlag zu machen, verschwand Brent.
Kaum war Brent in der Hütte, blitzten seine Augen listig. Das Warten war vorbei, Brent kannte das Wetter in dieser Ecke nun gut genug. Brent griff in die Tasche, zog blitzschnell den Lederbeutel heraus und öffnete ihn. Es war ein Tabaksbeutel, wie ihn viele Sträflinge besaßen. In der Nacht bereits hatte Brent Tabak gegessen. Vor Wochen, als man ihn wegen seiner angeblichen Magenschmerzen in das Krankenrevier des Jails verlegt hatte, war es Brent gelungen, zwei Löffel Brechwurzpulver zu stehlen.
Bis zu diesem Tag hatte Brent das Brechwurzpulver versteckt gehabt. Als er jetzt nach dem Blechbecher griff, stopfte er sich die kleine selbstgefertigte Papiertüte mit dem Brechmittel blitzschnell in den Mund. Dann trank er mit Todesverachtung einen Becher des lauwarmen Tees. Schließlich war das Pulver samt Papiertüte heruntergewürgt. Brent trank zur Sicherheit noch etwas Tee, ehe er hinausstolperte.
Stokes sah ihn prüfend an.
»Besser, Brent?«
»Weiß nicht, es zieht sich so seltsam in meinem Bauch zusammen, als bekäme ich Krämpfe«, antwortete Brent. »Wird schon werden, Sir.«
»Hoffentlich!«
Brent ging weiter, bekam für Old Jerry Ersatz und nahm seine Arbeit am Sandsteinblock wieder auf. Verstohlen blickte Brent zum Himmel. Wenn seine Berechnungen stimmten, braute sich ein Unwetter über der Gila-Wüste zusammen. Brent hatte das Wetter seit Monaten beobachtet und glaubte, daß es an diesem Tag noch Sturm oder sogar ein Gewitter geben würde. Der Plan, den Brent seit vielen Monaten in manch schlafloser Nacht immer wieder bedacht hatte, mußte glücken.
Zwei Stunden hatte Brent noch Zeit, dann kam der Essenswagen aus dem Jail und nahm eine Ladung roter Sandsteinplatten mit.
Brent kannte die Wirkung des Brechmittels genau.
Die Menge mußte ausreichen, um binnen einer halben Stunde aus dem jetzt noch arbeitenden Sträfling ein zitterndes, von Krämpfen gepeinigtes Wrack zu machen…
Stokes fuhr bei Wilsons Schrei herum, und einige Häftlinge hasteten los. Sogar Dutch Hayden, der in der Hüttentür neben dem nun frierenden Old Jerry gehockt hatte, erhob sich.
»Mr. Stokes, Brent!« schrie Wilson erschrocken. »Brent ist umgefallen, Sir!«
Brent hörte Wilsons Schreie wie aus weiter Ferne. Brents Magen arbeitete jetzt wie eine Pumpe. Schweiß stand auf seinem leichenblassen Gesicht.
In Brents Ohren rauschte es, sein Herz schlug wie ein Hammer, und einen Moment fürchtete Brent sogar, daß die Dosis des Brechmittels zu groß gewesen war. Zwei Sträflinge erreichten ihn, versuchten ihn an den Armen hochzuziehen und sprangen fluchend weg, als aus Brents Mund ein Stahl gelblich-grüner Flüssigkeit schoß.
»Mein Gott!« stieß Stokes hervor und beugte sich über den sich am Boden windenden Brent. »Mann, was ist los?«
Brent begann zu wimmern. Diesmal war es kein Bluff. Sein Magen krampfte sich zusammen, er spie alles aus, was er im Verlauf der Nacht und des Morgens gegessen hatte. Ein Teil seines stinkenden Mageninhalts klatschte gegen Stokes Stiefel, und Stokes sprang zur Seite. Brent lag nicht still, sondern wälzte sich nun – von Schmerzen zerrissen, hin und her. Dabei schrie er – und es waren echte Schreie, keine, die jemand narren sollten.
»Schnell doch!« befahl Dutch Hayden scharf. »Holt Tee, lauft, verdammt, läuft, ihr Narren! Haltet ihn fest, dreht ihn auf die Seite, sonst erstickt er noch! Mein Gott!«
Es war Brent schon oft im Leben dreckig ergangen, wenn er zuviel getrunken hatte, aber so schlecht war ihm bei Gott noch nie gewesen. Er glaubte nun schon selbst, daß er sich zuviel zugemutet hatte.
Männer kamen mit Tee. Man legte ihn auf die Seite, hob ihm den Kopf so an, daß man ihm Tee einflößen konnte und sprang dann doch wieder fort, denn Brent spie alles wieder im Bogen aus.
»Zur Hütte mit ihm!« keuchte Dutch schroff. »Tragt ihn, bringt ihn in den Schatten! Stokes, hat er etwas gesagt – ist ihm schlecht gewesen?«
»Ja, es ging ihm vorhin schon nicht besonders«, antwortete Stokes erschrocken. »Heiliger Moses, das sieht ja schlimm aus, Dutch! Neulich erst hat er gemeint, er hätte Angst, daß er Magengeschwüre hätte. Und nun das? Der hat ja richtige Krämpfe und Schaum vor dem Mund, Mann!«
Das stimmte, denn grünlicher, blasiger Schaum stand um Brents Lippen. Brents Röcheln trieb die Männer an, ihn zur Hütte zu bringen. Dort mußten sie ihn festhalten, sobald ihn ein Krampf durchtobte und er mit Armen und Beinen ausschlug.
»Bald kommt der Wagen, dann fährst du mit zurück. In zwei Stunden liegst du im Krankenrevier, Brent. Willst du trinken?«
»Nein – nein!« ächzte Brent. »Bloß nicht!«
Er wußte zu gut, daß er genügend Brechmittel im Magen behalten mußte, damit die Krämpfe vorläufig nicht nachließen.
In einer Stunde mußte der Wagen eintreffen, und bis dahin mußte es Brent hundeelend gehen.
Bis jetzt verlief alles nach Brents Plan.
*
Brent krallte die Hände in den Leib und wälzte sich auf den roten Sandsteinplatten.
Er wußte jetzt, daß er sich verrechnet hatte und die Krämpfe immer noch einsetzten.
Der Wagen rollte auf das Buschgelände zu, den Platz, der nach Brents Plan am günstigsten war. Mathews und Sherman, die beiden Fahrer, hatten ihn mitgenommen. Und der gefürchtete Dutch Hayden hatte einen Fehler gemacht. Brent trug die Armschelle nicht.
»Schon wieder?« fragte Sherman, indem er sich nach Brent umsah. »Mann, Mathews, fahr etwas schneller, nachher verreckt uns der Kerl noch auf dem Wagen, was?«
Die Sträflinge mochten Mathews nicht. Er war rauh, hart und ohne jedes Mitleid. Mathews grinste, dann fuhr er schneller, und der Wagen schwankte durch einige Löcher des Weges.
Er lachte schallend, als Brent Hard wimmerte. Brent brach jetzt der Angstschweiß aus. Sie waren bereits dicht vor dem Buschgelände, und waren sie an dem vorbei, war die Chance vertan.
Großer Gott, dachte Brent verzweifelt und kämpfte gegen die rasenden Schmerzen an, ich muß es schaffen. Zehn Minuten liegen zwischen jedem Krampf, nur zehn Minuten, aber das könnte Zeit genug sein.
Er biß die Zähne zusammen, während Mathews lauthals lachte und Sherman meinte, daß man die widerspenstigen Sträflinge alle vergiften müßte. Die beiden Jailwächter blickten nach vorn. Der Wagen war jetzt auf der Höhe der Büsche, und der Weg beschrieb einen Bogen.
Trotz der stechenden Schmerzen richtete sich Brent jäh auf. Er war kaum auf den Knien, als sich Büsche, Weg und Wagen um ihn zu drehen begannen. Dennoch klammerte sich Brent an den Steinplatten fest. Die nackte Angst packte ihn, als er merkte, wieviel Zeit er brauchte, um sich vorwärtsschieben zu können. Wenn sich einer der Wächter umsah, war alles aus.
Es mußte die Erregung sein, die Brent plötzlich nichts mehr von seinen Schmerzen spüren ließ. Er kroch wie ein weidwundes Tier über die Platten und starrte auf Mathews’ Revolver. Die Waffe ragte mit dem Kolben aus Mathews Halfter. Sie war das Ziel, auf das Brent zukroch.
Im nächsten Augenblick hockte Brent dicht hinter den beiden Männern. Das Klirren seiner Fußkette war nicht zu hören gewesen, weil die Deichselschwengelketten ein viel lauteres Geräusch machten.
Und dann schnappte Brents Hand zu. Mit einem Ruck riß Brent Mathews den Colt aus dem Halfter. Mathews zuckte gleich zweimal zusammen. Bei dem wilden Rucken an seinem Halfter flog Mathews Kopf herum. Dann hörte Mathews das scharfe Klicken und spürte, wie der Colt sich in seinen Rücken bohrte.
»Sherman!« keuchte Mathews entsetzt, während sein Gesicht aschfahl wurde. »Sherman, Brent hat…«
»Fahr weiter, Hundesohn!« fauchte Brent scharf. Sherman nahm den Kopf herum, sah den Colt in Mathews Rücken und erstarrte. Er blickte wie gebannt auf die bleiche Hand des Sträflings und den hochgezogenen Hammer. »Sherman, sieh nach vorn! Los, Mathews, du fährst weiter, wirst aber vor der nächsten Biegung langsamer und fährst dann in die Gasse zwischen den Büschen! Macht keinen Unsinn, ich schieße euch nieder!«
Sherman blickte Mathews von der Seite an, nahm den Kopf dann herum, streckte aber gleichzeitig die rechte Hand nach seinem am Sitz lehnenden Gewehr aus.
Brent erkannte die schwache Bewegung von Shermans Ellbogen. Er nahm alle Kraft zusammen, schnellte zur Seite, ließ den Colthahn zurückschnellen und schlug Sherman, so hart er konnte, in den Nacken. Der Aufseher stieß einen dumpfen Laut aus. Der Hieb ließ ihn nach vorn kippen, und er rutschte stöhnend vom Sitzbrett. An der vorderen Kastenwand blieb er liegen.
Mathews wollte im gleichen Moment etwas versuchen. Sein rechter Arm schwang herum, doch Brent warf sich geistesgegenwärtig an die rechte Kastenwand. Der Hieb ging ins Leere. Mathews blieb wie erstarrt schräg auf dem Sitzbrett hocken und schloß die Augen, als die Mündung des Revolvers ihm zwischen die Brauen zeigte.
»Weiter!« keuchte Brent. »Ich bluffe nicht, Mann, ich schieße! Langsamer jetzt – vorsichtig in die Buschgasse!«
Der Wagen rollte vom Weg. Seine Räder brachen Zweige nieder und walzten Schößlinge platt. Dann fuhr Mathews auf die Lichtung, und er wußte, daß sie nun nicht mehr vom Weg aus gesehen werden konnten.
»Halt!« kommandierte Brent. Er ahnte, daß er schnell handeln mußte. Der nächste Krampf kam bestimmt, und wenn er dann nicht mit den beiden Aufsehern fertig war, konnte alles umsonst sein. Landete er wieder im Jail, bekam er nie mehr eine Chance und einen Vorgeschmack der wahren Hölle. Sie würden ihn wie ein Stück Vieh behandeln.
Mathews hielt an. Sherman war zusammengesunken liegengeblieben, und er hörte, wie Brent eiskalt sagte: »Rüberrutschen, Mathews! Zieh Sherman den Colt aus dem Halfter. Sherman, wenn du dir wieder etwas einfallen läßt, kostet es dich den Kopf. Lieg still, du Halunke!«
Mathews gehorchte, sah sich aber um, als er Shermans Colt zog.
»Über Bord mit ihm!« befahl Brent eisig. »Das Gewehr hinterher, Mister! Komm über den Sitz, los, komm hierher, Mathews! Bist du hier, hältst du dich am Brett fest. Danach steht Sherman auf und steigt links vom Wagen. Du legst dich zwei Schritt neben dem Wagen auf den Bauch, Sherman. Deine Nase steckst du in den Sand. Also?«
»Damit kommst du nie durch!« keuchte Sherman abgerissen. »Mann, wohin du auch willst – wir erwischen dich doch wieder. Und was dir dann passiert, das brauche ich dir doch nicht zu sagen, eh? Brent, sei kein Narr!«
»Runter!« fauchte Brent entschlossen. »Nein, was ihr mit mir anstellen würdet, braucht mir wirklich keiner zu sagen. Absteigen, Sherman!«
Sherman gehorchte nach einem Blick in Brents Augen. Er sah, daß Brent zu allem entschlossen war, legte sich in den Sand und wartete auf Mathews. Der lag gleich darauf neben ihm. Dann kletterte Brent hinten vom Wagen, und sie sahen, wie er schwankte.
»Erwartet nur nicht, daß ich umfalle!« keuchte Brent. »Den Gefallen tue ich euch nicht. Mathews, aufsetzen und das Messer nehmen! Du schneidest jetzt die Sielenstricke ab, danach die Peitschenschnur. Solltest du dein Messer nach mir werfen wollen, holt dich der Satan, verstanden? Los, komm hoch, du Hundesohn!«
Mathews gehorchte mit zusammengebissenen Zähnen. Er versuchte, Zeit zu schinden und hoffte auf Brents nächsten Krampfanfall, doch Brent erkannte den Trick und stolperte zu Sherman. Dann zielte er auf Shermans Hinterkopf. Mathews beeilte sich nun, bekam den Befehl, die Stricke noch einmal zu zerschneiden, und mußte dann sein Messer zu Boden werfen. Ihm blieb keine Wahl, als den zähneknirschenden Sherman an Armen und Beinen zu binden. Brent beobachtete ihn aufmerksam. Mathews fluchte wild, mußte die Stricke straff anziehen und feste Knoten machen. Danach zwang ihn Brent, sich hinzusetzen, und er band den nächsten Strick um seine Beine.
»Auf den Bauch!« keuchte Brent. »Hinlegen, die Arme auf den Rücken, und ganz ruhig sein, Mister!«
»Du verfluchter Hund, das kommt dich teuer zu stehen!« gurgelte Mathews, als ihm Brent die Schlinge um beide Handgelenke warf und sie zusammenriß. »In anderthalb Stunden erwartet man uns im Jail. Dann suchen sie uns! Ah, nicht so fest!«
Brent zog so den Strick um Mathews Fußfesseln, daß Mathews die Beine anwinkeln mußte und sich seine Hände und Stiefelhacken beinahe berührten.
»Sie müssen euch erst finden«, erwiderte Brent. Der Schweiß brach ihm plötzlich aus, er krümmte sich zusammen und ging stöhnend in die Knie. Er hatte so lange durchgehalten, bis die beiden Aufseher gebunden waren. Jetzt kippte Brent auf die Seite. Er war zwei, drei Minuten nicht fähig, etwas zu tun, und sah entsetzt, daß sich Sherman herumrollte und zu ihm wollte.
»Ich packe ihn!« keuchte Sherman schrill. »Mathews, ich erwische den Hund noch!«
Er stieß ein Gebrüll aus, als sich Brent auch davonrollte und danach wieder auf die Knie kam. Obgleich Sherman alles versucht hatte, um Brent zu erreichen, blieb er anderthalb Schritt vor ihm liegen. Brent zog mit zitternden Händen den Colt aus dem Hosenbund. Mit schweißüberströmtem Gesicht starrte Brent Sherman an und versuchte ein Lächeln.
»Nicht ganz geschafft, was?« ächzte Brent. »Sherman, jetzt kommst du mit!«
Er torkelte zu ihm, packte ihn an den Beinen und schleifte ihn schwer atmend an das hintere Wagenrad. Dort band er ihn fest an, sah nach seinen Fesseln und nickte zufrieden. Wenig später hatte Brent auch Mathews ans Vorderrad gebracht. Er nahm nun die Waffen der beiden Männer an sich, streifte Mathews Jacke über, die Mathews wegen der Hitze ausgezogen und in den Fußkasten geworfen hatte, und näherte sich den beiden Aufsehern noch einmal.
»Etwas könnt ihr Dutch Hayden bestellen«, ächzte Brent, während er Mathews das Hemd zerriß und ihm einen Knebel gab. »Sagt ihm, daß ich damals nicht auf dieses fette Schwein Devine eingestochen habe. Ja, ich weiß, Sträflinge beteuern oft ihre Unschuld, aber ich spreche die Wahrheit! Damals ist Devine von mir in seinem Handelslager gestellt worden – er hat ein Messer gehabt. Ich hätte ihn erschießen können, wie? Ich habe es nicht getan – er hat versucht, mich niederzustechen.«
Brents Atem ging rasselnd, und er lehnte sich keuchend gegen den Wagen.