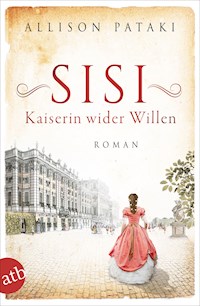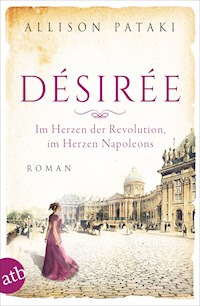
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Außergewöhnliche Frauen zwischen Aufbruch und Liebe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Napoleon, das Kaiserreich und die Krönung einer Liebe.
Marseille, 1794: Die Revolution hält ganz Frankreich in Atem. Désirée Clary trifft den charismatischen und ehrgeizigen Napoleon Bonaparte. Als ihre Schwester Julie seinen Bruder Joseph heiratet, wird auch Désirées eigene Zukunft unwiederbringlich mit der des jungen Generals verbunden. Napoleon macht Désirée heimlich den Hof, aber sein Versprechen, in Paris auf sie zu warten, hält er nicht ein – und nur wenige Jahre später ist er nicht nur einer der mächtigsten Männer Europas, sondern auch ihr politischer Feind ...
Von der Bestsellerautorin von »Sisi – Kaiserin wider Willen«: der mitreißende Roman über die Frau, die Napoleons Herz eroberte – und zur Mutter einer Dynastie wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 593
Ähnliche
Über das Buch
Marseille, 1794: Seitdem die Revolution das Land beherrscht, sieht Désirée Clary einer ungewissen Zukunft entgegen. Als ihr Bruder von den Sansculotten verhaftet wird, lernt sie den Korsen Joseph Bonaparte kennen, der ihr seine Hilfe anbietet und schließlich für Nicolas‘ Freilassung sorgt. Doch es ist sein rebellischer Bruder Napoleon, der Désirée augenblicklich in seinen Bann zieht. Joseph heiratet wenig später Désirées Schwester Julie, und auch Napoleon hält um Désirées Hand an. Doch der junge General hat Großes vor. Er geht nach Paris, um Einfluss auf das neue Regime auszuüben – und bricht bald darauf sein Versprechen an Désirée. Seine Liebschaft zu Joséphine de Beauharnais ist in aller Munde, dennoch zieht es Désirée weiterhin nach Paris, wo ihr Schicksal unweigerlich an das der Bonapartes gebunden bleibt. Und doch steht Désirée einige Jahre später Napoleon, dem Herrscher Frankreichs, als Königin von Schweden feindlich gegenüber …
Über Allison Pataki
Allison Pataki studierte Anglistik in Yale und arbeitete als Journalistin für die New York Times, ABC News, The Huffington Post u.v.a. sowie für zahlreiche Fernsehsender, bevor sie ihren Kindheitstraum vom Schreiben wahr werden ließ. Heute erscheinen ihre Bücher in mehr als zwölf Ländern und sind New-York-Times-Bestseller. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Familie in New York.
Im Aufbau Taschenbuch ist bereits ihr Bestsellerroman »Sisi – Kaiserin wider Willen« erschienen.Mehr zur Autorin unter www.allisonpataki.com
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Allison Pataki
Désirée – Im Herzen der Revolution, im Herzen Napoleons
Roman
Aus dem Amerikanischen von Gabriele Weber-Jarić
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Widmung
Prolog — Stockholm, Dezember 1860
Teil I
Kapitel 1: Kloster Notre-Dame Südfrankreich, 1789
Kapitel 2: Marseille, 1794
Kapitel 3: Marseille, 1794
Kapitel 4: Marseille, 1794
Kapitel 5: Marseille, 1794
Kapitel 6: Marseille, 1794
Kapitel 7: Marseille, 1794
Kapitel 8: Marseille, 1795
Kapitel 9: Marseille, 1795–96
Teil II
Kapitel 10: Paris, 1796
Kapitel 11: Paris, 1796
Kapitel 12: Rom und Mailand, 1797
Kapitel 13: Mailand und Rom, 1797
Kapitel 14: Paris, 1798
Kapitel 15: Paris, 1798
Kapitel 16: Paris, 1798–99
Kapitel 17: Paris, 1799
Kapitel 18: Paris, 1799
Kapitel 19: Paris, 1799
Kapitel 20: Paris, 1799
Teil III
Kapitel 21: Paris, 1799
Kapitel 22: Paris, 1800
Kapitel 23: Paris, 1800
Kapitel 24: Paris, 1801–2
Kapitel 25: Paris, 1803
Kapitel 26: La Rochelle, 1803
Kapitel 27: Paris, 1804
Kapitel 28: Paris, 1804
Kapitel 29: Paris, 1805
Kapitel 30: Mainz, 1806–7
Kapitel 31: Paris, 1807
Kapitel 32: Wien, 1809
Kapitel 33: Château de Fontainebleau, 1809
Kapitel 34: Paris, 1810
Kapitel 35: Paris, 1810
Teil IV
Kapitel 36: Stockholm, 1811
Kapitel 37: Stockholm, 1811
Kapitel 38: Plombières-les-Bains und Paris, 1811–12
Kapitel 39: Paris, 1812–14
Kapitel 40: Paris, 1815
Kapitel 41: Stockholm, 1818
Kapitel 42: Paris, 1821–22
Kapitel 43: Aachen, 1822
Kapitel 44: Auf dem Weg nach Schweden, 1823
Kapitel 45: Stockholm, 1823–30
Kapitel 46: Stockholm, 1844
Kapitel 47: Stockholm, 1860
Epilog
Anmerkung der Autorin
Dank
Impressum
Wer von diesem Roman begeistert ist, liest auch ...
Für Lucy, mit Dank.
Prolog
Stockholm, Dezember 1860
Wenn um Mitternacht Schnee fällt, der die leeren kopfsteingepflasterten Gassen bedeckt und den Glockenturm der Storkyrkan weiß pudert, wird die Phantasie geweckt. Für eine Frau, die wie ich aus dem Süden Europas kommt, wo der warme Wind den Salzgeruch des Meeres und einen Hauch der Zitronenbäume mit sich führt, ist das plötzliche Auftauchen dieser weißen Flächen etwas, das nie aufhört, mich zu verwundern.
»Runt och runt«, sagen sie hier. Immer rundherum. Es ist einer der wenigen schwedischen Ausdrücke, die ich mir die Mühe gemacht habe zu lernen: »Immer rundherum fährt sie, unsere verrückte alte Königin, sie fährt durch den Schnee und die mitternächtlichen Straßen und stellt sich vor, sie wäre in Paris.«
Ich lächele in mich hinein, drücke mich tiefer in den weichen Polstersitz der Kutsche und schmiege meine Wange an den Kragen meines Silberfuchsmantels. Wie sie sich irren. Ich fahre nicht durch das dunkle, verschneite Stockholm, um mir einzubilden, ich wäre in Paris. Ich fahre nicht durch die winterliche Nacht, um an ihn zu denken oder an sein Kaiserreich, an die goldglänzenden Adler auf den Standarten oder an den kühnen Spitzturm von Notre-Dame, der sich am Seineufer erhebt, ein trotziger, von Menschenhand gemachter Finger aus Stein, der Gott ins Auge sticht.
Nein, nein. Immer rundherum fahre ich, um sie noch einmal zu sehen: das Mädchen, dessen Name Désirée lautete, die Begehrte. Das Mädchen aus einem anderen Leben, jenseits des zugefrorenen Meeres und des vom Krieg versehrten Kontinents. Désirée. So hieß sie, bevor sie mich umtauften und mich, ihre Königin und schwedische Mutter, Desideria nannten.
Wahrscheinlich kommt er doch in diesen mitternächtlichen Träumereien vor – alle von damals tun es –, aber nur im Hinblick auf das Mädchen, das er liebte, das Mädchen, das den jungen, raubeinigen Soldaten aus Korsika für sich gewann. Das Mädchen, das er hätte wählen können. Hätte ich seinen Hunger stillen können, statt ihn anzustacheln? Hätte ich das Unheil verhindern und der unersättlichen Gier Einhalt gebieten können, die alles auf ihrem Weg verschlang – Krone, Kaiserreich, Kontinent, das eigene Leben?
Nachts in meiner schneebedeckten, königlichen Kutsche denke ich an sie. An das Mädchen, das ihn hätte retten können. Das uns alle hätte retten können.
Runt och runt. Immer rundherum laufen die Gedanken und die Erinnerungen, auch jene geisterhaften Phantome, die ganze Reiche eroberten und verloren. Herumwirbelnder Seidenstoff, Füße, die über das Tanzparkett gleiten. Dunkle Augen mit entschlossenem Blick, starke Arme, aufblitzende Farben von Offiziersuniformen. Kronen, mit Pomp und großem Zeremoniell aufgesetzt und später formlos heruntergerissen. Gelächter. Es ist das ihre. Auch seines. Hochrufe und Champagner, Trinksprüche und Lieder, immer so viele Worte. Sie sind alle verschwunden, sowohl die Worte als auch die Redner, nur ich bin noch da. Bin als Einzige geblieben.
Sollen sie über mich sagen, was sie wollen. Über ihre schöne Königin. Ihre schlaue Königin. Ihre liebenswürdige Königin. Ihre verrückte, alte Königin. Ich lasse sie. Sie werden mir Wörter anstecken und andere abnehmen. Was soll’s, ich habe etliche Mäntel und Kronen und Namen getragen. Doch niemand wird bestreiten, dass es etwas gibt, das ich von jeher gewusst habe, nämlich nicht nur, wie man über Menschen und ein Königreich herrscht; das schafft jeder Ehrgeizling, der eine Armee zur Verfügung hat. Ich aber – ich weiß, wie man überlebt.
Und obwohl ich nun spüre, dass jede Atemwolke, die ich ausstoße, meine letzte sein könnte, habe ich doch noch die Möglichkeit, alle zu überraschen. Das werde ich auch tun. Es beginnt mit dem feurigen Herzen eines jungen Mädchens, dessen Name »die Begehrte« bedeutete.
Teil I
Kapitel 1
Kloster Notre-Dame Südfrankreich, 1789
Ich spürte, dass uns etwas Schlimmes bevorstand. An diesem Morgen erkannte ich es an den verkniffenen Mienen der Nonnen, daran, wie sie über die Flure hasteten, mit aufgeregt klappernden Absätzen auf den uralten, kalten Steinböden der Abtei. Geflüster lag in der Luft, verhalten und unstet wie der schwach zuckende Kerzenschein, der den Dahineilenden nur wenig Licht spendete.
Mein Magen knurrte. Ich drückte eine Faust hinein und zwang mich, an etwas anderes als an meinen Hunger zu denken. »Seit Jahrzehnten hatten wir keine so schlechte Ernte.« Das erzählten die Nonnen uns, seit ich im Kloster war. Halb klang es wie Resignation, halb wie ein Tadel, als hätten wir uns die schlechte Ernte selbst zuzuschreiben. »Gott prüft unseren Glauben.« Gottes Prüfung dauerte zuerst Wochen, dann Monate. Monate, die einem hungrigen elfjährigen Mädchen wie eine Ewigkeit schienen. »Wir müssen für die gequälten, leidenden Seelen beten. Wir beten für die Armen, die hungern müssen.« Das sagten die Nonnen jeden Abend zur Vesper und jeden Morgen zur Laudes. Warum denn nur für die?, hätte ich am liebsten gerufen. Habe ich etwa keinen Hunger? Aber natürlich hütete ich mich davor, den Schwestern jemals anders als mit bekümmertem Nicken und fromm gesenktem Blick zu antworten. Ich wollte nicht, dass mein Hinterteil mich ebenso wie mein leerer Magen schmerzte.
Nur auf der Krankenstation gab es genug zu essen, das war uns allen bekannt. Als meine Schwester Julie im vergangenen Winter krank wurde und dort in einem sauberen Bett zwischen frischen weißen Laken lag, hüpfte ich auf dem Weg zu ihr. Ich warf mich auf sie, presste meinen Mund auf ihren. »Wie ein Kerl in der Brunft«, sagte Julie schockiert. Ich hatte sie in ihrer Sittsamkeit verletzt, und sie imitierte den pikierten Blick, den ich von unserer Mutter kannte.
Doch es hatte funktioniert – ich wurde herrlich krank, viel kränker noch als Julie. Zwei Wochen lang konnte ich mich mit Essen vollstopfen, mich im warmen Bett aalen und vor mich hin dösen, während die Glocken zur Matutin läuteten und die anderen Mädchen todmüde und mit knurrendem Magen über die dunklen Flure zum Gebet in die eiskalte Kapelle schlurften. Selbst als meine Halsschmerzen aufgehört hatten und meine Lunge frei war, tat ich noch für einige Tage so, als wäre ich leidend. Demnach hatte ich nicht nur gelogen, sondern es überdies getan, um die zweifache Sünde der Völlerei und der Faulheit zu begehen. Und ich hatte jede Minute genossen.
Doch an diesem Morgen war ich zweifellos in Schwierigkeiten. Nicht, weil ich meine Krankheit hinausgezögert hatte, auch nicht, weil ich gelogen hatte, um mehr essen und länger schlafen zu können. Nein, an diesem Morgen hatte ich noch schlimmer gesündigt. Du sollst nicht stehlen. Ich kannte die Zehn Gebote, trotzdem hatte ich gegen eines von ihnen verstoßen. Oder vielleicht hatte ich nicht richtig gestohlen, sondern bloß etwas verborgen. An diesem Morgen hatte Schwester Marie-Bénédictine während unserer Unterrichtspause eine schwere, mit dicken, großen Melonen beladene Karre über den Hof geschoben. Als die Karre umkippte, rollte eine Frucht der verführerischen Fracht über das kleine Stück ausgedörrten, gelben Grases, an dem ich stand. Schwester Marie-Bénédictine befahl uns, ihr beim Einsammeln zu helfen. Ich stellte mich vor eine Melone und trat sie hinter einen Busch. Ich war ausgehungert, und die Melone wirkte so reif und saftig – und so nah. Für einen Moment fühlte ich mich schuldig, denn Schwester Marie-Bénédictine zählte zu den netten Nonnen, doch dann ging dieses kleine Unbehagen in meiner Vorfreude auf den Leckerbissen unter. Als die Schwester mit der frisch beladenen Karre zur Küche gehinkt war, bat ich Julie, die Melone mit mir ganz hinten auf dem Hof zu verstecken, dort, wo niemand sie sehen konnte. Sie war unser Schatz.
Doch irgendjemand musste es mitbekommen haben. Dieser Jemand hatte uns verpetzt, und nun wusste es auch Mère Supérieure, dessen war ich mir sicher.
»Tut es sehr weh?«, fragte ich meine Schwester auf dem Weg über den trüb beleuchteten Flur, der zu unserem Schlafsaal führte.
»Was?«
»Du weißt schon«, flüsterte ich.
Julie schüttelte den Kopf.
»Die Schläge«, erklärte ich, und man hörte die Panik in meiner Stimme.
Julie runzelte die Stirn. »Woher soll ich das wissen?«
Richtig, sie hatte sich bisher nie einer Verfehlung schuldig gemacht. Oder genauer gesagt, man hatte sie nie ertappt. Julie war zu vorsichtig, zu klug. Nur ich war von jeher unbedacht und waghalsig gewesen.
»Sie haben die Melone gefunden.« Ich biss ein Stück Haut von meinem Finger ab und bemerkte den metallischen Geschmack von Blut in meinem Mund.
»Hör auf, an deinen Fingern zu kauen«, sagte Julie. Sie war sechs Jahre älter als ich. In der Regel war sie mir mehr Mutter als Schwester.
Meine Hand fiel schlaff von meinem Mund herab. »Aus welchem anderen Grund hätten sie den Unterricht unterbrechen und uns befehlen sollen, in den Schlafsaal zu gehen?« Für mich war unser Schicksal besiegelt.
»Ah, die beiden Clary-Mädchen, da seid ihr ja. Julie. Désirée.« Mit wehendem weißem Habit und flatterndem Schleier kam Mutter Marie-Claude uns den Flur entgegengeeilt.
Das war der größte aller Schrecken. Mère Supérieure, die Mutter Oberin, war persönlich gekommen, um uns zu züchtigen. Lieber Gott, in meinem ganzen Leben werde ich niemals wieder eine Melone stehlen. Bitte, lieber Gott, verschone mich diesmal vor Deinem Zorn. Ich erflehe Deine Gnade. O Heilige Muttergottes, bitte verwende Dich für mich bei Deinem Sohn.
Doch als ich Mutter Oberin ins Gesicht blickte, konnte ich dort keine Empörung entdecken. Vielmehr erkannte ich das, was ich selbst empfand: Mutter Oberin hatte Angst.
»Wir haben eure Familie verständigt«, sagte sie. »Ihr werdet umgehend abgeholt und nach Hause gebracht.«
Julie und mir verschlug es die Sprache.
»Warum denn?«, fragte Julie schließlich. In ihrer Verwunderung vergaß sogar meine artige Schwester, sich ehrerbietig auszudrücken.
»Packt eure Sachen zusammen«, war die einzige Antwort, die wir erhielten.
Ich sah meine Mutter vor mir, die Miene stets missmutig, vielleicht auch stets enttäuscht. Was würde sie sagen, wenn wir fortgeschickt würden?
»Bitte, Mutter Oberin!« Ich fiel auf die Knie. Man hörte sie auf dem Steinboden aufschlagen. Das würde blaue Flecken geben. Ich schob den Gedanken zur Seite und flehte mit erhobenen Händen: »Es war meine Schuld. Ich habe es verdient, nach Hause geschickt zu werden, meine Schwester nicht. Sie hat nichts damit zu tun. Ich bitte Sie, Julie zu – «
»Schweig, Désirée.« Mutter Oberin machte eine abwehrende Handbewegung und wirkte ungeduldig. »Sei ausnahmsweise einmal still, du dummes Mädchen. Ihr werdet nach Hause fahren, ebenso wie alle Mädchen, deren Familien für eine sichere Reise sorgen können. Die anderen, deren Familien in der Fremde leben … bei ihnen haben wir noch nicht entschieden, wie – « Mutter Oberin stieß einen Seufzer aus, ein für sie seltenes Zeichen innerer Anspannung. »Wie auch immer. Ihr beide habt Glück. Eure Familie wohnt nicht weit entfernt. Zu Hause werdet ihr geschützter als in unserem Kloster sein.«
»Aber warum? Wir haben doch noch gar keine Ferien.« Julie schien das Ganze ebenso wenig zu begreifen wie ich. Warum waren wir im Kloster plötzlich nicht mehr sicher?
»Weil Krieg ist«, antwortete Mutter Oberin, deren Blick angesichts unserer Verwirrung für einen Moment milder geworden war. »Ihr müsst beten. Für uns alle. Und für Frankreich.«
»Krieg?«, wiederholte ich ungläubig. Das Wort klang fremd und beinhaltete etwas so Merkwürdiges, als hätte Mutter Oberin uns erzählt, die Jungfrau Maria warte im Refektorium, um mit uns Brot zu essen und Milch zu trinken. »Krieg mit wem?«
Mutter Oberin zog die Brauen zusammen. »Mit uns selbst. Es ist Revolution.«
Julie nahm meine Hand, und ich spürte, wie kalt und feucht ihre Finger waren.
»Das Volk hat sich erhoben«, sagte Mutter Oberin. »Die Revolutionäre scheinen zu glauben, dass ihre Feinde im Adel und … und in der Kirche zu finden sind. Deshalb sind wir hier nicht mehr sicher. Im ganzen Land werden Klöster in Brand gesetzt und geplündert. Mönche werden niedergestochen, Nonnen geschändet.« Als wolle sie beten, legte Mutter Oberin ihre Hände vor ihrer Brust zusammen. »Ich habe schon zu viel gesagt. Mehr müsst ihr nicht erfahren … dazu habe ich keine Zeit.« Sie sah uns gebieterisch an. »Geht sofort in euren Schlafsaal und packt. Heute Abend werdet ihr abgeholt.« Ihr Blick ruhte noch eine Weile auf mir, und ihre Miene schien Sorge auszudrücken – und noch etwas. War es Kummer? Oder Angst um meine ungewisse Zukunft? Doch gleich darauf wirkte sie wieder streng, straffte die Schultern und richtete sich zu voller Höhe auf. Dann machte sie kehrt und schritt eilig davon.
»Revolution«, sagte Julie, als wir allein waren, so leise, dass es kaum hörbar war. »Mönche werden umgebracht. Klöster niedergebrannt. Wie sollen wir es da lebend nach Hause schaffen?«
Ich drückte die Hand meiner Schwester. »Papa wird uns heil zurückbringen. Oder Nicolas. Mach dir keine Sorgen, morgen um diese Zeit sind wir daheim.« Mein Vertrauen in meinen Vater und unseren älteren Bruder war grenzenlos. Im Übrigen stimmte mich die Aussicht froh, endlich wieder nach Hause zu kommen, ganz gleich wie schrecklich der Grund für den Adel und die Kirche sein mochte.
Kapitel 2
Marseille, 1794
Sobald meine Mutter zu jammern begann, verzog ich mich nach draußen. Außer unserer Köchin fiel das niemandem auf, doch ihr einvernehmlicher Blick und ihr kaum erkennbares Lächeln besagten, dass sie mein Geheimnis wahren würde.
»Psst!«, machte ich, wenn ich an der warmen Küche vorüberschlich, legte einen Finger auf meine Lippen und sah unsere Köchin bittend an. Sie nickte und griff nach der nächsten Zwiebel oder Karotte, um sie zu hacken.
Auch an diesem Morgen huschte ich an der Küche vorüber, summte vor mich hin und hüpfte hinaus in den Garten. Die Sonne war so hell, dass ich blinzeln musste. Wie gut es tat, aus der Enge unserer vollgepfropften Räume – mit zugezogenen Damastvorhängen, leisen Auseinandersetzungen und den lauten Klagen meiner Mutter über ihre Kopfschmerzen – in unseren wunderbar duftenden Garten zu verschwinden, wo leuchtende Farben auf mich einstürmten und in der milden Luft Vögel zwitscherten.
Damals wusste ich noch nicht, was für eine seltene Kostbarkeit es war, das ganze Jahr lang Vögel singen zu hören und den frischen Duft von Pflanzen zu riechen, deren saftige Blätter sich frühmorgens entfalteten, voll von den prallen Perlen des Taus. Woher hätte ich das in meinen jungen Jahren auch wissen sollen? Aber ich genoss jene heimlichen Stunden in unserem Garten. Der warme Wind strich über die Spaliere voller Hibiskus und durch die Ranken fielen dünne Schäfte Sonnenlicht. Man hörte das Geschrei der Möwen, durchsetzt vom Tuten der großen Schiffe, die in den Hafen einliefen.
Vor einigen Monaten war mein Vater gestorben, seither war die Atmosphäre in unserem Haus beklemmend geworden, ein Zustand, der sich in jüngster Zeit noch verschlimmert hatte. Meine Mutter war mit den Nerven am Ende. Jeden Tag lamentierte sie, dass wir alle das gleiche Schicksal wie unser Vater erleiden würden.
»Papa ist nicht in den Folgen der Revolution umgekommen«, erwiderte Nicolas jedes Mal. »Er musste nicht unter die Guillotine.« Nicolas war siebzehn Jahre älter als ich und nun der Patriarch der Familie Clary. Das Leid und die Furcht, die wir empfanden, drückten sich bei ihm in einer verkrampften Kinnpartie und neuen Stirnfalten aus. Trotzdem blieb er sanft und ruhig und fuhr meine Mutter nie an, wie ich es an seiner Stelle getan hätte. »Kein Tribunal hat uns irgendeines Vergehens bezichtigt, Maman.«
»Noch nicht«, entgegnete meine Mutter stets, bekam rote Flecken im Gesicht und knetete hektisch ihre Finger.
Daraufhin seufzte Nicolas geduldig. »Vater ist eines natürlichen Todes gestorben, Maman.«
»Eines natürlichen Todes? Niemals.« Meine Mutter stöhnte und antwortete immer wieder das Gleiche. »Die Sorge hat ihn umgebracht. Die Angst vor der Guillotine war sein Tod. Er hatte erkannt, dass wir alle in Gefahr sind.«
An diesem Punkt suchte Julie für gewöhnlich meinen Blick. Du sagst kein Wort, bedeutete sie mir stumm. Wenn du still bist, ist es gleich vorbei.
»Wir sind zu wohlhabend«, sagte meine Mutter, eine Beschwerde, die noch vor wenigen Jahren sonderbar geklungen hätte. »Sie werden uns holen. Wir haben schon zu lange überlebt.«
Ich war jung und naiv, eine behütete, verwöhnte Sechzehnjährige, doch ich wusste genug, um zu erfassen, dass die Ängste meiner Mutter nicht aus der Luft gegriffen waren. Unser Land war vom Wahnsinn befallen worden, von einer Schreckensherrschaft, die uns im Würgegriff hatte, gerade als hingen wir schon am Strang. Es war keine schöne Zeit, die wir in Frankreich erlebten. Unsere Furcht war so groß, dass man sie in den Straßen riechen und in den Gesichtern der Menschen erkennen konnte. Man hatte unseren König und unsere Königin ermordet, hatte sie vor den Augen einer aufgebrachten Menge enthauptet, ein schmachvolles Schicksal, das zuvor nur Verbrechern und Landesverrätern vorbehalten war. König Louis XVI. und Königin Marie-Antoinette hatten ihre Ämter von Gottes Gnade erhalten, so zumindest hatten wir es im Kloster gelernt. Inzwischen war Gott verbannt und von einem »höchsten Wesen« ersetzt worden. König und Königin waren in namenlose Gräber geworfen worden und fütterten die Würmer, zusammen mit Mitgliedern des Adels und gewöhnlichen Verbrechern. Und wer war an ihre Stelle getreten? Ein sogenannter Nationalkonvent oder die Herrschaft des Terrors. Es durfte keinen Adel mehr geben, auch unsere althergebrachte Religion war abgeschafft worden, und jeder, der über den Adel oder Gott etwas Gutes zu sagen wagte, fiel dem neuen Gesetz über die Verdächtigen zum Opfer.
Deshalb kontrollierte Maman uns noch strenger als zuvor, erst recht seit dem Tod meines Vaters. Insbesondere Nicolas bewachte sie wie eine Löwin ihr Junges. Sie war davon überzeugt, dass die Revolutionstribunale – denen ihr Mann durch seinen Tod entgangen war – sich nun an seinem Sohn und Erben rächen würden, schließlich gehörten wir Clarys zur Klasse begüterter Kaufleute und somit zum gehobenen Bürgertum. Allerdings war mein Vater aus bescheidenen Verhältnissen gekommen. Er hatte sich emporgearbeitet und im Handel mit Seide, Seife und Kaffee ein ansehnliches Vermögen erwirtschaftet. Doch Nicolas hatte das Geschäft geerbt und zählte nunmehr zu den wohlhabendsten Männern Südfrankreichs, besaß ein größeres Vermögen als etliche der Adligen, die geköpft worden waren. Das war das, was meine Mutter panisch machte. Meistens versuchten Nicolas und Julie sie zu beschwichtigen, doch dann regte meine Mutter sich nur noch mehr auf.
Ich, die Jüngste der Familie, half mir durch diese schwierige Zeit, indem ich die Einsamkeit suchte, die mir wenigstens für kurze Zeit Ruhe bot. Meistens versteckte ich mich im Garten, um den Tränen und der Sorge meiner Mutter zu entrinnen, und reckte mein Gesicht in die Sonne.
Ich vergaß nicht für eine Sekunde, dass außerhalb unseres Hauses der Terror regierte. In der Stadtmitte, dort, wo La Place war, kam man an der gefürchteten neuen Einrichtung – der Guillotine – vorüber. Zahllose Male hatte ich sie erblickt, auf dem Weg zum Markt, zum Ufer des Meeres oder an dem Bauwerk entlang, das einmal die Marienkirche von Marseille gewesen war und nun Tempel der Vernunft hieß. Ich hatte das Sägemehl auf dem Schafott gerochen, hatte die Karren erblickt, auf denen die Verdammten dorthingebracht wurden, auch die geköpften Leichen hatte ich gesehen, was das Allerschlimmste war. Ich bestritt nicht, dass wir die Hölle auf Erden hatten. Sogar jetzt in unserem Garten schauderte ich und begann trotz der warmen Morgensonne zu zittern.
Doch ebenso war ich mir darüber im Klaren, dass ich machtlos war. Es wäre müßig, mir vorzustellen, ich, eine Sechzehnjährige, könnte etwas ausrichten, wenn das nicht einmal unserem König und unserer Königin gelungen war. Meine Mutter, Nicolas und Julie waren viel eher in der Lage, für das Wohlergehen unserer Familie zu sorgen. Schon vor langer Zeit hatte ich erfasst, dass es für uns alle das Beste war, wenn ich mich abseitshielt, statt meiner Mutter noch mehr Grund zum Jammern zu geben.
An diesem Tag entdeckte ich im Garten ein Vogelnest auf der Erde. In der Nacht hatte es gestürmt und geregnet, dabei musste es aus dem Wacholderstrauch gerissen worden sein. Ich ging in die Hocke und sah die zerbrochenen Eier, die Scherben der Schalen in einem Blau gesprenkelt, das leuchtender war als der klare Himmel über mir.
Ich beugte mich tiefer hinab und spürte, wie mein Herz sich schmerzhaft zusammenzog. Es lag nicht nur an den zerbrochenen Vogeleiern, sondern auch an dem noch intakten, jedoch leeren Nest. Es hatte den Sturm und den Sturz aus dem Wacholder überstanden, und ich erkannte, mit welcher Sorgfalt die Zweige miteinander verwoben waren, um ein sicheres Heim zu schaffen, neues Leben willkommen zu heißen und aufzuziehen. Wie viel Vorfreude in diese Arbeit geflossen sein musste. Ebenso Hoffnung und ganz offenkundig Liebe. Und nun waren nur noch die zerbrochenen Eier übrig, in denen sich bereits Würmer wanden, um sich von den Überresten des zerstörten Lebens zu ernähren. Wo waren die Vogeleltern? Was wurde aus der Liebe, die ihrem Nachwuchs hatte gelten sollen?
Ich sagte mir, dass ein oder zwei Eier unversehrt geblieben sein könnten. Die wollte ich suchen und mit ins Haus nehmen. Unsere Köchin würde mir helfen, sie zu wärmen und die winzigen, zarten Lebewesen darin zu erhalten. Vorsichtig tastete ich über die feuchte Erde.
»Grundgütiger, was machst du da?«, hörte ich Julies Stimme. »Kopf in den Wolken und die Hände im Dreck. Musst du dich immer wie ein Kind benehmen? Ausgerechnet heute?«
Ich hatte meine Schwester nicht kommen hören und ihre Worte taten mir weh. Ich wandte mich zu ihr um. »Warum, was ist heute?«
Julie wedelte meine Frage mit der Hand fort. »Komm ins Haus. Maman möchte mit dir sprechen.«
In einer schwachen Form des Protests runzelte ich die Stirn und hoffte, Julie würde mich decken, wie sie es schon so oft getan hatte. Konnte sie nicht sagen, sie hätte mich nirgends gefunden?
Offenbar konnte sie es nicht. »Sofort, Désirée«, sagte sie ungeduldig. »Maman ist außer sich. Bekommst du von dem, was geschieht, gar nichts mehr mit?«
Ihr Ton war so scharf, dass ich mich rasch aufrichtete, die Erdkrumen von meinen Händen klopfte und meinen Rock glatt strich.
»Was ist heute?«, fragte ich noch einmal, diesmal den Rücken meiner Schwester, denn sie eilte bereits wieder davon.
Im Haus waren die Vorhänge zugezogen, um die helle Sonne auszusperren. In den großen, dämmrigen Räumen, die wir durchschritten, herrschte gespenstische Stille. Im Salon saß meine Mutter in einem mit dunkelrotem Satin bezogenen Sessel, die Füße auf einem Polsterschemel. Sie wirkte lethargisch. Selbst ihre Gesichtszüge waren unter der Last ihrer Sorgen erschlafft. Von Nicolas war nichts zu sehen, vielleicht war ihm das Warten auf mich zu lang geworden, und er hatte sich entschuldigt.
»Komm her, Désirée.« Maman winkte mich zu sich. Das war ungewöhnlich, normalerweise rief meine Mutter nur nach Julie und Nicolas. Zögernd trat ich näher. Sie nahm meine Hand mit festem Griff. »Mein liebes Mädchen, vielleicht bist du unsere Rettung.«
Das hörte sich selbst für meine Mutter eigenartig an. Ich entzog ihr meine Hand und schwieg.
»Wir brauchen dich.«
Ich drehte mich zu Julie um. »Wozu?«
»Du musst in die Stadt gehen«, antwortete meine Mutter.
Ich glaubte nicht recht zu hören. »Ich muss was?« Das war das genaue Gegenteil von dem, was meine Mutter uns an allen anderen Tagen befahl. Du gehst nicht in die Stadt. Du meidest La Place. Du machst einen Bogen um die Guillotine und hältst dich von Menschenmengen fern.
Meine Mutter massierte ihre Schläfen mit kreisförmigen Bewegungen. »Du gehst ins Hôtel de Ville.«
»Was soll ich da?«, fragte ich verwirrt.
Meine Mutter brach in Tränen aus.
»Es geht um Nicolas«, flüsterte Julie. »Er … er wurde festgenommen.«
Der Brust meiner Mutter entrang sich ein lauter Schluchzer. Ich sah meine Schwester mit großen Augen an. »Nicolas – festgenommen?«
Julie nickte.
»Warum?«, presste ich hervor, obwohl ich wusste, dass es eine dumme Frage war. Ebenso hätte man fragen können, warum nicht? Bei uns herrschte der Terror, und Nicolas war der Erbe eines großen Vermögens. Viele Menschen wurden täglich aus weitaus nichtigeren Gründen verhaftet.
»Es ist schlimmer, als ich befürchtet habe.« Meine Mutter betupfte ihre Augen mit einem Taschentuch, in das die Initialen meines Vaters gestickt waren. »Euer Vater hat uns größere Probleme hinterlassen, als ich ahnen konnte.«
Ich sah meine Schwester fragend an.
»Euer Vater …« Meine Mutter schluckte schwer, bevor sie weitersprach. »Vor einigen Jahren hatte er sich an den König gewandt und ihm eine großzügige Gabe zukommen lassen, gepaart mit der Bitte, uns in den Adelsstand zu erheben. Wir wären adlig geworden, bevor … bevor dann alles anders gekommen ist.« Ihre Kraft verließ sie, und sie schlug die Hände vors Gesicht.
Julie drückte meine Schulter. Ich wandte mich ihr zu. »Ich verstehe noch immer nicht, was ich tun soll.« Vor Angst wurde mein Mund trocken. »Und warum ich?«
»Maman glaubt, dass du am ehesten erfolgreich sein wirst.« Julies Miene wurde bittend. »Du gehst zum Rathaus und verwendest dich für Nicolas.«
Das Ungeheuerliche – und ganz und gar Vergebliche – dieser Aufgabe raubte mir kurz die Sprache. Dann fragte ich: »Ich soll das tun?«
»Ja«, antwortete Julie.
»Du wirst es als Erste versuchen.« Meine Mutter ließ die Hände sinken. »Du bist jung. Und sieh dich an. Wie hartherzig müsste jemand sein, der nicht von deiner Unschuld gerührt würde?«
Ich verschränkte die Arme vor der Brust. »Das kann ich nicht. Ich bin nicht …« Meine Stimme erstarb, denn in meinen Kopf ging es drunter und drüber.
Meine Mutter runzelte die Stirn. »Was bist du nicht? Heraus damit.«
»Ich bin nicht klug. Nicht so klug wie Julie«, antwortete ich, denn davon war ich felsenfest überzeugt. »Sag ihr, sie solle gehen.«
Meine Mutter wischte meinen Einwand mit einer ungeduldigen Handbewegung fort. »Klugheit hat damit nichts zu tun, du dummes Ding. Du bist schön, Désirée, schöner als Julie. Du wirst liebreizend sein, sanft und flehend, verstanden? Schau den Beamten im Rathaus ebenso ängstlich in die Augen wie jetzt mir. Jeder Mann wird willens sein, dir deinen Wunsch zu erfüllen.«
Meine Gedanken verknäuelten sich noch mehr. So etwas hatte meine Mutter noch nie zu mir gesagt. Es war kein Kompliment, darüber war ich mir im Klaren. Ebenso wenig wollte sie Julie beleidigen. Stattdessen trieb sie der verzweifelte Wunsch, ihren Sohn zurückzubekommen. Ich erfasste das ganze Ausmaß ihrer Not. Aber wie kam sie dazu, mir eine derart gewaltige Aufgabe zu übertragen?
Es war richtig, dass ich jung und hübsch war, ich hatte es den Blicken entnommen, mit denen mich Männer bedachten. Zuvor war ich nur ein kleines, bürgerliches Mädchen gewesen, das in der Respekt einflößenden Begleitung von Maman, Julie, unserer Köchin oder Nicolas eine Straße hinunterlief. Nun jedoch verharrten sie interessiert oder kehrten zu mir zurück. Sie wanderten über die Rundungen meines Körpers, ruhten auf meiner Taille oder meinem Dekolleté und bekamen einen Ausdruck, der hungrig wirkte. Ebenso war mir aufgefallen, dass mein Bruder mitunter die Brauen zusammenzog, wenn er mich musterte und sich leise fragte: »Musste Papa uns ausgerechnet in dem Jahr verlassen, als Désirée zur Frau wurde?«
Ich war selbst überrascht, wie schnell mein Körper sich in den vergangenen Monaten verändert hatte. Mein Monatsfluss hatte eingesetzt, die Kleider aus meiner Mädchenzeit passten mir nicht mehr, meine Brüste quollen aus meinem Korsett, meine Glieder waren voller und weicher geworden. Wenn ich in den Spiegel blickte, entdeckte ich in meinen dunklen Augen bisweilen einen Ausdruck, als wäre ich zu etwas erwacht, das ich noch nicht verstand. Ich studierte mein Gesicht, um das sich mein brünettes Haar in glänzenden Wellen rankte. War ich tatsächlich schöner als Julie? Vielleicht. Doch, das war ich. Unsere Augen und unser Haar hatten die gleiche dunkle Farbe, aber ihr Körper war eckiger und flacher als meiner. Im Gesicht glichen wir uns wie Schwestern, doch das ihre war länger und schmaler als das meine, ihre Züge waren weniger gefällig arrangiert.
Dennoch wusste ich meine neu erworbenen Reize nicht zu gebrauchen. Und wie sollte ich dann mit ihrer Hilfe das Leben meines Bruders retten?
»Ich begleite dich zum Rathaus«, sagte Julie. »Du wirst mit den Zuständigen sprechen, aber ich werde bei dir sein.«
Ich spürte, wie sich meine ängstlich verspannten Schultern lockerten. »Danke.«
»Nimm das an dich, Julie.« Meine Mutter zog eine prall gefüllte Seidenbörse aus den Falten ihres Gewands hervor und reichte sie Julie. »Der Preis spielt keine Rolle. Wenn der Betrag in der Börse nicht hoch genug ist, unterschreibst du einen Kreditbrief und erklärst, dass wir den Rest umgehend begleichen werden. Eine Obergrenze gibt es nicht, verstehst du? Selbst wenn wir unser gesamtes Vermögen opfern müssen, um Beamte und Wachen zu bestechen, ist es mir einerlei. Die Hauptsache, ihr bringt mir meinen Sohn zurück.«
Julie nahm die Börse entgegen. »Bist du so weit?«, fragte sie mich.
Ich wollte Nein sagen, doch dem Blick meiner Mutter konnte ich entnehmen, dass ich keine Wahl hatte. Offenbar war es an der Zeit, dass auch ich dazu beitrug, unser zerbrechlich gewordenes Leben zu schützen.
* * *
Hand in Hand traten Julie und ich hinaus in den Sonnenschein und zogen unsere Hauben tiefer in die Stirn, um unsere Augen vor dem hellen Licht zu beschirmen.
Wir wohnten in einem der besten Viertel der Stadt, nicht weit von der Place Saint-Michel entfernt. Auch der Weg zum Rathaus war nicht weit.
Die Gassen des Vieux Port im Herzen Marseilles kannte ich zeit meines Lebens, doch an den Gestank, der an einem warmen Tag vom Hafen in die Stadt zog, hatte ich mich noch immer nicht gewöhnt. Insbesondere gegen Mittag, wenn die Sonne am höchsten stand, verließ ich unser Haus nur selten.
Nun liefen Julie und ich naserümpfend an den Kalksteingebäuden entlang, bahnten uns einen Weg durch die Menge, rochen Fisch, Brackwasser, Pferdemist, überreifes Obst und Gemüse, das auf dem Markt verdarb.
Doch in den vergangenen Jahren hatte sich ein weiterer Geruch über das Viertel des alten Hafens gesenkt. Ebenso wie in anderen Städten stank es dort nun nach Sägemehl und Blut.
Als wir uns La Place näherten, wo die täglichen Hinrichtungen Schaulustige zuhauf anlockten, drehte sich mir der Magen um. Ich zwang mich, stur geradeaus zu sehen, nicht zu dem Podest, dem Auffangkorb und dem Gerüst, dessen Fallbeil nach dem morgendlichen Spektakel jedes Mal gesäubert wurde und in der Sonne glänzte.
Lieber blickte ich auf die Weite des schimmernden blauen Mittelmeers, auf die Frachter, die großen Handelsschiffe und die Fischerboote. Ich schaute zum Château d’If hinüber, das sich auf seiner Felseninsel erhob. Vor Jahrhunderten war es als Seefestung errichtet worden, nun diente es den Jakobinern als Gefängnis. Bei seinem Anblick bekam ich trotz des warmen Tags eine Gänsehaut. Ich wandte den Blick von den dicken, unüberwindlichen Mauern ab und befahl mir, nicht an die armen Seelen zu denken, die sich dahinter an ihr elendes Leben klammerten.
Auch die Marienkirche schien aus einem felsigen Hügel zu wachsen, ein Bauwerk, das die Altstadt überragte. Nein, verbesserte ich mich, »Kirche« war falsch. Als Tempel der Vernunft war sie nun ein Gebäude im Dienst des Volkes.
Ihr Geläut hatten wir nicht mehr gehört, seit Revolutionäre die Kirche gestürmt und die Glocken geraubt hatten, um sie einzuschmelzen und Gewehrkugeln für die Nationalgarde daraus zu schmieden.
»Heda, Bürgerin!« Auf der anderen Seite der stinkenden Gasse stieß ein ungeschlacht aussehender Mann einen Pfiff aus und grinste mich mit einem Mund voller Zahnlücken an. »Suchst du etwas, das es in den feinen Salons nicht gibt? Ich hätte eine schöne Rute zu bieten.« Mit einer obszönen Geste griff er in seinen Schritt. Ich erstarrte und konnte nicht glauben, dass ich gemeint sein sollte. Wie konnte jemand bei Tageslicht und vor aller Augen derart vulgär sein? Wie eine junge Clary auf so ekelhafte Weise beleidigen?
»Beachte ihn nicht.« Julie drückte meine Hand. Mit der anderen umklammerte sie die Börse, die sie in den Falten ihres Rocks verbarg. »Lauf weiter!« Sie zog mich mit sich. »Dieses Schwein«, zischte sie. »Solche Menschen sind nun die Herren unserer Stadt.«
Wir überquerten einen belebten Platz, vorbei an jungen Mädchen mit weißen Leinenhauben, die Blumen feilboten; an jungen Männern, die die neumodischen langen Hosen trugen, die Sansculotten der Jakobiner. Etliche von ihnen saßen auf den Bänken und debattierten, in den Händen ein Pamphlet oder ein Buch. Ebenso sahen wir ausgemergelte Frauen mit schmutzigen Gesichtern und einem Säugling an der bloßen Brust. Sie hielten die Hände auf und bettelten.
Schließlich erreichten wir das Barockgebäude, in dem das Rathaus untergebracht war. Die schwere, tiefliegende Eingangspforte wurde an beiden Seiten von hohen Bogenfenstern flankiert; die blau-weiß-rote Fahne der Republik fiel an diesem windstillen Tag schlaff von der Stange herunter.
Mein Herz zuckte ängstlich, und mein Schritt wurde schleppend. Julie nahm es wahr. »Komm«, sagte sie fest. »Wir tun es für Nicolas.«
Wir betraten das Rathaus. In der großen, hohen Eingangshalle war es kühl. Wir sahen geschäftig umherlaufende Beamte, doch keiner von ihnen schenkte uns einen Blick. »Wohin gehen wir?«, fragte ich Julie und war unglaublich froh, dass sie mitgekommen war. Zwar war ich früher schon einige Male mit meinem Vater hier gewesen, nie jedoch mit einem so wichtigen Auftrag wie heute.
»Dahin.« Julie deutete auf eine lange Schlange von Bittstellern an einem Schalter, hinter dem ein gleichgültig aussehender Mann seinen Dienst offenbar im Schneckentempo versah.
»Sollen wir hier bis Weihnachten stehen?«, flüsterte ich. »Wo ist Nicolas?«
»Warum fragst du mich das?«, antwortete Julie gereizt. Aber vielleicht hatte auch sie einfach nur Angst. »Ich weiß nicht mehr als du.«
Ich wandte mich an eine Wache, die vor einer Seitentür Posten bezogen hatte. »Entschuldigung.« Der Mann sah mich an, antwortete jedoch nicht. »Unser Bruder wurde fälschlicherweise inhaftiert. Wir sind gekommen, um seine Kaution zu zahlen. Wären Sie so freundlich, uns zu sagen, wo wir denjenigen finden, der für die Entlassung der Gefangenen zuständig ist?«
Der Wachmann taxierte mich, dann Julie, dann wieder mich. Sein Blick glitt über meinen Körper. Er grinste. Ich krallte meine Hände ineinander. Die unverhüllte Lüsternheit in seinem Gesicht erschreckte mich.
»Was bietest du mir denn, wenn ich dir helfe?«, fragte er lachend.
Ich errötete. Julie versteifte sich, und bevor ich eine Antwort stammeln konnte, sagte sie: »Wir haben Geldmittel.«
Der Wachmann musterte sie amüsiert. »Angesichts eurer Kleidung dachte ich mir das schon.« Sein Atem roch sauer nach Wein. »Aber Geldmittel hatte auch Louis Capet.« Er betonte den bürgerlichen Namen unseres ehemaligen Königs verächtlich. »Hat ihm nicht viel genützt.« Wieder lachte er und kratzte sich mit einem Finger im Schritt seiner schmutzigen Hose. »Ihr wartet, bis ihr an der Reihe seid, wie alle anderen freien Männer und Frauen auch.« Mit seinem stoppeligen Kinn deutete er auf die Menschenschlange. »Eure feine Kleidung beeindruckt mich nicht. Kann höchstens sein, dass eine der Wachen sie euch herunterreißt, um sie zu verscherbeln.«
»Komm, Julie.« Ich griff nach der Hand meiner Schwester und bedauerte, dass ich diesen Widerling angesprochen hatte. Doch unsere Entschlusskraft war nach der Begegnung mit ihm ins Wanken geraten, und wir entfernten uns mit hängenden Köpfen.
»Sieh dir die Schlange an«, murmelte Julie, während wir die Halle durchquerten, ohne zu wissen, wohin wir uns wenden sollten. Die Hauptsache war, dass wir von diesem grässlichen Wachmann fortkamen. »Wir werden hier tagelang stehen, ohne Nicolas helfen zu können. Bis wir an dem Schalter sind, könnte er schon verurteilt und hingerichtet worden sein.«
Ich nickte hilflos. Der Anblick des Château d’If, der entweihten Marienkirche, der Guillotine, die Begegnung mit dem vulgären Mann auf der Straße und nun mit dem Wachmann hatten mich verstört. Den Mann vor mir sah ich erst, als ich in ihn hineinlief. Ich taumelte zurück. »Entschuldigen Sie, Monsieur – ich meine, Bürger. Ich habe nicht aufgepasst.« Ich wagte kaum, ihn anzusehen, aus Furcht, er würde mich ebenso grob wie der Wachmann behandeln.
»Eine Dame muss sich nicht entschuldigen«, antwortete er zu meinem Erstaunen. In seiner Stimme schwang weder Feindseligkeit noch Bosheit oder Lüsternheit mit. Vorsichtig linste ich unter dem Rand meiner Haube hervor. Der Mann hatte ein gebräuntes, rotwangiges Gesicht. Er war nicht attraktiv, doch der Blick seiner großen Augen wirkte ebenso freundlich wie sein Lächeln. Ich entspannte mich ein wenig.
»Eine Dame sollte sich auch nicht sorgen und die Stirn krausziehen, doch Sie tun offenbar das eine wie das andere.« Er hatte einen ausländischen Akzent, womöglich einen spanischen, sprach jedoch mit der Autorität eines Mannes, der Einfluss besaß. Allerdings trug er weder eine Uniform noch eine andere offizielle Bekleidung, sondern die Hose der Sansculotten und eine einfache Jacke, an deren Aufschlag unübersehbar die blau-weiß-rote Kokarde der Revolutionäre steckte. Hochgewachsen und breitschultrig war er, auch älter als ich, wahrscheinlich Mitte oder Ende zwanzig. Aber wie kam es, dass er mich als »Dame« statt als »Bürgerin« bezeichnete? Und wer war er?
»Joseph Buonaparte, zu Ihren Diensten«, beantwortete er meine stumme Frage, wedelte elegant wie ein Höfling mit der Hand und verneigte sich vor meiner Schwester und mir. »Und Sie sind?« Er sah mich verschmitzt an, vielleicht sogar belustigt.
»Désirée Clary.« Ich schaute zu Boden und machte einen kleinen Knicks. »Julie Clary«, sagte meine Schwester und knickste ebenfalls.
»Ah, die berühmten Clary-Mädchen.« Joseph Buonaparte schlug die Hände zusammen. »Die Töchter des verstorbenen François Clary, des vorbildlichen Bürgers, der zum Reichtum dieser Hafenstadt beigetragen hat.«
Julie und ich tauschten einen verstohlenen Blick. Offenbar fragte auch sie sich, wer dieser merkwürdige Mann mit dem netten Lächeln und dem sonderbaren Akzent war.
»Bitte sagen Sie mir, was ich für die Töchter von François Clary tun kann.« Buonapartes Augen huschten zwischen Julie und mir hin und her, bevor sie auf mir ruhen blieben.
Die Frage überraschte mich so sehr, dass mir keine Antwort einfiel.
Julie sprang für mich ein. »Wenn es Ihnen mit Ihrer Frage ernst ist, wenn Sie tatsächlich gewillt sind, uns zu helfen – «
Buonaparte ließ sie nicht ausreden. »Ein Korse bietet nie etwas an, an das er sich nachher nicht hält. Es sei denn, er ändert seine Meinung. Aber das ist eine andere Geschichte.« Er lachte und sah mich noch immer an.
Ich tat, als hätte ich den Sinn seiner Worte verstanden. Aber wenigstens hatte ich erfasst, dass er Korse war. Demnach hatte er einen italienischen Akzent. Doch warum gab er vor, uns helfen zu können?
»In dem Fall werde ich Ihnen Ihr Entgegenkommen mit Offenheit vergelten, Monsieur – Bürger.« Julie schien diesem leutseligen Mann zu vertrauen und berichtete ihm, dass unser Bruder Nicolas festgenommen worden war und wir uns für ihn verwenden wollten. Von unserer Sorge wegen des Geldgeschenks unseres Vaters an Louis XVI. erzählte sie ihm nichts.
Buonaparte hörte ihr aufmerksam zu und verzog keine Miene, auch nicht, als der Kummer Julie zu übermannen drohte.
Als sie geendet hatte, verschränkte er die Arme vor seiner breiten Brust und sagte: »Verstehe.«
»Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns helfen könnten.« Julie griff in die Falten ihres Gewands und ließ die Geldbörse aufblitzen. »Wir würden uns auch erkenntlich zeigen.«
Buonaparte warf einen raschen Blick nach allen Seiten. Dann beugte er sich vor und hielt Julies Hand fest. Es war eine vermessene Geste, doch als er sagte: »Bitte, Bürgerin Clary, stecken Sie das wieder fort«, war an seinem Ton nichts Ungebührliches zu erkennen, sondern nur die Befürchtung, jemand hätte die Börse gesehen.
Julie betrachtete seine Hand, die ihre umfasst hielt. Dann befreite sie sich, und die Börse verschwand wieder.
»Vielleicht tun Sie Folgendes«, schlug Buonaparte vor.
»Wir tun alles«, fiel ich ein und spürte meine aufkeimende Hoffnung.
Er wandte sich mir zu. »Auf der anderen Seite des Vorplatzes ist ein hübsches Kaffeehaus. Warten Sie dort auf mich. Vielleicht bestellen Sie mir etwas Kaltes zu trinken – ein Glas Wein wäre schön. Ich verspreche Ihnen, dass Sie, bevor wir heute schließen, mit Ihrem Bruder nach Hause gehen können.«
Wieder wechselten Julie und ich einen Blick. Konnten wir diesem eigentümlichen Mann glauben?
Julie schaute kurz zu der langen Menschenschlange hinüber. »Sie geben uns Hoffnung. Vielen Dank.«
»Bedanken Sie sich, wenn ich Ihnen Ihren Bruder bringe. Nicolas ist der Name, oder?«
»Nicolas Clary«, antwortete Julie. »Er wurde heute Morgen abgeholt, aber wir wissen nicht, wohin er gebracht wurde.«
»Das finde ich heraus.« Buonaparte zwinkerte mir zu. »Und jetzt husch, husch ins Kaffeehaus. Das Hôtel de Ville ist kein Ort für Damen. Hier gibt es Schurken, die sich als Revolutionäre ausgeben.«
* * *
In dem Kaffeehaus schwiegen Julie und ich für lange Zeit und rührten unsere kalten Limonaden kaum an. Ich war mir sicher, dass meine Schwester ebenso wie ich überlegte, wer dieser Joseph Buonaparte sein konnte. Hatte er tatsächlich vor, uns zu helfen? War er dazu überhaupt in der Lage?
Draußen vor den Fenstern wanderte die Sonne langsam nach Westen. Es wurde Nachmittag, bald würde es Abend sein, und dann würde das Rathaus schließen.
Ich begann auf meinem Stuhl herumzurutschen, fuhr mit dem Finger rastlos über die klebrigen Spuren, die ein paar Tropfen Limonade auf meinem Glas hinterlassen hatten. Die Gedanken, die mir durch den Kopf gingen, waren schwermütiger Natur. Ich erinnerte mich an meinen Vater in den Tagen vor seinem Tod. Er war geschwächt, lag in seinem großen Bett und fiel hin und wieder in einen unruhigen Schlaf. Meine Mutter saß an seiner Seite. Sie weinte und betete, obwohl uns das Beten verboten war.
Nun stellte ich mir voller Grauen vor, wie es wäre, unverrichteter Dinge zu ihr zurückkehren zu müssen.
»Ich glaube es nicht.« Julies Stimme riss mich aus meinen düsteren Gedanken. »Sieh doch.« Sie deutete über den belebten Vorplatz des Hôtel de Ville.
Ich sah junge Männer, Frauen, kleine Kinder und jede Menge Tauben. Dann fiel mein Blick auf zwei Männer, die das Rathaus verließen. Einer war hochgewachsen und breitschultrig, der andere zierlicher, gut gekleidet und mir nur zu bekannt. Sie traten in das warme Licht des frühen Abends.
»Nicolas!«, rief ich. Julie und ich sprangen auf und stürzten aus dem Kaffeehaus. Ich war schneller und erreichte unseren Bruder kurz vor meiner Schwester. Außer Atem fielen wir in seine ausgebreiteten Arme.
Nicolas drückte uns an sich.
»Gott sei Dank«, flüsterte ich und lachte unter Tränen.
»Der Dank gebührt Monsieur Buonaparte«, entgegnete Nicolas und ließ zu, dass wir ihn noch ein wenig länger herzten. Einige Passanten sahen uns interessiert zu. Sicherlich waren ihnen vor dem Rathaus bisher mehr unglückliche als glückliche Menschen begegnet.
»Danke, Joseph Buonaparte.« Julie wandte sich unserem Wohltäter zu. »Wie können wir das jemals gutmachen?«
Buonaparte verneigte sich. Seiner Miene nach schien er sich zu fragen, ob wir allen Ernstes an ihm gezweifelt hatten. Das hatten wir natürlich, aber damit hatten wir ihm Unrecht getan.
»Bist du … frei?«, fragte ich meinen Bruder. Am liebsten hätte ich seine Hand genommen und ihn von dem Rathaus mit seinen Beamten und Wachen in die Sicherheit unseres Elternhauses gezogen.
»Wie du siehst, bin ich es«, antwortete Nicolas.
Ich konnte es noch immer nicht ganz glauben. »Bist du auch nicht mehr in Gefahr?«
Nicolas hob die Schultern. »So weit das in unserem Land möglich ist, nein.«
Wieder umarmte ich ihn. »Nur weil meine kleine Schwester das Herz eines wichtigen Mannes verzaubert hat«, flüsterte er mir ins Ohr, bevor er sich mir entzog und in meine Wange zwickte. Ich spürte, wie ich feuerrot anlief. Nur weil meine kleine Schwester das Herz eines wichtigen Mannes verzaubert hat. Nicolas betrachtete mich amüsiert, Joseph Buonaparte lächelte erwartungsvoll. Ich schaute zur Seite.
Julie rettete mich aus meiner Verlegenheit. »Sie haben mehr getan, als wir zu hoffen wagten«, sagte sie zu Buonaparte. »Aber wir müssen darauf bestehen, uns für Ihr Entgegenkommen erkenntlich zu zeigen.«
»Bitte holen Sie nicht wieder die Geldbörse hervor, Mademoiselle – Bürgerin Clary. Sie würden das Ehrgefühl eines Korsen verletzen.«
»Dann sagen Sie uns, wie wir Ihnen eine Freude machen können«, bat Nicolas.
Buonaparte schürzte die Lippen, betrachtete den Hut in seinen Händen. »Wenn meine Bitte nicht allzu kühn ist, würde es mich freuen, Ihre Schwestern gemeinsam mit Ihnen sicher nach Hause geleiten zu dürfen.«
Nicolas deutete ein Lächeln an und bot Julie seinen Arm an. »Dieses Angebot nehmen wir gern an. Nicht wahr, Désirée?«
Mein Bruder sah mich an. Julie arrangierte ihre Miene auf eine Weise, die ich nicht entschlüsseln konnte, was nur selten der Fall war. Joseph lächelte hoffnungsvoll. Ich legte keinen Wert auf die Aufmerksamkeit dieses Mannes, der so viel älter als ich war und so verwegen. Doch mir war klar, dass wir in seiner Schuld standen, und ich wusste, was mein Bruder von mir erwartete. »Aber selbstverständlich«, sagte ich.
Beschwingt trat Joseph zu mir und reichte mir seinen Arm. Und so machten wir uns zu viert auf den Weg.
Mich hatte noch nie ein Mann nach Hause begleitet. Die einzigen Ausnahmen waren mein Bruder und mein Vater gewesen. Es hatte mir auch bisher niemand den Hof gemacht, immerhin war ich erst sechzehn Jahre alt, und wir lebten in unruhigen Zeiten. Im Übrigen hätten mein Vater und mein Bruder so etwas nie gestattet, und darüber hinaus waren die jungen Männer unseres Standes entweder umgekommen, saßen im Gefängnis oder waren zu sehr mit der Politik beschäftigt, um etwas so Triviales zu tun, wie mit einer Frau poussieren.
Doch nun spazierte ich plötzlich an der Seite eines Mannes, dem ich erst vor wenigen Stunden begegnet war, durch den Abend.
Nicolas hatte Julie ein flottes Tempo vorgegeben, vielleicht um meinem Begleiter und mir ein wenig Abstand zu lassen. Doch behütet und schüchtern, wie ich war, fühlte ich mich an Buonapartes Arm unbehaglich und war froh, dass es zu unserem Haus nicht weit war.
Glücklicherweise redete er die ganze Zeit, sprach über Korsika und Marseille, ohne dass ich antworten musste. »Die Stadt, aus der ich komme, heißt Ajaccio, vielleicht haben Sie einmal von ihr gehört. Sie müssen sie sehen. Eines Tages. Auch dort blickt man auf das Mittelmeer. Nur dass meine Mutter nie Wein und Olivenöl kaufen muss, wir haben dort einen eigenen Weinberg und eigene Olivenbäume.«
An unserer Eingangspforte blieben Nicolas und Julie stehen und warteten auf uns. »Bitte kommen Sie mit hinein«, bat mein Bruder unseren neuen Bekannten. »Ich könnte schwören, dass meine Mutter meinen Befreier kennenlernen möchte.«
Buonaparte schien nichts gegen die Einladung zu haben. »Es wäre mir ein Vergnügen, die Dame kennenzulernen, die zwei so reizende Töchter hervorgebracht hat.«
»Obacht, mein Guter.« Nicolas lächelte liebenswürdig. »Mag sein, dass ich Ihnen mein Leben verdanke, doch ich werde nicht zusehen, wie Sie meinen Schwestern schöne Augen machen.«
»Ich bin Korse!«, antwortete Buonaparte emphatisch. »Korsen nutzen jede Gelegenheit, um einer hübschen Frau zu schmeicheln.« Er lachte tief aus dem Bauch heraus, doch meinen Arm ließ er dabei nicht los.
Die Freude meiner Mutter über Nicolas’ Rückkehr war ebenso übertrieben, wie es sonst ihre Klagen waren. Sie schlang die Arme um ihn und schien ihn nicht mehr freigeben zu wollen. Dann rief sie einen Dienstboten, der Champagner bringen, Kerzen anzünden und die Fenstertüren nach draußen öffnen musste.
Milde Abendluft drang in den Salon. Wir hörten Möwen schreien und Laubfrösche quaken. »Auf Ihr Wohl.« Meine Mutter hob ihr Glas. »Auf den Helden der Familie Clary.« Sie strahlte Buonaparte an, der die Dankesbekundungen meiner Mutter ganz offenkundig genoss.
Ich dagegen hätte am liebsten nur ein Glas Champagner getrunken, einen kleinen Imbiss zu mir genommen und wäre dann mit Julie nach oben in unser Zimmer gegangen, um alles, was an diesem Tag vorgefallen war, mit ihr zu bereden.
Doch meine Mutter wollte sich mit unserem Besucher unterhalten und die Gastgeberin spielen. Sie ließ uns allen nachschenken. »Ihr Akzent ist mir nicht vertraut, Bürger Buonaparte. Sind Sie Italiener?«
»Nicht ganz. Ich bin Korse.«
»Korse.« Meine Mutter legte die Stirn in Falten. »Wie ungewöhnlich. Ich glaube nicht, dass ich jemals einem Korsen begegnet bin.«
»So viele gibt es von uns auch nicht«, antwortete Buonaparte und lächelte gutmütig. Sein Blick wanderte zu mir. »Korsika ist eine kleine Insel, mit Bergen, Wäldern, Weinbergen und Olivenhainen. Aber es ist meine Heimat. Oder war es zumindest.«
»Wahrscheinlich ist die Lage dort ebenso unbeständig wie bei uns, oder?« Meine Mutter ließ die nächste Flasche Champagner bringen.
Ich wurde ungeduldig und wunderte mich über ihre Redseligkeit und ihr Interesse an Korsika. So gut gelaunt wie an diesem Abend hatte ich sie seit einer ganzen Weile nicht mehr erlebt, nicht seit Vaters Tod oder noch länger, seit dem Beginn der Revolution. Ich nahm an, dass sie nach den Monaten, in denen sie gedacht hatte, unser Wohlstand und unser Ansinnen, adlig zu werden, könnten unseren Untergang bedeuten, in Buonaparte nun einen Beschützer sah und vor Erleichterung überschäumte. Sicherlich war sie auch entschlossen, dafür zu sorgen, dass er uns gewogen blieb.
»Sie sind nicht nur so schön wie Ihre Töchter, Madame, sondern auch gut informiert«, antwortete Buonaparte. »Die Lage in Korsika ist tatsächlich ausgesprochen heikel. Zudem fürchte ich, dass meine Familie sich in der Politik auf die falsche Seite geschlagen hat. Daher leben einige von uns nun im Exil, und Frankreich ist unsere neue Heimat.« Den letzten Teil betonte er, als müsse er es sich selbst noch einreden.
Meine Mutter leerte ihr zweites Glas. »Wie dem auch sei, Monsieur Buonaparte.« Ihre Stimme war voller Wärme. »Korsikas Verlust ist unser Gewinn. Sie haben meinen Sohn gerettet und müssen uns gestatten, dass wir Ihnen unseren Dank erweisen.«
Buonaparte zog die Brauen hoch. »Warum ist es Ihnen allen so wichtig, Ihre Dankbarkeit unter Beweis zu stellen? Gibt es in Frankreich niemanden mehr, der etwas Gutes tut, ohne eine Gegenleistung zu erwarten?«
Meine Mutter hob die Schultern. »Wir sind Kaufleute. Bitte sehen Sie es uns nach, wenn wir Wert auf ausgeglichene Konten legen.«
»Nun, in dem Fall gibt es etwas«, antwortete Buonaparte und eine leise Röte stieg ihm ins Gesicht.
»Nennen Sie es«, sagte meine Mutter und lächelte aufmunternd.
Buonaparte holte tief Luft. »Wenn es Ihnen recht ist, würde ich Ihrer Tochter Désirée gern des Öfteren meine Aufwartung machen.«
Stille breitete sich aus. Julie verlagerte ihr Gewicht. Meine Mutter richtete ihren Blick auf mich und betrachtete mich perplex. Das war eindeutig nicht das, was sie erwartet hatte. Doch dann veränderte sich ihre Miene. Maman hatte das Vorteilhafte der Bitte erfasst. »Natürlich müssen Sie wiederkommen.« Sie lächelte entzückt. »Wir bestehen darauf.«
»Grazie. Wie wäre es mit morgen, vielleicht gegen – « Buonaparte brach ab. Draußen waren Rufe laut geworden. Unsere Salontüren öffneten sich zum Garten, die Rufe schienen aus der Gasse hinter der Gartenmauer zu kommen. »Wo steckst du, bastardo?«
Wir konnten nur wenig Italienisch, doch das Wort »bastardo« hatten wir verstanden.
»Gute Güte.« Meine Mutter war blass geworden. »Wie unangenehm«, sagte sie betreten. »Normalerweise bleiben wir in dieser Gegend von den Auswüchsen des Pöbels verschont. Vielleicht ist es ein Student, der ein Glas über den Durst getrunken hat.«
»Ich weiß, dass du da drinnen bist, du Hurensohn!«
»Um Himmels willen.« Meine Mutter schaute mich entsetzt an. »Désirée, bitte schließ die Türen. Nicolas, sieh zu, dass einer der Dienstboten die Gendarmen verständigt. Wir können es nicht dulden, dass ein Betrunkener in unserer Gegend Obszönitäten brüllt.«
Ich machte Anstalten aufzustehen, doch Buonaparte hielt mich fest. »Bitte, warten Sie.« Dann trat er auf unsere Terrasse hinaus, formte mit den Händen ein Sprachrohr an seinem Mund und rief: »Halt die Klappe, bastardo, sonst drehe ich dir den Hals um.«
Meine Mutter rang um Luft. Nicolas runzelte die Stirn. Julie und ich sahen uns mit großen Augen an. Ich musste lachen und presste eine Hand auf meinen Mund.
Buonaparte kehrte zurück und schüttelte den Kopf. »Denkt der Idiot, ich kann weniger gut fluchen als er?«
Wir gaben ihm keine Antwort. Meine Mutter wirkte benommen.
Buonaparte lachte. »Kein Grund zur Sorge, das ist nur mein Bruder.«
»Ihr … Bruder?«, wiederholte meine Mutter verdattert.
»Ja.« Buonaparte griff nach seinem Hut und schien nicht zu merken, wie schockiert wir waren. »Wir nennen ihn nicht umsonst ›Rabulione‹.«
Nicolas konnte von uns allen noch am besten Italienisch und fragte: »Rabulione, bedeutet das nicht so etwas wie ›Radaubruder‹?«
»Richtig«, antwortete Buonaparte zufrieden. »Das war er von jeher.«
»Nun dann.« Meine Mutter signalisierte Nicolas mit ihrem Blick, unseren Gast zu verabschieden.
»Radaubruder«, sagte ich und kniff die Lippen zusammen, um angesichts der gepeinigten Miene meiner Mutter nicht loszuprusten. Was für ein eigentümlicher Tag das war. »Und wie lautet sein richtiger Name?« Der Mann, der über die Mauern des herrschaftlichen Hauses fremder Menschen hinweg seinen Bruder beleidigte, den er drinnen vermutete, hatte mich neugierig gemacht.
Buonaparte war bereits an der Tür. »Er heißt Napoleone«, antwortete er. »Bis morgen, die Damen.«
Meine Mutter bedankte sich erneut bei ihm, doch auf ihre Einladung für den morgigen Tag kam sie nicht mehr zurück.
Ich trat an die geöffneten Terrassentüren und spähte hinaus. In der Dunkelheit konnte ich hinter unserer Gartenpforte ganz schwach den Umriss einer einsamen Gestalt ausmachen.
Was hatte Buonaparte gesagt, wie der Name seines Bruders lautete? Napoleone? Diesen Namen hatte ich noch nie gehört. Aber vielleicht passte der ungewöhnliche Name zu einem Mann, der sich so ungewöhnlich benahm.
Kapitel 3
Marseille, 1794
Die Brüder Buonaparte sollten ein fester Bestandteil unseres Lebens werden.
Joseph erschien am nächsten Morgen – zu einer früheren Uhrzeit, als wir erwartet hatten –, und er war nicht allein.
Maman, Julie und ich saßen noch beim Frühstück auf der sonnigen Terrasse, als einer unserer Dienstboten mit leicht irritierter Miene den Besuch der Herren Joseph und Napoleone Buonaparte meldete. Glücklicherweise waren wir bereits für den Tag gekleidet.
Meine Mutter seufzte. »Führen Sie die Herren zu uns.« Als wir allein waren, fügte sie leise hinzu: »Ich wünschte, er wäre ohne diesen fürchterlichen Bruder gekommen. Trotzdem werden wir äußerst charmant sein. Irgendwie scheint dieser Joseph Buonaparte so einflussreich zu sein, dass er uns schützen kann. Deshalb dürfen wir uns seine Gunst auf keinen Fall verscherzen.«
Gleich darauf waren die Buonapartes auf der Terrasse. Meine Schwester und ich standen auf und begrüßten sie. Zu meiner Verwunderung lächelte Julie Joseph auffallend herzlich an, was eigentlich nicht ihre Art war. Mich interessierte der jüngere Bruder mehr – dieser Napoleone, der den Beinamen Rabulione trug.
»Bitte, nehmen Sie doch Platz.« Meine Mutter deutete auf die freien Stühle am Tisch.
»Mit Vergnügen«, antwortete Joseph. »Ich freue mich, dass Sie nach den gestrigen Ereignissen so wohl aussehen. Schöner als die Sonne an diesem Morgen.« Er legte seinen Hut ab, an dem die Kokarde steckte, ebenso wie an dem Dreispitz seines Bruders.
So unauffällig wie möglich verglich ich die beiden Männer miteinander und stellte fest, dass sie sich äußerlich überhaupt nicht ähnelten, wahrscheinlich auch nicht in ihrem Wesen. Joseph war ein kräftiger Mann, mit breitem offenem Gesicht und strahlendem Lächeln. Napoleone wirkte weniger ungezwungen, auch schienen ihm Josephs geschmeidige Gesten zu fehlen, und von seiner Statur her war er eher schmächtig. Regelrecht steif wirkte er in seiner Offiziersuniform mit dem hohen roten Kragen und den glänzenden Messingknöpfen. Sein Haar war ebenso dunkel wie das seines Bruders, doch es reichte bis zu seinen Schultern und machte einen ungepflegten Eindruck. Seine schmale, gebogene Nase verlieh ihm etwas Römisches, die dunkelgrünen Augen blickten stur geradeaus, sein Gesichtsausdruck war mürrisch.
Ich wusste nicht, wie alt die beiden Buonapartes waren, doch mir schien, dass Joseph der Ältere war. Dennoch hatte ich den Eindruck, dass der jüngere Bruder tonangebend war. Er setzte sich zuerst, danach erst ließ Joseph sich nieder.
Ich betupfte meinen Mund mit meiner Serviette und schämte mich, wie es vor mir auf dem Tisch aussah. Wie würde dieser Anblick auf unsere Besucher wirken? Auf dem Kaffee in meiner Schale schwammen Fettaugen, weil ich meine gebutterten Scheiben Baguette eingetunkt hatte. Auf meinem Teller lagen Reste des aufgeweichten Brots. Es sah kindlich aus und schlampig, ganz anders als die makellose Uniform, die Napoleone trug.
Meine Mutter wies auf die Zutaten unseres Frühstücks. »Dürfen wir Ihnen Kaffee anbieten? Eine Brioche, ein Stück Kuchen?«
Napoleone gab eine Art Grunzen von sich, nahm sich eine Brioche mit der Hand und biss hinein. Es war schwer zu sagen, ob er sich absichtlich schlecht benahm oder es nicht besser wusste. »Danke, Bürgerin«, murmelte er mit vollem Mund.
»Gern geschehen«, entgegnete meine Mutter mit kaum verhohlenem Abscheu. Ein gut erzogener Mensch stopfte sein Essen nicht in sich hinein, wenn Fremde oder sogar Damen zugegen waren, nahm sich auch nicht einfach etwas mit der Hand und sprach erst recht nicht mit vollem Mund.
Ich musste mir ein Lächeln verbeißen. Napoleone hob den Kopf und sah mich an. Der Blick seiner grünen Augen war so intensiv und besaß eine derart magische Anziehungskraft, dass ich nervös schluckte und keinen Bissen mehr hinunterbrachte.
»Sie haben meinen Bruder gestern Abend nicht kennengelernt«, sagte Joseph. »Nur seine blumige Art, sich auszudrücken.«
»In der Tat«, antwortete meine Mutter spitz.
Napoleone schien sein Verhalten vom Vorabend einerlei zu sein, er entschuldigte sich nicht. Stattdessen deutete er mit dem Kinn auf mich und sagte: »Ich freue mich, Sie kennenzulernen.« Die Freude war weder seiner Miene noch seinem Ton anzumerken. Doch als sich unsere Blicke trafen, begann mein Herz schneller zu schlagen.
»Was für einen seltsamen Namen Sie haben«, bemerkte meine Mutter hölzern. Offenbar war sie nicht gesinnt, die Dankbarkeit und das Entgegenkommen, die sie Joseph am Vortag gezeigt hatte, auf seinen Bruder zu übertragen. »Napoleone. Ist das ein korsischer Name?«
»Italienisch.« Seine Stimme war einzigartig, weicher als die seines Bruders und mit einem seidigen Schmelz. »Aus dem Land Machiavellis. Kennen Sie seine Schriften?«
»Natürlich kenne ich die. Ich erinnere mich an seine Aussage, dass der Zweck die Mittel heilige«, erwiderte meine Mutter pikiert.
»Das war nur eine seiner vielen Aussagen.« Napoleone löste seinen Blick von mir und blickte meine Mutter an. »Stimmen Sie mit ihm überein?«
Maman zog die Brauen zusammen. »Worin?«
»Sind Sie der Auffassung, dass das Wohl eines Staates jede Tat des Herrschers rechtfertigt, ganz gleich wie rücksichtslos sie in jeder anderen Hinsicht ist?«