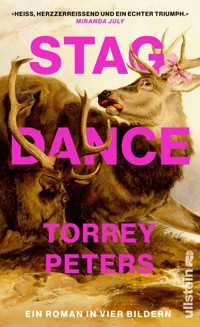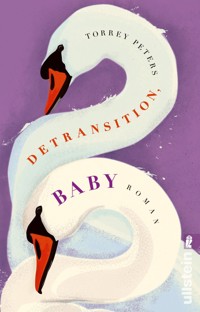
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Einer der gefeiertsten Romane des Jahres.« Time Reese und Amy sind ein glückliches Paar, zwei trans Frauen in New York, mit dem Traum von einer Familie. Doch dann entscheidet sich Amy, wieder als Mann zu leben, und die Liebe zerbricht. Als drei Jahre später Amesʻ Chefin Katrina unerwartet von ihm schwanger wird, fasst Ames einen Plan: Warum ziehen sie das Kind nicht gemeinsam groß, zu dritt? »Detransition, Baby stellt unsere Vorstellungen von Familie auf den Kopf.« The New York Times »So gut, dass ich schreien möchte!« Carmen Maria Machado
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Sammlungen
Ähnliche
Detransition, Baby
Die Autorin
Torrey Peters, aufgewachsen in Chicago, hat die Erzählungen Infect Your Friends and Loved Ones und The Masker veröffentlicht. Sie studierte kreatives Schreiben und Literaturwissenschaften. Detransition, Baby, ihr Debütroman, wurde 2021 für den Women’s Prize for Fiction nominiert – als das erste Buch einer trans Autorin in der Geschichte des Preises. Torrey Peters fährt ein pinkfarbenes Motorrad und lebt wechselweise in Brooklyn und einer Hütte in Vermont.www.torreypeters.comNicole Seifert ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und arbeitet als Übersetzerin aus dem Englischen sowie als Autorin. Zuletzt erschien ihr Buch Frauen Literatur: Abgewertet, vergessen, wiederentdeckt.Frank Sievers, Jahrgang 1974, lebt als Übersetzer und Autor in Berlin. Er arbeitet regelmäßig für die Reihe Naturkunden bei Matthes & Seitz und übersetzt Romane und Sachbücher. 2017 erhielt er mit Andreas Jandl den Christoph-Martin-Wieland-Übersetzerpreis.
Das Buch
Reese und Amy sind ein glückliches Paar, zwei trans Frauen in New York, mit dem Traum von einer Familie. Doch dann entscheidet sich Amy, wieder als Mann zu leben, und die Liebe zerbricht. Als drei Jahre später Ames’ Chefin Katrina unerwartet von ihm schwanger wird, fasst Ames einen Plan: Warum ziehen sie das Kind nicht gemeinsam groß, zu dritt?
Torrey Peters
Detransition, Baby
Roman
Aus dem Englischen von Frank Sievers und Nicole Seifert
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem TitelDetransition, Baby im Verlag One World, einem Imprintvon Penguin Random House LLC, New York.Die Arbeit der Übersetzer*innen am vorliegenden Text wurde vom Deutschen Übersetzerfonds gefördert.Die Übersetzer*innen bedanken sich sehr herzlich bei Jan Schönherr für die Hilfe und Übersetzungsideen bei den Baseball-Passagen.Der Verlag bedankt sich sehr herzlich bei Linus Giese für sein Sensitivity Reading.© 2021 by Torrey Peters© der deutschsprachigen Ausgabe2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAutorenfoto: © Natasha GornikE-Book-Konvertierung powered by pepyrusAlle Rechte vorbehalten.ISBN 978-3-8437-2678-8
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Danksagung
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Erstes Kapitel
Erstes Kapitel
Einen Monat nach der Zeugung
Für Reese war die Frage: Zogen verheiratete Männer sie magisch an? Oder waren in dem Pool von Männern, die für sie als trans Frau verfügbar waren, einfach nur Typen, die sich schon eine cis Frau gesichert hatten und jetzt »experimentieren« wollten? Die bequeme Antwort, für die alle ihre Freundinnen plädierten, hieß: Männer sind Tiere. Nur war Reese jetzt schon wieder mit so einem blendend aussehenden, charmanten, fremdgehenden Arschloch zugange. Da sitzt sie im schwarzen Spitzenkleid in seinem BMW und wartet auf ihn, während er im Duane Reade Kondome holt. Gleich wird sie ihn mit in ihre Wohnung nehmen, dem stechenden Blick ihrer Mitbewohnerin Iris ausweichen und sich auf der banalen Blümchendecke von ihm vögeln lassen, die ihr der letzte verheiratete Typ geschenkt hat, damit ihr Zimmer ein bisschen mädchenhafter und unanständiger wirkt, wenn er sich von seiner Frau wegschleicht.
Reese hatte ihr eigenes Problem längst erkannt. Sie konnte nicht allein sein. Sie floh vor ihrer eigenen Gesellschaft, vor der Einsamkeit. Ihre Freundinnen erzählten ihr nicht nur, wie furchtbar fremdgehende Männer sind, sondern auch, dass sie nach zwei krassen Trennungen Zeit braucht, um zu sich zu finden und zu lernen, mit sich allein zu sein. Aber sie hatte kein Maß fürs Alleinsein. Gab man ihr eine Woche für sich, igelte sie sich ein und schüttete einen exponentiell anwachsenden Ascheberg aus Einsamkeit auf, bis sie davon träumte, alles zu verkaufen und mit einem Boot ins Nirgendwo zu treiben. Um sich wieder ins Leben zu katapultieren, ging sie auf Grindr oder Tinder oder was auch immer – und schickte zehntausend Volt durch ihr Herz, wenn sie der Affäre nachjagte, die ihr das dramatischste Herzrasen versprach. Mit verheirateten Männern ließ sich die Einsamkeit am besten vertreiben, denn verheiratete Männer konnten selbst nicht allein sein. Verheiratete Männer waren Experten im Zusammensein, im Nicht-Loslassen, komme, was da wolle, bis dass der Tod uns scheide. Unter dem Vorwand, sie habe »nur eine Affäre«, machte Reese einen tiefen, harten Schwalbensprung. Sie redete sich ein, es wäre nur was Kurzes, was ihr erlaubte, jeden Fetisch auszuleben, von dem der Typ träumte, um jede seiner geheimen Wunden freizulegen, sich selbst auf die geilste, verruchteste, unverantwortlichste Art zu erniedrigen – und dann in Bitterkeit zu verfallen, weil es nur was Kurzes gewesen war. Weil – war sie nicht mutig und verletzlich genug gewesen, um so tief und hart zu tauchen?
Sie hielt sich selbst für attraktiv, volles Gesicht, üppige Figur, aber ihr war klar, dass sie keine Auffahrunfälle verursachte. Und dass die Leute ständig mit offenem Mund um sie herumstanden und die Auswüchse ihrer Intelligenz bewunderten, war ihr auch noch nicht aufgefallen. Doch mit dem richtigen Mann hatte sie Talent fürs Drama. Und wenn ihr die Einsamkeit kalt in den Knochen saß, konnte sie es destillieren und abfackeln wie Kerosin.
Der aktuelle Mann ähnelte den vorigen. Ein attraktives, verheiratetes Alphatier, das sie im Schlafzimmer an der Leine hielt. Nur war es diesmal noch besser, denn es war ein HIV-positiver ehemaliger Cowboy, jetzt Anwalt. Er stand auf trans Frauen und war serokonvertiert, als er seine Gattin mit einer trans Frau betrog, und seine Gattin war bei ihm geblieben und jetzt betrog er sie wieder, und zwar mit Reese. Raaah!
»Warst du etwa Bottom?«, hatte Reese ihn beim ersten Date gefragt.
»Scheiße, nein«, sagte er. »Mein Arzt meint, das Risiko, sich bei einem Blowjob zu infizieren, liegt bei eins zu zehntausend. Und wenn man mal davon ausgeht, dass es pro Minute zehntausend Blowjobs gibt, dann war der eine von den zehntausend halt ich. Aber sie hat mir auch echt oft einen geblasen.«
»Cool«, sagte Reese, die wusste, dass diese Erklärung nicht den Tatsachen entsprach, aber tat, als würde sie es glauben, allein schon, damit er bei ihr nicht versuchte, Bottom zu sein. Innerhalb einer Stunde hatte sie ihn in ihrem Zimmer und hörte seine Beichte, wo und bei wem er sich wirklich angesteckt hatte. Innerhalb von zwei Stunden brachte Reese ihn dazu, ihr von seiner enttäuschten Frau zu erzählen, die sich von ihm kein Kind machen lassen wollte, obwohl das Virus kaum noch nachweisbar war. Er erzählte, wie abscheulich seine Frau die In-vitro-Behandlung fand und dass sie das klinische Prozedere jedes Mal daran erinnerte, was er getan hatte, und warum sie jetzt auf einem kalten Behandlungstisch lag anstatt im warmen Ehebett.
»Ich bin bei dir viel offener als sonst«, sagte ihr Cowboy überrascht und knetete weiter ihre Brüste. »Die Macht der Möse, vermutlich.«
»Vielleicht kriegst du meine Möse«, ahmte sie seine gedehnte Cowboy-Melodie nach, »aber eine gute Frau häutet deine Seele.«
»Ist das so«, sagte er noch gedehnter. Er legte ihr seine große Pranke in den Nacken und zog ihr Gesicht näher an seins. Sie seufzte, ihr Körper erschlaffte.
Mit glasigen Augen begegnete sie seinem Blick.
»Pass mal auf«, meinte er, »ich nehm mir jetzt deine Möse vor …« Er hielt kurz inne und drückte ihr Gesicht langsam und bestimmt ins Kissen. »Und um meine Seele kümmern wir uns später.«
Jetzt schwingt er sich mit der kleinen braunen Tüte mit Gleitmittel und Kondomen ins Auto, und Reeses Bauch durchzuckt kitzelnde Vorfreude. »Brauchen wir die wirklich?«, fragt er und hält die Tüte hoch. »Eigentlich will ich dich ja schwängern.«
Genau deshalb hielt sie es immer noch mit ihm aus. Er hatte es kapiert. Mit ihm hatte sie Sex entdeckt, der wirklich gefährlich war. Cis Frauen mussten doch bei jedem Sex vor der Gefahr erschaudern. Das Risiko, der Nervenkitzel, schwanger zu werden – sich mit einer einzigen Nummer das ganze Leben zu versauen (oder zu vergolden?). Für cis Frauen, vermutete Reese, war Sex, als würde man auf einer Klippe spielen. Vor ihrem Cowboy hatte sie dieses spezielle Vergnügen noch mit keinem gehabt. Erst durch seine HIV-Infektion hatte sie eine vergleichbar lebensverändernde Gefahr erlebt. Ihr Cowboy konnte sie mit einem Schuss zeichnen. Ihrem Leben ein Ende machen. Sein Schwanz konnte sie auslöschen.
Er hatte ihr gesagt, dass bei ihm keine Viruslast mehr nachweisbar war, sie hatte es aber nie schwarz auf weiß sehen wollen. Das hätte die süße Gefahr gekillt. Er spielte auch gern nah an der Klippe, drängte darauf, sie zu schwängern, mit seinem viralen Samen zu befruchten. Sie zur Mama zu machen, ihren Körper zur Wirtin neuen Lebens, Teil von ihr und kein Teil, die ewige Mutter.
»Wir haben gesagt, nur mit Kondom. Du hast gesagt, du willst mich nicht auf dem Gewissen haben«, sagte sie.
»Ja, aber das war, bevor du die Pille genommen hast.«
So hatte sie am Anfang ihre PrEP genannt, in einem chinesischen Restaurant in Sunset Park, wo er sicher war, dass er den Freundinnen seiner Frau nicht in die Arme lief. Sie hatte es einfach so gesagt, als Witz, aber er sah sie an und sagte: »Fuck, jetzt habe ich einen Ständer.« Er fragte nach der Rechnung, sagte, dass sie heute Abend nicht mehr ins Kino käme, und fuhr sie zu ihrer Wohnung, wo er sie mit dem Gesicht in ihre Blümchendecke drückte. Am nächsten Morgen schickte sie ihm eine der sexysten und sexfreiesten Nachrichten ihres Lebens – ein kurzes Video, auf dem sie ein paar große blaue Truvada-Pillen in eine unverkennbare pastellfarbene Antibabypillen-Packung legt. Von da an gehörte »ihre Pille« zu ihrem Sexleben.
Neben dem Stigma, dem Tabu und der erotisierenden Wirkung hatte diese Sonder-Pozzen-Behandlung für Reese noch einen weiteren Reiz: Sie wollte wirklich gern Mama werden. Sie wollte es sogar unbedingt. Obwohl sie ihr gesamtes Erwachsenenleben mit queeren Menschen verbracht, ihre radikalen Beziehungen, Geschlechterrollen und Polyamorie in sich aufgesogen hatte, hatte sie die netten weißen Wisconsin-Muttis ihrer Kindheit im Grunde nie vom Gipfel der Weiblichkeit gestoßen. Sich nie von dem heimlichen Wunsch verabschiedet, eine von ihnen zu werden. Als Mutter, stellte sie sich vor, wäre sie befreit von ihrer Einsamkeit und Bedürftigkeit, denn als Mutter war man nie wirklich allein. Auch wenn sie und ihre trans Freund*innen die Erfahrung gemacht hatten, dass bedingungslose elterliche Liebe am Ende doch immer Bedingungen stellte.
Vielleicht genauso wichtig: Als Mutter würde ihr endlich die Weiblichkeit gewährt, die die Göttinnen ihrer Kindheit als ihr natürliches Recht ansahen. Einmal war sie schon kurz davor gewesen. Das war in einer lesbischen Beziehung mit einer trans Frau. Amy hatte einen guten Job in der Tech-Branche und war so vorortmäßig vorzeigbar, dass man ihre Worte, wenn sie redete, in Martha Stewarts Vintage-Schrift vor sich sah. Ein Leben, das häuslicher war, als Reese es mit Amy geführt hatte, war für eine trans Frau kaum denkbar – das Vertrauen und die Langeweile und die Stabilität waren jedoch inzwischen verblasst wie ein Traum nach dem Aufwachen. Sie hatten sogar eine gemeinsame Wohnung am Prospect Park gehabt, helle, luftige Räume, die so viel guten Geschmack und unerschütterliche Seriosität ausstrahlten, dass es eine der kleineren Hürden auf dem Weg zur Mutterschaft gewesen wäre, sie einer Adoptionsvermittlung vorzuführen.
Doch jetzt, drei Jahre später, bei Kilometerstand Mitte dreißig, dachte Reese allmählich über das Sex and the City-Problem nach, wie sie es nannte.
Das Sex and the City-Problem war nicht nur ihr Problem, sondern das Problem aller Frauen. Nur hatte es bisher im Gegensatz zu Millionen von cis Frauen noch keine Generation von trans Frauen gelöst. Das Problem ließ sich wie folgt beschreiben: Wenn eine Frau merkt, dass sie älter wird, wird das Bedürfnis, ihrem Leben einen Sinn abzugewinnen, immer dringender. Es ist das Bedürfnis nach Rettung, durch andere oder sich selbst, während die Freuden von Jugend und Schönheit immer weniger Wirkung zeigen. Doch auf der Suche nach Sinn gab es für Frauen – trotz aller Fortschritte durch den Feminismus – im Grunde nur vier Möglichkeiten, wie Reese meinte, nämlich die vier Handlungsbögen der Protagonistinnen von Sex and the City. Einen Partner suchen und eine Charlotte sein. Karriere machen und eine Samantha sein. Ein Baby bekommen und eine Miranda sein. Oder sich durch Kunst oder durchs Schreiben verwirklichen und eine Carrie sein. Jede Frauengeneration erfand diese Formel neu, glaubte Reese, mischte sie neu und bog sie sich zurecht, ohne ihr jemals zu entkommen.
Allerdings war das Sex and the City-Problem für jede Generation von trans Frauen vor Reese noch ein Luxusproblem gewesen. Nur die allerwenigsten, am besten getarnten, erfolgreichsten trans Frauen hatten überhaupt die Chance, sich damit auseinanderzusetzen. Allen anderen waren diese vier Möglichkeiten von Anfang an verwehrt. Keine Karriere, kein Lover, kein Baby, und eine trans Frau konnte zwar Muse sein, aber niemanden interessierte die Kunst, mit der sie für sich selbst sprach. Also zogen sich die trans Frauen in eine Art No-Future-Haltung zurück. Während andere Queers die Ironie, die Lebensfreude und die Gräber zelebrierten, in die sie so gern stürzten, fanden trans Frauen es glamouröser, die zurückbleibende Leiche als wilde bewusste Wahl darzustellen und nicht als statistische Wahrscheinlichkeit.
Als Reese mit Amy zusammen war, beschäftigte auch sie das Sex and the City-Problem. Es kam ihr radikal vor, als trans Frau in Fantasien zu schwelgen, wie bürgerlich sie werden könnte. Es fühlte sich wie ein Erfolg an, dass die Entscheidung nicht für sie getroffen wurde. Dann kam Amys Detransition, und alles fiel in sich zusammen.
Jetzt war wieder No Future. Also zog Reese ihr Glück aus den Erfolgen anderer Frauen und machte aus einem Virus ein Baby.
»Na gut«, sagt sie, nachdem sie etwa zehn Minuten gefahren sind.
»Na gut, was?«
»Na gut. Schauen wir mal, ob du mich schwängern kannst.«
»Im Ernst?«
»Ja.« Ihr Cowboy will etwas sagen, aber sie fällt ihm ins Wort. »Nur, wenn wir das machen, musst du mich ab jetzt besser behandeln. Du musst mich behandeln wie die Mutter deines Kindes.«
Er streckt den Arm aus und kneift sie in die Seite. »Die Mutter meines Kindes? Also komm … Das willst du gar nicht. Wenn ich dir eine Kaulquappe einpflanze, dann willst du die geschwängerte Sechzehnjährige aus dem miesen Viertel sein. Dann sollen alle wissen, dass du eine Schlampe bist.«
Sie windet sich aus seinem Griff. »Ich meine es ernst. Behandel mich besser.«
Er kneift die Augen zusammen, blickt aber weiter auf die Straße. »Mhm. Okay. Mach ich. Komm, wir essen was«, sagt er und bremst an einer roten Ampel.
»Echt?« Sie fahren gerade durch Greenpoint, wo sie wohnte und er so viele Leute kannte, dass er in der Gegend meist nichts mit ihr essen wollte. Einmal hatte sie ihn gezwungen, in das vegane Bistro nebenan zu gehen, und er hatte sie kaum angeschaut. Stattdessen zuckte sein Blick jedes Mal zur Tür, wenn irgendwer reinkam. Danach ließ sie sich von ihm in den Süden fahren und manchmal auch nach Queens. Nie Manhattan, nie Williamsburg, wo seine Frau ihr soziales Umfeld hatte.
Aber kaum sagt sie, dass er sie ohne Kondom vögeln kann, vergisst er alle seine Regeln. Wie befriedigend sich das für Reese anfühlt. Ihr Körper ist und bleibt ihr ultimativer Trumpf.
»Mhm, vielleicht gehst du irgendwo rein und holst uns was zum Mitnehmen.«
Natürlich. Was zum Mitnehmen. Während er im Wagen wartet. Sie nickt.
»Klar. Was willst du?«
Im Thai-Restaurant bestellt sie für sich selbst nichts. Er liebt Currys, und zwar so scharf, dass sie nach der Scoville-Skala kaum noch genießbar sind. Sie nicht. Sie macht sich dann später zu Hause was, wenn er wieder weg ist. Als sie gerade durch Instagram scrollt, klingelt ihr Handy, eine Nummer, die sie nicht kennt, irgendeine unbekannte Vorwahl. Ihr Cowboy benutzt Google Voice, damit ihre Nachrichten nicht zu Hause auf dem iPad auftauchen, das sich seine Frau manchmal leiht, und Google leitet die Anrufe oft über seltsame Nummern.
Sie drückt auf die grüne Taste und hält sich das Handy ans Ohr. »Ich habe für dich grünes Curry mit Rind bestellt, Fünf-Sterne-Schärfe«, sagt sie, statt sich zu melden.
»Hey, das ist nett von dir, aber was Schärfe angeht, war ich immer ein ziemliches Weichei, falls du dich erinnerst.« Eine Männerstimme. Warm und sanft, aber nicht dieses Gedehnte, das sich ihr Cowboy auch nach all den Jahren in New York bewahrt hat.
Sie hält das Handy vor sich, prüft die Nummer. »Wer ist da?«
Der Tonfall des Mannes verändert sich, wird eher herausfordernd als entschuldigend. »Reese. Hi. Sorry, ich bin’s, Ames.«
Draußen im Wagen kann sie ihren Cowboy sehen, der Schein seines Handys beleuchtet die Brille, die er nur zum Lesen trägt. Sie wendet sich ab, als könnte er sie durch die Glasfenster des Wagens und die Glasscheiben des Restaurants, über das Scheppern aus der Küche und die Gespräche der verschiedenen Gäste hinweg hören.
»Warum rufst du an, Ames? Ich dachte, wir reden nicht mehr miteinander.«
»Ich weiß.«
Sie wartet, presst die Lippen zusammen. Sie kann ihn atmen hören. Sie will ihn dazu bringen, als Erster zu reden.
»Ich will dich nicht stören«, fährt er fort. »Ich hatte auf deine Hilfe gehofft.«
»Meine Hilfe? Hast du dir nicht schon alles genommen, was es bei mir zu holen gibt?«
Er schweigt. »Ob ich mir …?« Er klingt aufrichtig erstaunt. Genau das war sein Problem. Dass er nicht begriff, was sie seinetwegen verloren hatte. »Vielleicht hab ich das verdient. Aber deshalb rufe ich nicht an, ehrlich. Eher im Gegenteil.«
»Ich habe grade ein Date. Ich warte beim Thai aufs Essen.« Das zu sagen ist rachsüchtig, das weiß sie. Aber sie kann nicht anders. Er hat sie abserviert, und dafür will sie sich revanchieren. Außerdem soll er sehen, dass ihr Leben weitergegangen ist.
»Ich kann auch später noch mal anrufen?«
»Nein, du hast Zeit, bis mein Essen kommt.«
»Sieht uns da jetzt irgendein Typ zu?«
»Ich hole was zum Mitnehmen. Er wartet im Auto.« Ein befriedigendes Sirren in Reeses Brust. Wie auch immer Ames sich dieses Gespräch vorgestellt hat, sie hat es an sich gerissen.
»Okay«, sagt er. »Ich hatte gehofft, die Sache ausführlich erklären zu können, aber dann machen wir es so, wie du willst. Weißt du noch, dass du immer ein Baby mit mir haben wolltest? Dass das unser Plan war?«
Irgendwas stimmt nicht mit ihm, wenn er sie deswegen anruft. Er tut anderen nicht aus Spaß weh, und er muss wissen, dass ihr die Frage wehtut, noch dazu so brutal direkt. Sie kommt sich dumm vor, weil sie gesagt hat, dass sie ein Date hat.
»Wünschst du dir das immer noch? Ein Baby, meine ich?« Seine Frage endet in einem hohen Ton, als hätte er Angst vor seiner eigenen Dreistigkeit.
»Was soll der Scheiß, natürlich will ich immer noch ein Baby«, blafft sie.
»Das ist schön, Reese«, sagt er. Er klingt erleichtert. Sie kennt ihn so gut, dass sie geradezu vor sich sieht, wie sich sein Körper entspannt. »Es ist nämlich was passiert. Und du bist irgendwie trotz allem noch der einzige Mensch, mit dem ich darüber sprechen kann. Nach allem, was zwischen uns war, kann ich dich bitte sehen, bitte? Ich muss mit dir reden.«
»Du musst mir schon mehr erzählen, Ames.«
Er atmet aus. »Na gut. Ich habe eine Frau geschwängert. Ich bekomme ein Baby.«
Reese kann es nicht fassen. Sie kann nicht glauben, dass Ames sie anruft, um ihr zu sagen, dass er das bekommt, was sie so verzweifelt wollte. Sie schließt die Augen, zählt bis fünf.
Die Kellnerin lässt eine braune Tüte auf die Theke plumpsen und bedeutet ihr, dass das ihre Bestellung ist. Aber Reese beachtet sie nicht. Ihr Cowboy, sein Fünf-Sterne-Curry, die Antibabypille, die er ihr später geben wird – alles weg. Amy hat irgendwie, irgendwo das Unmögliche geschafft: Sie ist an ein Baby gekommen.
Katrina sitzt vor Ames’ Schreibtisch auf dem Stuhl mit den Rollen. Eine ungewohnte Umkehrung der Situation. Da sie seine Chefin ist, geht Ames praktisch immer zu ihr ins Büro und sitzt vor ihrem Schreibtisch. Ihr Büro ist doppelt so groß wie seins, dem Platz entsprechend, den sie beide in der Firmenhierarchie einnehmen, mit zwei großen Fenstern, durch die sie auf zwei Nachbargebäude schaut, und dazwischen ein Streifen East River. Ames’ Büro hat ein Fenster mit Blick auf einen kleinen Parkplatz. Einmal sah er in der Dämmerung ein braunes Tier schemenhaft übers Pflaster trotten – seitdem besteht er darauf, dass es ein Kojote war. Jeder nimmt die Aufregung, die er kriegen kann.
Katrina durchwühlt eine Aktentasche, holt eine Mappe heraus und lässt sie auf den Schreibtisch fallen. Dass sie in sein Büro gekommen ist, macht ihn nervös. Er fühlt sich wie ein Jugendlicher, zu dem gerade die Eltern ins Zimmer kommen.
»Also«, sagt sie. »Es ist da. Es ist real.« Er greift nach der Mappe. Er hat eine gute Körperhaltung und lächelt sie unbekümmert an. In der Mappe sind Ausdrucke von einem Online-Patientenportal.
»Meine Gynäkologin …«, sagt Katrina und mustert ihn, » … hat noch einen Bluttest und eine Beckenuntersuchung gemacht. Das hat die Testergebnisse von zu Hause bestätigt. Ohne Ultraschall kann sie aber nicht sagen, wie weit ich bin, deshalb haben wir für übernächsten Donnerstag einen Termin ausgemacht. Mir ist klar, dass du noch nicht so genau weißt, wie du das findest, aber vielleicht hilft es, wenn du mitkommst? Wenn ich weiter bin als vierte Woche, können wir das Baby vielleicht schon sehen … also ich meine, den Embryo?«
Ihm ist bewusst, dass sie seine Reaktion genau beobachtet. Als der Schwangerschaftstest positiv ausfiel, war er nicht in der Lage gewesen zu reagieren. Wieder spürt er diese Benommenheit, nur dass er diesmal schlecht Zeit schinden kann, wenn er ihr sagt, er will noch die offizielle Bestätigung abwarten, bevor er sich emotional darauf einlässt. »Unglaublich«, sagt er und versucht, ein Lächeln hinzukriegen, das ihm aber zur Grimasse verrutscht. »Dann ist es also Fakt! Da wir hier« – er sucht kurz nach einer Formulierung – »ein ganzes Dossier voller Beweise haben.«
Katrina setzt sich anders hin, schlägt ein Bein über das andere. Sie trägt coole Keilabsätze. Er achtet immer auf ihre Kleidung, halb aus Bewunderung, halb aus Gewohnheit, weil er immer beobachtet, was sich in der Frauenmode tut. »Deine Reaktion ist etwas schwer einzuordnen«, sagt sie vorsichtig. »Ich weiß nicht, ich dachte, wenn du es schwarz auf weiß siehst, kann ich vielleicht einschätzen, was du eigentlich empfindest.« Sie macht eine Pause, schluckt. »Aber das kann ich immer noch nicht.« Er sieht, wie viel Mühe es sie kostet, sich zu dieser Erklärung durchzuringen.
Er steht auf, geht um den Schreibtisch herum und setzt sich halb darauf, direkt vor sie, sodass sein Bein ihres berührt.
Er dreht die Ausdrucke um, eine Liste mit Untersuchungsergebnissen, die für ihn aber keinen Sinn ergeben. Sein Hirn produziert einen Kurzschluss, wenn er die eindeutigen Fakten – er wird Vater – mit den Fakten in seinem Herzen abgleicht: Er sollte nicht Vater werden.
Vor drei Jahren hat Ames aufgehört, Östrogen zu nehmen. Seine letzte Dosis hat er sich an Reeses zweiunddreißigstem Geburtstag gespritzt. Reese, seine Ex, lebt immer noch in New York. Sie haben seit zwei Jahren nicht miteinander gesprochen, auch wenn er ihr letztes Jahr eine Geburtstagskarte geschickt hat. Eine Antwort hat er nicht bekommen. Während ihrer Beziehung redete sie immer selbstsicher davon, dass sie mit fünfunddreißig ein Kind hätte. Soweit er weiß, ist es nicht dazu gekommen.
Erst jetzt, drei Jahre nach der Trennung, ist Ames in der Lage, sich beiläufig über Reese zu äußern, sie »meine Ex« zu nennen und ohne zu stocken weiterzusprechen. Denn in Wahrheit vermisst er sie immer noch so sehr, dass es gefährlich ist, über sie zu reden, an sie zu denken – wie ein Alkoholiker, der nicht zu viel darüber nachdenken darf, wie gern er nur einen einzigen Drink hätte. Wenn Ames viel an Reese denkt, fühlt er sich verlassen und wird wütend, kriegt schlechte Laune und, das Schlimmste, er schämt sich. Weil er kaum erklären kann, was er noch von ihr will. Eine Zeit lang dachte er, es wär was Romantisches, aber sein Begehren hat nichts Sexuelles mehr. Er vermisst sie eher auf eine familiäre Weise, so wie er seine Herkunftsfamilie vermisst und sich von ihr verraten fühlt, nachdem sie in den ersten Jahren seiner Transition den Kontakt abbrach. Das Gefühl, verlassen zu sein, ging tiefer und war pubertärer als verschmähte erwachsene Liebe. Reese war nicht nur seine Geliebte gewesen, sie war so was wie seine Mutter. Sie hatte ihm beigebracht, eine Frau zu sein … oder er hatte mit ihr gelernt, eine Frau zu sein. Sie hatte ihn in einem frühen, formbaren Stadium seiner Entwicklung kennengelernt, einer zweiten Pubertät, und ihn nach ihrem Geschmack geformt. Jetzt war sie nicht mehr da, aber der Abdruck ihrer Hände blieb, deshalb konnte er sie nicht vergessen.
Ihm war nicht klar gewesen, wie wenig Sinn er als Mensch ohne Reese ergab, bis sie sich von ihm entfernte, bis ihr Fehlen so schmerzhaft wurde, dass er sich die Rüstung seiner Maskulinität zurückwünschte und wie kopflos detransitionierte, um wieder ganz fest darin zu stecken.
Jetzt lebt er also seit drei Jahren wieder in einem testosteronabhängigen Körper. Doch auch ohne die Spritzen und Pillen hatte Ames geglaubt, er hätte so lange Androgen-Blocker genommen, dass seine Hoden verkümmert und für immer unfruchtbar waren. Das erzählte er auch Katrina, als sie am Abend der jährlichen Easter Keg Hunt der Agentur zum ersten Mal Sex hatten. Er sagte ihr, dass er unfruchtbar ist – nicht, dass er eine trans Frau mit verkümmerten Hoden gewesen ist.
Ames geht die Unterlagen in der Mappe durch, die Katrina mitgebracht hat. Unter den Ausdrucken von ihrer Ärztin liegen noch andere Ausdrucke, die nach Internetforen aussehen. »Was ist das?«
Ihre Hand landet auf ihrem Bauch. Er ist flach, kein Babybauch, aber sie hat schon die Haltung einer Schwangeren. »Also ich weiß, du hast gesagt, du bist unfruchtbar. Ich habe nachgelesen, Vasektomien sind zu neunundneunzig Prozent erfolgreich, aber ich habe einen Thread gefunden von Männern, die trotzdem eine Frau geschwängert haben …«
Er hebt eine Hand. »Warte mal kurz. Ich habe nie gesagt, dass ich eine Vasektomie hatte.«
Sein Büro ist wie alle Büros auf diesem Gang nur durch eine Glasscheibe vom Flur getrennt. Es liegt am Ende des Gangs neben der Nische mit dem Kopierer, dem Wasserspender, der Kaffeemaschine und einem kleinen Küchenschrank, in dem es – infolge der jüngsten Initiative der Personalabteilung – nur gesunde Bioprodukte gibt. Das Verkehrsaufkommen im Flur ist den ganzen Tag über konstant. Er würde sein Büro nicht unbedingt als idealen Ort bezeichnen, um sich als ehemalige trans Frau zu outen.
»Nein? Aber wir haben monatelang kein Kondom benutzt, und ich dachte die ganze Zeit … was hast du denn damit gemeint? So was wie niedrige Spermienzahl?«
»Mein Testosteron war eine Zeit lang sehr niedrig.« Er bemüht sich, seine Stimme normal klingen zu lassen, dem Drang zu widerstehen, sie nervös zu senken. »Und in der Zeit sind meine Hoden verkümmert, und mein Arzt hat gesagt, dass mein Sperma das nicht überleben würde.«
Als sich Ames zum ersten Mal ein Östrogenrezept besorgen wollte, ging er zu einem sanftmütigen älteren Endokrinologen, der trans Patient*innen nicht aus besonderem Interesse annahm, sondern weil trans Menschen »so froh sind, bei mir in Behandlung zu sein«. Der größte Teil seiner anderen Patient*innen litt an hormonellen Störungen, die sie emotional unausgeglichen machten. Nachdem dieser Endokrinologe die Dankbarkeit von trans Menschen entdeckt hatte, machte er seinen Terminkalender mit ihnen voll.
Ames, der keine Trans-Therapie gemacht und keins der Papiere hatte, die die meisten Hormon-Gatekeeper verlangten, machte sich vor dem Termin wochenlang Sorgen, der Endokrinologe würde ihn für »nicht richtig trans« erklären und ihm die Hormone verweigern. Nachdem er gehört hatte, dass der Arzt Wertschätzung wertschätzte, quoll er bei seinem Termin vor Dankbarkeit über und verließ die Praxis folglich mit einem Rezept für injizierbares Östrogen. Beim nächsten Mal bekannte der Endokrinologe: »Vielleicht war ich da etwas vorschnell. Ich hätte mehr zum Thema Unfruchtbarkeit sagen müssen.« Er erklärte Ames, dass innerhalb der ersten sechs Monate einer Hormonersatztherapie dauerhafte Unfruchtbarkeit einsetze, und empfahl ihm, zu einer Samenbank zu gehen.
Am nächsten Tag nahm Ames seinen Mut zusammen und rief bei der Samenbank an. Er wollte über Vaterschaft nicht nachdenken, die letzte Feder am Hut der Männlichkeit, zwang sich aber, trotzdem anzurufen. Die Sprechstundenhilfe nannte ihm die jährlichen Kosten für die Spermienspeicherung, die seinem Kabeltarif glichen, was wohl ein angemessener Preis dafür war, die Lebensfähigkeit seiner künftigen Erblinie zu erhalten. Sie schaltete ihn in die Warteschleife, um einen Termin zu vereinbaren, und zu Vivaldi erwog Ames, sein HBO-Abo zu kündigen, um die Samenbank bezahlen zu können. Er konnte das enorme Gewicht von Vaterschaft und Abstammungslinie nicht ganz erfassen, aber er erfasste sehr wohl, wie ungern er HBO kündigen wollte.
Ohne weiter darüber nachzudenken, legte er auf. Und als im Frühling seine Brustwarzen wehzutun begannen, ging er davon aus, dass es zu spät war. Je mehr sie schmerzten, desto weniger schnürte ihm der Gedanke ans Vatersein die Luft ab. Jetzt, da Katrina in seinem Büro saß, musste er sich zum ersten Mal damit beschäftigen, dass er offenbar ein Kind gezeugt hatte. Bald, sogar sehr bald, würde er aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen, die andere Entscheidungen nach sich zog, die Generationen weiterer Entscheidungen mit sich brachten.
»Deine Hoden sind verkümmert?«, fragt Katrina verwirrt. »Ich fand sie ganz normal!«
»Ja«, pflichtet er ihr bei. »Gut, sie sind jetzt nicht riesig oder so.«
»Nein, riesig nicht«, bestätigt Katrina und fügt dann aufmunternd hinzu: »Aber völlig in Ordnung!«
Auf der anderen Seite der Glaswand bleibt Karen aus der Grafikabteilung stehen, um einen Müsliriegel auszupacken. Ames wird plötzlich bewusst, dass Katrina und er mitten im Büro über seine Eier plaudern.
Als Ames in der Agentur angefangen hatte, weihten ihn die Kolleg*innen umgehend in den Klatsch über Katrina ein: schlimme Scheidung. Sie hatte ein paar Monate vor seinem Vorstellungsgespräch ihren Mann verlassen. Es hieß, sie hätte in ihrem Büro geweint und dann ihre Sekretärin angewiesen, seine Anrufe nicht mehr durchzustellen. Er hätte sie betrogen, sagte einer. Nein, nein, sie hätte eine Fehlgeburt gehabt. Falsch, sagte noch wer anders, sie hätten finanzielle Probleme. Es wurde in einem Ton spekuliert, der genauso sensationslüstern wie pflichtschuldig war – Vorgesetzte zu haben ist so verbreitet, dass kaum darüber gesprochen wird, wie seltsam das eigentlich ist, obwohl dieses System noch um den durchschnittlichsten Menschen einen Personenkult macht. Als Untergebene*r braucht man eine Theorie, wie es dazu kommen konnte, dass diese*r Vorgesetzte Macht über die eigene Autonomie hat, unser aller höchstes Gut. Ein Grundverständnis für die eigenwillige Mechanik des Kapitalismus reichte da nicht aus – das Herz verlangt nach einer menschlichen Erklärung. Jedenfalls sagte das Ames, um seine anfängliche Verliebtheit zu rechtfertigen.
Während des ersten Jahres, das Ames für Katrina arbeitete, behielt sie ihr Privatleben für sich. Ohne dass sie über ihre Scheidung hätte reden müssen, wusste Ames intuitiv alles. Er bemerkte ihre leichte Verletztheit und Erschöpfung, die fast teenagerhafte Angst und Bereitschaft, schlechte Ideen auszuprobieren, die eine gewisse Scheißegal-Haltung ihrer Arbeit gegenüber mit sich brachte, und große Direktheit gegenüber ihren Angestellten.
Sie entwickelte ein instinktives Misstrauen gegen konventionelle Geschichten. Den harmloseren Firmenkunden, die gelegentlich in die Agentur kamen, schob sie ein oder zwei deutlich düsterere, experimentellere Pitches unter die konventionelle Kost ihrer Onlinekampagnen. Dada für Clorox-Bleiche. Verzweifelte Cyborgs für Anker-Akkus. Radiowerbung für Purina-Haustiernahrung mit Jon Lovitz, der noch mal in seine Neunziger-Kultrolle als Kritiker Jay Sherman schlüpfte, um als solcher diversen Welpen schlechte Kritiken zu verpassen. Ihre Arbeit profitierte davon. Ames führte ihren Hang zu neuen Erzählmustern auf ihre Scheidung zurück.
Als ihre Affäre schon eine ganze Weile ging und sie sehr oft miteinander geschlafen hatten, brachte sie das Thema auf ihre Scheidung. Sie lagen in seinem Bett, jede*r auf einer Seite, die Gesichter einander zugewandt, er auf den Ellbogen gestützt, ihr Gesicht auf einem seiner waldgrünen Kissenbezüge, und ihr glänzend braunes Haar fiel in Stufen über das Kissen und das Bett. Die Nachttischlampe hinter ihr beleuchtete die sichelhaften Konturen ihres Gesichts – instinktiv nahm er aber auch die Kurve einer Braue wahr.
»Du hast im Büro ja von der Fehlgeburt gehört«, sagte sie. »Dummerweise habe ich mit ein paar Leuten drüber geredet. Abby irgendwas zu erzählen ist ein Fehler.« Er lachte, denn, ja, Abby war eine Plaudertasche.
»Wenn man sich scheiden lässt«, sagte sie nach einer kurzen Pause, »erwarten alle eine Geschichte, mit der man das rechtfertigt. Jede geschiedene Frau, die ich kenne, hat zur Erklärung so eine Geschichte. Im echten Leben haben die Geschichte und die wahren Gründe für die Scheidung aber wenig miteinander zu tun. In Wirklichkeit ist es viel ambivalenter. Meine eigenen Gründe sind eher ein Klang als eine Folge verschiedener Ursachen und Wirkungen. Aber wenn ich darüber spreche, erwarten die Leute Ursache und Wirkung, ein klares Warum.«
»Okay«, sagte Ames. »Und was ist der Klang deiner Scheidung?«
»Ich nenne es gern den heterosexuellen Ennui.«
»Verstehe. Und leidest du immer noch unter dem heterosexuellen Ennui?«, fragte Ames und umfasste mit einer Geste das gesamte Tableau ihres postkoitalen Schlafzimmers.
»Ich hatte eine Fehlgeburt«, erwiderte sie barsch und ließ damit die Luft aus seiner Ironie.
Schnell entschuldigte sich Ames.
Katrina verlagerte ein Kissen, und als sie sich Ames wieder zuwandte, wirkte ihr Gesichtsausdruck … belustigt? »Siehst du? Was zu beweisen war. Als ich ›heterosexueller Ennui‹ gesagt habe, hast du nachgefragt, aber als ich ›Fehlgeburt‹ gesagt habe, hast du dich sofort entschuldigt. Deshalb ist die Fehlgeburt die offizielle Story meiner Scheidung. Da fragt keiner nach. Fehlgeburten sind was Privates, also ist meine Fehlgeburt der Freifahrtschein, um aus der Nummer rauszukommen. Eine Scheidung, an der Danny keine Schuld trägt – Trauer um etwas, das man nur schwer benennen kann. Die Leute denken, dass die Trauer einen schmerzhaften Keil zwischen das Paar getrieben hat – niemand kann was dafür. Alles stillschweigend. Niemand fragt, wie es mir eigentlich nach der Fehlgeburt ging.«
»Wie ging es dir denn nach der Fehlgeburt?«, fragte Ames.
»Ich war erleichtert.«
»Erleichtert?«
»Ja. Ich war erleichtert. Und habe mich deshalb wie eine Psychopathin gefühlt. Ich habe die ganzen Artikel über Fehlgeburten in Frauenzeitschriften gelesen, und überall stand, ich würde Schmerz und Schuld empfinden. Überall wurde mir versichert, es wäre nicht meine Schuld, es läge nicht an dem einen Glas Wein, das ich mal getrunken hatte, oder an dem italienischen Riesensandwich mit dem Industriefleisch, das ich mir nicht verkneifen konnte. Dabei dachte ich überhaupt nie, es wäre meine Schuld. Schuldgefühle hatte ich nur, weil ich keine Schuldgefühle hatte. Nach einiger Zeit habe ich mich dann gefragt, woran das liegt. Warum bin ich erleichtert? Daraufhin habe ich mir dann meine Ehe mal genauer angesehen. Ich war erleichtert wegen etwas, das ich mir nicht hatte eingestehen wollen: Ich wollte nicht mehr mit Danny zusammen sein. Aber wenn wir ein Kind bekommen hätten, hätte ich das gemusst. Danny war ein guter Freund, als ich jünger war, als wir aufs College gingen. Wie ein Bernhardiner ein guter Hund ist, wenn man sich in den Bergen verlaufen hat. Ein großer liebenswürdiger Körper, hinter dem ein Mädchen Schutz suchen kann. Danny verkörperte die Vorstellung davon, wie ein Mann sein soll, eine Vorstellung, die ich geerbt habe, vielleicht weil ich in Vermont aufgewachsen bin. Wir sahen gut aus zusammen. Ich wusste schon ganz früh, unser Hochzeitsfoto würde aussehen wie aus einer Zeitschrift. Also habe ich Ja gesagt, als er mir den Antrag gemacht hat, obwohl der Sex in den zwei Jahren, die wir zusammen waren, nie länger als fünfzehn Minuten gedauert hat, inklusive Vorspiel, und obwohl ich schon nach den berühmten drei Monaten für ihn die Wäsche gemacht habe.
Einmal habe ich gewitzelt, meine Ehe wäre wie ein Push-up-BH: Sieht ziemlich gut aus unterm T-Shirt, aber man weiß, dass alles nur Polsterung ist und kann es kaum erwarten, das Ding am Abend auszuziehen. Meine Freundinnen haben gelacht, aber mir wurde eiskalt, weil mir aufgegangen ist, dass ich unwillkürlich die Wahrheit gesagt hatte, und die war schrecklich.«
Ames hörte zu. Sie hatte ihm mal gesagt, ihr gefalle, dass er offenbar nicht das Bedürfnis oder die Notwendigkeit empfinde, etwas zu sagen oder ihr einen Rat zu geben, wenn sie laut über etwas nachdenke.
Katrina nahm ihre Ohrringe ab und legte sie auf den Nachttisch. »Danny und ich sind mal mit einem anderen Paar nach Dartmouth gefahren, Pete und Lia. Nachdem sie von Seattle nach New York gezogen waren, haben sie so Abende veranstaltet, wo sie andere Ehepaare zum Pie essen und Cheers kucken einluden. Das waren Leute, die gern bergsteigen und sich selbst Feinschmecker nennen. Alle außer mir waren sehr, sehr weiß. Cheers war Teil ihrer komischen Hipster-Ironie. Alle haben sich darüber kaputtgelacht, wie man in den Achtzigern mit Sex umgegangen ist, als wären wir seitdem so viel weitergekommen. Dieser Aufreißer, Sam Malone, und diese grelle Möchtegernfeministin, die in Wahrheit verrückt nach Schwänzen ist, wie hieß die noch mal? Keine Ahnung, vergessen!«
»Diane«, sagte Ames.
»Ja, Diane. Ich erinnere mich noch an einen Abend, nachdem ich das Baby verloren hatte. Alle Männer haben sich, kaum dass wir saßen, um ihre Frauen gefaltet, und die Frauen haben sich in die Arme ihrer Männer gekuschelt. Lauter gepaarte Tiere. Die wirkten plötzlich alle wie Affen, die sich gegenseitig das Fell lausen. Mich hat das abgestoßen. Danny hat sich auf der Couch zurückgelehnt und seine langen Arme ausgebreitet, damit ich mich wie alle anderen guten Gattinnen reinlegen konnte. Hab ich aber nicht gemacht. Ich habe steif neben ihm Platz genommen mit bestimmt dreißig Zentimetern Abstand. Die Gastgeber haben Cheers angestellt, und wir haben gekuckt, wie sich Männer und Frauen schreckliche Sachen sagen, und gelacht, als hätten wir nicht genau dasselbe gemacht. Oder machten es immer noch.«
»Mhm«, sagte Ames und nickte.
»Danny hat mich die ganze Zeit so verletzt angesehen«, fuhr Katrina fort. »Er wusste wohl gar nicht, was er schlimmer fand: was ich denke oder was unsere Freunde denken. Aber mir war das egal. Es gab in dem Moment nichts, was mir gleichgültiger gewesen wäre als seine verletzten Gefühle. Ich dachte nur, er hat mich zugrunde gerichtet, eine Psychopathin aus mir gemacht. Meine Gedanken waren auf ihn fokussiert, als wollte ich ihn damit niederstechen. Die ganze Zeit gingen mir immer wieder die Worte durch den Kopf: Wenn du mich nicht so aufregen würdest, wäre ich nicht so froh, das Baby verloren zu haben.
Das war bestimmt nicht fair, geschweige denn logisch, aber da habe ich begriffen, dass ich schon lange so empfand. Ich hatte mich nur nie getraut, es in Gedanken auszuformulieren. Aber irgendwas an der Selbstgefälligkeit dieser Situation hat das freigesetzt – sein Schoßäffchen zu spielen und so zu tun, als hätten wir uns zu Menschen weiterentwickelt.«
Katrina beendete ihre Geschichte mit einem freudlosen Lachen. »Außerdem habe ich ungefähr zur gleichen Zeit seine geheime Pornosammlung mit den Asiatinnen gefunden.«
»Er hatte eine geheime Pornosammlung mit Asiatinnen?«
»Ein paar auf seinem Computer und dann noch DVDs, Asiatinnen anal und so was.«
»Ich weiß nicht«, sagte Ames. »Wenn ich Asiatin wäre und mein Mann hätte eine Pornosammlung mit Asiatinnen, dann würde ich mich wahrscheinlich eher geschmeichelt fühlen. Das heißt ja zumindest, dass er mich attraktiv findet.«
»Nein«, sagte sie. »Du verstehst das nicht. Das heißt, du kommst zu der gruseligen Schlussfolgerung, dass der Mann, den du geheiratet hast, nach allem, was ihr durchgemacht habt, und nach all den Jahren, in denen ihr versucht habt, euch wie Erwachsene zu verhalten, vielleicht nur mit dir zusammen ist, weil er einen Fetisch für Asiatinnen hat – dabei habe ich mich selbst nie wirklich wie eine Asiatin gefühlt. Er konnte mich nicht mal angemessen fetischisieren.«
»Wie nennt man solche Chaser noch mal?«, fragte Ames.
»Solche was?«
Urplötzlich wurde ihm kalt, und er zog die Decke um sich herum. Es kam ihm vor, als wäre er blindlings in einen Wintersturm gelaufen und stünde jetzt auf einem nur hauchdünn mit Eis überzogenen See. Er kannte Chaser bisher nur aus einem Kontext. »Wie, äh, Trans-Chaser. Wie nennt man Chaser, die auf Asiatinnen stehen?«
Sie sah ihn abschätzend an. »Reis-Chaser«, sagte sie tonlos. »In Vermont, wo ich aufgewachsen bin, haben die Kinder mich, wenn sie meinen Vater mit meiner Mutter zusammen gesehen haben, immer damit geärgert, dass mein Vater Gelbfieber hätte.«
In diesem Moment begriff Ames, dass sie dachte, es wäre ihm um ihn selbst gegangen. Dass sie dachte, er wollte wissen, welcher beleidigende Begriff der richtige für ihn wäre, nachdem er mit ihr geschlafen hatte. Er unterdrückte das überwältigende Bedürfnis zu protestieren. Ihr zu sagen: O Gott, nein, ich würde niemals denken, dass ich abgestempelt bin, wenn ich Sex mit einem bestimmten Menschen habe – ich weiß selbst zu genau, was es heißt, fetischisiert zu werden. Wie es ist, wenn jemand denkt, mich zu begehren würde ihn herabsetzen oder erniedrigen.
Doch selbst in diesem Moment schien ihm ein solches Eingeständnis zu riskant. Was, wenn sein Coming-out als ehemalige trans Frau bedeutete, dass sie nie wieder mit ihm ins Bett ging? Wenn es das Ende ihrer beruflichen Zusammenarbeit war? Nein, besser, er wartete auf den passenden Moment.
Ab und zu musterte Ames Katrina und stellte sich vor, wie es wäre, es ihr zu sagen. Wie sie reagieren würde. Wenn er allein war, sagte er sich, dass es ihr ganz vielleicht sogar gefiele. Dass der eigentliche Grund für ihre Scheidung von Danny sexuell gewesen war. Dass sie zwar nicht richtig queer war – aber eben auch nicht wirklich auf Hetero-Eheleben stand.
Tatsächlich war sie ein Freak im Bett. Ihr Sex war viel wilder, als er es sich in seiner ersten Verliebtheit vorgestellt hatte. Beim ersten Mal waren sie betrunken gewesen und einer ziemlich typischen Heterodynamik gefolgt. Ihr zweites Mal – stocknüchtern und am helllichten Tag eine Woche später, als sie sich ›einen Tag Home-Office‹ genommen und ihn als ihren Mitarbeiter angewiesen hatte, dasselbe zu tun – hatte definitiv etwas Queeres gehabt.
Sie hatte in der Küche den Kühlschrank aufgemacht und sich hineingebeugt. Der Anblick ihrer Figur von hinten und die greifbare sexuelle Spannung hatten ihn buchstäblich auf die Knie sinken lassen, um den Arsch in ihrer Jeans halb zu küssen, halb zu streicheln. Sie sah sich mit irgendwie betroffenem Gesichtsausdruck zu ihm um und griff ihm gleichzeitig in die Haare.
»Ist das wirklich in Ordnung für dich?«, fragte sie. »Wenn umgekehrt ein Mann seiner Mitarbeiterin sagen würde, sie soll sich einen Tag freinehmen und zu ihm kommen – ich wäre entsetzt.«
Da seine Haare um ihre Finger gewickelt waren, konnte er den Kopf nicht zurücklegen und musste ihrem Hintern antworten. Sein Mund war vielleicht zwei Zentimeter von ihrer rechten Arschbacke entfernt, als spräche er in ein Mikrofon.
»Ich finde das großartig, wirklich«, versicherte er ihrem Hintern. »Für mich ist das der Himmel. Ich steh auf Frauen, die mich rumkommandieren. Und dass du auch noch meine Chefin bist, muss irgendein geheimes Geilheitslevel freigeschaltet haben. Du hast mein Einverständnis oder was auch immer du willst, wenn nur mein Gesicht bitte hier bleiben kann.«
»Soll ich vielleicht noch ein bisschen mehr die Chefin markieren?«
Er blickte zu ihr auf und konnte sein Glück kaum fassen. Eine dominante Frau, die ihm gegenüber tatsächlich das Sagen hatte? Ein Sechser im Lotto. »Ja«, sagte er. »Bitte.«
»Gut.« Sie lachte und drehte sich so um, dass sie ihn ansehen konnte und seine Nase auf einer Höhe mit ihrem Unterleib war. »Du erstellst mir eine PowerPoint-Präsentation, warum ich dir erlauben soll, dass du da unten bleiben und dein Gesicht an meine Möse legen darfst.« Er schloss die Augen und atmete glücklich ein; langsam dämmerte ihm, dass dieses Spiel sie genauso anmachte, und so löste sich eine der Kalkschichten, die ihm die Libido verkrustet hatten, und damit auch sein Herz und damit auch sein Leben.
Als sie am nächsten Tag beide wieder im Büro waren, schickte sie ihm eine Mail. Warte immer noch auf die PowerPoint-Präsentation, über die wir gestern gesprochen haben. Wann kann ich damit rechnen?
Er wusste nicht, ob er offen darauf antworten sollte. Jetzt stand er da mit seinen ganzen geheimen Queer-Qualifikationen, und diese geschiedene hetero Frau hatte ihn komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Was ihn natürlich dermaßen aufgeilte, dass er kurz überlegte, sich in einer entlegenen Toilette einen runterzuholen. LOL, antwortete er dürftig.
Nein, ich meine es ernst. Ich will spätestens Dienstag die Folien sehen. Wenn du es bis dahin nicht schaffst, machst du die Präsentation in einer Sitzung. Deine Entscheidung.
Was er da mit Katrina laufen hatte – ihre Machtspielchen, der Nervenkitzel, wenn sie im Büro umeinander herumschlichen, wie auffällig sie flirteten –, das alles ergab richtig guten Sex. In seinem früheren Leben war Ames zur Frau transitioniert, bevor er jemals richtig guten Sex gehabt hatte, ohne zu wissen, ob er nach der Detransition jemals wieder richtig guten Sex haben würde. Bei allen anderen Spielchen, die er als heterosexueller Mann ausprobierte, hatten sich bei ihm Körper und Geist voneinander abgekoppelt, was dazu führte, dass er keinerlei echte Erregung oder Freude empfinden konnte, obwohl er alles Notwendige dafür tat, bis seine Partnerin dieses Abgekoppeltsein irgendwann für Gleichgültigkeit hielt und ihn fallenließ. Wenn das passierte, trieb er einfach davon, ohne Gegenwehr, wie in der unvermeidlichen Szene in Schiffbruchfilmen, wenn die Leiche der Geliebten langsam ins ozeanische Nichts treibt. Nicht so bei Katrina; bei Katrina und ihren Machtspielchen war er immer voll da, elektrisiert, träumte sogar davon, wenn sie nicht zusammen waren. Erstaunlich, sie waren schon fünf Monate ein Paar und sein Verlangen hatte nicht nachgelassen. Es war eher noch gewachsen und wilder geworden: ein üppiges, unbändiges grünes Leben, das die ordentlich gepflegten Wege und Beete anständigen Verhaltens überwucherte.
Er vermutete, dass Katrina sich lange nach dem Sex, den sie hatten, gesehnt, aber nie darum gebeten hatte, auch wenn sie zu stolz war, das auszusprechen. Dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben die aufwühlenden Auswirkungen von gutem Sex erlebte – von Sex, für den man durchs ganze Land fährt, nur um ein paar Stunden zusammen zu verbringen, Sex, nach dem man darüber redet, zusammen eine Wohnung zu kaufen oder zusammenzuziehen oder das Leben auf eine Weise zu verflechten, die die kurze Intimität logistisch eigentlich nicht rechtfertigt. Kurz gesagt, der Sex, den Katrina und er hatten, gehörte in die Kategorie, in der ein positiver Schwangerschaftstest bedeutet, dass man das Baby durchaus zusammen bekommen kann.
Mit zwei Einschränkungen: Erstens wusste sie nicht, dass er trans gewesen war, und zweitens war für ihn eine Vaterschaft nach all den mentalen Verrenkungen, nach all den Lektionen, die er durch die Transition und die Detransition gelernt hatte, der letzte Affront gegen sein Geschlecht, bei dem ihn immer noch schleichendes Grauen überfiel. Durch seinen eigenen Körper zum Vater zu werden, wie sein Vater und wie dessen Vater und so weiter und so fort, würde ihn dazu verdammen, ein Leben lang mit diesem Grauen zu ringen.
Gott, wie viel er ihr von seiner Vergangenheit verheimlicht hatte, die immer im Trüben blieb, immer nur angedeutet war, unter dem Vorwand, ihre Beziehung vorm Büro zu schützen. Es ermüdete Ames, auch wenn ihm die Auslassungen beim Umgang mit seiner Vergangenheit schon zur zweiten Natur geworden waren.
Jetzt, in seinem Büro, rollt Katrina mit ihrem Stuhl nach vorn und nimmt seine Hand. »Ames, hilf mir«, sagt sie sanft. »Was willst du tun? Ich bitte dich nicht, für mich zu entscheiden. Es hat mich selbst überrascht, dass ich so begeistert bin. Ich fühle mich sehr angreifbar, wenn ich das so ausspreche, aber bitte sag mir, was es für dich bedeutet.«
Sie berührt wieder ihren Bauch. Das Baby-das-noch-kein-Baby-ist unter ihrer Hand. Er hat mal gehört, der Herzschlag des Fötus sei ab der vierten Woche nachweisbar. Er muss daran denken, dass sie schon eine Fehlgeburt hatte. Was für ein stiller Schmerz. Es tut weh, sich vorzustellen, was sie vermutlich gerade durchmacht. »Du hast gesagt, du bist unfruchtbar, und jetzt bin ich schwanger«, sagt sie. »Und nachdem meine Ärztin das bestätigt hat – worum du gebeten hattest –, ist das Einzige, was du mir zu sagen hast, dass deine Hoden verkümmert sind? Die meisten Männer reagieren anders, wenn sie hören, dass sie Vater werden.«
Vater. Sagt die Mutter. Sie lässt seine Hand los, greift nach der Mappe, dann geht sie selbst die Unterlagen durch und meidet dabei seinen Blick.
»Das ist definitiv nicht die Reaktion, die ich erwartet hätte, wenn du wirklich davon ausgegangen bist, dass es unmöglich ist. Glück, Angst, Freude, Wut, was auch immer. Aber du bist ungefähr so überrascht, als hätten wir in einem Restaurant einen Tisch bekommen, in dem man normalerweise kurzfristig keinen bekommt. Kannst du mir erklären, was in deinem Kopf vorgeht?«
Ames holt Luft. Wartet. Atmet aus. Sie wartet. Erwartet, dass er etwas sagt, etwas tut. So ein Mensch ist er jetzt, erinnert er sich selbst, ein Mensch, der Entscheidungen trifft, der das Leben nicht einfach über sich ergehen lässt. War das nicht die große Lektion seiner Transition und Detransition? Dass man nie alle Perspektiven kennt, dass Aufschieben ein Verstecken vor der Realität ist? Dass man einfach herausfinden muss, was man will, und es dann tut? Und wenn man nicht weiß, was man will, tut man vielleicht trotzdem was und alles ändert sich, und so zeigt sich dann vielleicht, was man wirklich will.
Also, tu was.
Und vielleicht war sein Büro ja tatsächlich die beste Wahl, um es ihr zu sagen – er hatte immer gedacht, es würde bei einem Abendessen passieren, wo man nicht abhauen konnte und drüber reden musste. Aber mit Blick auf die Büroküche? Bei der Arbeit? Hier und nur hier konnte sie nicht ausflippen und musste zumindest tun, als würde sie cool bleiben.
Sein Schweigen zieht sich in die Länge. Bis Katrina jäh die Hand hebt, wie um zu fragen: Was jetzt?
Sag es einfach.
Also sagt er es. »Ein Arzt, der mir Östrogen verschrieben hat, hat mir gesagt, dass ich davon unfruchtbar werde. Ich habe sechs Jahre Östrogen gespritzt und Testosteron-Blocker genommen, weil ich als trans Frau gelebt habe. Er hat gesagt, nach sechs Monaten wäre ich dauerhaft unfruchtbar. Nachdem ich so lange als Frau gelebt habe, ist es für mich also ziemlich heftig, damit klarzukommen, Vater zu werden.«
»Bitte was? Als was hast du gelebt?« Ihr Gesicht ist von einem Moment zum anderen völlig ausdruckslos.
»Ich war eine trans Frau. Deshalb habe ich gedacht, ich wäre unfruchtbar.« Er berührt ihre Schulter, um sie zu beruhigen. Er ist kurz davor zu fragen, ob er ihr alles erzählen kann.
Da zuckt ihr Arm unter seiner Hand zurück und die Mappe mit den Vasektomieberichten und dem Schwangerschaftstest fliegt ihm ins Gesicht. Instinktiv macht er einen Schritt zur Seite. Die Mappe streift seine Schulter, klappt auf und die Ausdrucke fallen heraus.
Er will sie besänftigen, wieder berühren – aber sie springt unvermittelt auf. »Das glaube ich nicht. Ich bin, o Gott, ich fühle mich so –« Sie kann nicht sprechen, hält sich die Hand an den Hals, als wollte sie die Worte rausdrücken, die darin stecken geblieben sind. »Betrogen! Du hast mich betrogen. Warum hast du mir das angetan?«
Er hat genug Erfahrung mit Coming-outs, um zu wissen, dass die Lage nur eskalieren würde, wenn er ihr jetzt sagte, dass er ihr gar nichts angetan hat. Stattdessen kämpft er gegen den Drang an, sich zu bücken, um die Papiere wieder aufzusammeln und in die Mappe zu legen. Die Ausdrucke vom Patient*innenforum wirken jetzt noch krasser, fast abartig, als hätte sie ihm ihre sämtlichen Selfies und Sexnachrichten der letzten fünf Monate entgegengeschleudert. Aber er rührt sich nicht. Sie hat jetzt eine Schulter vorn, wie eine Boxerin, und obwohl es überhaupt nicht zu ihr passen würde, weiß er nicht, ob sie ihm nicht eine langen würde, wenn er sich jetzt vorbeugt. Doch dann zuckt sie plötzlich zusammen und fährt herum.
Josh aus der Unternehmensentwicklung starrt sie durch die Glaswand an. Als Katrina ihn ansieht, macht er einen halben Schritt in die Küche und nimmt einen Apfel aus dem Drahtkorb, der neben der Tür hängt. Aber er kann nicht anders, er dreht sich noch mal um und betrachtet durch die Scheibe das Büro-Diorama. Er wirft Ames einen schnellen Scheiße-Mann-Blick zu. Katrina starrt Josh an. Sie ist sichtlich aufgebracht, ihre Beherrschte-Chefin-Pose in Trümmern.
»Hallo, Josh«, sagt Katrina barsch durch die Scheibe. Josh ist so begeistert von der Szene, dass er das Durchbrechen der vierten Wand gar nicht bemerkt. Entschlossen macht sie zwei Schritte, ohne die verstreuten Papiere zu beachten, und öffnet die Tür. Im Flur fährt sie herum und funkelt Ames an. »Kannst du bitte die Akte aufheben, die mir da runtergefallen ist« – sie deutet auf die auf dem Boden verstreuten Blätter –, »und sie mir in einer Stunde ins Büro bringen? Ich habe jetzt ein wichtiges Telefonat. Danach können wir alles Weitere besprechen.«
»Natürlich«, sagt Ames. »Kann’s kaum erwarten.«
Ames bückt sich und sammelt die Papiere ein. Josh wartet, bis Katrina um die Ecke ist, lehnt sich gegen die weit geöffnete Tür, wirft den Apfel in die Luft, fängt ihn wieder auf und grinst auf Ames runter. »Streit unter Liebenden?«
»Dein Jungbrunnen ist anscheinend immer noch nicht versiegt«, stellt Ames fest und wirft einen schnellen Blick auf Reeses Gesicht. Sie bewegen sich in einem langsamen Strom von Müßiggängern, die die Aprilsonne genießen, durch den Prospect Park.
Sie wirkt auf ihn noch fast wie mit Mitte zwanzig. Tatsächlich sieht sie sogar noch weicher aus in ihrem lila-weiß karierten Kleid, in dem sie die Birnenform offenbart, die in Frauenzeitschriften gern als eine Körperform dargestellt wird, die man sorgfältig kaschieren und unauffällig umschmeicheln muss, die für Reese jedoch schon immer eine ungewöhnliche Möglichkeit war, alles andere als unauffällig als Frau durchzugehen.
Seine eigene Phase östrogenisierter Vampirhaut hat die Bildung von Falten und Furchen verlangsamt, aber seit seine Haut wieder gröber wurde und sich wieder Stoppeln zeigten, kündigten sich zwischen den dunklen Haaren auch ein paar graue an. Er hat sich heute Morgen gründlich rasiert. Als ein Mann, der die Zeichen des Alters verbirgt, bevor er zum ersten Mal nach Jahren eine Ex wiedersieht, aber auch – verwirrenderweise – aus einem schlummernden Konkurrenzdenken heraus, dem Drang zu zeigen, dass er immer noch eine Schönheit ist.
»Deine Östrogenwerte scheinen eher nicht mehr so hoch zu sein«, sagt Reese, aber ohne Gehässigkeit, nicht, um ihm wehzutun, eher, als wäre sie zu müde für Nettigkeiten.
»Ich habe mir sagen lassen, meine Krähenfüße seien umwerfend.«
Reese seufzt. »Ich will nicht über dein Äußeres reden, Amy. Da mach ich nicht mit.«
»Okay. Versteh ich.« Er ignoriert das »Amy«. Es verletzt ihn nicht, es ist nur einfach ein Name, den niemand mehr benutzt. »Ich wollte dir nur sagen, dass du toll aussiehst.«
Reese zuckt mit den Schultern und leckt am Rand des Eis-Sandwichs, das er ihr mitgebracht hat.
Ihr Desinteresse überrascht ihn. Er hatte gedacht, das Kompliment würde ihr etwas bedeuten.
»Hey«, sagt er betont leichthin, »ich gebe mir hier Mühe, wenn ich dir sage, wie toll du aussiehst.«
Sie sieht ihn an, als stiege er gerade aus einem Raumschiff. »Oh«, sagt sie endlich. »Jetzt kapier ich das. Du hast mir das Kompliment als Mann gemacht. Du bist dran gewöhnt, dass Frauen auf Komplimente reagieren, als wärst du ein Mann.«
Das stimmt. Seine Komplimente werden normalerweise zumindest als solche wahrgenommen.
Sie legt eine grausige Parodie hin, greift sich ans Herz und klimpert mit den Wimpern. »Oh! Du meinst mich?«
»Schon gut, Reese.«
»Du hast Glück, dass ich überhaupt gekommen bin. Ich gebe jetzt nicht auch noch den Teenager, der verrückt nach Jungs ist.«
»Ja, das sehe ich.«
Hier hatten sie sich kennengelernt, bei einem Picknick unter trans Frauen. Er hatte immer noch die Wohnung nördlich vom Prospect Park, in der sie zusammengewohnt hatten. Mit der Zeit waren die Erinnerungen an Reese und den Park durch Neues ersetzt worden. Seine Laufstrecken, die Stellen am Teich, wo er las oder Vögel beobachtete – um vielleicht einen Rotschwanzbussard zu sehen, der dort nistete, einen entflogenen Singvogel oder zur Not auch einen Schwan. Aber Reeses Anwesenheit lässt alles anders erscheinen, sie beschwört die Vergangenheit herauf.
Ihm ist nicht ganz klar, ob sie ihn aus taktischen Gründen hier treffen wollte. Um ihn aus dem Konzept zu bringen. Er spürt, dass ihre frühere Vertrautheit nicht mehr da ist, aber ob diese fehlende Intimität für immer verschwunden ist oder nur wie ein Kind Verstecken spielt, weiß er nicht recht.
Aus den Baumkronen ertönt das rostige Quietschen einer Grackel. Er will sich gerade entschuldigen, ihr sagen, dass er einen Fehler gemacht hat, und nach Hause gehen, als sie ihm ihr Eis-Sandwich anbietet. Zum ersten Mal an diesem Nachmittag lässt sie das Visier herunter und bringt so was wie ein Lächeln zustande. »Schau«, sagt sie, »ich hab ja mitgespielt. Ich hab mit den anderen Frauen gewartet und hab mir ein Eis von dir kaufen lassen, als wären wir eins von hundert Hetero-Paaren hier, die an ihrem Hetero-Sonntag die langweilige Hetero-Idee haben, in den Park zu gehen. Jetzt nimm schon, ich ess das nicht alleine auf.«
Er beißt ein Stück ab, und sie zieht die Hand zurück.
»Aber eins sag ich dir«, sagt sie. »Du bewegst dich anders als früher.«
»Ich bewege mich anders?«
»Ja, diese Eleganz hattest du schon immer, aber früher hast du darauf geachtet, dich in den Hüften zu wiegen. Du warst ein lässiger Junge, der gelernt hat, sich wie eine Frau zu bewegen, die dann wieder gelernt hat, sich wie ein Junge zu bewegen, aber ohne jedes Mal die Festplatte zu löschen. Ich habe dich beobachtet, als du in der Schlange standst – du gleitest dahin.«
»Wow, Reese. Echt, wow.«
»Nein! Das ist charismatisch! Weißt du noch, als Johnny Depp einen betrunkenen Keith Richards gespielt hat, der einen tuntigen Piraten spielt? Und man ist einfach nur total gebannt und denkt: Was ist denn mit dem los?« Sie lächelt ihn an und leckt betont unschuldig an ihrem Eis.
»Ich hatte vergessen, wie es ist, mit trans Frauen zusammen zu sein«, sagt er zustimmend. »Dass ich ausnahmsweise nicht der Einzige bin, der permanent in jeder einzelnen Situation die Geschlechterdynamik analysiert, um meine Rolle zu spielen.«
»Willkommen zurück«, sagt sie, offenbar beträchtlich erheitert. »Darüber hinaus scheinst du vergessen zu haben, dass du alles, was du weißt, von mir gelernt hast.«
»Bitte. Der Schüler hat seine Meisterin längst überholt.«
»Das hättest du wohl gern, Mädchen.«
Es ist wie nach Hause kommen, dieses schnelle »Mädchen«. Wärmer und süßer als die Frühlingssonne in seinem Nacken und das Eis auf seiner Zunge. Es ist furchteinflößend verführerisch, mit Betonung auf furchteinflößend. Wenn er diese Art von Trost sucht, macht er sich nur zum Idioten.