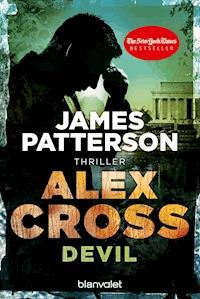
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Alex Cross
- Sprache: Deutsch
Noch nie stand für Alex Cross so viel auf dem Spiel – die nervenzerreißende Fortsetzung von »Evil«!
***Jetzt verfilmt als Amazon Original Serie CROSS!***
Detective Alex Cross ist ins Visier eines grausamen Psychopathen geraten, eines kriminellen Masterminds, der ihn zwingt, das mörderischste Spiel seiner gesamten Karriere zu spielen. Denn nie war der Einsatz höher. Cross‘ Familie – seine Ehefrau Bree, seine Großmutter und seine Kinder – wurde entführt. Ihr Leben hängt am seidenen Faden. Cross ist verzweifelt: Er muss seinem wahnsinnigen Widersacher geben, was er verlangt, wenn er seine Familie je wiedersehen will. Kann ein Opfer zu groß sein, um die zu retten, die man liebt?
Alle Alex-Cross-Thriller können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Für Alex Cross bricht eine Welt zusammen: Nachdem er zuletzt Hoffnung geschöpft hatte, dass seine entführte Familie noch am Leben ist, wurde nun eine Frau, die seiner Ehefrau Bree zum Verwechseln ähnlich sieht und deren Kleidung und Schmuck trägt, tot aufgefunden, das Gesicht völlig entstellt. Kurz darauf erhält Cross einen Anruf des Entführers, Marcus Sunday alias Thierry Mulch. Dieser stellt eine grausige Forderung, die Cross unmöglich erfüllen kann. Doch dann entdeckt er in seinem eigenen Garten den Leichnam eines grausam zugerichteten Jungen, in dem er seinen Sohn Damon zu erkennen glaubt. Hat er wirklich zwei seiner liebsten Menschen unwiederbringlich verloren, oder ist auch dies nur ein perfider Schachzug des psychopathischen Entführers, der Cross um jeden Preis in den Wahnsinn treiben will? Cross muss ihm geben, was er verlangt – denn kann irgendein Opfer zu groß sein, um die zu retten, die man liebt?
Autor
James Patterson, geboren 1947, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den »Women’s Murder Club« erreichen regelmäßig die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N.Y.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Patterson
DEVIL
Thriller
Deutsch von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Hope to Die« bei Little, Brown and Company, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2014 by James Patterson
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl, text in form
Umschlaggestaltung und -abbildung: © Johannes Wiebel | punchdesign, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com
AF · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-20193-7V002www.blanvalet.de
Gewidmet den tapferen Männern und Frauen des Palm Beach Police Department.
Erster Teil
1 Als Marcus Sunday gegen 19.00 Uhr bei Whodunit Books, einer auf Krimi- und Thrillerliteratur spezialisierten Buchhandlung in Philadelphia, eintraf, teilte der Geschäftsführer ihm bedauernd mit, dass vermutlich nicht allzu viele Zuhörer zu erwarten waren. Es war der Dienstag nach Ostern, viele Leute waren noch im Urlaub, und außerdem regnete es.
Doch dann erlebten sie beide eine positive Überraschung. Fünfundzwanzig Besucher waren erschienen, um seine Lesung zu hören und sich mit ihm über sein kontrovers diskutiertes, auf wahren Begebenheiten beruhendes Buch Der perfekte Verbrecher auseinanderzusetzen.
Der Geschäftsführer stellte ihn mit folgenden Worten dem Publikum vor: »Marcus Sunday besitzt einen Doktortitel der Universität Harvard in Philosophie und hat mit diesem Buch überall im Land die Bestsellerlisten gestürmt. Es bietet seinen Lesern eine faszinierende Perspektive auf zwei ungeklärte Mordfälle. Freuen Sie sich also auf eine Reise tief ins Innerste der kriminellen Seele unter kundiger Führung eines wahrhaft originellen Denkers.«
Die Zuhörer applaudierten, und Sunday, ein groß gewachsener, schlanker Mann Ende dreißig, trat ans Rednerpult. Er trug eine schwarze Lederjacke, eine Jeans und ein frisches, weißes Hemd.
»Vielen Dank, dass Sie sich an so einem regnerischen Abend nach draußen gewagt haben«, sagte er. »Ich freue mich sehr, hier bei Whodunit Books zu Gast sein zu dürfen.«
Dann sprach er über die Morde.
Vor sieben Jahren, zwei Tage vor Weihnachten, um genau zu sein, war die fünfköpfige Familie Daley in einem Vorort von Omaha niedergemetzelt worden. Vier Familienmitglieder hatten mit durchgeschnittenen Kehlen in ihren Betten gelegen, nur die Ehefrau und Mutter hatte man nackt im Badezimmer gefunden, ebenfalls mit durchtrennter Kehle. Entweder war die Haustür unverschlossen gewesen, oder der Mörder hatte einen Schlüssel gehabt. Da in der Nacht ein Schneesturm gewütet hatte, hatte der Täter keinerlei Spuren hinterlassen.
Vierzehn Monate später, im Anschluss an ein schweres Gewitter, hatte man in einem Vorort von Fort Worth die Familie Monahan unter ganz ähnlichen Umständen vorgefunden: den Vater sowie die vier Kinder – keines älter als dreizehn Jahre – mit aufgeschlitzten Kehlen in ihren Betten, die Mutter unbekleidet und ebenfalls mit zerfetzter Kehle auf dem Boden des Badezimmers. Auch diese Tat ließ sich nur so erklären, dass die Tür nicht abgeschlossen gewesen war oder der Täter einen Schlüssel gehabt hatte. Und auch in diesem Fall war es der Polizei aufgrund des Sturms und des sorgfältigen Vorgehens des Täters nicht gelungen, verwertbare Indizien zu sichern.
»Dieses Fehlen aller Beweise, dieses vollkommene Nichts, das hat mich interessiert«, teilte Sunday seinem gebannt lauschenden Publikum mit.
Zuerst habe ihn dieser Mangel verwirrt. Und im Gespräch mit den beteiligten Ermittlern hatte er erfahren, dass diese gleichermaßen ratlos waren. Doch dann hatte sein wissenschaftlich geschulter Verstand angefangen, über die philosophische Weltsicht eines solchen Täters nachzudenken.
»Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es sich hier um einen Existenzialisten mit einer seltsam grotesken Weltsicht handeln muss«, fuhr er fort. »Um einen Menschen, der das Leben für vollkommen sinnlos, absurd und wertlos hält. Der an absolut nichts glaubt, weder an Gott noch an das Gesetz noch an irgendeine andere moralische oder ethische Instanz.«
In diesem Stil machte Sunday noch eine ganze Weile weiter. Er las etliche Stellen aus seinem Buch vor und erläuterte, wie die Indizienlage rund um die Schauplätze der Morde seine kontroversen Thesen gestützt und zu weiteren Thesen geführt hatte. Nur dadurch, dass der Mörder nicht an ein Gut oder Böse glaubte, so Sundays These, konnte er ein »perfekter« Verbrecher sein, weil er keinerlei Schuldgefühle empfand. Und nur dadurch war er in der Lage, solch haarsträubende Taten mit einer vollkommen unbeteiligten, emotionslosen Präzision auszuführen.
Ein Mann hob die Hand. »Das klingt ja fast so, als würden Sie den Täter bewundern.«
Sunday schüttelte den Kopf. »Ich versuche lediglich, seine Weltsicht so genau wie möglich zu beschreiben, um meinen Lesern ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ermöglichen.«
Eine Frau mit aschblondem Haar – nicht schön im klassischen Sinn, aber dennoch attraktiv – meldete sich. Dabei wurde die Tätowierung auf ihrem Unterarm sichtbar, ein Panther inmitten einer farbenprächtigen Dschungelwelt.
»Ich habe Ihr Buch gelesen«, sagte sie mit hörbarem Südstaatenakzent. »Und es hat mir gefallen.«
»Ich bin erleichtert«, erwiderte Sunday.
Etliche Zuhörer kicherten leise.
Die Frau lächelte. »Könnten Sie vielleicht noch etwas zu Ihrer Theorie des Gegenspielers des perfekten Verbrechers sagen? Dem perfekten Ermittler?«
Sunday zögerte einen Moment, dann sagte er: »Ich habe spekuliert, dass der perfekte Killer nur durch einen Ermittler zur Strecke gebracht werden kann, der die genaue Antithese zu ihm bildet – einen Ermittler, der an Gott glaubt, der das moralische, ethische Universum und den Sinn des Lebens gewissermaßen verkörpert. Das Problem ist nur, dass dieser perfekte Ermittler nicht existiert, dass er gar nicht existieren kann.«
»Und warum nicht?«, wollte sie wissen.
»Weil Kriminalbeamte Menschen sind und keine Monster wie der perfekte Verbrecher.« Er registrierte die Verwirrung auf den Gesichtern einiger Zuhörer. Sunday lächelte. »Lassen Sie es mich so ausdrücken: Können Sie sich vorstellen, dass ein kaltblütiger, berechnender Massenmörder sich schlagartig in einen edlen Ritter verwandelt, der immer das Richtige tut und seinen Mitmenschen unermüdlich zur Seite steht?«
Die Zuhörer schüttelten den Kopf.
»Ganz genau«, fuhr Sunday fort. »Der perfekte Verbrecher ist und bleibt der, der er ist. Solche Ungeheuer verändern sich nicht.« Er machte eine kurze, effektvolle Pause. »Aber wie ist es mit der Vorstellung, dass ein Kriminalpolizist angesichts der Grausamkeiten, denen er bei seiner Arbeit tagtäglich ausgesetzt ist, seinen Idealismus verliert? Seinen Glauben an Gott? Wie schwierig ist es, sich vorzustellen, dass ihn das alles so deprimiert, dass er keinen Sinn, keinen Wert, keine Hoffnung mehr sieht, dass er selbst ein existenzialistisches Monster und ein perfekter Verbrecher wird? Nicht besonders schwierig, oder?«
2 Nachdem Sunday zwei Dutzend Bücher signiert hatte, lehnte er die Einladung des Geschäftsführers zum Abendessen höflich ab, weil er angeblich noch mit einem alten Freund verabredet sei. Als er die Buchhandlung verließ, hatte es aufgehört zu regnen.
Er überquerte die Twentieth Street und ging an einem Dunkin’ Donuts vorbei, als die Frau mit dem Panther-Tattoo sich neben ihn schob und sagte: »Das ist gut gelaufen.«
»Es kann nie schaden, die geheimnisvolle Acadia Le Duc mit im Publikum zu haben.«
Acadia lachte und hakte sich bei ihm unter. »Sollen wir uns eine Kleinigkeit zu essen besorgen, bevor wir nach Washington zurückfahren?«
»Erst will ich noch die Abfahrt beobachten«, erwiderte er.
»Es ist alles in Ordnung«, sagte sie in beschwichtigendem Tonfall. »Ich habe doch selbst gesehen, wie du ihn versiegelt hast. Wir sind für sechzig Stunden – na gut, achtundfünfzig von mir aus – auf der sicheren Seite. Im Notfall könnten es sogar siebzig sein.«
»Ich weiß«, entgegnete er. »Aber ich bin eben ein bisschen obsessiv.«
»Also gut.« Acadia seufzte. »Aber danach gehen wir zum Thailänder.«
»Versprochen.«
Zwei Querstraßen weiter setzten sie sich in einen neuen Dodge Durango und fuhren quer durch die Stadt bis zum menschenleeren Eagles-Stadion in der Darien Street. Dort bog Sunday nach links auf einen riesigen Supermarkt-Parkplatz ab und hielt am hintersten Ende vor dem Metallzaun, wo sie unter dem Delaware Expressway hindurch freie Sicht auf den Güterbahnhof hatten.
Sunday griff nach einem Fernglas und entdeckte in knapp hundert Metern Entfernung das gesuchte Objekt: eine lange Reihe aneinandergekoppelter Güterwaggons, darunter auch einer mit einem rostroten Fünfundvierzig-Fuß-Container, dessen Dach von vorn bis hinten mit Solarmodulen bestückt war. Aus der Vorderfront ragte eine Klimaanlage hervor. Er ließ das Fernglas sinken, schaute auf seine Armbanduhr und sagte: »In einer Viertelstunde müsste es eigentlich losgehen.«
Gelangweilt ließ Acadia sich an ihre Sitzlehne sinken. »Und wann nimmt Mulch Kontakt mit Cross auf?«
»Am Freitagmorgen. Da bekommt Dr. Alex eine unmissverständliche Nachricht«, erwiderte Sunday. »Dann ist es eine Woche her. Dann ist er bereit.«
»Aber am Freitag müssen wir allerspätestens nachmittags um fünf in St. Louis sein.«
Sunday war ungehalten. Acadia war die klügste und unberechenbarste Frau, die er kannte. Aber sie hatte die unangenehme Angewohnheit, ihn ständig an Dinge zu erinnern, über die er sich vollkommen im Klaren war.
Doch bevor er ihr genau das mitteilen konnte, registrierte er eine Bewegung auf dem Bahnhof. Er hob das Fernglas vor die Augen und sah einen dunkel gekleideten, jungen Schwarzen an den Güterwaggons entlangschleichen. Er trug Handschuhe, einen kleinen Rucksack und hielt ein Stemmeisen in der Hand. Jetzt blieb er stehen und betrachtete die Solarmodule.
»Scheiße«, sagte Sunday.
»Was denn?«
»Sieht fast so aus … Scheiße!«
»Was denn?«, wiederholte Acadia.
»Irgend so ein Arschloch will unseren Waggon aufbrechen«, sagte er.
»Gibt’s doch nicht.« Sie beugte sich vor und starrte in die Schatten des Güterbahnhofs. »Woher soll er denn …«
»Tut er nicht«, fiel Sunday ihr ins Wort. »Ist reiner Zufall. Oder er hat die Solarmodule gesehen.«
»Und was machen wir jetzt?«
»Da gibt es nur eine Möglichkeit.«
Sechzig Sekunden später befanden sie sich auf der anderen Seite des Zauns. Unter der Brücke teilten sie sich auf und huschten geduckt im Schutz einer Böschung, die neben den Gleisen verlief, in unterschiedliche Richtungen davon. Sunday hatte den Wagenheber in der Hand und blieb erst siebzig Meter hinter dem rostroten Container stehen. Der Bahnhof war beleuchtet, wenn auch weniger gut als auf der Nordseite. Trotzdem – erst, wenn er den Schatten des Zuges erreicht hatte, würde er nicht mehr zu sehen sein.
Aber er hatte keine andere Wahl. Er kletterte über den Erdwall und huschte so lautlos wie irgend möglich über die Gleise, wissend, dass Acadia auf der Nordseite genau dasselbe machte. Dann hatte er den Schatten erreicht, in dem er den Schwarzen hatte herumschleichen sehen. Der Container mit den Solarmodulen war sechs Waggons entfernt. Er blieb stehen und wartete ab. Dann vibrierte sein Handy und zeigte ihm eine neue SMS.
Schnell ging Sunday weiter, bis er neben dem rostroten Container stand. Er hörte ein metallisches Kratzen, hörte, wie das Stemmeisen das Vorhängeschloss bearbeitete.
Er wartete, bis sein Handy erneut vibrierte, dann packte er den Wagenheber mit beiden Händen wie einen Vorschlaghammer.
»Was soll das denn werden, wenn’s fertig ist?«, ertönte im selben Augenblick Acadias Stimme. Sie stand auf der anderen Seite des Waggons.
»Fick dich, du Schlampe«, mehr konnte der Dieb nicht sagen, bevor Sunday um die Ecke huschte und ihn auf der Waggonkupplung stehen sah, von wo er Acadia mit seinem Stemmeisen bedrohte.
Sundays Wagenheber traf ihn mit voller Wucht am Knie. Er stöhnte vor Schmerz auf und fiel auf Acadias Seite zu Boden. Sunday sprang über die Waggonkupplung und war schon bei dem Kerl, noch bevor dieser reagieren konnte.
Dieses Mal zielte er auf den Kopf und machte den Möchtegernräuber mit einem Schlag bewusstlos. Der dritte Hieb kam dann etwas gezielter und zerschmetterte die Schädeldecke des jungen Schwarzen.
Schwer atmend blickte Sunday Acadia an, die seinen Blick mit leuchtenden Augen und geblähten Nüstern erwiderte. Wie jedes Mal nach einem Mord wurde sie von einer mächtigen sexuellen Gier erfasst.
»Marcus«, sagte sie. »Ich bin plötzlich …«
»Später«, unterbrach er sie bestimmt und deutete auf den Güterzug auf dem Nachbargleis. »Hilf mir, ihn unter den Zug da zu schieben. Wenn wir Glück haben, wird er erst morgen früh entdeckt. Oder noch später.«
Sie packten den Toten unter den Achselhöhlen, schleiften ihn die drei Meter zu dem anderen Zug und legten ihn zwischen die Gleise mit dem Gesicht nach unten unter einen Waggon.
Da ertönte ein leises Quietschen, und sie zuckten zusammen.
Der Güterzug setzte sich langsam Richtung Westen in Bewegung. Der Container mit den Solarmodulen war unterwegs.
3 »Carter Billings war der Wahnsinn!«, rief Ali im Dämmerlicht. »Beim allerersten Schlag!«
Mein Siebenjähriger rannte voraus, hüpfte die Eingangstreppe zu unserem Haus empor und stellte sich mit ausladenden Bewegungen in Schlagposition, während er den aufblasbaren Baseballschläger, den ich ihm vorhin geschenkt hatte, wie wild durch die Luft schwang.
Er schnalzte laut mit der Zunge und lieferte eine recht brauchbare Imitation von Billings’ übermütigem und leidenschaftlichem Lauf um das Infield, nachdem der Neuling mit seinem allerersten Schlag überhaupt nicht nur einen atemberaubenden Home Run geschlagen, sondern seinen Nationals damit im ersten Saisonspiel auch den Sieg beschert hatte.
Ich hatte die Tickets über einen alten Freund bekommen, und wir waren alle dabei gewesen, um diesen wundervollen Augenblick mitzuerleben – Ali, meine Frau Bree, mein ältester Sohn Damon, meine Tochter Jannie und meine Großmutter Nana Mama mit ihren über neunzig Jahren. Während Ali seinen Jubellauf beendete, klatschten wir stürmisch Beifall und drängten uns durch die Tür unseres Häuschens in der Fifth Street in Southeast Washington, D. C.
In den vergangenen Wochen war im Hause Cross viel umgebaut und renoviert worden. Die Küche wurde neu gestaltet, und wir sollten einen Anbau bekommen, damit wir unten ein größeres Wohnzimmer und im ersten Stock ein neues Schlafzimmer einrichten konnten. Als wir zum Spiel gefahren waren, hatte alles noch genau so ausgesehen, wie die Bauarbeiter es am Karfreitag hinterlassen hatten – die Außenwände standen, die Fenster waren eingebaut und das Dach fertig. Das Ganze war eine staubige, leere Hülle, vom Haupthaus durch eine Plastikfolie abgetrennt.
Doch als Nana Mama die ersten Schritte ins Innere des Hauses gemacht hatte, blieb sie abrupt stehen und rief laut: »Alex!«
Ich eilte zu ihr, weil ich befürchtete, dass irgendeine Katastrophe passiert war, aber meine Großmutter blickte mich freudestrahlend an. »Wie hast du das bloß geschafft?«, sagte sie.
Ich blickte über ihre Schulter hinweg und sah, dass der Anbau und die Küche fertig waren. Komplett fertig. Die Schränke hingen an den Wänden. Die italienischen Fliesen waren verlegt. Der feuerrote Gastronomieherd mit den sechs Flammen war fertig installiert, genau wie der farblich darauf abgestimmte Kühlschrank und die Spülmaschine. Und das neue Wohnzimmer jenseits der Küche war komplett neu eingerichtet. Es sah aus wie frisch aus dem Katalog eines Möbelhauses.
»Wie ist das denn möglich, Alex?«, stieß Bree hervor.
Ich war genau so sprachlos wie der Rest meiner Familie. Es kam mir vor, als hätte ein Flaschengeist uns hundert Wünsche gleichzeitig erfüllt. Die Kinder rannten durch die Küche in das neue Wohnzimmer, um die Sofas und die plüschigen Sessel auszuprobieren, während Nana Mama und Bree die Arbeitsplatten aus schwarzem Granit, die Edelstahlspüle und die Zinnleuchten bewunderten.
Meine Aufmerksamkeit galt jedoch einem Blatt Papier im DIN-A4-Format, das mit Magneten an der Kühlschranktür befestigt war. Zuerst dachte ich, es sei ein Brief der Baufirma, in dem sie uns zu unserer neuen Einrichtung beglückwünschten.
Aber dann sah ich, dass auf dem Blatt fünf Fotos nebeneinander abgebildet waren. Die Bilder waren nur schwer zu erkennen, darum trat ich näher. Und dann packte mich das nackte Grauen.
Auf jedem Foto war eines meiner Familienmitglieder zu sehen. Sie lagen auf einem Betonfußboden, den Kopf in einer Blutlache, ausdruckslos und mit stumpfen Augen. Alle hatten über dem linken Ohr, ein wenig nach hinten versetzt, eine hässliche, klaffende Wunde, wie von einem Schuss aus nächster Nähe.
Irgendwo in der Ferne jaulte eine Sirene.
»Nein!«, brüllte ich.
Doch als ich mich umdrehte, um mich zu vergewissern, dass die Fotos nicht echt waren, da waren meine Kinder, meine Frau und meine Großmutter verschwunden. Hatten sich einfach in Luft aufgelöst. Bis auf die widerlichen Fotos an der Kühlschranktür war nichts mehr von ihnen übrig.
Ich bin allein, dachte ich.
Allein.
Der Schmerz bohrte sich wie eine stählerne Klinge in meinen Schädel. Ich befürchtete ernsthaft einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt, sank auf die Knie, ließ den Kopf hängen und reckte meine Arme zum Himmel empor.
»Warum, Mulch?«, schrie ich. »Warum?«
4 Im Morgengrauen wurde ich wach, schreckte ruckartig auf und spürte sofort wieder das dumpfe Pochen in meinem Schädel. Zuerst hatte ich keine Ahnung, wo ich überhaupt war, bis ich im Halbdunkel schemenhaft mein eigenes Schlafzimmer erkannte. Ich lag im Bett, immer noch in Arbeitskleidung und vollkommen durchgeschwitzt. Ohne nachzudenken, streckte ich den Arm nach meiner schlafenden Frau aus.
Aber Bree war nicht da, und das war der Moment der eiskalten Erkenntnis. Wieder einmal war ich in einer Wirklichkeit aufgewacht, die schlimmer war als jeder Albtraum.
Meine Frau war verschwunden. Alle waren verschwunden.
Und ein Wahnsinniger namens Thierry Mulch hatte sie in seiner Gewalt.
Ich war wild entschlossen, mich seinem Wahnsinn nicht zu beugen, drehte mich um und drückte meine Nase in Brees Kissen. Ich wollte ihren Duft riechen. Das brauchte ich, um stark zu bleiben, um meinen Glauben und meine Hoffnung aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich konnte ich noch einen Hauch von ihr wahrnehmen. Aber ich wollte mehr. Ich brauchte mehr. Also stand ich auf, ging zu ihrem Schrank und vergrub, so seltsam es sich auch anhören mag, mein Gesicht in ihren Kleidern.
Etliche Minuten lang ließ ich Brees vollkommenen Duft in mein Gehirn einsinken, so tief, dass meine Kopfschmerzen verschwanden und sie ganz dicht bei mir war, diese wunderschöne, kluge, fröhliche Frau, die da fast greifbar durch meine Erinnerungen tanzte. Doch das Gefühl, sie bei mir zu haben, verebbte viel zu schnell wieder, und auch die Düfte in ihrem Schrank veränderten sich, rochen plötzlich schal und sauer.
Ich erstarrte.
War das in den anderen Zimmern auch so? Würden die Düfte dort auch verschwinden?
Hundeelend und voller Angst vor dem, was mich erwartete, zwang ich mich, Alis Zimmertür zu öffnen. Mit angehaltenem Atem trat ich ein und machte die Tür hinter mir zu. Ich ließ das Licht aus, wollte keinen zweiten Sinn aktivieren, wollte mich nur auf den einen konzentrieren.
Als ich dann schließlich wagte, Luft zu holen, war Alex juniors Kleiner-Jungen-Duft allgegenwärtig. Ich konnte seine Stimme hören und spürte, wie gut es tat, ihn im Arm zu halten. Ich musste daran denken, wie er sich manchmal, wenn er müde war, in meinen Arm kuschelte.
Als Nächstes betrat ich Jannies Zimmer. Doch die Luft dort machte mich eher ratlos und ein bisschen nervös. Ich schätze, dass ich mich nach Düften längst vergangener Zeiten gesehnt hatte. Aber Jannie stand kurz vor dem Abschluss ihres ersten Highschooljahrs und war bereits der Star ihres Leichtathletikteams. Ich stand lange stumm in ihrem stockdunklen Zimmer, überwältigt von der Erkenntnis, dass mein kleines Mädchen eine junge Frau geworden und dann verschwunden war, zusammen mit allen anderen Mitgliedern meiner Familie.
Mit zitternden Fingern griff ich nach Nana Mamas Türklinke und drückte sie nach unten. Ich trat ein, machte die Tür hinter mir zu und sog ihren Fliederduft ein. Doch dann stürmten Dutzende Erinnerungen auf mich ein, und ich fühlte mich sehr plötzlich sehr beengt. Ich musste auf der Stelle das Zimmer verlassen.
Also machte ich die Tür hinter mir zu und ging nach oben. In meinem Arbeitszimmer unter dem Dach war die Luft vermutlich besser. Dort konnte ich klarer denken. Aber schon nach den ersten Stufen wurde mir zu meiner großen Erschütterung bewusst, dass ein bestimmter Duft bereits nicht mehr vorhanden war.
Damon, mein siebzehnjähriger Erstgeborener, besuchte eine Privatschule in Massachusetts und war seit zwei Monaten nicht mehr zu Hause gewesen. Die Vorstellung, dass ich ihn womöglich nie wieder riechen würde, ließ meine allerletzten Kräfte schwinden.
Ich dachte an die Fotos, die durch meine Träume spukten. Waren es Inszenierungen, die mir vor Augen führen sollten, was noch alles auf mich zukam? Meine Kopfschmerzen wurden unerträglich. Ich drehte durch, raste in mein Arbeitszimmer und stellte mich direkt vor eine Kamera, die versteckt zwischen zwei Fachbüchern in meinem Bücherregal stand.
»Warum, Mulch?«, brüllte ich. »Was habe ich Ihnen getan? Womit habe ich das verdient? Was wollen Sie von mir, verdammt noch mal? Los, sagen Sie schon! Was zum Teufel wollen Sie von mir?«
Aber ich erhielt keine Antwort. Das kleine Objektiv starrte mich nur stumm an. Ich packte die Kamera, riss das Kabel ab und zertrat sie mit dem Absatz.
Scheiß auf Mulch oder Elliot und wie immer er sich nennen mochte. Es war mir egal, dass ich ihm gerade eben gezeigt hatte, dass wir über die Wanzen und die Kameras Bescheid wussten. Scheiß drauf!
Keuchend wischte ich mir den Schweiß von der Stirn. Dann beschloss ich, alle Abhörgeräte im Haus zu zerstören, bevor sie mich zerstörten.
Draußen auf der Straße bellte ein Hund, und dann hämmerte jemand gegen meine Haustür.
5 Ich machte die Tür auf und sah mich einer kleinen, sportlich-attraktiven Mittdreißigerin mit braunen Haaren gegenüber. Sie machte ein Gesicht, als wäre sie jetzt am liebsten irgendwo anders gewesen, ganz egal wo, nur nicht auf meiner Eingangsveranda, und streckte mir ihre Dienstmarke entgegen.
»Herr Dr. Cross«, sagte sie. »Ich bin Detective Tess Aaliyah. Ich arbeite bei der Mordkommission der Metro Police.«
»Ach, tatsächlich?«, erwiderte ich, weil ich sie noch nie zuvor gesehen hatte.
»Erst seit letzter Woche. Davor war ich bei der Mordkommission in Baltimore, Sir«, gab Detective Aaliyah zurück. »Als Sie die Massagesalon-Morde und die Sache mit den entführten Babys aufgeklärt haben.«
Für einen kurzen Augenblick war ich verwirrt und wusste gar nicht, was sie meinte, aber dann fiel es mir wieder ein. Es kam mir vor, als sei das alles eine Ewigkeit her und nicht erst eine Woche. Ich nickte. »Und dann auch noch ganz ohne Partner, Detective … ääh …«
»Aaliyah«, half sie mir und blickte mich mit schief gelegtem Kopf an. »Chris Daniels ist mein Partner, aber er hat sich heute Morgen beim Hanteltraining anscheinend den Knöchel verstaucht.«
Ich verzog das Gesicht und nickte. »Daniels ist ein guter Mann.«
»Den Eindruck habe ich bis jetzt auch«, meinte sie zustimmend. Dann schluckte sie und starrte den Verandaboden an.
»Was kann ich für Sie tun, Detective?«
Aaliyah stieß kurz und heftig den Atem aus, dann sah sie mich an. »Sir, ein paar Querstraßen weiter hat man auf einer Baustelle einen weiblichen Leichnam entdeckt. Eine Afroamerikanerin. Sie wurde schwer misshandelt, und es tut mir leid, Dr. Cross, aber wir haben bei ihr auch die Dienstmarke und den Ausweis Ihrer Frau gefunden. Ist sie vielleicht hier?«
Ich wäre beinahe zusammengebrochen, konnte mich gerade noch am Türgriff festhalten und hervorstoßen: »Sie ist spurlos verschwunden.«
»Verschwunden?«, hakte die Detective nach. »Seit …«
»Bringen Sie mich hin«, sagte ich. »Ich will es mit eigenen Augen sehen.«
Ich verbrachte die zweiminütige Fahrt in fast völliger Erstarrung. Aaliyah stellte mir eine Frage nach der anderen, und ich antwortete immer nur: »Ich muss sie sehen.«
Streifenwagen tauchten vor uns auf, gelbes Absperrband, alles vertraute Dinge, die mir aber nicht den geringsten Trost spendeten. Ich habe schon mehr Mordschauplätze gesehen, als ich zählen kann, aber noch nie hatte ich auch nur annähernd solche Angst vor dem gehabt, was da auf mich zukam, als an diesem Morgen. Ich ging neben Detective Aaliyah her an einem Streifenbeamten vorbei, der den Zugang zu der von einem Maschendrahtzaun geschützten Baustelle bewachte.
»Sie liegt da unten, Sir«, sagte Aaliyah.
Ich ging bis zur Kante und blickte in das Loch hinab, in dem die Fundamente gelegt werden sollten.
Steine und Armiereisen lagen auf dem Boden der Baugrube verstreut und warteten darauf, mit Zement übergossen zu werden. Und dann war da noch eine Frau zu sehen. Sie lag auf der Seite, hatte Brees Statur und Haarfarbe und wandte mir den Rücken zu, der von zahlreichen ovalen Wunden und verklebten Blutspuren übersät war. Sie trug denselben BH und dasselbe Höschen, das Bree am Karfreitag getragen hatte. Und da lag auch Brees Armbanduhr.
Ich taumelte ein bisschen dichter an die Kante. Blitze zuckten durch meinen Schädel, und ich war mir sicher, dass ich gleich hinunterstürzen würde. Aber Detective Aaliyah hielt mich am Ellbogen fest.
»Ist sie es, Dr. Cross?«, erkundigte sie sich. »Ist das Bree Stone?«
Ich starrte sie dumpf an. »Ich muss erst nachsehen.«
Wir gingen zu einer Leiter, und ich muss wohl irgendwie hinuntergeklettert sein, obwohl ich mich beim besten Willen nicht daran erinnern kann. Bei jedem Schritt brach mir das Herz. Jeder Handgriff war der letzte.
Ich stieg über das Durcheinander der Armiereisen und sah sie mir von vorn an. Die Ohrringe waren jedenfalls genau dieselben, die ich Bree zum Hochzeitstag geschenkt hatte.
Ein Stöhnen, wie ich es noch nie gehört hatte, drang aus meiner Brust.
Ich machte noch einen Schritt auf sie zu und sah, dass ihr Gesicht bis zur Unkenntlichkeit zerschmettert war und dass die ovalen Wunden sich auch über die Vorderseite ihres Körpers erstreckten. Es sah aus, als hätte ihr jemand mit einer Gartenschere alle zehn bis fünfzehn Zentimeter ein Stück Haut abgeschnitten, bis hin zu dem Verlobungsring, den ich ihr geschenkt hatte, zu ihrem Ehering, zu den blutigen Stummeln, wo eigentlich ihre Fingerspitzen hätten sein müssen. Ihr Mund stand offen, und sie hatte keine Zähne mehr.
»Großer Gott«, flüsterte ich in abgrundtiefem Entsetzen und sank vor ihr auf die Knie. »Was hat dieses kranke Arschloch dir angetan?«
6 »Ist das Ihre Frau, Herr Dr. Cross?«, wollte Detective Aaliyah wissen.
Ich starrte den verstümmelten Leichnam an, der da vor mir lag, die Haare, die Hautfarbe, die Größe, die Statur, den Schmuck, und sagte: »Ich weiß nicht. Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht sicher. Sie … in diesem Zustand kann ich es nicht erkennen.«
»Wo waren Sie gestern Abend?«, wollte sie wissen.
Während ich bei der Toten nach eindeutigen Hinweisen suchte, ob es Bree war oder nicht, erwiderte ich: »Ich war zu Hause, Detective, und habe mir alte Folgen von The Walking Dead angeschaut.«
»Wie bitte?«
»Diese Fernsehserie über eine Zombie-Apokalypse. Mein Sohn Ali sieht die wahnsinnig gern.«
»Und war er auch dabei?«
Ich schüttelte den Kopf, spürte, wie mir die Tränen über die Wangen liefen, und sagte: »Er ist auch verschwunden. Sie sind alle verschwunden. Hat Ihnen das niemand gesagt? John Sampson? Captain Quintus? Das FBI?«
»FBI?«, wiederholte sie. »Nein, ich war auf dem Weg zur Arbeit, habe die Funkdurchsage gehört und bin direkt hierhergefahren. Wie wär’s, wollen wir den Kriminaltechnikern Platz machen? Und dann erzählen Sie mir am besten alles, was ich wissen muss.«
Ich kniete noch ein paar Sekunden länger vor der Toten und hatte dabei Bilder von Bree vor meinem geistigen Auge, die das Ganze surreal und absolut unerträglich werden ließen.
»Dr. Cross?«
Ich nickte, kam schwankend auf die Füße und schaffte es, ohne Zwischenfall die Leiter hochzuklettern. Wir setzten uns in ihr Zivilfahrzeug.
»Dann lassen Sie mal hören«, sagte sie in professionellem Tonfall.
Im Verlauf der nun folgenden fünfunddreißig Minuten breitete ich den ganzen Irrsinn der vergangenen Wochen vor ihr aus und versuchte, keine einzige wichtige Einzelheit auszulassen.
»Der erste Kontakt mit Thierry Mulch, das waren seine seltsamen, spöttischen Briefe über die Massagesalon-Morde. Darin hat er mich als Idioten beschimpft und ein paar Theorien entwickelt, die, wie ich zugeben muss, bei der Festnahme des Täters von unschätzbarem Wert waren. Etwas später hat er sich dann als Internet-Unternehmer ausgegeben und an der Schule meines Sohnes Ali einen Vortrag gehalten.
Ich habe ihn gegoogelt und genau sieben Personen mit diesem Namen gefunden. Einer davon war tatsächlich ein Internet-Unternehmer. Aber da ich damals bis zum Hals in den Ermittlungen rund um diese Massagesalon-Morde gesteckt habe, habe ich das als reinen Zufall abgetan. Doch es hat sich schnell herausgestellt, dass dieser Mulch sich intensiv mit mir und meiner Familie beschäftigt hatte«, fuhr ich fort. »Er hat Kameras und Abhörmikrofone in unserem Haus versteckt, vermutlich, um unsere Gewohnheiten und unseren Alltag kennenzulernen, weil er nämlich am vergangenen Freitag – am Karfreitag – innerhalb weniger Stunden alle anderen entführt hat, sogar meinen Sohn Damon, der in den Berkshires im Westen von Massachusetts zur Schule geht.«
»Und wieso habe ich bisher kein Sterbenswörtchen von alldem gehört?«, wollte sie wissen. »Woher wissen Sie überhaupt, dass dieser Mulch Ihre Familie in seiner Gewalt hat?«
»Das kann ich Ihnen erklären.«
Aaliyah nickte, und ich erzählte ihr, wie Mulch mir am Karfreitagabend über das Handy meiner Tochter Fotos von allen Familienmitgliedern geschickt hatte, gefesselt und mit zugeklebten Mündern. Außerdem hatte er mir Textnachrichten geschickt und gedroht, dass er sie alle umbringen wird, wenn ich die Polizei oder das FBI einschalte. Am Samstagnachmittag stand dann John Sampson vor meiner Haustür. Er ist mein bester Freund und mein Partner bei der Metro Police. Er hatte sich Sorgen gemacht, weil ich mich gar nicht gemeldet hatte.
»Ich habe John wieder weggeschickt, ohne ihm ein Sterbenswörtchen zu verraten, aber Mulch hat das überhaupt nicht interessiert«, sagte ich und fischte mein Handy aus der Hosentasche. »Dann habe ich diese Bilder geschickt bekommen, immer eines pro Stunde.«
Ich gab ihr das Handy und bat sie, die Fotogalerie aufzurufen. Kurz darauf starrte sie mit entsetzter Miene auf das Display und die Bilder meiner Angehörigen, alle mit einer tödlichen Kopfwunde.«
»Sind die echt?«, erkundigte sie sich.
»Nein. Aber das habe ich damals noch nicht gewusst.«
Dann erzählte ich Aaliyah, wie ich nach dem ersten Betrachten der Bilder vollkommen am Boden zerstört gewesen war. Dass ich wie ein Zombie durch Washington gelaufen war, in der düsteren Hoffnung, irgendjemand würde mir den Schädel wegpusten. Schlussendlich war ich in einem Crack-Haus gelandet und hatte die Junkies gebeten, mich umzubringen, ja, ich hatte ihnen sogar Geld dafür geboten. Und irgendjemand hatte es versucht und mir eine Eisenstange über den Schädel gezogen.
Doch dann hatte Ava mich gefunden, auch eine Süchtige, die aber eine Zeit lang bei uns im Haus gewohnt hatte. Sie brachte mich nach Hause, und ich erzählte ihr alles. Anschließend war ich mit einer Gehirnerschütterung bewusstlos zusammengebrochen.
»Ava ist sehr intelligent und kann hervorragend mit Computern umgehen«, fuhr ich fort. »Während ich geschlafen habe, hat sie die Bilder auf einen Laptop überspielt und sie so vergrößert, dass man die Manipulationen erkennen konnte.«
Mit dieser Information hatte Ava sich an Sampson und Ned Mahoney gewandt, meinen ehemaligen Partner in der Abteilung für Verhaltensanalyse beim FBI. Ava konnte die beiden davon überzeugen, dass meine Familie gar nicht tot war.
Anschließend fanden Sampson und Mahoney eine Möglichkeit, sich in mein Haus zu schleichen, ohne dass Mulchs Wanzen etwas davon mitbekamen. Es stellte sich heraus, dass eine Frau in Alexandria, Virginia, von einem Mann vergewaltigt worden war, der sich Thierry Mulch genannt hatte. Und die DNA-Spuren, die dort am Tatort gefunden wurden, passten zur DNA eines brillanten, einzelgängerischen Computertechnik-Studenten an der George Mason University, der seit zwei Wochen spurlos verschwunden war.
»Sein Name ist Preston Elliot. Angesichts der hochmodernen Abhörtechnik, die Mulch in meinem Haus installiert hat, haben wir von Anfang an vermutet, dass Elliot und Mulch ein und dieselbe Person sind. Wir haben die Wanzen also an Ort und Stelle gelassen und beschlossen, dass ich weiterhin so tun sollte, als sei ich vom Tod meiner gesamten Familie überzeugt. Mulch/Elliot sollte glauben, dass ich vollkommen am Boden bin – ein Opfer und keinesfalls eine Bedrohung. Außerdem haben wir beschlossen, die Suche nach meiner Familie unter Verschluss zu halten. Aber die Tage sind vergangen, und jetzt ist es schon eine Woche her. Und wir haben nichts von ihm gehört. Bis … jetzt.«
Mit regungsloser Miene ließ Detective Aaliyah sich das alles durch den Kopf gehen. Nach mehreren Minuten sagte sie dann: »Glauben Sie, dass Mulch … äh, Elliot für den Tod Ihrer … dieser Frau verantwortlich ist?«
»Mit Sicherheit«, erwiderte ich. »Das ist überhaupt keine Frage.«
Aaliyah überlegte kurz. »Was hat er davon, dass er Ihnen und Ihrer Familie das alles antut?«
»Ich habe aufgehört, mir diese Frage zu stellen«, lautete meine Antwort. »Aber ganz egal, was für einen kranken, hirnrissigen Grund er dafür auch haben mag, für mich fühlt es sich an wie die brutalste Folter. Als wollte er mich immer wieder an den äußersten Rand des Erträglichen bringen, in der Hoffnung, dass ich irgendwann springe.«
Sie legte den Kopf ein wenig schief und fragte: »Und? Werden Sie es tun?«
»Wenn sich herausstellen sollte, dass das da unten in der Baugrube Bree ist, dann, ganz ehrlich, weiß ich’s nicht.«
7 Alles in allem war Marcus Sunday mit der Entwicklung sehr zufrieden. Trotz der einen oder anderen kleinen Abweichung vom ursprünglichen Plan hatte er das Gefühl, genau auf Kurs zu sein.
Jetzt saß er auf dem Beifahrersitz des Durango und starrte auf den Monitor eines Laptops, um einen Videostream zu verfolgen. Die Bilder stammten aus einer winzigen Kamera, die er vor etlichen Wochen schon hoch oben in einem Baum direkt neben der Baustelle versteckt hatte.
Er hatte alles mit angesehen … wie Cross vor der Toten auf die Knie gefallen war, wie er lange Zeit dort gekauert hatte, am Boden zerstört.
»Es kann nicht mehr lange dauern«, sagte er zu Acadia, die auf der Rückbank saß. »Hast du gesehen, wie er die Kamera in seinem Arbeitszimmer angebettelt hat, kurz bevor die Polizei bei ihm geklingelt hat? Betteln ist ein klassischer Indikator. Stimmt’s, Mitch?«
Der Fahrer – ein bulliger Kleiderschrank in Jeans, Wanderstiefeln und einem Pullover mit dem Emblem der Boston Red Sox – nickte. »Stimmt genau, Marcus.«
Acadia hatte ihre Zweifel. »Woher willst du das wissen?«
Mitch Cochran hatte keinen Hals, zumindest keinen, der diese Bezeichnung wirklich verdient hatte. Es sah vielmehr so aus, als würden seine Schultern übergangslos in seinen gewaltigen Schädel münden. Jetzt drehte er sich zu ihr um und sagte: »Bevor ich auf alles geschissen hab, war ich im Irak. Mit der beschissenen US-Army. Als Wachsoldat in Abu Ghraib. Ich hab mehr als ein Verhör mitgemacht. Und es ist genau so, wie Marcus gesagt hat: Erst betteln sie, dann brechen sie zusammen. Alle.«
Acadia war noch immer nicht zufrieden. »Aber wie lange sollen wir noch warten?«
»Es dauert nicht mehr lange«, versicherte ihr Sunday. »Mulch hat seine Frau getötet, und den anderen kann er jederzeit das Gleiche antun.«
»Wie lange noch?«, wiederholte sie schroff.
Sunday erwiderte verärgert: »Ein Projekt von dieser Größenordnung funktioniert nicht nach einem genau festgelegten Stundenplan, Acadia. Habe ich dir nicht schon hundert Mal erklärt, dass die Erschaffung eines Monsters mit der Zerstörung eines Menschen beginnt?«
»Du hast schon viel gesagt«, fauchte Acadia. »Zum Beispiel, dass Cross zusammenbrechen würde, wenn wir ihm diese Fotos schicken.«
»Cross war am Boden«, fuhr er sie an. »Und er ist seither nicht wieder aufgestanden, im Gegenteil. Es geht ihm immer schlechter. Hast du das nicht gerade mit eigenen Augen gesehen? Bald ist nichts mehr von ihm übrig.«
Es dauerte einige Zeit, dann erwiderte Acadia: »Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass das mit den Fotos ein Fehler war.«
»Ein Fehler?« Jetzt war Sunday hörbar wütend.
Acadia fuhr fort: »Du hast auf den kurzfristigen Effekt gesetzt. Du wolltest wissen, wie Cross reagiert, wenn er sieht, dass seine komplette Familie ausgelöscht worden ist. Aber dadurch hast du gleichzeitig ein Druckmittel aus der Hand gegeben. Und genau das hast du jetzt wieder gemacht. Eine Tote kann man nicht mehr retten, Marcus. Man kann ihr nicht mehr helfen. Also warum sollte er noch der perfekte Killer werden, den du so unbedingt aus ihm machen willst?«
»Gelegentlich zeigt sich, dass du nur eine oberflächliche Kenntnis unserer tierischen Anteile besitzt«, gab Sunday verächtlich zurück. »Es geht um den richtigen Zeitpunkt.«
»Was soll das denn heißen?«, sagte sie und verschränkte die Arme vor der Brust.
»Hast du schon mal einen Hundetrainer bei der Arbeit beobachtet?«, fragte er. »Einen richtigen Trainer meine ich, der Jagd- oder Kampfhunde ausbildet?«
»Das Arschloch, das sich mein Vater genannt hat, hatte ein Rudel Jagdhunde.«
»Dann weißt du auch, was mit dem Begriff Beuteaggression gemeint ist, oder?«
»Ich kann’s mir denken«, erwiderte die. »Irgendein Vieh rennt durch den Wald, der Hund jagt hinterher und will es erlegen. Das liegt in seiner Natur.«
»Na bitte, da hast du’s.« Sunday schnipste mit den Fingern. »Und um diese Beuteaggression zu fördern, nehmen die Trainer dem Hund etwas weg, was ihm sehr wichtig ist, einen Knochen zum Beispiel oder ein Spielzeug. Sie lassen Bello tagelang in dem Glauben, dass sein Lieblingsknochen für immer verschwunden ist. Und dann taucht das Ding plötzlich wieder auf, und zwar an einem Seil. Jedes Mal, wenn der Hund losrennt, um sich sein Spielzeug zu schnappen, zieht der Trainer es ihm vor der Nase weg. Immer wieder, so knapp wie nur möglich. Stimmt’s, oder hab ich recht, Mitch?«
Cochran bremste und sagte: »Der Hund dreht komplett durch. Er will sein Spielzeug wiederhaben, um jeden Preis. Das ist der Moment, wo der Trainer die totale Kontrolle über die Situation übernimmt. Er setzt das Spielzeug als Belohnung ein, wenn der Hund was gut gemacht hat.« Er blickte Acadia an. »Woher ich das weiß? Wir hatten auch gottverdammte Hunde in Abu Ghraib. Jede Menge.«
Sie befanden sich im Nordwesten von Maryland, in einer sehr ländlichen Gegend, wenige Kilometer südlich von Frostburg. Cochran lenkte den Wagen nach rechts auf einen matschigen Feldweg, vorbei an einem heruntergekommenen Bauernhof. In Gedanken konnte Sunday das Quieken der Schweine hören. Der Weg schlängelte sich durch einen Eichenwald mit zahlreichen frischen, hellgrünen Blättern.
Nach anderthalb Kilometern musterte Sunday die Bäume etwas genauer und sagte dann: »Da ist es. Die Birken da rechts. Da stellen wir den Wagen ab.«
8 Cochran parkte den Durango unmittelbar neben dem Entwässerungsgraben, der dicht bei den drei Birken verlief. Sie standen so eng beisammen, dass es aussah wie drei Triebe eines einzigen Baums.
»Wir haben immer noch zehn Minuten.« Sunday wandte sich wieder dem Laptop zu, aber auf der Baustelle war Cross nicht mehr zu sehen.
»Geht es vielleicht auch ein bisschen früher?« Acadias Stimme klang verärgert. »Wie gesagt, zweiundsiebzig Stunden ist das absolute Maximum. Wir haben wirklich nicht mehr viel Zeit.«
Sunday warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Wir stehen jetzt bei siebenundsechzig Stunden. Das schaffen wir.«
»Ich muss mal groß«, sagte Cochran.
»Was soll das denn? Sind wir jetzt im Kindergarten?«, zischte Acadia ihn an.
»Vielleicht ist ja das mein Problem, verdammte Scheiße. Dass ich zu kindisch bin.« Cochran lachte, stieg aus und entfernte sich.
Sunday starrte schweigend durch die Windschutzscheibe, dann sagte er: »Der Bauernhof, an dem wir gerade vorbeigefahren sind, hat ein paar Erinnerungen ausgelöst. In genau so einem Höllenloch ist Mulch aufgewachsen.«
»Der sagenumwobene Ort, an dem alles begann?«, hakte Acadia nach.
»Wo Mulch entsprang, und wo er sein Ende fand.«
»Warst du je wieder da?«
»Nicht mal in der Nähe.« Sunday blickte wieder auf seine Uhr. »Ich glaube, es ist so weit.«
»Und du willst wirklich alleine los?«
Sunday nickte. »Es hat lange genug gedauert, bis ich diesen Typen gefunden und Vertrauen aufgebaut habe. Ich will ihn auf keinen Fall verschrecken, vor allem nicht jetzt. Schließlich hat er sich als ausgesprochen findiger Geist erwiesen.«
»Denk an den Honig«, sagte Acadia und reichte Sunday eine kleine Sporttasche mit dem Nike-Symbol.
»Wenn ich in fünfzehn Minuten noch nicht wieder da bin, dann kommt ihr nachsehen. Aber vorsichtig, ja?«
»Bewaffnet?«
»Auf jeden Fall.«
Sunday stieg aus. Überall roch es nach Frühjahrsfäulnis. Es hatte angefangen zu nieseln, und das war gar nicht schlecht. Die Regentropfen klatschten auf die frischen Blätter und übertönten alles andere. So hatte er die Möglichkeit, sich noch einmal gründlich umzusehen, bevor er den letzten Schritt tat.
Er rutschte die Böschung hinab und folgte einem überwucherten Holzfällerpfad. Die Tasche reckte er hoch in die Luft, damit Dornen und Stacheln ihr nichts anhaben konnten. Es dauerte nicht lange, bis er ein Holzfeuer roch und seine Schritte verlangsamte. Vor ihm lag eine Felskante, von der man freie Sicht auf eine Lichtung und den dahinter verlaufenden, überquellenden Bachlauf hatte.
Zu seiner Rechten, unmittelbar neben dem Bachufer, war eine Hütte aus Sperrholz und Dachpappe zu sehen. Ein Rohr ragte aus dem Dach heraus, und sanfter Rauch quoll daraus hervor. Zwischen der Hütte und einer Art Scheune stand ein alter blauer Chevy Pick-up mit abgedeckter Ladefläche.
Sunday sah das Tuch vor dem Fenster flattern und wusste, dass er bereits entdeckt worden war. Darum hob er die Tasche in die Höhe und ließ sich über die Felskante nach unten gleiten, bis er vor der Hütte stand. Quietschend öffnete sich eine Tür. Ein großer Rottweiler-Rüde kam auf ihn zugejagt.
Sunday blieb vollkommen regungslos stehen und starrte in die Schwärze hinter der Tür, während der Hund ihn mit tiefem Knurren umrundete und Witterung aufnahm. Dann bellte er, die Tür öffnete sich noch ein Stückchen weiter, und Sunday näherte sich der Eingangstreppe. Er ging die wenigen Stufen hinauf, vorbei an einer Kettensäge und einem Benzinkanister, und trat ein.
»Muss das eigentlich jedes Mal sein?«, fragte er den muskulösen Glatzkopf, der gerade im Halbdunkel seine primitive Küche ansteuerte. Sein Name lautete Claude Harrow.
»Jedes Mal«, erwiderte Harrow. »Das beruhigt, vor allem jetzt, wo wir gemeinsam eine finstere Grenze überschritten haben.«
Der Hund kam ebenfalls herein. Sunday zog die Tür ins Schloss und blieb stehen, bis seine Augen sich an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten und er den Resopaltisch, die Liegestühle, die kaputte Couch und den Holzofen in der Ecke erkennen konnte. Abgesehen von einer Konföderierten-Flagge und einem zwanzig mal dreißig Zentimeter großen Bilderrahmen, in dem ein Foto von Hitler mit gerecktem Arm steckte, waren die Wände kahl. Der Hund legte sich vor den Ofen und ließ Sunday nicht aus den Augen.
»Anscheinend hat ja alles nach Plan geklappt«, sagte Sunday. Es roch nach Putzmittel. Ganz in der Nähe sah er eine Waschschüssel auf dem Boden stehen. Darin lagen zwei Schlachtermesser und eine Blechschere in einer Chlorbleichenlösung.
»Na, was hast du denn erwartet? Einen Stümper?«, erwiderte Harrow und wandte sich zu ihm um.
Jetzt konnte Sunday auch die hässliche, dünne Narbe auf seiner rechten Wange und das Tattoo mit dem flammenden Schwert an seinem Hals sehen. Als Nächstes registrierte er den Spiegel mit den weißen Pulverresten auf dem Tisch. Er runzelte die Stirn. »Ich dachte, wir wären uns einig gewesen. Kein Speed, solange das Spiel läuft.«
»Aber jetzt ist gerade Pause«, gab Harrow zurück. »Keine Sorge. Das war bloß eine kleine Stärkung für zwischendurch. Ich war die ganze Nacht auf, und als ich zurückgekommen bin, hab ich ziemlich gezittert.«
Sunday überlegte, ob er diesen Punkt vertiefen sollte, entschied sich aber dagegen und streckte dem anderen die Sporttasche entgegen. »Der Rest für Nummer eins und eine Anzahlung für Nummer zwei.«
Harrow bedeutete ihm, die Tasche auf den Tisch zu legen, und fragte: »Wann?«
»Heute Abend. Der ältere Junge.«
Sunday merkte sofort, dass das Harrow nicht passte.
»So kurzfristige Planänderungen sind nicht billig«, sagte Harrow.
»Wie viel?«
»Damit alles sauber über die Bühne geht? Hundert Riesen, alles in allem.«
Sunday mochte kein Nachverhandeln. »Ein ziemlich großer Nachschlag.«
»Ich gehe auch ein wahnsinniges Risiko ein. Da sind die Bullen mit im Spiel, stimmt’s?«
»Ich glaube ja, du würdest das alles sogar machen, wenn ich dir kein kleines Vermögen dafür bezahlen würde«, sagte Sunday, während er die Tasche auf den Tisch stellte.
»Könnte schon sein.« Zum ersten Mal lächelte Harrow. »Von den Bullen mal abgesehen, aber diese Säuberungen machen mir wirklich Spaß.«
»Sagst du mir Bescheid, wenn du fertig bist?«
»Ich will ja schließlich bezahlt werden, stimmt’s? Kaffee?«
»Tut mir leid, aber ich muss ein Flugzeug kriegen. Um fünf muss ich in St. Louis sein, koste es, was es wolle«, sagte Sunday und ging zur Tür.
»Und wenn nicht?«
»Das wäre ziemlich übel.«
9 Als ich zusah, wie der Leichensack aus der Baugrube gehoben wurde, traf John Sampson ein.
Er hat zwar einen Körper wie ein Basketball-Profi, aber als er jetzt mit Tränen in den Augen auf mich zukam, da sah er ebenso schwach aus wie ein neugeborenes Kätzchen. John und ich sind wie Brüder, und das schon seit unserem zehnten Lebensjahr. Jetzt schlang er seine mächtigen Arme um mich. Es hätte nicht viel gefehlt, und ich wäre an Ort und Stelle einfach zerflossen.
»Großer Gott, Alex«, stieß Sampson heiser hervor. »Ich bin sofort ins Auto gesprungen, als ich das gehört habe. Stimmt es denn? Ist es …?«
»Ich glaube schon, aber es gibt noch keine Gewissheit. Das wird noch bis morgen dauern, mindestens … und das ist wahrscheinlich das Schlimmste daran«, erwiderte ich dumpf, während der Leichensack auf eine Rolltrage gelegt und zum Wagen der Gerichtsmedizin gebracht wurde.
Ich versuchte, mir einzureden, dass in diesem Sack jemand anderes lag als Bree. Aber Mulch, er …
»Soll ich dich nach Hause bringen?«, erkundigte sich Sampson.
»Nein. Zu Hause ist nicht gut. Dort kann Mulch mich beobachten, da sieht er ständig, wie ich leide. Aber damit ist jetzt Schluss. Ich werde ein bisschen spazieren gehen, um den Kopf freizubekommen.«
»Soll ich dir Gesellschaft leisten?«
»Wir sehen uns dann im Büro.«
»Mein Lieber, du kannst doch unmöglich arbeiten, in so einer …«
»John, in so einer Situation muss ich arbeiten«, fiel ich ihm ins Wort. »Nur so bleibe ich wenigstens halbwegs bei Verstand.«
Sampson schien noch etwas sagen zu wollen, doch dann trat Detective Aaliyah zu uns und sagte: »Herr Dr. Cross, ich habe …«
»John, darf ich vorstellen, das ist Tess Aaliyah«, sagte ich. »Sie ist neu hier, frisch aus Baltimore. Sie muss auf den aktuellen Stand gebracht werden. Kannst du ihr alles sagen, was die geheime Sonderkommission über Mulch herausgefunden hat?«
»Geheime Sonderkommission?«, fragte Aaliyah.
»Ganz genau.« Dann ging ich und versuchte, mir immer wieder einzureden, dass das, was da im Wagen der Gerichtsmedizin lag, nicht der Leichnam meiner Frau war.
Doch Trauer und Verlust können selbst den stärksten Geist schwach werden lassen, sodass auch die besten Vorsätze sich in Luft auflösen.
Schon als ich die nächste Querstraße erreicht hatte, verlor ich mich in Erinnerungen an die ersten Tage mit Bree, als sie mich mit ihrer unerschütterlichen Liebe aus einer langen Einsamkeit befreit hatte, einer Liebe, an die ich nicht mehr geglaubt hatte. Dann überfiel mich die Erkenntnis, dass ich sie höchstwahrscheinlich für alle Zeiten verloren hatte. Ich stand auf dem Bürgersteig und begann zu heulen und zu schluchzen.
Alle Frauen, die ich je geliebt habe, waren entweder tot oder so traumatisiert von der Gewalt, die mein gesamtes Leben prägt, dass sie meinen Anblick nicht mehr ertragen konnten. Meine erste Frau, Maria, war aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen worden, als Damon noch ein Kleinkind und Jannie ein Baby gewesen war. Alis Mutter war von einem Wahnsinnigen als Geisel genommen worden, und obwohl es uns gelungen war, sie zu befreien, hatte unsere Beziehung irreparablen Schaden genommen. Und jetzt Bree, die größte Liebe meines Lebens. War sie auch ein Opfer dieser Düsternis geworden, die mich umgab, seitdem ich Polizist war?
Und meine Kinder? Meine Großmutter? Waren auch sie dazu verdammt, meinen Geliebten in die Finsternis zu folgen? Und was war mit mir?
War ich nicht bereits dort? Hatte ich das Reich der Schatten jemals verlassen? Würde ich es jemals verlassen können? Diese Fragen jagten mir durch den Kopf, während ich weiterging und mir die Tränen aus den Augen wischte.
Wie auf Autopilot schlug ich eine Route ein, die ich mit meinen Kindern tausend Mal gegangen war. Jeden Morgen, oder zumindest so oft wie möglich, hatte ich sie zur Schule gebracht, zur Sojourner Truth. Und während ich diese über Jahre vertraut gewordenen Schritte setzte, wurde ich von Erinnerungen an Damon, Jannie und Ali, an ihre allerersten Schultage, überschwemmt.
Damon war sehr eifrig gewesen und hatte es kaum mehr erwarten können. Er und seine Freunde hatten seit Wochen über nichts anderes geredet. Aber Jannie und Alex junior waren nervös gewesen.
»Und wenn ich einen doofen Lehrer bekomme?«, hatte Jannie gefragt.
Ali hatte mir genau die gleiche Frage gestellt, und dann hatte ich sie plötzlich alle beide vor mir, zwei Sechsjährige, die mich ansahen und eine Antwort erwarteten. Ich ging vor ihnen in die Hocke, zog sie an mich und genoss ihren Duft und ihre Unschuld.
»Es gibt nichts, was ich nicht für euch tun würde«, sagte ich. »Und ich liebe euch. Mehr müsst ihr nicht wissen.«
»Ich lieb dich noch mehr«, sagte Jannie.
»Ich lieb dich noch mehr«, sagte Ali.
»Ich lieb euch noch viel, viel mehr«, flüsterte ich. »Ich lieb euch …«
Da ertönte eine Frauenstimme: »Herr Dr. Cross?«
10 Die wunderschönen Bilder meines Lebens vor Thierry Mulch zerplatzten vor meinem geistigen Auge, und ich stellte verdutzt fest, dass ich vor dem Zaun des Spielplatzes der Sojourner-Truth-Grundschule stand. Er war verlassen. Ich hatte doch den Pausengong gehört? Wo waren meine Kinder? Wo war ihr Lachen?
»Herr Dr. Cross?«
Ich blinzelte und sah eine groß gewachsene Afroamerikanerin in einem blauen Hosenanzug neben mir stehen. Sie sah mich besorgt an.
»Ja«, erwiderte ich. Irgendwoher kannte ich diese Frau. Ich war verärgert und wusste nicht genau, wieso.
Sie musterte mich forschend und fragte: »Geht es Ihnen nicht gut?«
»Ich bin nur … Wo sind denn die Kinder? Es hat gegongt. Jetzt ist doch Pause.«
»Wir haben Osterferien«, erwiderte sie.
Ich sah sie an wie eine Fremde in einem Traum.
»Herr Dr. Cross«, sagte sie. »Erkennen Sie mich?«
Plötzlich wusste ich, wer sie war, und wurde von einer irrationalen Wut gepackt. »Sie sind Dawson. Die Direktorin. Sie haben Mulch an die Schule geholt. Wo haben Sie denn gesteckt? Wir haben Sie die ganze Zeit gesucht.«
Meine Miene und mein Tonfall mussten sie erschreckt haben, jedenfalls trat sie einen Schritt zurück. »Es tut mir leid. Ich war im Urlaub. Ich habe …«
»Thierry Mulch«, schrie ich sie an. »Sie haben dieses kranke Arschloch in Alis Klasse geholt! Sie haben ihn in die Nähe der Kinder gelassen!«
»Was?«, sagte sie und schlug die Hand vor den Mund. »Was hat er getan?«
»Er hat meine Familie entführt«, sagte ich. »Er hat vielleicht meine Frau ermordet. Und womöglich hat er demnächst vor, auch Ali zu ermorden.«
Die Direktorin war völlig entsetzt. »Mein Gott, nein!«
Erst jetzt wurde mir ihre Erschütterung bewusst, und ich wurde schlagartig aus meinem Dämmerzustand gerissen.
»Wir haben Ihnen die ganze Woche lang hier in der Schule Nachrichten hinterlassen«, sagte ich. »Die Polizei. Das FBI.«
»Es tut mir schrecklich leid.« Ihre Stimme zitterte. »Ich war auf Jamaika, bei meinen Cousinen. Ich bin noch gar nicht lange zurück und wollte gerade in mein Büro gehen, um die nächste Woche vorzubereiten. Da habe ich Sie hier stehen sehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«
»Erzählen Sie mir alles, was Sie über Thierry Mulch wissen.«
Dawson berichtete, dass Mulch sich aus heiterem Himmel bei ihr gemeldet hatte, zuerst per E-Mail, dann telefonisch. Er hatte sich als Internet-Unternehmer mit mehreren erfolgreichen Projekten vorgestellt, der sich jetzt einer anderen Altersschicht zuwenden wollte. Er hatte von der Idee gesprochen, eine Plattform für sechs- bis zwölfjährige Kinder zu entwickeln, die nur nach einer sorgfältigen persönlichen Überprüfung zugänglich war.
»Um den ganzen Perversen keine Chance zu lassen?«
»Genau.«
»Keine schlechte Geschäftsidee.«
»Das habe ich auch gedacht. Darum habe ich sein Angebot, bei uns an der Schule einen Vortrag zu halten, ja angenommen. Und ich habe ihn natürlich gründlich überprüft. Seine Firma hat eine ganz normale Webseite. Kommen Sie doch mit in mein Büro, dann kann ich es Ihnen zeigen.«
Sie schloss den Haupteingang auf und knipste das Licht an. Die Gerüche waren mir so vertraut und so stark mit den Erinnerungen an meine Kinder verknüpft, dass ich nicht länger durch die Nase atmen konnte.
In ihrem Büro angekommen, setzte Dawson sich an ihren Computer, tippte, runzelte die Stirn und tippte noch einmal. Voller Enttäuschung sagte sie: »Entweder mache ich etwas falsch, oder die Webseite ist gelöscht worden.«
Sie fing an, in ihren Schreibtischschubladen herumzuwühlen, und sagte: »Irgendwo muss doch noch seine Visitenkarte … Ah, da ist sie ja!«
»Nicht anfassen!«, schrie ich sofort und kam hastig auf ihre Seite des Schreibtischs. Sie zuckte zurück. »Tut mir leid. Es ist nur … wir würden gerne die Fingerabdrücke nehmen.«
Sie erwiderte mit schwacher Stimme: »Er hat dünne weiße Handschuhe getragen.«
»Natürlich.« Am liebsten hätte ich gegen die Wand getrommelt. »Aber trotzdem. Haben Sie vielleicht eine Plastiktüte?«
»Geht auch ein Briefumschlag?«
»Ja.«
Sie reichte mir einen Umschlag, und ich holte die Visitenkarte mit einer Pinzette aus der Schublade und legte sie auf ihren Schreibtisch.
»Eine Kopie seines Führerscheins habe ich auch noch«, sagte sie.
»Den haben wir schon, aber trotzdem vielen Dank.« Ich betrachtete die Visitenkarte und fotografierte sie dann mit meinem Smartphone.
Thierry Mulch, Vorstandsvorsitzender, TMI Entertainment, Beverly Hills. Darunter war eine Telefonnummer mit der Vorwahl 213 sowie eine Adresse am Wilshire Boulevard zu sehen, dazu eine Internetadresse – www.TMIE1.info – und eine E-Mail-Adresse: [email protected].
Ich wollte die Visitenkarte gerade in den Umschlag stecken, da brachten die Webadresse und die E-Mail einen Erinnerungsfetzen in meinem Kurzzeitgedächtnis zum Vorschein.
»Versuchen Sie es mal mit www.TMIE.com.«
Die Direktorin runzelte die Stirn, gab die URL ein und drückte ENTER. Der Bildschirm flackerte kurz, dann erschien die Homepage der Firma TMI Enterprises, die in den Bereichen Multimedia und soziale Netzwerke aktiv war.
»Das ist sie«, sagte Dawson. »Das ist seine Webseite.«
»Klicken Sie die Vorstandsmitglieder an.«
Auf der nun folgenden Seite waren Fotos und kurze, biografische Angaben zu den Führungskräften der Firma zu sehen. Und an der Spitze thronte das gleiche Gesicht wie vor zwei Wochen, als ich die Webseite angeklickt hatte: ein blonder Surfer-Typ Ende zwanzig mit einer dicken schwarzen Brille und einem schwarzen Kapuzenpullover.
»Auf der Seite, die ich damals aufgerufen habe, war aber ein anderes Bild von Mulch«, sagte Dawson. »Da hat er so ausgesehen wie der Mann, der hier den Vortrag gehalten hat. Rote Haare, roter Bart und so weiter.«
»Und wer ist nun der wahre Thierry Mulch?«, fragte ich leise und spürte, wie das Pochen in meinen Schädel zurückkehrte.
11 Mein Kopf dröhnte immer noch, als ich die abgesperrte Baustelle im zweiten Stock der Zentrale der Metropolitan Police betrat. Männer mit Schutzhelmen, Atemmasken und Vorschlaghämmern waren gerade dabei, alte Gipskartonwände einzureißen. Dichte Staubwolken hingen in der Luft. Ich schob mich durch die Plastikfolie, die zwischen den Bauarbeiten und den bereits abgerissenen Bereichen aufgespannt worden war.
Ich musste husten, wodurch meine Kopfschmerzen noch schlimmer wurden. Am liebsten hätte ich mich einfach fallen lassen, mich wie ein Embryo zusammengerollt in den Staub gelegt und um meine Frau getrauert. Aber der Drang weiterzumachen, weiterzukämpfen, war stärker. Wenn ich überhaupt noch eine Chance haben wollte, meine übrige Familie vor dem sicheren Tod zu retten, dann musste ich am Drücker bleiben, musste Fragen stellen, musste mich wehren mit allem, was mir zur Verfügung stand.
Ich zog eine lose Plastikbahn beiseite und betrat einen großen Raum, der bis auf den Betonfußboden entkernt worden war. In der Mitte, unter ein paar Leuchtstofflampen, standen acht Schreibtische. Und dort saßen und standen Männer und Frauen bei der Arbeit.
Ned Mahoney, mein alter Partner beim FBI, unterhielt sich gerade mit Sampson. Dann sah er mich und sprang auf. »Mein Gott, Alex, ich hab’s gerade erst erfahren. Und es tut mir so verdammt … Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber ich verspreche dir, dass wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen werden, um diesen Drecksack zu finden.«
Ich schluckte trocken und klopfte ihm auf die Schulter. Mahoney und ich hatten in der Abteilung für Verhaltensanalyse in Quantico zusammengearbeitet. Wir hatten beide schon viel zu viel mit wahnsinnigen Kriminellen zu tun gehabt, um uns mit psychologischen Spitzfindigkeiten und falschen Prämissen etwas vorzumachen.
»Ned«, stieß ich mühsam hervor, »wenn wir ihn nicht kriegen, dann schlitzt er die anderen genauso auf.«
»Ganz sicher nicht«, schaltete sich Captain Roelof Antonius Quintus ein. Er war mein Chef und kam jetzt mit anderen Angehörigen der Sondereinheit auf mich zu. »Wenn sich tatsächlich herausstellen sollte, dass es sich bei der Toten um Bree handelt, dann hat er eine Polizeibeamtin des District of Columbia auf dem Gewissen. Zumindest hat er die Familie eines Polizeibeamten des District of Columbia entführt. Allein dafür wird er bezahlen.«
Die Detectives und FBI-Agenten hinter ihm nickten grimmig.
»Danke, Captain«, sagte ich und nickte den anderen ebenfalls zu. »Danke für alles.«
Dann zog ich den Briefumschlag aus der Tasche, den ich aus der Schule mitgebracht hatte.
»Ich war an der Sojourner Truth. Die Direktorin ist aus dem Urlaub zurück«, sagte ich. »Und das ist eine Visitenkarte, die sie von Mulch bekommen hat, als er dort seinen Vortrag gehalten hat.«
Ich reichte sie dem Captain und erläuterte ihm auch die Sache mit der falschen Webseite, die der des echten Thierry Mulch täuschend ähnlich gewesen war.
»Alles war absolut identisch, abgesehen von Mulchs Foto. Da war ein Spezialist am Werk. So einer wie Preston Elliot zum Beispiel.«
Quintus, Sampson und Mahoney tauschten eine Reihe von Blicken aus.
»Setzen Sie sich doch, Alex«, sagte der Captain.
»Was ist denn los?«
Quintus holte tief Luft und deutete auf einen Stuhl. Zögernd setzte ich mich und spürte, wie meine Augen anfingen zu brennen, noch bevor Ned Mahoney einen Ton gesagt hatte.
»Vor drei Tagen hat sich ein Schweinezüchter aus Berryville, Virginia, beim Sheriffbüro von Fairfax County gemeldet«, fing Mahoney an. »Er hat in seinem Stall einen menschlichen Schädel und ein Stück eines Oberschenkelknochens gefunden. Quantico hat die DNA mit der Datenbank abgeglichen und drei Treffer bekommen.«
Ich kniff die Augen zusammen. Plötzlich kam mir das Licht im Raum viel zu hell vor. »Drei?«
Sampson nahm den Faden auf: »Samenspuren von der Vergewaltigung in Alexandria, Samenspuren vom Hosenbein des ermordeten Rechtsanwalts von Mandy Bell Lee und die Haarprobe, die Preston Elliots Mutter zusammen mit der Vermisstenmeldung abgegeben hat.«
Es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, was das alles zu bedeuten hatte. Vor zehn Tagen war der Rechtsanwalt der bekannten Country- und Westernsängerin Mandy Bell Lee vergiftet in seinem Zimmer im Mandarin Oriental Hotel aufgefunden worden. In derselben Nacht hatte ein Mann, der sich Thierry Mulch nannte, eine Frau in Alexandria vergewaltigt.
Da die DNA-Spuren eindeutig auf Preston Elliot als Täter hindeuteten, waren wir davon ausgegangen, dass der vermisste Student der Computertechnik und Mulch ein und dieselbe Person waren.
Aber Mulch war nicht Elliot. Er konnte es nicht sein, weil die DNA der Knochen aus dem Schweinestall mit hundertprozentiger Sicherheit das Gegenteil bewiesen. Und das bedeutete …
»Mulch hat Elliot umgebracht und ihn dann in diesem Schweinestall entsorgt«, sagte ich.
»Genau das vermuten wir auch.« Sampson nickte. »Schweine sind Allesfresser.«
Mir fiel etwas ein, was Ali über Mulch erzählt hatte.
»Das passt. Bei seinem Vortrag an Alis Schule hat Mulch erwähnt, dass er auf einer Schweinefarm aufgewachsen ist.«
»Aber wie gehört das alles zusammen?«, wollte Captain Quintus wissen. »Mulch hat Elliot seinen Samen abgeluchst und ihn anschließend umgebracht?«
»Warum nicht?«, entgegnete Sampson. »Ist doch eine fantastische Methode, um uns ordentlich ins Schlingern zu bringen, oder? Eine Vergewaltigung und einen Mord begehen und an beiden Tatorten die DNA eines Toten hinterlassen?«
»Dieses dreckige Schwein ist wirklich der Teufel persönlich«, sagte Mahoney.
»Das stimmt«, stimmte ich zu. »Mulch ist der Teufel. Er ist intelligent, denkt weit voraus, ist grausam und risikobereit. Das klingt wirklich genau wie die Verkörperung des narzisstischen Bösen.«
Captain Quintus nickte. »Er hält sich für besser als alle anderen und glaubt, dass er viel zu schlau ist, um gefasst zu werden.«
»Was bedeutet, dass er schon andere, grausame Verbrechen begangen hat und damit durchgekommen ist«, ergänzte Sampson. »Genau so funktionieren diese Typen. Es wird von Mal zu Mal schlimmer.«





























