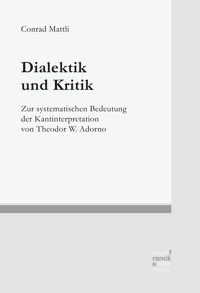
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Basler Studien zur Philosophie
- Sprache: Deutsch
Philosophie im Sinne Adornos bedeutet, die Traditionslinien der Dialektik und der Kritik miteinander engzuführen. Diese Engführung erfolgte bislang vor allem gemäß der Vorgabe Hegels - mit dem Resultat, dass das Profil einer dezidiert negativen Dialektik durch Identitätsdenken überformt und in der Forschung als mangelhafte Kopie der positiv-spekulativen Dialektik gehandelt wurde. Dagegen schlägt diese Arbeit vor, dieses Profil von Kant her zu sichten: Indem die Grundzüge von Adornos Kantinterpretation erhellt werden, soll deren systematische Bedeutung für das adornosche "Antisystem" zur Geltung gelangen. Negative Dialektik, so die These, ist nur als grenzbegriffliche Reflexion auf den Erkenntnisanspruch der traditionellen Dialektik möglich.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 790
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Conrad Mattli
Dialektik und Kritik
Zur systematischen Bedeutung der Kantinterpretation von Theodor W. Adorno
Publiziert mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung.
Conrad Mattlihttps://orcid.org/0000-0002-8937-8995
DOI: https://doi.org/10.24053/9783381119325
© 2025 · Conrad Mattli
Das Werk ist eine Open Access-Publikation. Es wird unter der Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen | CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) veröffentlicht, welche die Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und Wiedergabe in jeglichem Medium und Format erlaubt, solange Sie die/den ursprünglichen Autor/innen und die Quelle ordentlich nennen, einen Link zur Creative Commons-Lizenz anfügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Die in diesem Werk enthaltenen Bilder und sonstiges Drittmaterial unterliegen ebenfalls der genannten Creative Commons Lizenz, sofern sich aus der am Material vermerkten Legende nichts anderes ergibt. In diesen Fällen ist für die oben genannten Weiterverwendungen des Materials die Einwilligung des jeweiligen Rechteinhabers einzuholen.
Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG · Dischingerweg 5 · D-72070 Tübingen
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0941-9918
ISBN 978-3-381-11931-8 (Print)
ISBN 978-3-381-11933-2 (ePub)
Inhalt
Für Tata und Yoyo
Danksagung
Dieses Buch ist eine leicht überarbeitete Version des Textes, der im Sommer 2022 an der Universität Basel und der Universität Freiburg im Rahmen einer Cotutelle de thèse als Dissertation angenommen wurde und in den dreieinhalb Jahren davor in Basel, Freiburg i. Br., New York und Zürich entstanden ist.
Aufrichtigen Dank schulde ich: Prof. Dr. Gunnar Hindrichs, Prof. Dr. Philipp Schwab und Prof. Dr. Katrin Meyer für die angenehme Betreuung, das Vertrauen und die Möglichkeit zur freien Ausführung meines Plans. Dem Schweizerischen Nationalfonds (SNF) für die Förderung im Rahmen von «Doc.CH». Swissuniversities für die Erleichterung der Cotutelle durch den «mobility grant». Allen Mitarbeitenden und Studierenden des Philosophischen Seminars in Basel für die freundliche Aufnahme. Dem gesamten Freiburger Arbeitsbereich «Klassische Deutsche Philosophie und ihre Rezeption» um Philipp Schwab für die produktiven Kolloquien und Symposien. Omri Boehm für den freundlichen Empfang an der New School for Social Research in New York City im Frühjahr 2020. Den Mitgliedern der New School Adorno Reading Group für viele anregende Lektüresitzungen unter außergewöhnlichen Umständen. Stefan Selbmann für die verlegerische Betreuung. Verena Stauffacher, Marlene Kienberger und meinem besten Freund Nicolas Hofmänner für das Korrekturlesen. Robert Pfeiffer für seine unendliche Urteilskraft, guten Rat und die langen Telefondialoge zu Kant.
Meinen Eltern Waly und Yoyo (†) sowie meinen Geschwistern Florentina und Jöri Mattli danke ich für den Rückhalt. Marion Keller für die Wärme.
Zürich, im Mai 2024 Conrad Mattli
«Im Kampf zwischen Dir und der Welt sekundiere der Welt.»1
Vorbemerkung
Die vorliegende Arbeit entstand in der Absicht, das komplexe Verhältnis Adornos zu Kant zu erhellen. Schnell wurde klar, dass dieses Vorhaben eine Erweiterung des philosophiegeschichtlichen Blickwinkels durch eine systematische Perspektive erfordert. Denn es zeigte sich, dass gerade der Zusammenhang zwischen Geschichte und System der Philosophie das sachliche Kernproblem des adornoschen «Antisystem[s]»1 darstellt. Und es zeigte sich auch, dass Adornos dialektische Behandlung dieses Problems weit mehr mit einer transzendentalen Geltungsreflexion à la Kant gemein hat als mit einer Dialektik nach hegelschem Vorbild – mit welcher die negative Dialektik nach wie vor verwechselt und infolgedessen (wie sich zeigen soll, zu Unrecht) als mangelhafte Kopie erachtet wird. Die zahlreichen, mitunter polemischen Kantbezüge Adornos sind entsprechend nirgends bloße Kantexegese. Ebenso wenig sind sie aber Ausdruck einer dogmatisch vorentschiedenen, pauschalisierenden Kantkritik. Vielmehr sind sie das Resultat jenes bei Kant selbst vorgebildeten, prinzipiengeleiteten Umgangs mit der Philosophiegeschichte, der auf den Namen ‹Kritik› lautet; ein Umstand, der allein das verbreitete Vorurteil widerlegen dürfte, wonach das Antisystem selbst keinen Anspruch auf Verbindlichkeit erheben darf. Einen solchen Anspruch erhebt das Antisystem als (Selbst-)Kritik des Systemdenkens der Klassischen deutschen Philosophie. Entsprechend beabsichtigt diese Arbeit, den Prinzipiengehalt von Adornos Antisystem aus dem Dialog mit der Tradition heraus zu rekonstruieren. Es könnte ja sein, dass Prinzipien, «deren Unveräußerlichkeit» als Prinzipien gerade «in der Ohnmacht besteht äußerlich zu werden»,2aus systematischen Gründen nicht unmittelbar, sondern nur ‹vermittelt› zur Darstellung gebracht werden können. Ist dies der Fall, muss die Forschung Wege finden, um den Wortlaut dieses Dialogs von seiner systematischen Bedeutung unterscheiden und dennoch beides aufeinander beziehen zu können. (Sonst legen wir den Buchstaben der negativen Dialektik unweigerlich als Ausdruck einer positiven Dialektik, kurz: unangemessen aus.) Die systematische Bedeutung dieses Dialogs am Beispiel Kants zu untersuchen, scheint deswegen angezeigt, weil das kantische Modell reflexiver Kritik für Adorno in entscheidender Hinsicht mehr als nur ein Beispiel darstellt. In den «Brüchen und Widersprüchen» der Vernunftkritik, so Adorno, «drückt eben wirklich das Leben der Wahrheit selber sich aus».3
I. Einleitung: Dialektik und Kritik
1.
Was Dialektik ist, lässt sich angesichts ihrer zweieinhalbtausendjährigen Geschichte kaum auf einen präzisen Begriff bringen. Das Konzept ist inzwischen von einer derartigen Unschärfe gekennzeichnet, dass Dialektik «im generellen Sinn […] im wesentlichen alles das ab[deckt], was heute in Abgrenzung von den Sachwissenschaften unter dem Titel ‹Philosophie› (i.e.S.) behandelt wird».1 Diese Not lässt sich freilich in eine Tugend wenden: Der Umstand, dass Dialektik mit Philosophie gleichgesetzt werden darf, legt bei aller Verwässerung ihres Profils zugleich nahe, dass (was auch immer dies im Einzelfall bedeutet) die Dialektik eine tragende Rolle bei der Erlangung philosophischer Erkenntnis spielen muss. Tatsächlich ist die Dialektik in der Geschichte der Philosophie immer wieder als zielführende Methode verteidigt worden, um «durch eine entsprechend organisierte Befragung der Realität zum universalen Wissen gelangen zu können».2
Diese Hoffnung ist, als Ausgriff auf universales Wissen, freilich von Beginn weg mit Enttäuschungen einhergegangen. Zunächst wäre da der Umstand, dass der Inhalt des angeblich universalen Wissens in keiner Form je alle Menschen zu überzeugen vermocht hat. Entsprechend nimmt die Dialektik den Widerstreit der Meinungen zum Anlass, fügt diesem aber keine neue Meinung hinzu, sondern empfiehlt sich als «gemeinsame[…] Wahrheitsfindung und Geltungssicherung vor dem Hintergrund einer gemeinsamen Anerkennung und Kontrolle von Kriterien, die explizit artikulieren, was es überhaupt heißt, etwas als richtig oder wahr zu bewerten».3 Das Problem: Wenn die ausgezeichnete Methode, universales Wissen zu erlangen, zuerst zu ermitteln hat, was überhaupt als wahr gelten darf und was nicht, dann wird diese Methode nicht unmittelbar zielführend sein. Vielmehr beschreibt sie einen Umweg, der, statt auf Erkenntnis, auf die Gründe zurückführt, welche erklären, warum uns der unmittelbare Zugang zum Universalen versagt bleibt. Und weil also das schiere Faktum des Widerstreits partikularer Meinungen hinreicht, um den universellen Geltungsanspruch der Philosophie zu negieren, wird die Philosophie, solange sie mit Dialektik gleichgesetzt werden darf, ihren Anspruch auf Universalität noch nicht erfüllt haben.
Angesichts dessen musste die Dialektik ihr Selbstverständnis als eine «Kunst der Unterredung»4 erlangen – als methodische Anstrengung, den Widerstreit der Meinungen zu befrieden, aber mit dem übergeordneten Ziel, in den Partikularmeinungen bruchstückhafte Spiegelungen des Universalen zu erblicken. Dialektisch ausgedrückt: Der Gegensatz zum Widerstreit der Meinungen (die Ausrichtung auf den Frieden) ist der Dialektik wesentlich. Oder – noch dialektischer – mit Adorno:
Die Dialektik ist in der Sophistik entsprungen, ein Verfahren der Diskussion, um dogmatische Behauptungen zu erschüttern und, wie die Staatsanwälte und Komiker es nannten, das mindere Wort zum stärkeren zu machen. Sie hat sich in der Folge gegenüber der Philosophia perennis zur perennierenden Methode der Kritik ausgebildet, Asyl allen Gedankens der Unterdrückten, selbst des nie von ihnen gedachten. Aber sie war als Mittel, Recht zu behalten, von Anbeginn auch eines zur Herrschaft, formale Technik der Apologie unbekümmert um den Inhalt, dienstbar denen, die zahlen konnten: das Prinzip, stets und mit Erfolg den Spieß umzudrehen. Ihre Wahrheit oder Unwahrheit steht daher nicht bei der Methode als solcher, sondern bei ihrer Intention im historischen Prozeß.5
Ob die Dialektik ihren Wahrheitsanspruch jenseits bloßer Sophistik und diesseits überfliegender Dogmatik einlösen kann, hängt folglich daran, ob sie ihren Wahrheitsanspruch als Kritik einlösen kann. Die Dialektik ist, mit anderen Worten, dazu bestimmt, fortlaufend «dogmatische Behauptungen zu erschüttern», um darüber indirekt jene Prinzipien in Anspruch zu nehmen, die uns kraft ihrer Allgemeinverbindlichkeit für die Anspruchskritik vielleicht doch noch zu universalem Wissen führen könnten.
Damit ist der Begriff der Dialektik aber ein wenig präziser geworden: Dialektik ist offenbar nicht einfach nur ein unscharfer Begriff, sondern ein bestimmt zweideutiger: Erkenntnismethode und Geltungsreflexion in einem, bringt die Dialektik das Dilemma aller bisherigen Philosophie zum Ausdruck: In ihren höchsten Erkenntnisansprüchen sieht sie sich auf den Umweg der Erkenntniskritik verwiesen; den Umweg der Kritik aber kann sie nur dort einschlagen, wo am Horizont das Versprechen universeller Erkenntnis steht.
Sind aber Dialektik und Kritik derart mit- und durcheinander wechselbestimmt, dann darf es der Dialektik nicht darum gehen, einen geschichtslosen Wissensbestand zu verwalten.6 Vielmehr zeigt sich, dass das noch nicht gänzlich verhallte Versprechen der Dialektik, uns zu universalem Wissen zu führen, nur durch die Bezugnahme auf die eigene Geschichte nicht leer bleibt. Denn seit sie bei Platon als «Prinzipienwissenschaft»7 in den Gegensatz zur bloßen Sophistik getreten ist, muss die Dialektik ihre spekulativen Erkenntnisansprüche immer wieder von neuem durch Erkenntniskritik einlösen. Ebenso kann es der Kritik nicht darum gehen, im Zuge der Prüfung von Erkenntnisansprüchen die Aussicht auf inhaltliche Erkenntnis zu versperren. Vielmehr ist es angesichts der Wechselbestimmtheit von Dialektik und Kritik beiderseits geboten, den vermeintlichen Gegensatz von Methode und Methodenreflexion so zu vermitteln, dass daraus weder eine leere Dogmatik noch eine fruchtlose Kritik resultiert. Anders gesagt: Die Dialektik verinhaltlicht sich nur durch Kritik, während Kritik ohne Dialektik formlos bliebe.
‹Vermittlung› bezeichnet daher nicht zufällig einen Kernbegriff der dialektischen Tradition. Dialektik ist Vermittlung. Vermittlung ist aber nur dann überhaupt gefordert, wenn der Umweg der Kritik bereits eingeschlagen worden ist. Nur bereits Unterschiedenes kann vermittelt werden. Bei Hegel, der vielen nach wie vor als Kulminationspunkt der dialektischen Tradition gilt, beschreibt ‹Vermittlung› daher den eindeutig zweideutigen Vorgang der «Unterscheidung und Beziehung von Verschiedenem aufeinander».8
Jedes auf Eindeutigkeit Anspruch erhebende Konzept dialektischer Vermittlung müsste folglich angeben können, wie der Zusammenhang von Unterschiedenem und Bezogenem als solcher zu beurteilen ist. Bestimmt der Sinn der Unterscheidung etwa jenen der Beziehung oder erfolgt die Unterscheidung umgekehrt nur, um eine Beziehung zwischen dem Verschiedenen herzustellen? Bildet also die Kritik oder die Dialektik den Sinnhorizont von Vermittlung? Anders gefragt: Wie wirkt sich die Koinzidenz von Unterscheidung und Beziehung auf die Möglichkeit dialektischer Erkenntnis aus? Ermöglicht oder verunmöglicht jene diese? Stellen die Prinzipien der Geltung, auf welche sich die Dialektik zur Differenzierung von den Partikularmeinungen beruft, schon Gegenstände eines universalen Wissens dar oder verlangt jede Konkretisierung dieser Prinzipien noch einmal, dass die Dialektik ihren eigenen prinzipiellen Anspruch kritisch reflektiert?
2.
Das Folgende stellt den Versuch dar, Theodor W. Adornos negative Dialektik als Antwort auf diese Fragen und als Vorschlag zum angemessenen Umgang mit dem besagten Dilemma zu begreifen. Diese Herangehensweise ist nicht von außen an Adorno herangetragen. In der Vorlesung über Negative Dialektik von 1965/66 erklärt Adorno seiner Zuhörerschaft: «Ich würde denken, die beiden Termini Kritische Theorie und Negative Dialektik bezeichnen das gleiche.»9 Diese Wechselbestimmtheit von Dialektik und Kritik trägt sich danach in die adornosche «Definition» von Dialektik ein: «Denken braucht nicht an seiner eigenen Gesetzlichkeit sich genug sein zu lassen; es vermag gegen sich selbst zu denken, ohne sich preiszugeben; wäre eine Definition von Dialektik möglich, so wäre das als eine solche vorzuschlagen.»10 Zu verstehen, was «gegen sich selbst zu denken, ohne sich preiszugeben» der Sache nach bedeutet, ist das Ziel dieser Arbeit. Sollte Adorno recht haben, kämen wir damit einem Verständnis dessen näher, was Dialektik bedeutet.
Worin gründet also die Möglichkeit eines Denkens, das zugleich traditionelle Vernunftkritik11 und materialistische Gesellschaftstheorie12 sein und nach Maßgabe eines methodischen Negativismus13 eine Dialektik von philosophischem Rang14 ausbilden sollte? Inwiefern «bezeichnen» denn hier Kritik, Theorie, Negativismus und Dialektik «das gleiche»? Die These lautet: Sie bezeichnen ein allen zugrunde liegendes Reflexionsmodell. Dieses Reflexionsmodell enthält die Prinzipien, welche sowohl erfordern als auch ermöglichen, dass die traditionelle Philosophie angesichts ihrer Verstrickung in die Wirklichkeit und ihrer Bedingtheit durch materielle Grundlagen kritisiert werden kann; während diese Kritik in Form einer der Philosophie nur scheinbar äußerlichen, materialistischen Theorie der Gesellschaft ausformuliert werden muss, deren Zweck aber die negative Erweiterung des philosophischen Horizontes bleibt.15
Ein einheitliches Verständnis der adornoschen Philosophie als kritische Theorie/negative Dialektik hängt folglich davon ab, ob eine plausible Antwort auf das exponierte Problem gegeben werden kann; ob also gesagt werden kann, wie der Zusammenhang von Dialektik und Kritik bei Adorno genau zu konzipieren ist. Die Forschung scheint im Unklaren darüber. Nach wie vor ist nämlich unklar, ob – und wenn ja, wie sich ‹das adornosche Denken› angesichts seines aporetischen Charakters überhaupt in den herrschenden Diskurs einbringen lässt. Schuld daran trägt wohl nicht zuletzt Adorno selbst. So legt etwa schon das Konzept einer negativen Dialektik nahe, es als Linienverlängerung und Bruch mit Hegel zu verstehen. Seit längerem zeichnet sich eine entsprechende Interpretationslinie ab, welche Adorno als Schüler und Kritiker Hegels lesen möchte. So produktiv diese Lesart sein mag, so fragwürdig bleibt es, ob es überhaupt möglich ist, Schüler und Kritiker Hegels zu sein, ohne dass der Anspruch des Schülers von dem des Lehrers überformt wird. Adorno als Schüler und Kritiker Hegels zu lesen, bedeutet vor allem eines: ihn als Hegelianer zu lesen. Und ist die negative Dialektik einmal im Bannkreis des hegelschen Denkens verortet, ist es mehr als fragwürdig, ob sie sich noch als eigenständige Denkart abgrenzen lässt. Hegel hätte dann nämlich alles vorgeformt, was als charakteristisch für Adorno und für sein Denken gelten darf. Die Idee einer ‹negativen Dialektik› wäre nur das augenfälligste Beispiel.16 Adornos negative Dialektik ist aber gar nicht zu denken ohne die im Bewusstsein der «Differenz von Hegel»17 vollzogene «Lossage von Hegel»;18 sie wäre sonst ja eine positive Dialektik. Und weil die negative Dialektik kein geschichtsloses Dogma zur Verfügung hat, anhand dessen das hegelsche Denken gleichsam transzendent ‹von außen› kritisiert werden könnte, muss die Frage, wie negative Dialektik möglich ist, die Möglichkeit einer internen Relativierung der hegelschen Dialektik in Erwägung ziehen. Der integrale Anspruch der positiven Dialektik wird, wenn überhaupt, dann nur angesichts seiner Stellung innerhalb der Geschichte der Philosophie nach Kant zu widerlegen sein. Hegel ist nämlich derjenige, dessen Denken gerade eine Immunisierungsstrategie gegen jede Form der Relativierung darstellt. Der Verweis auf Relativität stellt keinen gewichtigen Einwand gegen ein Denken dar, dessen Gegenstand die Relation ist, in der alles zueinander und also auch es selbst steht. Da die Stimme, die diese Selbstrelativierung des Absoluten auktorial bespricht, eben die Stimme Hegels ist, kann dessen dialektische Rede nicht relativiert werden, ohne sofort den Einwand zu provozieren, dass auch diese Relativierung schon bei Hegel vorgedacht ist.
Wie also ist negative Dialektik möglich? Die These lautet jetzt, dass diese Frage überhaupt nur dann angemessen beantwortet werden kann, wenn Hegels Dialektik als Position innerhalb der Geschichte der Philosophie relativiert wird. Da nun aber, wie gezeigt, diese Relativierung nicht darüber erfolgen kann, dass Hegels historische Kontingenz gegen den Anspruch des Absoluten ausgespielt wird (das Absolute stellt bei Hegel gerade die Integration der eigenen Kontingenz zur Notwendigkeit dar), muss ein anderer Weg eingeschlagen werden.
Für diesen alternativen Weg erweist sich der Gegenstand der vorliegenden Arbeit als vielversprechend. Die Philosophie Kants ist es, die allein eine relativierende Wirkung auf Hegel und die spekulative Dialektik entfalten kann; weil sie den Sinnhorizont dessen bildet, was Hegel Reflexion nennt. Was nämlich, wenn das Ganze, das die positive Dialektik als das Wahre betrachtet, ein Reflexionszusammenhang ist, der seinen eigenen Ursprung aus dem Geist der Kritik vergessen machen muss, um als Gegenstand eines absoluten Wissens betrachtet werden zu können? Dass es sich so verhalten könnte, dass also die Kritik den Horizont bildet, in dem sich die spekulative Dialektik ausbilden konnte, dafür spricht eine eigentümliche Zweideutigkeit im Begriff der Reflexion. Diese Zweideutigkeit der Reflexion besteht (nach Kant und Hegel) darin, sowohl in das Geschehen der Erkenntniskritik wie in spekulative Erkenntniszusammenhänge eingebunden zu sein. Was bestimmt danach den Sinnhorizont der geschichtlich zweideutig gewordenen Reflexionsbegriffe – Spekulation oder Kritik? Die Beantwortung dieser Frage erweist sich als wegweisend für jede nachidealistische Reflexionskonzeption, zumal deren Grundbegriffe von einer Tradition vorgegeben werden, welche als Klassische deutsche Philosophie zugleich die Norm vorschreibt, gemäß der die Aneignung und Anwendung dieser Begriffe vonstattenzugehen hat. Dass das Verhältnis von Spekulation und Kritik allerdings keine ausschließende Disjunktion, sondern eben ein Vermittlungsverhältnis darstellen dürfte, könnte man als Index dafür lesen, dass Dialektik alternativlos geworden ist.
3.
Der späte Neukantianer Hans Wagner hat diese Schwierigkeiten im Blick, wenn er in Philosophie und Reflexion betont, dass
die Untersuchung des Reflexionsprinzips [es] mit jenem säkularen Gegensatz aufnehmen muß, unter welchem die gesamte neuere Philosophie (bewußt oder unbewußt) steht, dem Gegensatz zwischen Kant und Hegel, d. h. zwischen dem kritischen Motiv und dem spekulativen Motiv in der Philosophie. Beide Motive haben ihren unerschütterlichen Rechtsgrund, und doch ist ihr Gegensatz bis heute nicht versöhnt.19
Was Wagners hellsichtige Darstellung verschweigt, ist, dass der Gegensatz «zwischen dem kritischen Motiv und dem spekulativen Motiv» nicht erst mit dem Auftreten Hegels in die Tradition der sogenannten ‹Reflexionsphilosophie› einbricht, sondern schon Gegenstand der kantischen Geltungsreflexion gewesen sein dürfte. Kants Anliegen war es ja, durch Kritik einen Rahmen zu schaffen, innerhalb dessen die konfligierenden spekulativen Ansprüche der Tradition miteinander vereint werden können, ohne mit diesem Rahmen selbst nur einen weiteren kritikwürdigen Anspruch auf Einerleiheit zu erheben, wo faktisch keine vorliegt. Ob die Kunst der Unterredung mit der Tradition den «Kampfplatz […] endlose[r] Streitigkeiten»20 befrieden kann, hängt folglich auch davon ab, ob der eigene prinzipielle Erkenntnisanspruch vor dem Einheitsanspruch der spekulativen Vernunft gerechtfertigt werden kann. Kritik der Philosophie und philosophische Erkenntnis sind, mit anderen Worten, nicht erst seit Hegel ‹dialektisch› miteinander verschränkt. Vielmehr muss der dialektischen Vernunftkritik Kants exakt jene spekulative Relevanz zugesprochen werden, die die dialektische Kantkritik gegen ihn einklagen möchte.
Die intime Verschränkung von Kritik und Erkenntnis gelangt bei Kant nicht zuletzt darüber zur Geltung, dass er den Großteil seiner Kritik der reinen Vernunft darauf verwendet, Erkenntnisansprüche, die aus bloßer Vernunft gewonnen werden, als ein «Blendwerk objektiver Behauptungen» zu durchschauen und zu entzaubern – nur um dann mit seiner «Transzendentalen Methodenlehre» selbst einen Weg vorzuschlagen, wie wir aus bloßer Vernunft zu Erkenntnissen gelangen können. Welchen Weg Kant vorschlägt – ja, wie sich zeigt, selbst längst eingeschlagen hat, wird allerspätestens auf der letzten Seite der Kritik der reinen Vernunft klar, wenn es heißt: «Der kritische Weg ist allein noch offen.»21 Dieses Urteil ist kein Bekenntnis, auch kein Aufruf zur Bescheidenheit, sondern formuliert eine grundlegende Einsicht, jene spekulative Einsicht, die dem gesamten Unternehmen der Kritik vorauseilt und überall mitimpliziert ist. Diese Einsicht besagt, dass der einzig zielführende Weg zu allgemeinverbindlicher Erkenntnis aus bloßer Vernunft eben der Weg der Erkenntniskritik ist.
Da hiernach der Weg der Philosophie zur Erkenntnis notwendig über den Umweg der (Selbst-)Kritik führt, fordert Kant in seiner «Methodenlehre», zwischen zwei Arten subjektiver Erkenntnis zu unterscheiden: historischer und rationaler Erkenntnis. «Die historische Erkenntnis ist cognitio ex datis, die rationale aber cognitio ex principiis».22 So kann sich der historisch erkennende Mensch das Überlieferte bis zur Gelehrtheit aneignen; aber, «ob er gleich alle Grundsätze, Erklärungen und Beweise, zusamt der Einteilung des ganzen Lehrgebäudes, im Kopf hätte, und alles an den Fingern abzählen könnte […]; er weiß und urteilt nur so viel, als ihm gegeben war». Und so kann vom historisch Erkennenden gesagt werden:
Streitet ihm eine Definition, so weiß er nicht, wo er eine andere hernehmen soll. Er bildete sich nach fremder Vernunft, aber das nachbildende Vermögen ist nicht das erzeugende, d. i. das Erkenntnis entsprang bei ihm nicht aus Vernunft, und, ob es gleich, objektiv, allerdings ein Vernunfterkenntnis war, so ist es doch, subjektiv, bloß historisch. Er hat gut gefaßt und behalten, d. i. gelernet, und ist ein Gipsabdruck von einem lebenden Menschen.23
Dem bloß historischen Erkennen setzt Kant nun jene «Vernunfterkenntnisse» entgegen, die «aus allgemeinen Quellen der Vernunft, woraus auch die Kritik, ja selbst die Verwerfung des Gelerneten entspringen kann, d. i. aus Prinzipien geschöpft werden».24 Das Entscheidende: Die rationale Erkenntnis aus Prinzipien erlangt ihre Eigenbestimmtheit zwar im Unterschied zum bloß historischen Philosophieren, dennoch aber nicht losgelöst von der eigenen Geschichte. Rationalität ist die unterscheidende Vermittlung des eigenen Gehalts mit der Tradition, der Name dieser Vermittlung nach allgemeinverbindlichen Prinzipien: Kritik. Die Vernunft geht also weder in der Geschichte auf, noch schwebt sie auf einer Wolke über diese hinweg. Vielmehr hat sich die rationale Erkenntnis jederzeit ihrer Differenz zum historisch Vorgegebenen zu versichern, um den Anspruch auf Rationalität zu erfüllen. Ohne Kritik keine Rationalität. Es zeigt sich danach, dass die Verbindlichkeit, die die Geltungsreflexion beansprucht, den prinzipiengeleiteten Umgang mit den ex datis vorliegenden Anspruchsgehalten der spekulativen Philosophie darstellt – «woraus auch die Kritik, ja selbst die Verwerfung des Gelerneten entspringen kann».25
Wie steht nun die negative Dialektik zu alldem? Offenbar doch so, dass sie sich den ex datis vorliegenden Gehalt der traditionellen Dialektik gemäß den Prinzipien der Kritik aneignet, d. h. das Überlieferte angesichts seiner Verstrickung in die Gesamtwirklichkeit auslegt und – verwirft. Konkret bedeutet es, dass sie den Reflexionszusammenhang der traditionellen Dialektik in den Horizont der Selbstkritik der Vernunft reintegriert, aus dem sie seit Hegel ausgebrochen zu sein vorgibt. Hierfür eignet sich Adorno das kantische Modell der Geltungsreflexion kritisch an; wobei der entscheidende Unterschied dieser Aneignung zur Aneignung des dialektischen Traditionsgehalts ist, dass Adorno das kantische Modell der Geltungsreflexion nicht verwerfen kann, wo er das kantische Modell angesichts seiner Verstrickung in die Wirklichkeit kritisiert. Vielmehr zeigt sich, dass sich noch die Kantkritik Adornos auf dem von Kant vorgezeichneten kritischen Weg bewegen muß. Anders ausgedrückt: Adornos kritische Bezugnahme auf Kant dient insgesamt der (mit dem Programmtitel einer ‹negativen Dialektik› beanspruchten) «Lossage von Hegel».26 Denn, wie es Adorno selbst 1962 in seinem Beitrag «Wozu noch Philosophie?» im Merkur formuliert hat:
Philosophie, wie sie nach allem allein zu verantworten wäre, dürfte nicht länger des Absoluten sich mächtig dünken, ja müßte den Gedanken daran sich verbieten, um ihn nicht zu verraten, und doch vom emphatischen Begriff der Wahrheit nichts sich abmarkten lassen. Dieser Widerspruch ist ihr Element. Es bestimmt sie als negative. Kants berühmtes Diktum, der kritische Weg sei allein noch offen, gehört zu jenen Sätzen, in denen die Philosophie, aus der sie stammen, die Probe besteht, indem sie, als Bruchstücke, das System überdauern.27
4.
Das Nachfolgende soll zeigen, dass und inwiefern der dialektische Weg, den Adorno einschlägt, eben als Fortsetzung des kritischen Wegs, den Kant eingeschlagen hat, zu begreifen ist. Adornos kritisch-spekulatives Reflexionsmodell ist dabei Ausdruck der Bemühung, das Verhältnis zwischen Kant und Hegel sowohl von deren Gegensatz aus als auch aus dem sie einigenden Band heraus zu bestimmen. Negative Dialektik ist Dialektik, weil sie das kritische und das spekulative Motiv miteinander vermittelt, beides unterscheidet und aufeinander bezieht. Der Zusatz ‹negativ› gibt entsprechend Auskunft darüber, wie der Zusammenhang zwischen Kritik und Spekulation als solcher zu beurteilen ist: Er ist, wenn es um seine inhaltliche Artikulation geht, zu negieren. Kritik bestimmt daher insgesamt den Sinn aller Vermittlungen bei Adorno. Danach findet sich die negative Dialektik in einer ständigen Reflexion auf die eigene Legitimationsgrundlage wieder. Dieses Reflexionsgeschehen, das von der Forschung immer noch weitgehend als «dialektische[r] Taumel in kleinsten Kreisen»28 ohne systematischen Zusammenhang wahrgenommen wird, würde insofern trotz oder gerade aufgrund seiner Exzentrik der zitierten Standarddefinition von Reflexion bei Wagner entsprechen. Sie wäre das «Beisichsein im Modus der Rückkehr aus dem Außersichsein» des dialektischen Reflexionssubjekts.29 Das negativ-dialektische Reflexionssubjekt ist bei sich, wo es die kritische Vernunft vor der Projektion ihrer Einheit auf die Welt bewahrt hat. Denn: «Das Unheil geschieht durchs Thema probandum: man bedient sich der Dialektik anstatt an sie sich zu verlieren.» Das negativ-dialektische Reflexionssubjekt ist entsprechend außer sich, wo es sich an die Dialektik der Welt verliert; und zwar, um dasjenige zu vergegenwärtigen, was in der All-Einheit nie aufgehen wird: das Nichtidentische. So zeigt sich, dass die wesentliche Verinnerlichungstendenz aller Reflexion gegen sich selbst gekehrt wird: Der Modus, der das Beisichsein des Reflexionssubjekts bestimmt, ist nun wesentlich an die Vergegenwärtigung radikaler Andersheit rückgebunden.
Diese ‹Widerlegung› der bestehenden Welt durch kritische Theorie soll im Folgenden durch das In-Beziehung-Setzen der kritischen Theorie zu Kant nachvollzogen werden. Diese Gedanken eröffnen den Horizont, innerhalb dessen Adornos Kantinterpretation Kontur gewinnen kann. Um einen Grundzug derselben vorwegzunehmen: Adornos Kantinterpretation verfolgt überall (also auch dort, wo Kant heftig kritisiert wird) das Ziel, «den eigentümlichen Januscharakter der Kantischen Philosophie» zu entfalten und so die «großartige Zweideutigkeit»30 dieser Philosophie herauszuarbeiten, mit dem Ziel, diese Zweideutigkeit gegen die eindeutig positive Dialektik auszuspielen. Adornos Kantinterpretation nimmt so eine tragende Rolle ein für das Konzept einer an Hegel anschließenden, aber final negativen Dialektik. Adorno legt die Zweideutigkeit der kantischen Philosophie in seiner 1959er Vorlesung über Kants «Kritik der reinen Vernunft» nämlich dahingehend aus, dass diese «gleichzeitig eine Identitätsphilosophie […] und eine Nichtidentitätsphilosophie» ist. Nun würde man doch denken, dass genau das auf Hegel zutrifft, stammt von letzterem doch immerhin jene epochemachende «Definition des Absoluten» als einer «Identität von Identität und Nichtidentität».31 Hierin liegt aber gerade die Pointe von Adornos Interpretament der großartigen Zweideutigkeit. Hegels positive Dialektik fällt trotz deren Großartigkeit hinter diese Großartigkeit zurück und bleibt bloße Identitätsphilosophie. Insofern wäre der Horizont der zweideutigen Kritik nämlich größer als derjenige der eindeutig spekulativen Tradition. Dies zeigt sich zumal daran, dass der Hegelianismus als Identitätsphilosophie jene Zweideutigkeit der Zweckbestimmtheit philosophischer Reflexion zwischen Kritik und Spekulation vereindeutigen muss, die uns – ex datis – als säkularer Gegensatz zwischen Kant und Hegel vorliegt. Adorno ist daher Hegelianer nur aus methodischen Gründen – um den Horizont der positiven Dialektik final durch Kritik zu erweitern. Hegel lässt sich, wie gesagt, ja nur von innen heraus relativieren; darum soll die negativ-dialektische Reflexion darlegen, dass all die spekulativen Motive, die Hegel gegen Kant ins Feld führt, schon bei Kant angelegt sind, aber mit dem grundlegend andersartigen Ergebnis, dass bei Kant die Koinzidenz von Identität und Nichtidentität von Kant noch als Grund zur Kritik gewertet und in den Horizont der Grenzbestimmung der Vernunft integriert wird. In seiner Vorlesung zur Einführung in die Dialektik hebt Adorno entsprechend hervor, «daß eigentlich die Dialektik in einem eminenten Sinn die zu ihrem Selbstverständnis, zu ihrem Selbstbewußtsein gekommene Kantische Philosophie sei».32
Angesichts dessen liegt die systematische Bedeutung des Verhältnisses zu Kant auf der Hand: Adornos Dialektik wäre als eine Spielart hegelscher Dialektik nur die selbstbewusste Explikation der kantischen Philosophie. Entsprechend wäre das Reflexionsgeschehen der negativen Dialektik in Analogie zur kantischen Geltungsreflexion nachzuvollziehen. Dieselbe Einheit von Identität und Nichtidentität nämlich, in der Hegel die spekulative Ermächtigung des Denkens erkennt, dient dem Denken Adornos (wie bei Kant) als Grund zur (Selbst-)Kritik. In diesem Sinne erhält das Verhältnis zu Kant eine ‹grundlegende› Bedeutung für die negative Dialektik: Der Weg zurück zu Kant erweist sich als einziger Weg, auf dem die hegelianische Tradition noch gegen sich selbst zu denken vermag. Und gegen sich selbst denken muss die Dialektik – sie muss Grenzbestimmung sein, um spekulativ relevant zu bleiben.
5.
Überblicken wir die Forschungslage, finden sich wenig Belege dafür, dass die systematische Tragweite von Adornos Kantbezügen breite Anerkennung findet. Vielmehr besteht gerade in systematischer Hinsicht eine Forschungslücke mit Blick auf Adornos Kantinterpretation. Die m.W. einzige Monographie, die sich exklusiv Adornos Kantinterpretation widmet33 – die 1983 in den Ergänzungsheften der Kant-Studien publizierte Studie Kritische Theorie versus Kritizismus von Carl Braun –, gelangt zum Schluss, dass die Prätentionen der kritischen Theorie die Natur des Kritizismus grundsätzlich verfehlen. Danach steht Adornos unorthodoxe Kantinterpretation unter dem Verdacht, ein «grundlegendes Mißverständnis von Transzendentalphilosophie»34 darzustellen. Nach dem bisher Gesagten muss allerdings gesagt werden, dass diese Linie der Adornokritik die Methodenbestimmtheit der negativen Dialektik ausklammert und vereinzelte Interpretamente als Momente einer eindeutig ablehnenden Kantkritik liest, statt die Zweideutigkeit zu hören, die aus ihrem Zusammenspiel spricht. Kein Wunder also, beginnt der Beitrag zur Rolle Kants im Adorno-Handbuch mit einer apologetischen Note: «In einer Essenzbeschreibung dessen, was man Frankfurter Schule oder, weiter gefasst, Kritische Theorie nennt, kommt der Name Kants zunächst nicht vor.»35 Ähnlich sieht sich Jay Bernstein in A Companion to Adorno zur Emphase veranlasst, dass eine grundlegende Beschäftigung mit Adornos Kantinterpretation angezeigt wäre, was impliziert, dass dies bislang nicht der Fall ist.
Although Negative Dialectics is premised on a conversation with Hegel over dialectics, both its critical object, constitutive subjectivity, and its metaphysical promise, aesthetic semblance, derive fundamentally from a dialog with Kant’s Critique of Pure Reason. Getting this in plain view is the first task for a reading of Adorno’s philosophy.36
Die vorliegende Untersuchung wird diese Aufgabe selbstredend nicht alleine lösen können. Sie strebt nicht materiale Vollständigkeit an und zielt auch nicht auf eine enzyklopädische Erschließung ihres Gegenstandes. Auch muss davon abgesehen werden, die Auseinandersetzung Adornos mit Blick auf die praktische Philosophie und die Ästhetik eingehend zu behandeln, obwohl die Motive des «neuen kategorischen Imperativ[s]»37 oder die kantischen Problemstellungen des Erhabenen und des Naturschönen in der Ästhetischen Theorie Grund genug dafür wären. Zweck dieser Untersuchung ist es stattdessen, einen Grundstein zu legen, um die erstaunlich hartnäckigen Vorurteile herausfordern zu können, wonach Adornos offenkundig widersprüchlichen Kantbezüge als unseriös, wirr oder einfach nur falsch abgetan, statt als notwendige Funktion zur Spezifizierung der negativen von der positiven Dialektik begriffen zu werden. Das Kernanliegen dieser Untersuchung ist daher eine rationale Rekonstruktion von Adornos Kantinterpretation, wie sie in ihrer zweideutigen Anlage systematisch durch die Idee einer negativen Dialektik vorgezeichnet und durch Adornos zeitlebens erfolgende Auseinandersetzung mit Kant zum Ausdruck gekommen ist.
6.
Der Grundgedanke hinter dieser Interpretation lautet darauf, den Begriffsgehalt der spekulativen Reflexion, Reflexionsbegriffe, an ihren Ursprung aus dem Geist der Kritik zu erinnern. Bei Kant spielen die Reflexionsbegriffe eine tragende Rolle. Deren Einsatz im Anhang zur «Transzendentalen Analytik» führt die Grundoperation der Kritik beispielhaft vor Augen. Die Grundoperation der Kritik besteht jeweils in der Rückführung eines Unbedingtheitsanspruchs auf eine zugrunde liegende Negationshandlung – darin, in der affirmativen Gestalt unendlicher Urteile das zugrunde liegende Reflexionsverhältnis sichtbar zu machen und die wechselseitig einander negierenden Bestimmungen von der Sache, die durch sie bestimmt werden soll, zu unterscheiden.38 Kritik bedeutet so die Rückübersetzung objektiv beanspruchter Negationsverhältnisse in erkenntnislimitierende Gehalte. Denn die Kritik deckt die Negationsverhältnisse in den unendlichen Urteilsgehalten der Tradition auf und eignet sich diese prinzipiell an; während die vorkritische Tradition diese unendlichen Urteilsgehalte positiv beansprucht, legt die Kritik dieselben Gehalte als Grenzen unseres Erkenntnishorizonts aus. Die Kritik bringt den kritisierten Traditionsgehalt zwar noch einmal positiv zur Darstellung, als Grenzbestimmung aber verlangt dieser Gehalt neu nach einer negativen Ausdeutung.39 Entsprechend dieser negativen Ausdeutung beschreibt die Grundoperation der Kritik eine Anverwandlung ex datis vorliegender, positiver Anspruchsgehalte – und zwar gemäß Prinzipien, die im Zuge ihres Einsatzes zur Grenzbestimmung als vor allen Menschen vertretbar erachtet werden dürfen.40
Die universale Geltungsanspruch der Kritik stellt mithin keinen unmittelbar objektiven Erkenntnisanspruch dar. Weit gefehlt aber, dass die Kritik deshalb gar keinen Erkenntnisanspruch erheben würde; es ist vielmehr ein unmittelbar subjektiver und vermittelt objektiver Erkenntnisanspruch, den die Kritik erhebt. Und hieraus folgt: Sofern der kritische Weg zu Erkenntnis führen soll, ist die Kritik notwendig auf Vermittlung und insofern auf Dialektik angewiesen.
Dass die Reflexionsbegriffe bei Kant die Prinzipien der Kritik (Kritik im Sinne der Prüfung dogmatischer Erkenntnisansprüche) darstellen und als solche an Verbindlichkeit gewinnen, erhellt aus dem Gedanken einer «Amphibolie der Reflexionsbegriffe». Er besagt: Am Leitfaden der Reflexionsbegriffe soll es uns mit Blick auf alle Erkenntnisansprüche der Tradition möglich werden, historisch-kontingente Artikulationen der Philosophie ex principiis zu verstehen, d. h., das Prinzipiierte (die data) als Ausdruck der allen Menschen gemeinsamen Vernunft zu interpretieren. Die hiermit vollzogene Verwandlung kontingenter Ansprüche in notwendige Äußerungen der einen Vernunft erfolgt in dem Moment, wo die kritische Vernunft die Amphibolie aufdeckt, die die Tradition dazu verleitet hatte, einen Reflexionsgehalt mit einem objektiv bestehenden Sachverhalt zu verwechseln.
Für den vorliegenden Zusammenhang nimmt das Reflexionsbegriffskapitel der Kritik der reinen Vernunft daher eine zentrale Rolle ein. Dieser Abschnitt offenbart, dass die Einheit der besagten ‹einen› Vernunft nur die Einheit der radikal selbstkritischen Vernunft sein kann – jene Einheit, die ihr Selbstverständnis als Einheit nur im Zuge des Sich-Unterscheidens von etwas Anderem gewinnen kann. Durch Reflexion auf die dogmatische Tradition wird eine negative Einheit von System und Geschichte der Philosophie konzipiert, die den Reflexionszusammenhang der Tradition nicht in sich abschließt, sondern kritisch erweitert. Diese kritische Erweiterung zum Ende der «Analytik» ist aus systematischen Gründen notwendig, weil sie den Einsatz der «Transzendentalen Dialektik» vorbereitet. Kants Dialektik-Konzeption gewinnt dadurch an spekulativer Relevanz: indem sie die Grenze des Reflexionszusammenhangs abschließend bestimmt und also – indirekt – eine «Verknüpfung des Bekannten mit einem völlig Unbekannten»41 herstellt. Nur ein einseitig auf Identität fixiertes Denken konnte der Dialektik Kants diese spekulative Bedeutung absprechen. Und es ist insofern kein Zufall, dass die genannte ‹Verknüpfung› erst im Kontext radikaler Hegelkritik wieder zur Geltung gelangten kann
Worüber erlangen die Reflexionsbegriffe aber ihre objektive Bedeutung – jene Bedeutung, die sie von ‹herkömmlichen›, Objekte subsumierenden Begriffen abhebt? Die Antwort: Im Zuge des Nachweises ihrer Verwechslung mit Dingbegriffen. Der einzig rechtmäßige Gebrauch von Reflexionsbegriffen ist nichts anderes als die Kritik ihres unrechtmäßigen Gebrauchs.
Kant nennt den unrechtmäßigen Gebrauch von Reflexionsbegriffen ‹Amphibolie›. Der Begriff ‹Amphibolie› bedeutet, wenn wir mit Peter Baumanns von Aristoteles her denken: Zweideutigkeit aus Verwechslung.42 Der traditionell falsch beurteilten Zweideutigkeit gegenüber stellt das kantische Reflexionsbegriffskapitel also die erstmalige nichtamphibolische Inanspruchnahme der betreffenden Gehalte dar. Zweideutig bleiben die Reflexionsbegriffe zwar auch im Horizont der Kritik. Denn ein Reflexionsbegriff impliziert ja immer den anderen mit. Und zugleich schließt der eine den anderen Begriff im Namen der eigenen Bestimmtheit aus: Was einerlei ist, ist gerade nicht verschieden; was in sich stimmig, ist nicht widersprüchlich. Das Innere ist nicht das Äußere; die Form das Andere des Inhalts. Aber die Kritik artikuliert diese Zweideutigkeit der Reflexionsbegriffe ohne Verwechslung des transzendentalen Ortes, an dem sich ihr Inhaltsanspruch einlösen ließe. Das Innere zum Beispiel ist als Reflexionsgehalt meist Index seiner Zugehörigkeit zur Subjektivität. Ebenso Einerleiheit, Einstimmigkeit oder Form – sie alle wurden traditionell mit objektiven Bestimmungen verwechselt. Kants transzendentale Reflexion dient dazu, diese Verwechslungen endlich als Projektionen einer sich selbst missverstehenden Subjektivität zu entlarven – dieser Subjektivität also durch Selbstkritik zu einem geläuterten Selbstverständnis zu verhelfen.
Ihre gleichförmige43 Gestalt erlangen die Reflexionsbegriffe entsprechend als vor-kategoriale und dennoch kategorial-bestimmte Artikulationen des Verhältnisses zwischen Sinnlichkeit und Denken. Da dieses Verhältnis im Horizont der Selbstkritik des Denkens thematisiert wird, bestimmt der Unterschied zwischen Sinnlichkeit und Denken den Sinn ihrer Beziehung zueinander. Das heißt: Vermittlungen durch Reflexionsbegriffe verbürgen keine objektstufige Erkenntnis von Gegenständen, sondern beschreiben nichts anderes als das negative Tun der Selbstkritik. Die reflexive Kritik zeigt auf, inwiefern bestimmte Ansprüche nur mit Blick auf Erscheinungen und nicht auch für Dinge an sich gelten können. Die durchgängige Zweistelligkeit als solche der vier Reflexionsverhältnisse ‹symbolisiert› das Negationsverhältnis von Erscheinung und Ding an sich. Kants Amphiboliekritik nimmt dieses negative Symbol positiv in Anspruch, interpretiert das daraus entspringende unendliche Urteil aber nicht mehr als ein positives Urteil über Unendlichkeit, sondern als die Grenze endlicher Vernunft.
Dasselbe, was Kant mit Blick auf die dogmatische Tradition vor ihm tut, muss Adorno mit der traditionellen Dialektik tun; er muss deren Themen der Herrschaft der bestimmenden Urteilskraft entreißen und einem Reflexionsgeschehen aussetzen, das die Dialektik von einer heiligenden Bestätigung des Bestehenden differenziert. Auch bei Adorno hängt die Verbindlichkeit der Reflexion somit an der Möglichkeit zur prinzipiellen Anverwandlung des Anspruchsgehalts der traditionellen Dialektik im Horizont einer Kritik ihres amphibolischen Fehlgebrauchs. Die hegelsche Dialektik nämlich, so Adorno in der Negativen Dialektik, «restauriert die Verfahrungsweise des Denkens, welche Kant am älteren Rationalismus als Amphibolie der Reflexionsbegriffe mit Grund tadelt. Sophistisch wird die Hegelsche Dialektik, wo sie mißlingt.»44 Gereicht nämlich die Not der Kritik zur Tugend der Spekulation, ist die versöhnende Reflexion nicht mehr von der Apotheose des Widerstreits der Meinungen zu unterscheiden, das Ganze jetzt der ewige Kampfplatz, den die kritische Geltungsreflexion ursprünglich befrieden sollte. Durch kritische Distanznahme von jener Sophistik, die ihre eigene prinzipielle Verfahrensweise auf die Welt an sich projiziert, statt sie aus dem Antagonismus zu befreien, soll die negative Dialektik ihren eigenen Wahrheitsanspruch einlösen. Dazu führt sie die Grundoperation der Kritik an der positiven Dialektik durch. Das heißt, sie führt den Unbedingtheitsanspruch der Dialektik – die absolute Identität – auf das ihm zugrunde liegende Negationsverhältnis zurück – das Nichtidentische. Ohne das Nichtidentische käme jene Vermittlung nämlich gar nicht erst in Gang, die sich dieses einverleiben möchte – das Bedürfnis der Vermittlung entsteht als Bedürfnis, wie gesagt, erst dort, wo der Weg der Kritik bereits eingeschlagen ist. Die negative Dialektik, die sich von jeder Heiligung des Kampfes vor dem Absoluten bestimmt distanzieren will, übersetzt daher den affirmativen Anspruch der Dialektik auf den Gesamtzusammenhang aller Negationsverhältnisse in einen unendlichen Urteilsgehalt zurück (i.e. das Nichtidentische). Als Grenzbegriff der traditionellen Dialektik setzt dessen Nichtidentität die bestehende mit anderen möglichen Welten ins Verhältnis.
So ist der Begriff der negativen Dialektik aber ein wenig präziser geworden: Bei Adorno bestimmt die Unterscheidung des Ganzen von etwas anderem den Sinn der vermittelnden Bezugnahme auf das Ganze. Die Idee einer negativen Dialektik fordert daher zuallererst dies: Die Verwechslung aus Zweideutigkeit, die die positiv-dialektische Reflexion vollzieht und dann unter Begriffe fasst, soll in die ‹großartigere›, da nichtamphibolische Zweideutigkeit einer Grenzbestimmung rückverwandelt werden. Ansonsten wäre Adorno tatsächlich nur der moderne Gipsabdruck Hegels und seine negative Dialektik die ‹historische Aktualisierung› der positiven Dialektik, wie sie uns allen ex datis im hegelschen Buchstaben vorliegt. Aus dem prinzipiellen Gesichtspunkt der allgemeinen Menschenvernunft betrachtet bliebe die negative Dialektik damit aber belanglos.
*
Der Hauptteil der Untersuchung ist, nach zwei hinführenden Abschnitten (II/1–2), in vier Unterkapitel (III/A–D) gegliedert. Die Vierteilung folgt der thematischen Vorgabe der kantischen Reflexionsbegriffe und steht daher im Horizont einer kritischen Geltungsreflexion. Die vier Bereiche dieses Horizontes sollen gemeinsam den argumentativen Raum erschließen, innerhalb dessen das negativ-dialektische Reflexionsmodell als Kantinterpretation exponiert werden kann.
Unter dem Titel Einerleiheit und Verschiedenheit (A) wird die Leitidee der negativen Dialektik thematisiert – der Gedanke der Nichtidentität des Identischen und des Nichtidentischen. Das Nichtidentische seinerseits wird als Grenzbegriff der dialektischen Vermittlung gekennzeichnet. Unter dem Titel Einstimmung und Widerstreit (B) soll einerseits Adornos Idee des Antisystems exponiert und mit dem Verhältnis von Constituens und Constitutum andererseits ein wichtiges Motiv von Adornos Kantinterpretation untersucht werden. Im Problemhorizont von Innerem und Äußerem (C) geht es darum, den Komplex des Kantischen Blocks zu rekonstruieren. Dabei gilt es zu sehen, inwiefern das auf den ersten Blick anti-kantische Konzept einer metaphysischen Erfahrung in wesentlichen Punkten an Kant anknüpfen muss. Der Gedanke einer Erkenntnis durch Analogie, wie er in den Prolegomena vorgestellt wird, erweist sich hier als maßgebend. Hierüber ist das Motiv des Niemandslandes, das in Adornos Kantvorlesung von 1969 eine tragende Rolle spielt, zu erhellen. Das Niemandsland wird als das Resultat von Adornos Aneignung der transzendentalen Geltungssphäre zu begreifen sein. Im letzten Abschnitt soll die Rekonstruktion des negativ-dialektischen Reflexionsmodells abgerundet und der systematische Gedanke dieser Arbeit dem Ziel zugeführt werden. Die negative Dialektik wird als transzendentale Reflexion auf Materie und Form (D) der traditionellen Dialektik dargestellt. Unter dieser Vorgabe kann Adornos Interpretation der transzendentalen Ästhetik, die Idee des Vorrangs vom Objekt sowie zum Ende Adornos bilderloser Materialismus erhellt werden.
II. Zur systematischen Bedeutung der Kantinterpretation Adornos
Analytic gehört zur doctrin; dialectic zur Kritik.1
1.Das Reflexionsmodell der negativen Dialektik aus systematischer Perspektive
Zunächst mag es befremdlich wirken, im Falle Adornos überhaupt von einer ‹systematischen Perspektive› zu reden. Ist Adorno nicht der Anti-Systemdenker par excellence? Bedeutet es nicht, Adornos Denken gegen den Strich zu bürsten, wenn wir dieses als ein ‹Reflexionsmodell› auslegen – es ‹aus systematischer Perspektive› betrachten? Im Folgenden soll plausibel werden, weshalb es nicht bloß möglich, sondern sogar notwendig ist, die Philosophie Adornos genau in dieser Hinsicht gegen den Strich zu bürsten.
Um den wichtigsten Grund vorwegzunehmen: Bei Adorno wird das dialektische Denken dem identifizierenden Systemdenken zwar scharf gegenübergestellt; nirgends aber wird behauptet, dass die Dialektik dem Bann des Systems entronnen wäre. Würde dies behauptet, wäre es sinnlos, im Falle Adornos von einer ‹Dialektik› sui generis zu reden; nur eine positive Dialektik darf sich anmaßen, durch ihre Vermittlungen dasjenige, was außerhalb des Systems liegt, unmittelbar zu erfassen. Stattdessen gilt es, die Dialektik von System und Antisystem nachzuvollziehen, was wiederum bedeutet, diejenigen Vermittlungen selbst nachzuvollziehen, die die dialektische Reflexion Adornos gerade zu ihrem Thema hat. Der Anspruch der negativen Dialektik lautet schließlich darauf, «mit konsequenzlogischen Mitteln […] anstelle des Einheitsprinzips und der Allherrschaft des übergeordneten Begriffs die Idee dessen zu rücken, was außerhalb des Banns solcher Einheit wäre».1 Dass sich die negative Dialektik auf das außerhalb des Systems Liegende also explizit in Form einer «Idee» bezieht, ist der Sache dieser Dialektik nicht nebensächlich. Und dass sie sich überdies gegen den Herrschaftsanspruch der Logik wendet, bedeutet daher auch nicht, dass sie ohne jede Logik verfährt. Es geht Adorno vielmehr darum, dem Systemdenken und seiner logischen Gestalt von innen heraus zu opponieren. Das Andere, das Außerhalb des Systems, ist noch nicht das Hoheitsgebiet der dialektischen Philosophie; deren Anspruch auf dieses Gebiet muss insofern die Gestalt einer Idee annehmen, deren Platz im Ganzen noch durch die Ordnung des Systems vorgegeben ist. Dieses Verhältnis zum kritisierten Systemdenken formt den Erkenntnisgehalt dialektischer Systemkritik wesentlich mit. Wollen wir diesen Gehalt bei Adorno verstehen, müssen wir darum zunächst verstehen, inwiefern der Gehalt der adornoschen Philosophie Ausdruck eben des dialektischen Verhältnisses von System und Systemkritik als solchen ist. Als das Überlieferte des adornoschen Denkens stellt dieser Gehalt einen bloßen Erkenntnisanspruch dar, der, wie jeder Anspruch, einer Prüfung bedarf, bevor er für bare Münze genommen und auf dem Markt der Theorien gehandelt werden darf.
Diese Anspruchsprüfung aber verlangt mit Blick auf Adorno, das Antisystem als einen Zusammenhang von Gedanken auszulegen, dessen Gehalt in jedem Moment noch auf das zu unterwandernde System rückbezogen bleibt. Adornos Antisystem ist daher sein eigenes Verhältnis zum System, keine abstrakte Alternative zum System, die mit der Tradition zu ‹vergleichen› und dann für philosophisch würdig oder unwürdig zu befinden wäre.2 Wenn also Adorno dieser Tradition im Namen von Dialektik vorhält, sie entstelle das Nichtidentische durch Identifikation, dann impliziert das nicht, dass es die negative Dialektik irgendwo vermag, das Nichtidentische positiv auf den Begriff zu bringen. Wir dürfen nicht so tun, als ob die Philosophie des Nichtidentischen nicht von den Aporien betroffen wäre, die sie der gesamten philosophischen Tradition als deren Mangel vorhält. Vielmehr müssen wir in der Wende zum Nichtidentischen die Vollendung der selbstkritischen Reflexionsbewegung erkennen, die diese Tradition trotz ihrer Mängel durchzieht. Dialektik ist für Adorno ‹nur› das Problembewusstsein, das stets von neuem die Möglichkeit aktualisiert, «gegen sich selbst zu denken, ohne sich preiszugeben».3 Ohne dieses Problembewusstsein wäre die Dialektik auch bei Adorno positiv zu nennen.
Halten wir fürs Erste fest: Negative Dialektik agiert nicht abseits des kritisierten Systemzusammenhangs, sondern beschreibt ein systemimmanentes Verhältnis; dieses Verhältnis gelangt zur Darstellung als problembewusste Auseinandersetzung mit und durch Kritik ander «Allherrschaft» von Begriff und System. Insofern ist die negative Dialektik – in den Worten Adornos – das «konsequente Bewusstsein von Nichtidentität»4 – wobei der Begriff ‹Nichtidentität› all dasjenige unter sich befasst, was dem kritisierten System aufgrund seiner Verfahrensweise äußerlich bleibt. Als dezidiert reflexive Auseinandersetzung mit dem Systemdenken hat das Antisystem wie gesagt noch Teil an der Ordnungsvorgabe des Systems, das durch dialektisches Philosophieren bestimmt negiert werden soll. Es gilt daher im Folgenden, insgesamt das analoge (d. h. sowohl identische als auch nichtidentische) Verhältnis von Antisystem und System zu erforschen und zu explizieren – auch wenn die Art und Weise dieser Explikation dem antisystematischen Gestus des adornoschen Denkens scheinbar widerspricht.
a) Über den Grundsatz: «Denken heißt identifizieren.»
Einen Denkzusammenhang in Analogie zu einem System zu betrachten heißt, diesen Zusammenhang aus einigen wenigen Sätzen oder gar aus einem einzigen Grundsatz heraus zu begreifen und gleichzeitig zu wissen, dass der einheitlich dargestellte Zusammenhang die eigentliche Sache nicht erschöpfen wird. Wo aber, wenn überhaupt, fände sich nun ein solcher Grundsatz bei Adorno? Welcher Gedanke könnte das Zentrum seines Antisystems bilden? Ich behaupte: Der Satz «Denken heißt identifizieren»1 bildet das Zentrum des negativ-dialektischen Antisystems. Vom Verständnis dieses Satzes, seines Gehalts und des Zwecks seines Einsatzes hängt viel, wenn nicht alles für das Verständnis der dialektischen Philosophie Adornos ab. Als Erstes soll deshalb versucht werden, ihn auszulegen.
Zunächst wirkt der Satz grob vereinfachend. Denken sei gewiss mehr als nur mechanisches Identifizieren; Denken bedeute doch mindestens auch Unterscheiden, Vergleichen, Negieren, Fragen, hypothetisch Erwägen, nicht zu vergessen Fürchten, Glauben, Hoffen etc. An dem Satz wird des Weiteren moniert, ihm liege ein äquivoker Begriff von Identität zugrunde. Es werde daraus nicht klar, welchen Begriff von Identität Adorno überhaupt meine; z. B. das ‹Etwas-als-etwas-› oder das ‹Etwas-mit-etwas-Identifizieren›. Adorno verwische, meint etwa Carl Braun, hier wie sonst auch «den Unterschied zwischen einer logischen Notwendigkeit und einer (im weitesten Sinne) psychologischen Nötigung». Und: «Da», so Braun weiter, «der Versuch, die Unterdrückung des Besonderen als logisch notwendig aus dem Begriff des allgemeinbegrifflichen Denkens abzuleiten, scheitert, muß Adorno auf psychologische Vorstellungen ausweichen».2 So glaubt man, durch den Nachweis mangelnder analytischer Differenziertheit mit dem Satz und mit der diesem impliziten Dialektik fertig zu sein.3
Aber dem Satz geht es weder um eine Theorie der Identität noch geht es um eine psychologische Erklärung dessen, was Denken ist und tut. Vielmehr soll mit dem Satz ein Reflexionsgeschehen zur Schau gestellt werden, das dem Gesagten seinen kritischen Sinn verleiht – ohne den er tatsächlich nur simplifizierend und belanglos wäre. Dieses Reflexionsgeschehen und seine gezielte Zurschaustellung im Text der Negativen Dialektik gilt es nachzuvollziehen. Danach erst kann das Reflexionsmodell konturiert werden, kraft dessen dieses Reflexionsgeschehen seine Verbindlichkeit als Kritik der philosophischen Tradition erlangt.
Der Satz «Denken heißt identifizieren» stellt zur Schau, dass er selbst als eine bereits vollzogene Identifikationshandlung in Betracht zu ziehen ist. Identifiziert worden ist das Denken als Denken und dabei als Handlung des Identifizierens. Der Satz «Denken heißt identifizieren» ist streng genommen also eine Tautologie; er beschreibt eine Identifikationshandlung, die sich selbst als Identifikationshandlung thematisiert und urteilsförmig darstellt. Diese selbstdarstellende Identifikationshandlung ließe sich auf verschiedene Weisen nachvollziehen: Zum Beispiel könnte man den Satz mit dieser oder mit jener Identitätskonzeption kurzschließen; der Satz könnte sogar die Komplexität eines Traktats über Identität annehmen und alle möglichen Operationen des Denkens ausdifferenziert zur Darstellung bringen. Jedes Mal aktualisierten wir aber nur auf verschiedene Weise diese eine Identifikationshandlung. Die Verschiedenheit möglicher Vollzüge des Identifizierens spricht also nicht gegen die Einfachheit des Grundsatzes «Denken heißt identifizieren». Denn der Satz besagt in jedem Fall: Die Einfalt des Identifizierens liegt aller möglichen Ausdifferenzierung des Identifizierten voraus und zugrunde.
Die nachfolgenden Sätze im Text der Negativen Dialektik erläutern den Befund nun dahingehend: «Befriedigt schiebt begriffliche Ordnung sich vor das, was Denken begreifen will. Sein Schein und seine Wahrheit verschränken sich.»4 Hier gilt es zwei Momente herauszustellen: Offenbar weiß das identifizierende Denken um eine mit jedem Akt des Identifizierens einhergehende, grundlegende Differenz: den Unterschied zwischen dem, «was Denken begreifen will», und dem, was überhaupt im Horizont seiner Möglichkeiten als begrifflichem Denken liegt – kurz: um die Differenz von Anspruch und Erfüllung des begrifflichen Denkens.
Adorno geht offenbar von einem diskursiven Modell des Denkens aus. Für Kant ist alles menschliche Denken diskursives Denken. Diskursives Denken ist solches, das zur «Erkenntnis durch Begriffe»5 gelangen muss und sonst inhaltsleer bleibt. Begriffliches Denken aber bedarf, um nicht leer zu sein, der mindestens einmaligen Vermittlung mit der Sinnlichkeit. Die Theorie vom diskursiven Denken impliziert daher die Dualität der Erkenntnisstämme Sinnlichkeit und Denken. Deren Unterschiedenheit, die nur im Horizont der Kritik vergegenwärtigt werden kann, bildet den Erkenntnisgrund jeglicher reflexiv beanspruchten synthetischen Einheit.6 Das diskursive Modell besagt also: Um als Mensch überhaupt ‹etwas› und nicht nichts denken zu können, muss dieses Etwas begrifflich vermittelt sein. Nun kann das Denken den Unterschied zwischen dem, was es notwendig zu leisten beansprucht, und dem, was es leisten kann, begrifflich benennen (identifizieren). Aber es hat dadurch die unterschiedenen Glieder eben gerade nicht als Unterschiedene (d. h. als voneinander unabhängige, zufällig zusammengetretene Glieder) identifiziert. Wenn nämlich die Selbstidentifikation des Denkens bedeutet, der Scheinhaftigkeit der Identität von Begriff und begriffener Sache gewahr zu werden, dann bedeutet dies, des grundlegenden Mangels des identifizierenden Denkens innegeworden zu sein. Diese Not lässt sich nicht unmittelbar in eine Tugend verwandeln; denn der Mangel besteht ja darin, dass die Identifikation dessen, was identifiziert werden sollte, notwendig den Schein eines Einerleis von Verschiedenem produziert und infolgedessen am Ziel, das Verschiedene als solches zum Ausdruck zu bringen, scheitert. Schein und Wahrheit verschränken sich insofern in der begrifflich gefassten Identität von Verschiedenem. Adorno: «Der Schein von Identität wohnt […] dem Denken selber seiner puren Form nach inne.»7 Das macht den Schein jedoch nicht schon wahr. Der Satz «Denken heißt identifizieren» bleibt als das Mal des Scheiterns der Selbstidentifikation des Denkens und seines Scheins zu begreifen. Schein ist bei Adorno daher das eigentliche Thema der Dialektik, nicht Sein.
So müssen wir sagen: Der zunächst naheliegende, letztlich aber fehlgeleitete Einwand, dass der Satz «Denken heißt identifizieren» von mangelnder Komplexität ist, ist Ausdruck einer grundlegenderen Fehlinterpretation. Die Fehlinterpretation besteht darin, dass das vollzogene Geschehen der Selbstreflexion – das hier die Einfalt einer für das identifizierende Denken geltenden Bestimmung angenommen hat – nicht als reflexives Geschehen nachvollzogen wird. Der Satz wird stattdessen als Information über etwas, von dem selbstverständlich scheint, was es ist, interpretiert – über das Denken. Kurz, man erachtet den kritischen Grundsatz der negativen Dialektik als Erkenntnisgehalt einer traditionellen Theorie vom Denken – die als solche in der Tat mangelhaft wäre. Die These hier lautet dagegen: Der Grundsatz der negativen Dialektik ist nur als Erkenntnisgehalt einer kritischenTheoriedesDenkens sinnvoll – einer Theorie, die von der Differenz zwischen Anspruch und Erfüllung des Denkens (und sonst nichts) handelt.
b) Was heißt: kritische Theorie des Denkens?
Es lohnt sich, Adornos Bestimmung traditioneller Theorie aus der Negativen Dialektik ins Gedächtnis zu rufen: «Traditionelle Theorie wähnt, das Unähnliche zu erkennen indem sie es sich ähnlich macht, während sie damit eigentlich nur sich selbst erkennt.»1 Traditionelle Theorie also macht Gegenstände sich und einander ähnlich, um sie begrifflich erkennen zu können. Nur vergisst sie darüber die Unähnlichkeit, die durch das Geschehen der Verähnlichung verdeckt wird, diesem Geschehen aber als dessen Bedingung logisch vorangeht und es also in reflexiver Erinnerung als vergessenes Implikat des Gleichförmigen überdauert haben wird. Traditionelle Theorie ist dadurch unmittelbar nur Ausdruck des begrifflichen Denkens und seiner eigenen Verfahrensweise; sie identifiziert nur – und vergisst darüber das Nichtidentische, das die Bedingung der Möglichkeit aller Identifikation darstellt. Traditionelle Theorie ist tautologisch.
Hiervon vermag sich eine kritische Theorie des Denkens dadurch abzuheben, dass sie sich – als Kritik des identifizierenden Denkens – darauf besinnt, dass noch der Satz «Denken heißt identifizieren» Ausdruck identifizierenden Denkens ist. Auch dieser Satz identifiziert ja wie gezeigt etwas als etwas – konkret: Denken als Identifizieren. Aber wir müssen nun zugeben: Der Satz verfehlt sich selbst. Die besagte Tautologie einer sich selbst identifizierenden Identifikationsleistung offenbart ihren Mangel und damit denjenigen allen Denkens. Der Mangel allen Denkens besteht darin, in der innersten Zelle seiner Identität mit sich selbst auf etwas verwiesen zu sein, das nicht selbst Denken ist. Dabei bleibt es dem identifizierenden Denken aufgrund seiner Form notwendig verwehrt, dieses Etwas dem Gedanken zu integrieren: Sofort und unweigerlich wird dem Außerhalb des Denkens der Schein der Gedankenförmigkeit aufgeprägt, sobald dieses zum Gegenstand einer Identifikationsleistung geworden ist. Denn der Satz identifiziert das Denken ja gerade nicht an sich, wenn er denn zutrifft. Sein Timbre als kritischer Satz legt nahe: Das begriffliche Denken erfasst sich nicht ganz, wenn es sich selbst identifiziert. Der Satz stellt lediglich den Mangel des identifizierenden Denkens zur Schau, sich das Unähnliche ähnlich machen zu müssen.
Adornos reduktionistische Bestimmung des Denkens als Identifizieren wandelt sich auf den zweiten Blick zu einer indirekten, da negativen Bestimmung dessen, was Denken nicht ist, nicht tut und nicht integrieren kann. Diese negative Selbstbestimmung des Denkens besagt, dass das Einerlei, das das Denken durchgängig produziert, bloßer Schein ist und als notwendiges Implikat die Verschiedenheit mit sich führt. Als solche Selbstbestimmung des Scheins gelingender Identifikation dient die Bestimmung als Grundsatz negativ-dialektischer Reflexion. Adornos negativ-dialektische Reflexionslogik ihrerseits besagt: Wer die Scheinhaftigkeit der Identität im Zuge theoretischer Identifikationsleistungen nicht stets mit vergegenwärtigt, dem bleibt jede Erkenntnis des Gegenstandes versperrt.
Im Zuge der grundsätzlich kritischen Selbstbestimmung des Denkens verschränken sich der kritische und der theoretische Zugang zum Gegenstand ‹Denken›. Dass der diskutierte Grundsatz danach nicht mehr im Skopus einer traditionellen Theorie des Denkens stehen kann, bedeutet: Er bringt durch seine zur Schau gestellte Einfalt die, mit Kant zu reden, «elende Tautologie»2 der unkritischen Theorie des begrifflichen Denkens auf den Begriff – sonst nichts. So steht der Satz vorneweg im Skopus einer kritischen Reflexionsstruktur, deren Bestimmtheit als kritische der Satz rückwirkend begründet. Damit aber verändert sich sein Sinn grundlegend. Er wird zum Grundsatz einer Reflexion, die den Übergang bloßer Theorie in Kritik anleitet. Anders gesagt: Der Satz trägt eine grundlegende Nichtidentität in den Identitätsanspruch des Denkens ein.
Das heißt, in dem Grundsatz «Denken heißt identifizieren» drückt sich von vornherein ein anderes Interesse aus, als dasjenige zu sagen, was Denken ist und tut; nämlich das kritische Interesse des theoretischen Nachweises dessen, was das identifizierende Denken als solches gerade nicht zu sein bzw. nicht zu tun vermag, vielleicht aber einmal sein könnte, wenn es nur aus seinem ursprünglichen Fehler3 der Verähnlichung von an sich Unähnlichem lernen würde.4
Hieraus ergibt sich eine folgenreiche Konsequenz: Die Vorwürfe grober Vereinfachung an den Grundsatz der kritischen Theorie des Denkens sind falsch – und so falsch auch wieder nicht. Denn Adorno kann den Einwürfen das ganze Argument zugeben. Es geht ihm mit dem Satz «Denken heißt identifizieren» ja gerade darum, den Schein der Identität, der «dem Denken selber seiner puren Form nach inne[wohnt]», als unterkomplexe Beschreibung des Seins des Denkens auszuweisen. Der bevormundende Nachweis der Forschung, der Satz wäre stark vereinfachend, ist der Sache nach also nicht verfehlt; genau das soll ja zur Schau gestellt werden. Der Sinn des Satzes wird dadurch freilich verfehlt: Der Grundsatz der kritischen Theorie des Denkens zweckt auf das Zurschaustellen des Scheiterns seiner eigenen Identifikationsleistung ab. Er erklärt den besagten Urfehler allen Denkens zum Prinzip – zum Ausgangspunkt der begründeten Selbstkritik. Die negative Dialektik ist in ihren Identifikationsleistungen als identifizierende Theorie folglich insgesamt dazu bestimmt, die Reflexionsstruktur des seines notwendigen Mangels innewerdenden Denkens zur Schau zu stellen. Die negative Dialektik als verbindliche Darstellung dieser selbstkritischen Reflexionsstruktur zu begreifen, ist das Ziel der folgenden Ausführungen.
c) Urfehler und Korrektiv
Der Urfehler1 des Denkens – der Grundtatbestand, der jedem Denkvollzug als Bedingung vorausliegt – besteht gemäß Adorno also darin, dass das Denken den nichtidentischen Gegenstand (zwecks seiner Denkbarkeit) begrifflich identifizieren muss – dass also jede Identifikation eine Abstraktionshandlung voraussetzt, die uns denken lässt, «in der Bewegung der Abstraktion werde man dessen ledig, wovon abstrahiert ist».2 Hiergegen verspricht nun die Dialektik, ein heilsames Korrektiv zu sein. Warum aber sollte dialektisches Denken geeignet dafür sein, den Urfehler des auf Identität geeichten Denkens zu korrigieren? Wodurch kann sich Dialektik von den nur identifizierenden Vollzügen der traditionellen Theorie abheben? Nun – Adornos Antwort lautet, dass die Dialektik deshalb den Urfehler des Denkens korrigieren kann, weil sie «das konsequente Bewusstsein von Nichtidentität»3 ermöglicht.
Um diese Antwort besser zu verstehen, ist zunächst eine Bemerkung anzuführen, die trotz (oder vielleicht auch gerade wegen) ihres mündlichen Charakters wegweisende Bestimmungen für das Folgende enthält. Zu Beginn der 9. Vorlesung zur Einführung in die Dialektik vom 24. Juni 1958 stellt Adorno grundsätzliche Überlegungen darüber an, welcher Anlass uns eigentlich zu dialektischer Philosophie nötige. Dabei werden sogleich einige Zentralmotive der acht Jahre später veröffentlichten Negativen Dialektik eingeführt. Es scheint geboten, die Argumentation in voller Länge auszubreiten und dann mit Blick auf die vorliegende Problematik zu rekapitulieren.
Meine Damen und Herren,
entsinnen Sie sich der Bestimmung, Dialektik sei der Versuch, das Nichtidentische, also diejenigen Momente, die in unserem Denken nicht aufgehen, gleichwohl im Gedanken zu ihrem Recht zu bringen, dann ist es offenbar, daß in diesem Satz selbst ein Widerspruch gelegen ist, das heißt, daß die Identität des Nichtidentischen, wenn man sie so einfach ausspricht, wie ich sie eben ausgesprochen habe, ein falscher Satz wäre. Das bedeutet nun eine Aufgabe. Die Dialektik könnte von diesem Satz her interpretiert werden als die Anstrengung, diese Paradoxie, die in der Situation des Gedankens überhaupt gelegen ist, zu bewältigen. Und es leuchtet ein, daß diese Schwierigkeit nicht bewältigt werden kann in einem einfachen Satz. Das ist eigentlich die Nötigung zu dem systematischen oder sich ausbreitenden Charakter, den die Dialektik insgesamt hat. Das heißt, die Paradoxie des Versuchs, den ich Ihnen also so nun charakterisiert habe, nötigt dazu, sich selbst zu entfalten, und in einem gewissen Sinn könnten Sie die Dialektik betrachten als einen einzigen, sehr weit ausholenden Versuch, durch die Entfaltung dieses Widerspruchs eine Aufgabe, die in der Lage der Erkenntnis selbst gegeben ist, doch zu bewältigen. Sie können diesen Gedanken am besten vielleicht dadurch in seiner Nötigung verstehen, wenn Sie sich klar machen, daß der paradoxe Ansatz […] seinerseits eine nicht bloß ausgedachte Paradoxie ist, sondern daß er eigentlich die Aufgabe von Erkenntnis überhaupt in sich schließt.4
Das Argument verfährt in vier Schritten. (1) Es geht von einer «Bestimmung» der Dialektik als des Versuchs aus, das Nichtidentische innerhalb des Gedankens zu seinem Recht zu bringen. Weil denken aber identifizieren heißt, verwickelt sich das Anliegen, das Nichtidentische innerhalb des Gedankens zu seinem Recht zu bringen, in einen Widerspruch, eine Paradoxie. (2) Die Paradoxie des Denkens besteht offensichtlich darin, dass das Nichtidentische identifiziert werden muss, obwohl es als solches (selbstredend) nicht identifiziert werden kann. Ein Satz von der Form ‹…ist das Nichtidentische› ist immer paradox, da er sich selbst negieren muss, um seinen Anspruch zu erfüllen. Der Satz identifiziert etwas als Nicht-Identifiziertes und ist damit per se, wie Adorno hier sagt, «ein falscher Satz». Denken qua Identifizieren scheitert daher notwendig an dem eigenen Anspruch, etwas zu identifizieren. Müssen und Nicht-Können fallen beim Denken in eins. (3) Da die Dialektik dem Ziel verpflichtet bleibt, das Nichtidentische zur Geltung (Adorno: ‹zu seinem Recht›) zu bringen, erkennt sie eine «Aufgabe» darin, den Anspruch des Nichtidentischen gegen das identifizierende Denken zu vertreten.5 Der erste Schritt zur Lösung dieser Aufgabe wird darin bestehen, den Grundwiderspruch des Denkens zu benennen und zu Bewusstsein zu bringen, wo er unterschlagen wird. (4) Um diese Aufgabe aber zu meistern, muss sich die Dialektik von dem Diktat der identifizierenden Satzform emanzipieren und zur vermittelnden Reflexion auf die identifizierte Sache übergehen, um so stets von neuem das erwähnte Paradox zu entfalten. Nur so könne das Denken dem Nichtidentischen zu seinem Recht verhelfen. Das Nichtidentische hat sich hiermit unversehens von einem bloßen Gehalt, dem je schon verpassten Gehalt identifizierenden Denkens, in eine ungelöste Aufgabe, die Aufgabe des dialektischen Denkens, zurückverwandelt.
Adorno fährt an der zitierten Stelle wie folgt fort:
Denn es leuchtet ein, daß Denken oder daß Erkennen eigentlich nur dort ein Erkennen ist, wo es mehr ist als das bloße Bewußtsein von sich selbst, wo es also auf ein anderes geht, wo es nicht bei der bloßen Tautologie bleibt. Wenn wir etwas erkennen wollen, dann wollen wir – wenn Sie mir das Schulmeisterlich-Geistreiche verzeihen wollen – etwas erkennen und nicht bloß bei der Erkenntnis stehenbleiben. Mit anderen Worten: Wir wollen über den Bereich unseres Denkens hinausgehen. Auf der anderen Seite aber wird dadurch, daß wir dies Etwas erkennen wollen, dies doch selber auch zu einem Moment unseres Denkens, es wird selber Erkenntnis, es wird selber eigentlich auch Geist. Erkennen heißt immer soviel wie: das, was uns fremd, unidentisch gegenübersteht, in unser eigenes Bewußtsein hineinzunehmen, gewissermaßen uns zuzueignen, zu unserer eigenen Sache zu machen.6





























