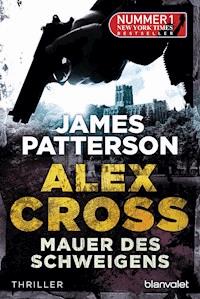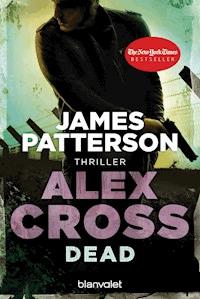10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Women's Murder Club
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Fall für Lindsay Boxer und den »Women's Murder Club« von SPIEGEL-Bestsellerautor James Patterson!
Drei junge Lehrerinnen verschwinden nach einem Kneipenabend in der Stadt ohne jede Spur. Als eine von ihnen ermordet aufgefunden wird, ahnt Sergeant Lindsay Boxer, dass ihr wenig Zeit bleibt, um die beiden anderen lebendig aufzuspüren ... Auch ihr Ehemann, Special Agent Joe Molinari, arbeitet an einem scheinbar hoffnungslosen Fall: Eine junge Frau will einen berüchtigten Kriegsverbrecher aus Serbien in San Francisco gesehen haben, dessen Gesicht sie noch heute in ihren Albträumen verfolgt. Doch dann reiht sich Joes Informantin ebenfalls in die Riege der verschwundenen Frauen ein, und die Fälle prallen aufeinander. Joe, Lindsay und der »Women's Murder Club« müssen erneut ihre Kräfte vereinen, um dem Monster, das in der Stadt wütet, Einhalt zu gebieten ...
Lesen Sie auch die anderen Bände um den »Women's Murder Club«! Jedes Buch erzählt einen hochspannenden Fall und kann eigenständig gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Drei junge Lehrerinnen verschwinden nach einem Kneipenabend in der Stadt ohne jede Spur. Als eine von ihnen ermordet aufgefunden wird, ahnt Sergeant Lindsay Boxer, dass ihr wenig Zeit bleibt, um die beiden anderen lebendig aufzuspüren … Auch ihr Ehemann, Special Agent Joe Molinari, arbeitet an einem scheinbar hoffnungslosen Fall: Eine junge Frau will einen berüchtigten Kriegsverbrecher aus Serbien in San Francisco gesehen haben, dessen Gesicht sie noch heute in ihren Albträumen verfolgt. Doch dann reiht sich Joes Informantin ebenfalls in die Riege der verschwundenen Frauen ein, und die Fälle prallen aufeinander. Joe, Lindsay und der »Women’s Murder Club« müssen erneut ihre Kräfte vereinen, um dem Monster, das in der Stadt wütet, Einhalt zu gebieten …
Autor
James Patterson, geboren 1947, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Seine Thriller um den Kriminalpsychologen Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Auch die Romane seiner packenden Thrillerserie um Detective Lindsay Boxer und den »Women’s Murder Club« erreichen durchweg die Spitzenplätze der internationalen Bestsellerlisten. Regelmäßig tut er sich für seine Bücher mit anderen namhaften Autoren oder Stars zusammen wie mit Dolly Parton für den »New York Times«-Nr.-1-Bestseller »Run, Rose, Run«. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester County, N. Y.
Die »Women’s Murder Club«-Reihe bei Blanvalet:Der 1. Mord · Die 2. Chance · Der 3. Grad · Die 4. Frau · Die 5. Plage · Die 6. Geisel · Die 7 Sünden · Das 8. Geständnis · Das 9. Urteil · Das 10. Gebot · Die 11. Stunde · Die Tote Nr. 12 · Die 13. Schuld · Das 14. Verbrechen · Die 15. Täuschung · Der 16. Betrug · Die 17. Informantin · Die 18. Entführung
Weitere Bände in Vorbereitung
James Patterson
mit Maxine Paetro
Die 18. Entführung
Thriller
Deutsch von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »The 18th Abduction« bei Little, Brown and Company, Hachette Book Group, New York.Die Figuren und Ereignisse in diesem Buch sind fiktional. Ähnlichkeiten zu realen Personen, lebend oder verstorben,wären rein zufällig und vom Autor nicht beabsichtigt.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2019 by James Patterson
This edition arranged with Kaplan/DeFiore Rights through Paul & Peter Fritz AG.
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München.
Redaktion: Gerhard Seidl, text in form
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © Getty Images (Jia Ji Yin/Eye Em; Scott Barbour/The Image Bank)
JA · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27662-1V001
www.blanvalet.de
Im Gedenken an Alexander Campbell Paetro
PROLOG
1 Joe und ich saßen auf der Rückbank einer schwarzen Limousine und glitten über die Autobahn. Wir waren auf dem Weg vom Amsterdamer Flughafen Schiphol zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.
Der Himmel war grau. Nur gelegentlich drangen einzelne Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke und brachten die Tulpenfelder entlang der A 44 zum Leuchten. Ich war zum allerersten Mal in den Niederlanden, aber es gelang mir nicht, mich dem Charme dieses Landes zu öffnen. Wir waren nicht hier, um Urlaub zu machen. Es war alles andere als eine Vergnügungsreise.
Ich bin Polizeibeamtin bei der Mordkommission des San Francisco Police Department. Ich besitze fünf blaue Hosen, dazu passende Blazer und ein ganzes Fach voller Oxford-Hemden. Am liebsten trage ich flache Halbschuhe, und meine blonden Haare binde ich normalerweise ganz automatisch zu einem Pferdeschwanz zusammen.
Heute jedoch hatte ich mich für ein gediegenes schwarzes Kostüm entschieden, dazu eine Perlenkette, Pumps und einen frischen Haarschnitt – das volle Programm.
Mein Ehemann Joe, ehemaliger Polizist und Experte für Terrorismusbekämpfung, ist heute einer der führenden Berater für Risikomanagement und arbeitet von zu Hause aus. Dem Anlass entsprechend hatte er heute Kakihose und Pullover gegen einen konventionellen grauen Anzug und eine unauffällige, blau gestreifte Krawatte ausgetauscht.
Förmliche Kleidung war vorgeschrieben.
Wir waren wegen eines ganz bestimmten Prozesses hierhergekommen. Es war kein gewöhnliches Gerichtsverfahren, sondern eines von höchster, ja von globaler Bedeutung. Wir fieberten dem Urteilsspruch entgegen. Meine Gefühle schwankten zwischen Nervosität und Vorfreude, Aufregung und Angst hin und her.
In nicht einmal einer Stunde würden wir in einem Saal des Internationalen Strafgerichtshofs Platz nehmen. Dieses Gericht wird von über hundertzwanzig Staaten auf der ganzen Welt anerkannt und ist für die strafrechtliche Verfolgung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen zuständig.
Welches Urteil würde das Gericht über Slobodan Petrović sprechen?
Am Abend würden wir es wissen.
2 Als Joe und ich die Einfahrt in die Internationale Zone von Den Haag erreicht hatten, säumten zahlreiche Demonstranten den Straßenrand. Sie hielten Plakate und Transparente in die Höhe und skandierten Sprechchöre. Nach allem, was ich mitbekam, machten sie sich für die Wahrung der Menschenrechte und die Ahndung von Kriegsverbrechen stark.
Der Himmel verdunkelte sich, und ein feiner Nieselregen wehte über den Oude Waalsdorperweg, die Straße, die zum Internationalen Strafgerichtshof führte.
Jan, unser Fahrer, bremste, um keine Fußgänger zu gefährden. Der Wagen hinter uns tat es ihm gleich.
Joe starrte zum Fenster hinaus, aber ich hatte eher das Gefühl, als würde er nach innen schauen und sich an die Anfänge des Ganzen erinnern. Er nahm mein Spiegelbild im Fenster wahr, drehte sich zu mir um und lächelte mich mit schmalen Lippen an.
»Bist du bereit, Lindsay?«
Ich nickte und drückte seine Hand. »Und du?«
»Ich habe diesen Moment herbeigesehnt. Seit einer gefühlten Ewigkeit.«
Am Fuß einer Treppe hielt der Wagen an. Die Stufen führten hinauf zu einem Gebäudekomplex aus Glas und Stein. Jan stieg aus, klappte einen großen Schirm auf und öffnete uns die Tür.
Der Wagen hinter uns blieb ebenfalls stehen. Die beiden prominenten Rechtsanwälte aus San Francisco stiegen aus, spannten ihre Schirme auf und waren Anna Sotovina, unserer fünfundvierzig Jahre alten Freundin, beim Aussteigen behilflich. Zu fünft gingen wir mit schnellen Schritten die Treppe hinauf und über die Plaza bis zum Haupteingang.
Überrascht stellte ich fest, dass sich unter einem Gebäudevorsprung zahlreiche Menschen drängten. Sie entdeckten uns ebenfalls, rannten auf uns zu und scharten sich um uns.
Auf den Jacken konnte ich die Schriftzüge verschiedener europäischer Zeitungen lesen. Sie hatten offensichtlich die US-Medienberichte aufmerksam verfolgt und uns erkannt.
»Sergeant Boxer, ich bin Marie Lavalle von Agence France-Presse«, wandte sich eine ernsthaft dreinblickende junge Frau an mich. Der Regen tropfte vom Rand ihrer Kapuze. »Darf ich Sie um einen Kommentar bitten? Was erwarten Sie von der heutigen Gerichtsverhandlung?«
Ich wich zurück, aber sie gab nicht nach. »Nur ein paar Worte«, sagte sie. »Ein kleines Zitat für unsere Leser.«
»Tut mir leid«, erwiderte ich. »Aber hier geht es um mehr als ein paar Wortschnipsel.«
Dann wurde Lavalle von einem rotgesichtigen Mann mit einem Diktiergerät in der Hand beiseitegedrängt.
»Madam, Hans Schultz, Der Spiegel. Ich habe gehört, dass Sie aus persönlichen Gründen heute hier sind. Stimmt das?«
Bevor ich antworten konnte, schob sich der nächste Reporter mit dem Rücken gegen mich und hielt Joe ein Mikrofon unter die Nase.
»Nigel Warwick, BBC, Sir. Ich habe Ihre Karriere verfolgt, Mr. Molinari. FBI, US-Heimatschutz. CIA. Sind Sie als offizieller Vertreter Ihrer Regierung gekommen?«
Die Kameraleute kamen näher.
»Meine Frau und ich sind als Privatpersonen hier in Den Haag«, fauchte Joe ihn an. Dann wandte er sich ab und legte mir schützend einen Arm um die Schultern.
Wir schoben uns weiter in Richtung Eingang. Kurz bevor wir die Tür erreicht hatten, spürte ich eine Berührung am Arm. Ich drehte mich um und wollte den aufdringlichen Journalisten unwirsch abschütteln, als ich Anna erkannte. Die Kapuze sorgte dafür, dass ihr Gesicht im Schatten lag, aber ich sah, dass ihre Augen vom vielen Weinen ganz geschwollen waren.
Auch mir standen Tränen in den Augen.
Ich nahm sie in den Arm, und sie drückte erst mich und dann Joe fest an sich.
Als die beiden sich losgelassen hatten, sagte ich: »Du kannst mir vertrauen. Das ist der richtige Weg.«
»Ich vertraue dir, Lindsay, und ich vertraue auch Joe. Aber ich weiß, wie das System funktioniert. Nicht einmal in diesem Gerichtssaal gibt es Gerechtigkeit, das ist meine Erfahrung. Die Amerikaner verlassen sich auf ihr Justizsystem. Aber wir nicht.«
Die Pressemeute und mit ihr Dutzende von anderen Interessierten kamen näher und stießen uns vorwärts. Joe ergriff meine Hand.
Ich sagte zu meinem Mann: »Falls das hier schiefgeht, bricht mir das Herz.«
FÜNF JAHRE ZUVOR
1 Anna streifte eine leichte Jacke über ihr Sweatshirt und ihre Baumwollhose, wickelte sich einen Schal um den Kopf und band ihn unter dem Kinn fest, um die handtellergroße Brandnarbe auf ihrer linken Wange zu verdecken.
Sie wollte noch einkaufen, bevor es dunkel wurde, und mit dem Fahrrad konnte sie sich gut durch den Feierabendverkehr schlängeln. Sie setzte den Rucksack auf, schloss die Wohnungstür ab und schnappte sich ihr Fahrrad. Dann trug sie es die beiden Stockwerke von ihrem Studio-Apartment hinab bis vor die Haustür, wo angenehme sechzehn Grad herrschten. Nachdem sie auch die Eingangstreppe hinter sich gebracht hatte, schwang sie sich auf den Sattel und fuhr los.
Wie immer genoss sie den Anblick der riesigen Rasenfläche des Alamo Square Parks gegenüber ihrer Wohnung in der Fulton Street. Was für ein Glück sie doch hatte, dass sie am Leben war, und zwar hier in den Vereinigten Staaten.
Jedes Mal wieder freute sie sich darüber wie am ersten Tag.
Sie kam an wunderschönen, alten, viktorianischen Häusern vorbei, den sogenannten Painted Ladies von San Francisco, und bog nach rechts auf die Fell Street ab. Jetzt ging es bis zu ihrem Lebensmittelhändler nur noch geradeaus. Sie passierte mehrere Querstraßen und musste schließlich vor einer roten Ampel warten. Aber dort sah sie etwas, was schlicht und einfach nicht wahr sein konnte.
Ein groß gewachsener Mann mit geröteten Wangen und einer Zigarre im Mund kam die Eingangstreppe vor einem der viktorianischen Häuser herab. Sein Anblick war wie ein Schlag in die Magengrube. Sie kam sich vor, als sei sie von einem Auto angefahren worden.
Anna wurde schwarz vor Augen. Ihre Knie gaben nach, aber obwohl sämtliches Blut aus ihrem Gehirn zu weichen schien, schaffte sie es noch, den Lenker mit beiden Händen zu packen und nicht umzufallen.
Als sie die Augen wieder aufmachte, stand er immer noch da auf der Treppe und versuchte, seine Zigarre anzuzünden. So hatte sie ein paar Sekunden Zeit, um sich zu vergewissern, dass sie nicht halluzinierte oder einen psychotischen Schub erlitten hatte. Vielleicht hatte sie sich ja doch getäuscht.
Anna fixierte den Teufel, der da an seiner Zigarre zog. Seine Haare waren grau geworden, aber sein Gesicht hatte sich kein bisschen verändert: dieselben vollen Lippen, dieselbe breite, faltenfreie Stirn, derselbe Stiernacken. Dazu die Körperform, die sie niemals vergessen würde, seine Art zu gehen – steif und bedächtig, wie ein Bär auf den Hinterpfoten.
Das war Slobodan Petrović, der Mann, dem sie in ihren nächtlichen Angstträumen begegnete, so, wie sie ihm zuvor im echten Leben begegnet war.
Annas Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Bilder zuckten vor ihrem inneren Auge auf: Petrović, wie er auf den Trümmern eines Wohnhauses stand. Er bückte sich, um ein kleines Mädchen zu umarmen, und stellte sich anschließend mit strahlender Miene vor der Menge und den Kameras in Positur. Seine Stimme klang überschwänglich und freundlich.
»Legt die Waffen nieder, dann werden wir euch beschützen. Das verspreche ich euch.«
Seine Worte wurden vom ununterbrochenen Ratta-ta-ratta-ta-tatt der Maschinenpistolen, von Babygeschrei und ohrenbetäubenden Bombenexplosionen untermalt. Sie musste an ein anderes Versprechen aus Petrovićs Mund denken: »Wir werden euch unter Bomben und Granaten begraben.«
In diesem Fall hatte er sein Wort gehalten.
Anna kehrte wieder zurück in die Gegenwart. Petrović schritt in seiner schicken amerikanischen Kleidung die Treppe auf die Fell Street herab. Er befand sich tatsächlich hier in San Francisco, kerngesund und quicklebendig.
Und nahm sie überhaupt nicht wahr.
Hinter ihr ertönte ungeduldiges Hupen und riss sie aus ihren Gedanken. Die Ampel war auf Grün gesprungen. Petrović machte die Tür seines Jaguar auf und stieg ein.
Er wartete nicht ab, bis die anderen Autos an ihm vorbeigefahren waren. Er riss das Steuer herum, gab Gas und nahm dem nächsten heranrollenden Wagen die Vorfahrt.
Begleitet von wütendem Hupen sah Anna dem Jaguar nach. Mit festem Griff packte sie den Lenker ihres Fahrrads und stieß sich ab, verfolgte Petrović und versuchte gleichzeitig, die Erinnerungen an seine Brutalität auszublenden. Aber das gelang ihr nicht.
Diese Bilder lebten in ihr weiter.
Petrović würde mit seinen Taten nicht davonkommen.
Dieses Mal nicht. Nicht schon wieder.
2 Mit Autos kannte Anna sich aus.
Ihr Vater und ihr Bruder waren vor dem Krieg Automechaniker gewesen, und so hatte sie eine Menge mitbekommen. Sie wusste, dass der Jaguar in etwa sechs Sekunden von null auf hundert beschleunigen konnte, allerdings nur auf freier Strecke.
Doch jetzt steckte Petrović wie alle anderen im Feierabendverkehr fest, der mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von vielleicht dreißig Stundenkilometern vorwärts kroch.
Vorteil Anna.
Eine Fahrradfahrerin mit mehreren Fahrzeugen Abstand würde Petrović nicht bemerken. Sie würde ihn so lange verfolgen, wie sie konnte.
Jetzt ging es weiter, und Anna huschte in den Schutz eines SUV, der dicht hinter dem Jaguar fuhr, sodass sie Petrovićs Blicke nicht zu fürchten hatte. Bergab war das alles kein Problem, aber als dann der unvermeidliche Anstieg kam, hatte sie große Mühe, Schritt zu halten.
Sie richtete sich auf und trat mit aller Kraft in die Pedale.
Wie lange würde sie das durchhalten? Petrović fuhr einen ausgesprochen leistungsstarken Sportwagen, während ihre müden Muskeln sich auf einem zwölf Jahre alten Drahtesel abmühten. Ein Auto sauste laut hupend und viel zu knapp an ihr vorbei. Der Luftzug rüttelte an ihrem Rad und hätte sie beinahe aus dem Gleichgewicht gebracht.
Doch sie fing sich wieder und fuhr weiter, hielt den Blick auf Petrovićs Wagen gerichtet. Jetzt näherte er sich einer Kreuzung. Die Ampel stand auf Gelb und sprang auf Rot, doch der Jaguar gab Gas und fuhr geradeaus weiter in die Einbahnstraße Richtung Golden Gate Park.
Anna fuhr ihm hinterher. Ohne das Protestgeschrei der Fußgänger auf dem Zebrastreifen zu beachten, jagte sie über die Kreuzung wie eine Wahnsinnige.
Sie war eine Wahnsinnige.
Inmitten des Hupkonzerts behielt sie den Jaguar weiter im Auge, bis ihr die Ironie der Situation bewusst wurde.
Selbst nach all diesen Jahren gelang es Petrović immer noch, sie in Lebensgefahr zu bringen.
Hastig schob sie diesen Gedanken beiseite. Wenn es in dieser Welt auch nur einen Hauch von Gerechtigkeit gab, dann würde sie diesen Mann jagen und zur Strecke bringen.
Mittlerweile hatten sich vier Autos zwischen sie und den Jaguar geschoben. Da wurde der silberfarbene SUV direkt vor ihr unvermittelt langsamer und bog, ohne zu blinken, in die Cole Street ab. Noch mehr Fahrzeuge schoben sich in die Lücke, und der Abstand zu Petrović wurde stetig größer.
Anna hatte sich sein Kennzeichen zwar eingeprägt, aber jetzt konnte sie sich schon nicht mehr daran erinnern. Ihr Brustkorb schmerzte. Die Beine brannten ihr. Tränen rannen ihr über die Wangen. Schweißtropfen liefen ihr den Rücken hinunter. Und hinter ihren Augenlidern zuckte, im Takt mit dem Ratta-ta-ratta-ta-tatt der Artillerie, eine grässliche Diashow aus Grausamkeit und Tod auf.
Sie wollte nicht aufgeben, fuhr immer noch weiter, wenn auch langsamer, und wurde dann, am Westende des Panhandle und beim Übergang auf den JFK Drive, wieder schneller. Sie würde es schaffen. Sie würde gewinnen.
Sie würde herausfinden, wo Petrović hinfuhr, und dann würde sie sich einen Plan zurechtlegen. Er würde nicht noch einmal entkommen.
In hohem Tempo näherte Anna sich der Stelle, wo Fell Street und Oak Street ineinander übergingen, da ertönte hinter ihr lautes Hupen. Ein Auto zog an ihr vorbei und schnitt ihr den Weg ab. Sie lenkte scharf nach rechts, geriet aus dem Gleichgewicht und stürzte.
Der Verkehr rollte weiter, und Anna Sotovina lag im Rinnstein.
Sie schrie zum Himmel, aber niemand hörte sie.
3 An einem kühlen Mittwochmorgen stellte mein Partner Rich Conklin unseren Streifenwagen auf dem abschüssigen Teil der Jackson Street im Schatten der Pacific View Preparatory School ab.
Die PVP galt als die vielleicht beste Highschool in ganz Kalifornien. Das Fächerangebot war innovativ und genügte höchsten Ansprüchen, die Sportabteilung stellte in fünf verschiedenen Mannschaftssportarten die aktuellen Highschoolmeister des Bundesstaats, keine andere Schule konnte mehr Absolventen an den besten Colleges des Landes vorweisen, und das Kollegium war durchweg mit erstklassigen Lehrkräften bestückt.
Conklin und ich waren hier, weil drei dieser Lehrkräfte auf verstörende Weise verschwunden waren. Heute war der zweite Tag unserer Ermittlungen, und es sah nicht gut aus.
Am Montagabend hatten Carly Myers, Adele Saran und Susan Jones allem Anschein nach die Pacific View Prep verlassen, um gemeinsam eine Kneipe in der Nähe aufzusuchen. Sie hatten im The Bridge zu Abend gegessen, sich lebhaft unterhalten und waren nach dem Verlassen des Lokals spurlos verschwunden. Alle drei waren Singles zwischen Ende zwanzig und Anfang dreißig. Der Barkeeper hatte genau gewusst, was sie jeweils getrunken hatten. Die Kellnerin und ein anderer Gast hatten beobachtet, wie sie gegen 21.00 Uhr und offensichtlich bester Stimmung gemeinsam das Bridge verlassen hatten.
Als die Lehrerinnen am nächsten Morgen nicht zur Arbeit gekommen waren, hatte man ihre verschlossenen Autos auf dem Schulparkplatz entdeckt. Ihre Taschen und Laptops hatten auf den Beifahrersitzen gelegen.
Wir hatten den ganzen gestrigen Tag damit zugebracht, ihre Wohnungen zu durchsuchen und ihre Gewohnheiten zu erfragen. Sie hatten nicht in ihren Betten geschlafen, hatten niemanden angerufen und über ihre Abwesenheit informiert und hatten keine Geld- oder Kreditkarten benutzt. Dem Anschein nach waren sie einfach verschwunden.
Der Leiter unserer kriminaltechnischen Abteilung, Charles Clapper, hatte seine besten Techniker und Ermittler aus allen Teams zusammengezogen.
Sie arbeiteten verbissen.
Auf dem Lehrerparkplatz gab es keine Überwachungskameras, aber die Kriminaltechnik hatte sich bereits das Video aus dem Bridge vorgenommen und untersuchte jedes einzelne Bild. Dazu wurden die Autos der Lehrerinnen ebenso gründlich unter die Lupe genommen wie ihre Laptops.
Bis jetzt hatte das Labor jedoch nichts Verdächtiges entdeckt und keinen einzigen Hinweis gefunden.
Das bedeutete unterm Strich: Seit sechsunddreißig Stunden hatte niemand mehr etwas von ihnen gesehen oder gehört.
Als wir mit ihren Wohnungen fertig waren, hatte Lieutenant Warren Jacobi sich bereits mit den Eltern der Frauen in Verbindung gesetzt. Und da Jacobi ein sehr guter Polizeibeamter war, hatten seine Fragen die Eltern sofort in Panik versetzt.
Carly Myers’ Familie wohnte in der Stadt. Conklin und ich hatten sie schon gestern Abend aufgesucht, unmittelbar nach Jacobis Anruf. Wir wollten sichergehen, dass wir nichts unversucht gelassen hatten. Es war in etwa so gelaufen wie erwartet: nackte Angst, Wut, unbeantwortbare Fragen und die dringende Bitte um die Zusage, dass ihrer Tochter nichts zugestoßen war.
Ihre Angst, ihr Schmerz und ihr Nichtwahrhabenwollen ließen mich seither nicht mehr los und hallten in mir nach.
Ich kippte den letzten Rest Kaffee hinunter, knüllte den leeren Becher zusammen und stopfte ihn in den Müllbeutel, den wir immer im Auto haben. Mein Partner tat es mir nach.
Rich Conklin ist eigentlich ein positiver Mensch, aber heute sah man ihm das nicht an. Er seufzte lang und tief, und das war mehr als nur die Frustration darüber, dass wir nichts als eine Schachtel voller unbedruckter Puzzleteile vor uns hatten. Er war wirklich erschüttert. Jahrelang hatte er auf eine Stelle bei der Mordkommission hingearbeitet, aber jetzt bekam er es mit der dunklen Seite seines Traums zu tun. Ich wusste, was er dachte, weil ich genau das Gleiche dachte.
Wo steckten die drei Lehrerinnen?
Lebten sie noch?
Wie viel Zeit blieb ihnen übrig?
Während ich meinem frisch angetrauten Ehemann Joe eine Textnachricht schickte, sang mein Partner den Refrain eines alten Steve-Miller-Songs vor sich hin: »Time keeps on slippin’, slippin’, slippin’, into the future.«
Ich machte Meldung bei der Funkzentrale und sagte dann zu meinem Partner: »Okay, Rich. Abfahrt.«
4 Conklin und ich stiegen aus unserem Fahrzeug und gingen die Steintreppe hinauf, die von der Straße zum Schulgebäude führte.
Oben angelangt hatten wir eine gepflegte Rasenfläche vor uns, und außerdem – in einem Radius von hundertachtzig Grad – freie Sicht auf das von einem dichten Nebelschleier verhüllte Meer. Die Pacific View Preparatory School bestand aus insgesamt drei mehrstöckigen Gebäuden, die als rechtwinkliges Hufeisen um einen offenen Innenhof angeordnet waren.
Der Haupteingang befand sich genau vor uns im Zentralgebäude. Wir zeigten dem bewaffneten Wachmann unsere Dienstmarken. Auf seinem Namensschild stand K. STROOP.
Ich stellte uns vor.
»Sergeant Boxer, Mordkommission. Und das ist mein Partner, Inspektor Conklin.«
»Mordkommission?«, erwiderte Stroop. »Moment mal, nein. Haben Sie etwa die Leichen gefunden?«
»Nein, nein«, beschwichtigte Conklin. »Aber wir bearbeiten diesen Fall mit höchster Priorität. Alle Einheiten, alle verfügbaren Kräfte sind im Einsatz.«
Stroop schien erleichtert zu sein. Ich fragte ihn: »Haben Sie mitbekommen, wie Myers, Jones und Saran am Montagabend hier weggegangen sind?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich mache immer um vier Feierabend.«
»Aber Sie kennen die drei, oder nicht?«
»Na klar, flüchtig jedenfalls. Ab und zu begegnet man sich im Flur und sagt ›Guten Morgen‹ oder ›Schönes Wochenende‹. So in der Art.«
»Wissen Sie vielleicht, ob eine der Frauen Feinde hat? Einen eifersüchtigen Freund vielleicht? Oder einen verärgerten Schüler, der sich ungerecht behandelt fühlt? Könnte auch eine Schülerin sein. Hat irgendjemand ein ungewöhnliches Interesse an einer von ihnen gezeigt?«
Erneut schüttelte er den Kopf.
»Alle drei sind wirklich nette Menschen. Genau wie unsere Schüler auch.«
Ich nickte. »Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Routinefragen stellen.«
»Schießen Sie los«, sagte er.
Ich wollte wissen, wo er die beiden vergangenen Abende zugebracht hatte. Am Montagabend war er zu Hause bei seiner Frau und seinem Sohn gewesen. Gestern hatte er zusammen mit seiner Frau und Freunden eine Geburtstagsfeier in einem Restaurant besucht.
Er zog sein Handy aus der Tasche und zeigte mir mehrere Selfies aus dem Restaurant. Die leitete er an mich weiter, zusammen mit seiner eigenen Telefonnummer und der des Geburtstagskindes.
Dann sagte er: »Ich würde Ihnen so gerne weiterhelfen. Ich muss ununterbrochen an die drei denken.«
Conklin reichte ihm seine Visitenkarte. »Wenn Ihnen etwas einfällt, egal was, rufen Sie uns bitte an.« Dann betraten wir das Hauptgebäude und gingen einen breiten Flur entlang.
Vor zwei Tagen hatten Carly Myers, Adele Saran und Susan Jones auf dem Weg in ihre Klassenzimmer ebenfalls diesen Flur benutzt. Stroop hatte uns bestätigt, dass der Montag ein ganz gewöhnlicher Arbeitstag gewesen war. Ihm war jedenfalls nichts Verdächtiges aufgefallen.
Was war also mit diesen drei Lehrerinnen geschehen?
Es sprach alles dafür, dass sie keine Ahnung gehabt hatten, dass sie von einem gewöhnlichen Arbeitstag direkt in eine Katastrophe gerissen werden würden. Dass sie schon wenige Minuten nach dem Verlassen des Bridge entführt werden würden.
Mit jeder verstreichenden Stunde erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie tot waren.
5 Auf unserem Weg durch den breiten, von Spinden gesäumten Flur lasen Conklin und ich die Namensschilder an den Türen. Wir suchten das Büro der stellvertretenden Schulleiterin Karin Slaughter.
In einem Gespräch mit dem Schulleiter hatten wir erfahren, dass Slaughter zweiunddreißig Jahre alt war, einen Masterabschluss in Pädagogik besaß und seit fünf Jahren an der Pacific View Prep tätig war. Das Wichtigste aber: Sie war mit den drei vermissten Frauen befreundet.
Es war daher gut möglich, dass sie uns einen Hinweis geben konnte, der den Grund ihres Verschwindens offenbarte, selbst wenn ihr das gar nicht bewusst war.
Slaughters Bürotür stand offen, und Conklin klopfte an. Sie erhob sich, kam uns entgegen und reichte uns die Hand. Sie war konservativ gekleidet – schwarzes Kostüm und Schuhe mit flachen Absätzen – und wirkte ehrlich besorgt.
Ich hörte mich sagen: »Sie heißen genau wie eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen.«
»Das höre ich nicht zum ersten Mal«, erwiderte sie lächelnd. »Wir sind Google-Zwillinge.«
»Google-Zwillinge? Ach so, Sie meinen Leute mit demselben Namen?«
»Genau. Wenn Sie Karin Slaughter googeln, finden Sie auch mich. Und ich bin ein großer Fan von ihr.«
Sie war mir auf Anhieb sympathisch. Nachdem sie auf eine Reihe von Bestsellern in ihrem Bücherregal gezeigt hatte, kehrte sie an ihren Platz hinter dem Schreibtisch zurück. Tiefe Sorgenfalten zerfurchten ihr Gesicht.
Kaum hatten mein Partner und ich uns auf die beiden Stühle vor ihrem Schreibtisch gesetzt, da platzte es aus ihr heraus: »Ich habe schreckliche Angst. Ich kann nicht mehr schlafen und an nichts anderes mehr denken als an die drei. Wussten Sie, dass ich am Montagabend eigentlich auch mitkommen wollte? Aber ich hatte noch zu tun und musste absagen.«
Conklin und ich hatten zwar Fotos der vermissten Frauen und kannten ihre Adressen und Stundenpläne, aber über ihre Charakterzüge, Gewohnheiten und Beziehungen wussten wir bis jetzt kaum etwas. Karin Slaughter gab uns bereitwillig Auskunft.
»Carly Myers ist die geborene Anführerin«, sagte sie. »Wenn es eine Party oder einen Ausflug zu organisieren gibt, dann macht sie das. Sie unterrichtet Geschichte und liebt Sport, Baseball, Football, ganz egal. Ich würde sie als kontaktfreudig und abenteuerlustig beschreiben. Und das meine ich durch und durch positiv.«
Anschließend beschrieb sie uns Susan Jones, Musiklehrerin, geschieden. Sie sah jeden Abend bis spät in die Nacht fern und hatte im letzten Jahr knapp zwanzig Kilogramm abgenommen. »Sie ist witzig, eine begnadete Pianistin und auf der Suche nach der Liebe«, sagte sie. Sie hatte sich eine hautenge Jeans gekauft und war blond geworden.
Als Nächstes erkundigten wir uns nach Adele Saran und erfuhren, dass sie neu an der Schule war. »Sie ist vor rund einem Jahr aus Monterey zu uns gekommen. Unterrichtet englische Literatur, liest viel und trainiert jeden Tag in der Mittagspause in unserem Fitnessstudio. Ich würde sie als umsichtigen, ernsthaften Menschen bezeichnen. Erst in letzter Zeit ist sie etwas aufgetaut. Ich würde sagen, wir tun ihr gut. Obwohl, jetzt …«
Wir hatten viele Fragen: Hatte eine der drei Frauen in letzter Zeit vielleicht über Probleme mit Schülern oder Kolleginnen geklagt? Waren sie womöglich bedroht worden? Gab es Süchte, Probleme mit Verwandten oder Verehrern? Irgendwelche Anzeichen für eine depressive Erkrankung?
Nein, nein, nein, nein.
Nach Slaughters Angaben hatten die drei jungen Frauen keinen einzigen Arbeitstag verpasst, waren beliebt und hatten, bis auf Adele, gelegentlich auch die eine oder andere Verabredung.
»Es ist wirklich schrecklich«, sagte sie. »Ich habe so ein schlechtes Gewissen, dass ich das jetzt sage, aber ich könnte ebenso gut eine der Vermissten sein. Und dann würden Sie jetzt auch nach mir suchen. Bitte sagen Sie mir, dass Sie zumindest die Möglichkeit sehen, dass die drei … dass sie in Sicherheit sind.«
Ich konnte das, was sie hören wollte, nicht aussprechen, darum wechselte ich das Thema.
»Sämtliche Polizeibeamten der ganzen Stadt suchen im Moment nach Ihren Freundinnen. Unser kriminaltechnisches Labor untersucht ihre Autos, ihre Wohnungen und ihre Computer. Wir stehen im Kontakt mit den Eltern. Wir finden die drei. Garantiert.«
Ich wollte Karin Slaughter beruhigen und gleichzeitig mir selbst versichern, dass wir bis zum Abend eine wirklich belastbare Spur finden würden, um diesen Fall aufzuklären. Es musste doch irgendeinen Videoausschnitt, einen Zeugen, einen Hinweis geben, der uns zu diesen vermissten Lehrerinnen führte. Oder? Es durfte auch gern eine Lösegeldforderung sein.
Wir bedankten uns bei Karin Slaughter für ihre Hilfe, baten sie, uns auf jeden Fall anzurufen, falls ihr noch etwas einfiel, und machten uns auf den Weg zum nächsten Gespräch.
Am Ende des Schultags hatten mein Partner und ich mit zwei Dutzend Personen gesprochen, aber nur einige wenige, sehr dürftige Hinweise erhalten, die zu nichts führen würden. Gegen 17.00 Uhr schauten wir noch kurz im kriminaltechnischen Labor vorbei.
Als wir eintraten, schlüpfte Clapper gerade in seine Jacke.
»Die Autos sind schmutzig«, berichtete er. »Also, ganz normal schmutzig. Jede Menge Fingerabdrücke, Dreck auf den Fußmatten, Wasserflaschen. Wir analysieren jeden einzelnen Abdruck. Auf ihren Computern, sowohl bei der Arbeit als auch zu Hause, haben wir nichts Auffälliges gefunden, aber wir sind immer noch dran, genau wie an den Handydaten.«
»Das heißt also … Du hast uns nichts zu sagen, richtig?«
»Boxer, wir machen so schnell wir können«, entgegnete Clapper.
Gemeinsam gingen wir nach draußen auf den Parkplatz.
Nicht einmal ein kleines bisschen Small Talk brachten wir zustande.
Wo waren diese vermissten Frauen? Bei wem? Was war mit ihnen geschehen?
6 Gegen 19.00 Uhr verließ Joe Molinari sein Büro in der FBI-Zweigstelle von San Francisco und machte sich auf den Weg zu seinem Auto, das er in der Golden Gate Avenue, unweit der Larkin Street, abgestellt hatte.
In dem Labyrinth aus dunklen Straßen zwischen Civic Center und Tenderloin waren zahlreiche Stundenhotels angesiedelt. Außerdem war dies die bevorzugte Gegend für Drogendealer und ihre Kundschaft, für Kriminelle aller Art, darunter auch gewaltbereite, sowie alle diejenigen, die ohnehin ständig vom Pech verfolgt waren.
Joe hatte die Autoschlüssel in der Hand. Sein Wagen stand unter einer Straßenlaterne und war allem Anschein nach unbeschädigt. Er dachte an zu Hause und ans Abendessen, als er die Frau entdeckte, die neben seinem Auto auf dem Bordstein hockte. Sie hatte den Kopf gesenkt, die Hände vors Gesicht geschlagen und schluchzte.
Beim Näherkommen sah Joe, dass sie nur einen Schuh trug und ihre Jacke im Schulterbereich eingerissen war. Doch davon abgesehen machte ihre Kleidung einen guten Eindruck. Es sah jedenfalls nicht so aus, als sei die Frau obdachlos.
Vielleicht war sie ja überfallen und ausgeraubt worden.
»Hallo«, sagte er.
Die Frau hob den Blick. Das Licht der Straßenlaterne fiel auf eine entstellende Brandnarbe auf ihrer linken Gesichtshälfte, vom äußeren Augenwinkel bis zu ihrer Oberlippe. Sie zog an ihrem Schal, um die Narbe zu verdecken.
»Alles in Ordnung?«, erkundigte sich Joe.
»Bestens«, entgegnete sie.
Dann verzog sie das Gesicht und ließ erneut den Kopf in die Hände sinken.
Joe setzte sich neben sie auf den Bordstein.
»Wie heißen Sie?«
Sie wischte sich mit dem Ärmel die Tränen aus dem Gesicht und sagte schließlich: »Anna.«
»Ich heiße Joe. Geht es Ihnen nicht gut, Anna?«
»Ganz allgemein? Oder eher im Speziellen?«
Er lächelte sie an. Sie war schätzungsweise Ende dreißig und sprach mit einem osteuropäischen Akzent.
»Zunächst mal aktuell. Sind Sie verletzt?«
Sie zuckte mit den Schultern. »Ich glaube nicht. Ich bin gestürzt, mit dem Rad.«
Sie zeigte auf das Fahrrad, das ein kleines Stück entfernt an einer Hauswand lehnte. Der Rahmen war verbogen und die Kette gerissen. Und es sah so aus, als sei es schon vor dem Sturz nicht mehr das allerneueste gewesen.
»Kann ich Sie irgendwo hinbringen?«
Sie wirkte sehr verunsichert. Verletzlich. Ihm war nicht wohl bei der Vorstellung, sie hier in dieser Gegend allein mit ihrem Rucksack auf dem Bürgersteig zurückzulassen.
»Sie können unbesorgt sein«, sagte er. Dann klappte er seinen Jackenkragen um und zeigte ihr seine Dienstmarke.
»Kann ich die noch mal sehen?«
Er zeigte ihr die Marke noch einmal, und sie beugte sich dicht davor, um die Inschrift rund um das Wappen zu entziffern: Federal Bureau of Investigation. Sie wich zurück und sagte: »Das wäre sehr schön.«
Joe fragte Anna, wo sie wohnte, und war ihr beim Einsteigen behilflich. Er holte das Fahrrad, schob es in den Kofferraum und rief anschließend Lindsay an.
»Blondie, ich komme etwas später. Eine halbe Stunde, mehr nicht.«
Nachdem er aufgelegt hatte, setzte er sich ans Steuer seines Mercedes. Anna drückte sich dicht an die Beifahrertür und sagte: »Danke.«
»Ich bin froh, dass ich Ihnen helfen kann.«
Er ließ den Motor an und fuhr auf der Golden Gate Avenue nach Osten. Nach mehreren Abzweigungen hatten sie den Tenderloin-Distrikt hinter sich gelassen. Er sagte: »Anna, können Sie mir vielleicht verraten, wieso Sie mitten in einer der übelsten Gegenden der Stadt ganz alleine auf dem Bürgersteig gesessen haben?«
»Ich war beim FBI, weil ich es ihnen sagen wollte. Aber wahrscheinlich sehe ich nicht vertrauenswürdig aus, jedenfalls wollte mich niemand anhören. Und Sie werden mir auch nicht glauben.«
»Ich bin ein guter Zuhörer«, erwiderte er. »Versuchen Sie’s einfach.«
7 Joe musste sich sehr anstrengen, um Annas Worte über dem Verkehrslärm auf der McAllister hören zu können.
Mit brechender Stimme berichtete sie ihm, weshalb sie zum FBI gegangen war. Unter den wenigen Worten, die er klar und deutlich verstehen konnte, stach der Name eines Kriegsverbrechers hervor, der vor vielen Jahren für den Tod Tausender Menschen verantwortlich gewesen war.
»Sie stammen aus Bosnien?«
Sie nickte.
»Aus Srebrenica?«
»Nein. Aus Djoba.«
Djoba war so etwas wie eine Aufwärmübung für das Massaker in Srebrenica gewesen.
Joe wusste eine ganze Menge über die Kriege in Bosnien: Wie Jugoslawien nach dem Zusammenbruch des Ostblocks in sechs Volksrepubliken zerfallen und förmlich zerrissen worden war. Wie die in Bosnien und Kroatien lebenden Serben die Einheit mit ihren Brüdern und Schwestern in Serbien gesucht hatten. Dabei waren die Auseinandersetzungen zwischen christlich-orthodoxen Serben und muslimischen Bosniern besonders brutal gewesen – eine Fortsetzung der Kriege im Verlauf der osmanischen Invasionen viele Jahrhunderte zuvor.
Aber hier ging es um Völkermord. Tausende Männer und Jungen waren abgeschlachtet, Tausende Frauen vergewaltigt, Kinder brutal ermordet worden.
Anna versuchte, ihre Tränen zu unterdrücken, dann brach sie zusammen. Joe holte eine Packung Papiertaschentücher aus dem Handschuhfach und bereute, dass er sie nicht in sein Büro gebeten hatte. Dort hätte er sie direkt zu einem diensthabenden Agenten bringen sollen, dessen Aufgabe darin bestand, zu entscheiden, ob eine neue Fallakte angelegt wurde oder nicht.
Aber jetzt schuldete er ihr seine gesamte Aufmerksamkeit, und darüber hinaus musste er auf den Verkehr achten. Um ihre Worte besser verstehen zu können, machte Joe die Fenster zu und schaltete die Lüftung aus.
»Verstehen Sie, was ich sage? Ich habe ihn gesehen, hier, und das ist gerade einmal zwei Stunden her. Slobodan Petrović.«
»Ja, ich weiß, wer das ist. Sprechen Sie weiter. Ich verstehe, was Sie sagen, und ich weiß auch, woher Sie kommen.«
Anna schnäuzte sich, knotete ihren Schal auf und fing an zu berichten, was sich an einem heißen Sommertag in der kleinen Stadt Djoba zugetragen hatte.
»Ich habe gerade mein Baby gebadet, in der Küchenspüle, da kamen Soldaten in das Dorf, auf der Hauptstraße«, sagte sie und starrte durch die Windschutzscheibe nach draußen, mitten in den Schrecken ihrer Vergangenheit.
»Die ersten sind zu Fuß gekommen. Dann die Panzer und die Offiziere in ihren Jeeps.
Mein kleiner Sohn, Bakir, hat angefangen zu weinen. Mein Mann ist in die Küche gekommen und hat gesagt: ›Bleib hier.‹ Dann ist er nach draußen gerannt. Zerin war noch nicht einmal dreißig Jahre alt«, sagte Anna. »Er war so stark und voller Energie. Aber das war das letzte Mal, dass ich ihn lebend gesehen habe.«
Joe murmelte: »Das tut mir sehr leid. Es tut mir furchtbar leid, Anna.«
Sie starrte nach draußen auf die dunklen Straßen wie auf eine Leinwand mit den Bildern ihrer grässlichen Geschichte. Sie berichtete Joe, dass ihre Stadt von den Vereinten Nationen zur Sicherheitszone erklärt worden war und dass Hunderte Flüchtlinge dorthin gekommen waren. Dass sie sich in der glühenden Hitze mit viel zu wenig Wasser und Nahrung zusammengedrängt hatten. Und dass die meisten, die in dieser sogenannten Sicherheitszone gestrandet waren, Frauen, Kinder und alte Menschen gewesen waren.
Anna erzählte, dass die serbischen Soldaten sich unter die Flüchtlinge gemischt und die Männer willkürlich erschossen hatten. Doch das hatte ihnen noch nicht gereicht. Sie hatten auch diejenigen, die sich in den umliegenden Feldern und Bauernhöfen versteckt hatten, aufgespürt und hingerichtet. Sie hatten die Häuser und Scheunen niedergebrannt, und dann hatten die serbischen Soldaten sich den Frauen und Kindern zugewandt, die im Dorf eingeschlossen gewesen waren.
»Ich habe mich mit Bakir in unserem Haus versteckt«, fuhr Anna fort. Das Grauen in ihrer dumpfen Stimme war nicht zu überhören. »Aber sie haben mich gefunden. Sie haben mir mein Kind weggenommen, meinen wunderhübschen Jungen. Dann haben sie mich zu Boden gedrückt und … Sie wissen, was sie dann getan haben. Zu viert. Sie haben gelacht. Sie haben versucht, mir so sehr wie möglich wehzutun. Ich bin bewusstlos geworden. Am nächsten Morgen waren sie verschwunden. Ich habe mein Baby am Straßenrand gefunden, mit aufgeschlitzter Kehle.«
Anna stöhnte, und dann schluchzte sie haltlos in ihre vors Gesicht geschlagenen Hände, während sie den unaussprechlichen Tod ihres kleinen Jungen noch einmal durchlebte.
Joe lenkte den Wagen an den Straßenrand und legte ihr die Hand auf die Schulter. Sie schüttelte ihn ab und lehnte den Kopf ans Fenster, wurde von Weinkrämpfen geschüttelt, so lange, bis sie keine Tränen mehr hatte.
Dann drehte sie sich zu ihm um. »Was ich am wenigsten begreifen kann, ist … dass da so etwas Unfassbares geschieht, etwas, was einen im Innersten tötet, und dass man trotzdem weiteratmet, dass das Herz trotzdem weiterschlägt und man weiterlebt. Dass die Zeit einfach weitergeht.«
Joe musste gegen seine eigenen, sehr widersprüchlichen Gefühle ankämpfen. Er wollte sie trösten. Er wollte jemanden töten – Petrović. Er wollte weinen.
»Es ist so lange her, dass ich jemandem davon erzählt habe, Joe«, fuhr Anna fort. »Es tut mir leid, dass es Sie getroffen hat. Aber dass ich Petrović heute gesehen habe, gesund und munter … wohlhabend. Ich dachte, er wäre tot. Ich dachte, er wäre schon lange tot.«
»Wie kann ich Ihnen helfen?«
Anna und Joe saßen in dem parkenden Wagen und unterhielten sich. Sie schilderte ihm ihre Fantasien, in denen sie Petrović immer wieder ermordete, und erzählte ihm ausführlich von den Gesprächen mit anderen Frauen in Djoba. Gespräche im Flüsterton, und nie hatte eine ausgesprochen, was ihr angetan worden war. Das war nicht nötig gewesen.
Schließlich war sie erschöpft. »Bitte, bringen Sie mich nach Hause, Joe. Ich muss jetzt allein sein.«
Er ließ den Motor an.
Zehn Minuten später waren sie in der Nähe des Hauses angelangt, in dem Anna ein Studio-Apartment gemietet hatte. Er versprach, ihr Fahrrad reparieren zu lassen, und brachte ihren Rucksack nach oben. Dann gab er ihr seine Kontaktdaten und bat sie, ihn anzurufen, falls sie noch einmal mit ihm sprechen wollte.
Sie bedankte sich, betrat ihre Wohnung und machte die Tür hinter sich zu.
Annas Schmerz hatte sich in seinem Auto eingenistet.
Er hatte immer noch die brutalen Bilder vor Augen, die sie gezeichnet hatte – von alten Menschen, die seitlich an Lastwagen hingen, von abgeschlachteten Kindern und Flüchtlingen, die sich lieber selbst erhängt hatten, als von Slobodan Petrović gefoltert zu werden.
Diese Bilder begleiteten ihn bis nach Hause.
8 Nachdem ich eine kleine Runde mit Martha gejoggt war, saß ich jetzt wieder in unserem Apartment in der Lake Street.
Im Fernsehen liefen die Abendnachrichten, und die Suppe fing gerade an zu köcheln, da stürmte Martha bellend und schwanzwedelnd zur Tür, um Joe zu begrüßen.
Er bückte sich, um unseren braven Hund zu streicheln, aber ich konnte ihm ansehen, dass er einen sehr schlechten Tag hinter sich hatte.
Ich sagte: »Liebling, was ist denn los?«
»Hast du schon was gegessen?«
»Nein. Du?«
Er schüttelte den Kopf.
»Ich mache gerade eine Erbsensuppe warm. Die Hühnerkeulen können auch noch ein paar Runden in der Mikrowelle vertragen.«
»Kannst du das machen? Ich muss mich unbedingt umziehen.«
Während ich das Essen »kochte«, rief Jacobi an, und wir brachten uns gegenseitig auf den neuesten Stand im Fall der verschwundenen Lehrerinnen: null Fortschritt.
»Wir haben nichts in der Hand«, sagte Jacobi. »Wie ich das hasse.«
Wir bedauerten uns gegenseitig und besprachen das Vorgehen für den nächsten Tag. Als ich aufgelegt hatte, kam Joe mit nassen Haaren und im Bademantel in unsere weitläufige Küchen-Wohnzimmer-Kombination.
Er erkundigte sich, wie mein Tag gewesen war, aber ich erwiderte: »Du zuerst.«
Zwischen den Bissen berichtete er mir von seiner Begegnung mit Anna Sotovina, einer Überlebenden des Bosnienkriegs. Ihre Geschichte hatte ihn bis ins Mark getroffen. Und sie traf mich ebenso.
»Wie ist sie denn so?«
»Vollkommen gebrochen. Sie hat eine auffällige Narbe im Gesicht, aber auch ihr ganzes Leben ist voller Wunden und Narben. Sie hat die schlimmsten Misshandlungen überlebt – Folter, Vergewaltigung, den Mord an ihrem Mann und ihrem Kind – und ist nach dem Krieg nach San Francisco gekommen. Hier hat sie einen guten Job und eine Wohnung in der Fulton Street gefunden. Sie hatte noch einmal von vorne angefangen, Linds. Und dann sieht sie Slobodan Petrović aus einer Haustür kommen, nur wenige Querstraßen von ihrer eigenen Wohnung entfernt.«
»Und sie ist sich ganz sicher, dass das wirklich Petrović war?«
»Ohne jeden Zweifel.«
Ich brauchte Joe nicht zu sagen, was es mit Augenzeugenberichten auf sich hatte. Das Gehirn ergänzt eventuelle Erinnerungslücken mit überzeugenden Details und sorgt so dafür, dass eine Erinnerung mit jedem Aufruf ein klein wenig korrigiert und angepasst wird. Wir hatten beide schon erlebt, dass Zeugen mit großer Bestimmtheit einen Verbrecher identifiziert hatten, der aber zum Zeitpunkt des Verbrechens im Hochsicherheitstrakt von San Quentin eingesessen hatte.
»Das habe ich schon einkalkuliert«, sagte Joe.
Er brachte seinen halb vollen Teller zur Spüle und schenkte uns beiden Wein nach.
»Petrović«, sagte ich. »Ich weiß noch, wie der aussieht. Ein großer, bulliger Typ mit roten Backen.«
»Genau«, meinte Joe. »Damals hat man ihn wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht gestellt, aber nach der Verhandlung hat man ihn laufen lassen. Damals war das ein richtiger Skandal.
Und danach ist er von der Bildfläche verschwunden. Irgendwann hat man dann eine Leiche aus dem Fluss gezogen, aufgedunsen und schon halb verwest. Irgendjemand hat den Leichnam als Petrović identifiziert, aber wer? Irgendwelche ranghohen Freunde vielleicht? Wenn Anna recht hat, dann ist ihm die Flucht hierher gelungen.«
»Was sagt dir dein Gefühl?«
Damals waren Joe und ich erst seit wenigen Monaten verheiratet, aber Martha hatte ihn schon fest in ihr Herz geschlossen. Sie kam zu ihm getrottet und legte ihm die Schnauze aufs Knie. Joe streichelte sie, trank seinen Wein und schwieg lange und nachdenklich. Ich wartete geduldig.
Dann sagte er: »Ich glaube ihr, Lindsay. So weit jedenfalls, dass ich mir das Ganze näher ansehen will. Ich weiß zwar noch nicht, ob und wie ich ihr helfen kann, aber gleich morgen früh fange ich an, ein bisschen herumzuschnüffeln.«
Genau das hätte ich an seiner Stelle auch getan.
9 Am nächsten Morgen fuhr Joe zur Arbeit und war mit den Gedanken bei Anna Sotovina, als sein Handy klingelte.
»Können wir uns bitte treffen?«, sagte Anna. »Ich möchte Ihnen ein paar Dinge zeigen.«
Zwanzig Minuten später stellte Joe seinen Wagen vor dem Haus in der Fulton Street ab. Er wollte gerade klingeln, als er sie aus einem roten Kia auf der anderen Straßenseite steigen sah. Sie trug Arbeitskleidung – ein blaues Kostüm und Lippenstift –, und ihre Haare fielen über die Brandnarbe auf ihrer Wange.
Sie wartete auf eine Lücke im Verkehr, überquerte die Straße, machte die Beifahrertür auf und stieg ein. »Ich muss mich wegen gestern Abend entschuldigen. Ich habe viel zu viel geweint.«
»Dafür müssen Sie sich doch nicht entschuldigen. Sie haben allen Grund, traurig zu sein.«
»Ich war total schockiert, weil ich Petrović gesehen habe.«
»Natürlich.«
»Ich habe es Ihnen ja erzählt. Ich habe ihn mit dem Fahrrad verfolgt. Wahnsinn.«
»Wie gut, dass Sie ihn nicht erwischt haben«, erwiderte Joe.
Sie nickte. »Ich habe überhaupt nicht mehr nachgedacht. Das war vollkommen automatisch. Ich habe ihn gesehen. Und wenn ich ihn erwischt hätte … Was hätte ich dann getan? Ihn beschimpft? Aber er war es. Ganz sicher. Der Schlächter von Djoba.«
Joe sagte: »Sie waren sehr tapfer, Anna. Wahnsinnig, aber tapfer.«
Sie nickte.
»Sie wollten mir etwas zeigen.«
»Ja.«
Sie machte ihre Handtasche auf und holte eine DIN-A4-Plastikmappe heraus. Darin lag ein auf Drittelgröße zusammengefalteter Zeitungsartikel. Mit zitternden Fingern klappte sie die vergilbte, zerfledderte Seite auf und zeigte sie Joe.
Der Artikel war auf Bosnisch geschrieben. Anna zeigte mit dem Finger auf das Foto am Textanfang, unter der Überschrift.
»Da wird er in Handschellen vor den Internationalen Strafgerichtshof geführt, sehen Sie? Man hat ihm Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorgeworfen, aber dann hat das Gericht ihn laufen lassen. Ich weiß nicht, warum. Er hat das Leben Tausender Menschen auf dem Gewissen. Ich habe die Toten mit eigenen Augen gesehen. Und ihn haben sie einfach auf freien Fuß gesetzt.«
Sie kramte ihre Brieftasche hervor und holte ein Foto heraus, das hinter einem viereckigen Fenster aus durchsichtigem Plastik gesteckt hatte. Sie hielt es Joe entgegen, und er sah einen lachenden jungen Mann Mitte zwanzig, der ein kleines Baby auf dem Arm hielt.
»So viel Liebe, sehen Sie das?«
»Das sehe ich«, erwiderte Joe.
»Es gibt keinen Zweifel, Joe«, sagte Anna. »Petrović war der befehlshabende Offizier bei der Zerstörung meiner Heimatstadt. Mein Ehemann wurde gehängt. Sie haben meinem kleinen Jungen die Kehle durchgeschnitten. Tausende wurden ermordet, und viele von ihnen hat Petrović mit eigenen Händen getötet. Warum soll meine Familie tot sein, während er lebt und frei herumlaufen darf?«
»Ich finde keine Worte für diese Grausamkeiten«, sagte Joe leise.
Sie nickte und fuhr fort: »Nach Petrovićs Freispruch gab es viele Proteste. Und dann hieß es, dass er tot sei. Ermordet.«
»Das habe ich auch gelesen. Man hat seinen verwesten Leichnam aus einem Fluss gezogen. Hören Sie, Anna, ich muss Ihnen diese Frage stellen: Ist es denkbar, dass Petrović tatsächlich tot ist, und dass der Mann, den Sie gestern gesehen haben, ihm nur sehr ähnlich sieht? Dass er Sie an ihn erinnert hat?«
»Er ist es, Joe. Glauben Sie nicht, dass ich das sehen würde?« Sie hielt sich die gespreizte Hand dicht vors Gesicht. »Ich war ihm so nahe. Unter ihm! Verstehen Sie?«
»Oh, Gott. Es tut mir so leid.«
Es tat ihm mehr als leid. Er wollte den Kerl, der ihr das angetan hatte, töten. Ganz langsam töten.
Anna sagte: »Bis gestern habe ich auch geglaubt, er sei tot. Jetzt weiß ich, dass das ein Fehler war oder eine Lüge oder eine Vertuschung. Petrović ist aus Europa entkommen. Irgendjemand muss das wissen und hat ihm vielleicht sogar dabei geholfen.«
»Ich habe gestern Abend noch bei Interpol nachgesehen. Es gibt keinen Haftbefehl auf seinen Namen. Nichts kann ihn davon abhalten, seinen Reisepass zu benutzen.«
»Als Soldat hat er die Haare sehr kurz getragen. Jetzt sind sie etwas länger, und er hat zugenommen. Fünfzehn Kilogramm vielleicht. Aber ansonsten sieht er noch genauso aus wie damals. Er ist dick und gesund. Er fährt ein teures Auto. Fünfundsiebzigtausend Dollar, Joe. Woher hat er so viel Geld?«
Joe konnte ihre Frage nicht beantworten. Mit einer zehnminütigen Recherche hatte er festgestellt, dass durchaus die Möglichkeit bestand, dass Petrović mit geändertem Namen legal in die Vereinigten Staaten eingereist war. Das FBI hatte keine Handhabe gegen einen angeklagten Kriegsverbrecher, der vom Internationalen Strafgerichtshof, aus was für Gründen auch immer, freigelassen worden war.
»Fahren wir ein Stück?«, fragte Anna.
10 Die Fahrt führte drei Häuserblocks die Steiner Street entlang, dann über die Fell Street und dauerte keine drei Minuten.
»Da drüben«, sagte Anna.
Joe fuhr an den Straßenrand, und Anna ließ ihr Seitenfenster herunter. »Da drüben. Da habe ich ihn gesehen.«
Sie zeigte auf ein gepflegtes, viktorianisches Haus, blassgelb mit dunkelblauen Zierleisten. »Er ist die Treppe heruntergekommen, als würde ihm das ganze Land gehören.«
Anna wandte sich zu Joe um und schob den Vorhang aus Haaren zurück, der ihre Brandnarbe verdeckte. »Das hat er mir angetan. Nachdem er mich vergewaltigt hatte, nachdem ich ihm sämtliche Schimpfworte an den Kopf geworfen hatte, die mir eingefallen sind. Ich wollte, dass er mich erschießt. Ich wollte nur noch sterben. Da hat er sein Feuerzeug genommen …«
»Sie waren in dem Hotel«, sagte Joe.
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann nicht darüber sprechen.«
Mehr musste sie nicht sagen. Joe war in Virginia für das FBI tätig gewesen, damals, als die serbischen Truppen die Männer von Djoba grausam ermordet und die Frauen gefangen genommen hatten. Viele von ihnen waren in einem Schulgebäude festgehalten worden, dem sogenannten »Vergewaltigungshotel«. Es war den Serben nicht nur darum gegangen, diese muslimischen Frauen und Mädchen zu demütigen und zu schänden, sie wollten sie zudem auch mit dem Samen ihrer Feinde schwängern.
Er wurde von Annas Stimme aus seinen Gedanken gerissen. Sie nannte seinen Namen und zeigte auf einen Jaguar, der hundert Meter entfernt am Straßenrand stand.
»Das ist sein Auto«, sagte sie. »Er ist da, dort, in seinem Haus. Können Sie nicht einfach reingehen und ihm in den Kopf schießen?«
»Nein, das kann ich nicht. Bleiben Sie hier.«
Joe stieg aus, um das Haus zu fotografieren, und dann trat der Mann, den Lindsay als großen, bulligen Typen mit roten Backen in Erinnerung hatte, zur Tür des hübschen, gelben Hauses heraus. Er kam mit schnellen Schritten die Treppe herab und telefonierte dabei.
Joe richtete seine Handykamera auf Petrovićs Gesicht, das jedoch durch das Telefon und die Hand des Mannes kaum zu erkennen war. Kurz darauf stieg er in seinen Wagen und fuhr los.
Anna war ausgestiegen und brüllte Joe zu: »Das ist er! Das ist er! Das ist Slobodan Petrović! Glauben Sie mir jetzt? Hinterher! Fahren Sie ihm hinterher, bitte!«
Der Jaguar wurde schneller, dann füllten andere Autos die Lücke zu Joe und Anna.
»Nein, Anna. Auch wenn er in Bosnien schwere Verbrechen begangen hat, kann ich ihn hier nicht einfach festnehmen.«
Anna ließ sich gegen den Wagen sinken.
»Tja«, sagte sie schließlich. »Vielleicht kann ich ja etwas unternehmen. Ich brauche eine Pistole. Dann kann ich ihn eigenhändig erschießen.«
Sie reckte den Hals und sah den Jaguar aus ihrem Blickfeld verschwinden.