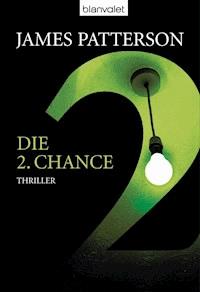
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Women's Murder Club
- Sprache: Deutsch
Vier eiskalte Morde. Jeder einzelne von ihnen höchst raffiniert geplant und präzise ausgeführt: Ein neuer Fall für den „Club der Ermittlerinnen“! Mit Wut, Witz und viel Erfahrung ermittelt Lieutenant Lindsay Boxer zusammen mit der Reporterin Cindy Thomas, der Pathologin Claire Washburn und der Staatsanwältin Jill Bernhardt. Bis sich die Vendetta eines rachsüchtigen Polizistenmörders plötzlich gegen die vier Ermittlerinnen selbst richtet …
Ein Scharfschütze schießt wahllos vor einer Kirche in eine Gruppe Kinder. Ein kleines Mädchen stirbt ...
Eine Witwe wird erhängt aufgefunden. War es Selbstmord aus Verzweiflung oder ein Unfall …
Ein Streifenpolizist wird zu einem ganz alltäglichen Einsatz gerufen, doch am Zielort wartet eine tödliche Falle auf ihn ...
Ein Lieutenant der Mordkommission stirbt nach einem Einkauf im Supermarkt durch eine Kugel ...
Eine eiskalt geplante Mordserie erschüttert San Francisco: Die Opfer waren zwar unterschiedlich alt und wurden mit verschiedenen Waffen getötet, allen gemeinsam aber ist, dass sie Verbindungen zur Polizei hatten. Lieutenant Lindsay Boxer, der einzige weibliche Detective bei der Mordkommission San Franscico, nimmt diesen Fall sehr persönlich, denn die Blutspur führt in die eigenen Reihen. Ein neuer Fall also für ihre Freundinnen, den „Club der Ermittlerinnen“: Mit Wut, Witz und Erfahrung setzen sich die Staatsanwältin Jill Bernhardt, die Journalistin Cindy Thomas und die Pathologin Claire Washburn auf die Fährte des Killers und lassen sie sich selbst dann nicht stoppen, als die oberen Etagen in der Polizeihierarchie Lindsays Arbeit behindern. Dann aber richtet sich die blutige Vendetta des mysteriösen Täters auf die vier Ermittlerinnen selbst. Bald benötigt der „Club der Ermittlerinnen“ nur noch zwei Dinge: ein bisschen Glück zum Überleben - und eine 2. Chance ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 374
Veröffentlichungsjahr: 2004
Ähnliche
Buch
Ein Scharfschütze schießt wahllos vor einer Kirche in eine Gruppe Kinder. Ein kleines Mädchen stirbt …
Eine Witwe wird erhängt aufgefunden. War es Selbstmord aus Verzweiflung oder ein Unfall …?
Ein Streifenpolizist wird zu einem ganz alltäglichen Einsatz gerufen, doch am Zielort wartet eine tödliche Falle auf ihn …
Ein Lieutenant der Mordkommission stirbt nach einem Einkauf im Supermarkt durch eine Kugel …
Eine eiskalt geplante Mordserie erschüttert San Francisco: Die Opfer waren zwar unterschiedlich alt und wurden mit verschiedenen Waffen getötet, allen gemeinsam aber ist, dass sie Verbindungen zur Polizei hatten. Lieutenant Lindsay Boxer, der einzige weibliche Detective bei der Mordkommission San Francisco, nimmt diesen Fall sehr persönlich, denn die Blutspur führt in die eigenen Reihen. Ein neuer Fall also für ihre Freundinnen, den »Club der Ermittlerinnen«: Mit Wut, Witz und Erfahrung setzen sich die Staatsanwältin Jill Bernhardt, die Journalistin Cindy Thomas und die Pathologin Claire Washburn auf die Fährte des Killers und lassen sich selbst dann nicht stoppen, als die oberen Etagen in der Polizeihierarchie Lindsays Arbeit behindern. Dann aber richtet sich die blutige Vendetta des mysteriösen Täters auf die vier Ermittlerinnen selbst. Bald benötigt der »Club der Ermittlerinnen« nur noch zwei Dinge: ein bisschen Glück zum Überleben – und eine 2. Chance…
Autor
James Patterson, geboren 1949, war Kreativdirektor bei einer großen amerikanischen Werbeagentur. Inzwischen ist er einer der erfolgreichsten Bestsellerautoren weltweit. Sein Markenzeichen: Romane, deren überraschende Wendungen selbst ausgebuffte Thrillerleser verblüffen. Nach dem phänomenalen Erfolg des Bestsellers »Der 1. Mord« ist »Die 2. Chance« der Folgeband seiner Thriller-Reihe um Lindsay Boxer und den »Club der Ermittlerinnen«. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N.Y.
Von James Patterson ist bereits erschienen Die Alex-Cross-Romane
Stunde der Rache, Mauer des Schweigens, Vor aller Augen, Und erlöse uns von dem Bösen, Ave Maria, Blood, Dead, Fire, Heat, Storm, Cold, Dark, Run, Evil, Devil
Der Women’s Murder Club
Der 1. Mord, Die 2. Chance, Der 3. Grad, Die 4. Frau, Die 5. Plage, Die 6. Geisel, Die 7 Sünden, Das 8. Geständnis, Das 9. Urteil, Das 10. Gebot, Die 11. Stunde, Die Tote Nr. 12, Die 13. Schuld Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Pattersonmit Andrew Gross
Die 2. Chance
ThrillerAus dem Amerikanischen von Edda Petri
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel »2nd Chance« bei Little, Brown and Company, New York.
Copyright © by SueJack, Inc., 2002
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2004
by Limes Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de, München
Umschlagmotiv: © Hayden Verry/buchcover.com
AF · Herstellung: sto
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-89480-819-8V003www.blanvalet.de
Prolog
Der Kinderchor
Aaron Winslow würde die nächsten Minuten nie vergessen. Er erkannte die grauenvollen Geräusche, sobald er das Knallen in der Abendluft hörte. Ihm wurde eiskalt. Er konnte es nicht fassen, dass jemand in dieser Gegend mit einem Hochleistungsgewehr schoss.
Peng, peng, peng… peng, peng, peng.
Sein Chor verließ soeben die La-Salle-Heights-Kirche. Achtundvierzig Kinder strömten an ihm vorbei zum Straßenrand. Sie hatten soeben die Generalprobe vor dem San-Francisco-Sing-Off beendet – und sie waren hervorragend gewesen.
Dann ertönte das Gewehrfeuer. Eine Salve jagte die nächste. Nicht ein einzelner Schuss, ein regelrechter Beschuss. Eine Attacke.
Peng, peng, peng… peng, peng, peng.
»Alle runter!«, schrie er, so laut er konnte. »Alle auf den Boden legen! Schützt die Köpfe! Sucht Deckung!« Er vermochte es kaum zu fassen, dass diese Worte aus seinem Mund gekommen waren.
Anfangs schien ihn niemand zu hören. Für die Kinder, in den weißen Blusen und Hemden, mussten die Schüsse wie Feuerwerk geklungen haben. Dann traf eine Gewehrsalve das wunderschöne bunte Glasfenster der Kirche. Die Darstellung, wie Christus ein Kind in Kapernaum segnet, zerbarst. Glassplitter spritzten umher, einige trafen die Köpfe der Kinder.
»Jemand schießt!«, schrie Winslow. Vielleicht waren es mehrere Personen. Wie konnte das sein? Er rannte wie verrückt zwischen den Kindern hindurch, schrie, fuchtelte mit den Armen und drückte so viele Kinder wie möglich ins Gras.
Als die Kinder schließlich alle flach auf dem Boden lagen, sah Winslow zwei seiner Chormädchen, Chantal und Tamara, die wie Statuen auf dem Rasen standen. Kugeln pfiffen an ihnen vorbei. »Chantal, Tamara! Runter!«, brüllte er, aber sie blieben eng umschlungen stehen und schrien voller Panik. Die beiden waren enge Freundinnen. Er kannte sie schon seit der Zeit, als sie beim »Himmel und Hölle«-Spiel als ganz kleine Kinder auf dem Asphalt umhergehopst waren.
Er musste nicht zweimal überlegen, rannte zu den Mädchen, packte sie an den Armen und riss sie zu Boden. Dann legte er sich auf sie.
Kugeln zischten über seinen Kopf und verfehlten ihn nur um Haaresbreite. Seine Ohren schmerzten. Er zitterte am ganzen Leib, die Mädchen unter ihm ebenso. Er hatte den sicheren Tod vor Augen. »Alles wird gut«, flüsterte er.
Und dann hörte der Beschuss so abrupt auf, wie er begonnen hatte. Entsetztes Schweigen breitete sich aus. Es war, als sei die ganze Welt verstummt und würde jetzt lauschen.
Aaron Winslow erhob sich. Der Anblick, der sich ihm bot, war unfassbar. Überall kamen die Kinder langsam wieder auf die Beine. Einige weinten, aber er sah kein Blut. Niemand schien verletzt zu sein.
»Seid ihr alle in Ordnung?«, rief er. »Ist jemand verletzt?«
»Ich bin okay… ich bin okay«, lauteten die Antworten. Fassungslos schaute er um sich. Ein Wunder war geschehen.
Dann hörte er ein Kind wimmern.
Er drehte sich um und sah Maria Parker, erst zwölf Jahre alt. Maria stand auf den frisch gewaschenen Stufen der Holztreppe, die zum Kircheneingang hinaufführte. Sie hatte einen Schock, ersticktes Schluchzen drang aus ihrem offenen Mund.
Dann fielen Aaron Winslows Blicke auf die Ursache ihres Entsetzens. Ihm stockte das Herz. Selbst im Krieg und obwohl er auf den Straßen Oaklands aufgewachsen war, hatte er nie etwas so Grauenvolles, Trauriges oder Sinnloses gesehen.
»O mein Gott. Nein, nein. Wie konntest du das geschehen lassen?«
Tasha Catchings, gerade erst elf Jahre alt, lag zusammengesunken in einem Blumenbeet neben der Kirche. Ihre weiße Bluse war blutdurchtränkt.
Jetzt brach auch Reverend Aaron Winslow in Tränen aus.
Erster Teil
Der Club der Ermittlerinnen – wieder in Aktion
1 Es war Dienstagabend, und ich spielte mit drei Bewohnern des Jugendheims Hope Street Mau-Mau. Ich liebte dieses Spiel.
Auf der ramponierten Couch mir gegenüber saßen Hector, ein Kind aus dem Barrio, vor zwei Tagen erst aus dem Jugendgefängnis entlassen; Alysha, still und hübsch und mit einer Familiengeschichte, die niemand gern hören würde; und Michelle, die mit vierzehn bereits ein Jahr hinter sich hatte, in dem sie ihren Körper auf den Straßen San Franciscos verkauft hatte.
»Herz«, erklärte ich, legte eine Acht ab und wechselte die Farbe, als Hector gerade die letzte Karte ablegen wollte.
»Verdammte Bullen-Lady«, stieß er hervor und stöhnte. »Wie kommt es, dass du mir jedes Mal ein Messer reinrammst, wenn ich Schluss machen will?«
»Damit du lernst, nie einem Bullen zu trauen, Schwachkopf.« Michelle lachte und warf mir ein verschwörerisches Lächeln zu.
Seit einem Monat verbrachte ich einen oder zwei Abende pro Woche im Jugendzentrum. Nach der grauenvollen Mordserie an Brautpaaren im Sommer war ich völlig zusammengebrochen. Ich nahm einen Monat Urlaub vom Morddezernat, lief zur Marina hinunter oder blickte aus der Sicherheit meiner Wohnung auf dem Potrero Hill hinaus auf die Bucht.
Nichts half. Kein Psychologe, auch nicht die Unterstützung meiner Freundinnen, Claire, Cindy und Jill. Auch nicht, dass ich wieder anfing zu arbeiten. Ich hatte hilflos mit ansehen müssen, wie aus dem Menschen, den ich liebte, langsam das Leben entwich. Immer noch fühlte ich mich für den Tod meines Partners verantwortlich. Nichts schien diese entsetzliche Leere füllen zu können.
Und dann bin ich hier gelandet – hier in der Hope Street.
Und die guten Neuigkeiten waren, dass mir das half.
Ich spähte über meine Karten hinweg zu Angela, einem Neuankömmling, die auf dem Metallstuhl am anderen Ende des Zimmers saß und ihre drei Monate alte Tochter wiegte. Das arme Mädchen, ungefähr sechzehn Jahre alt, hatte den ganzen Abend noch nicht viel gesagt. Ich nahm mir vor, mit Angela zu reden, ehe ich ging.
Die Tür öffnete sich, und Dee Collins, eine der Leiterinnen, kam herein. Eine Afroamerikanerin in konservativem grauem Kostüm folgte ihr. Die strengen Züge verrieten auf Anhieb, dass sie vom Jugendamt kam.
»Angela, deine Sozialarbeiterin ist da.« Dee kniete sich neben sie.
»Ich bin nicht blind«, sagte die Halbwüchsige.
»Wir müssen jetzt das Baby abholen«, erklärte die Sozialarbeiterin so hastig, als würde sie ihren Zug verpassen, wenn sie diese Aufgabe nicht schnell erledigte.
»Nein!« Angela drückte den Säugling an sich. »Ihr könnt mich hier in diesem Loch einsperren oder mich in den Knast zurückschicken, aber ihr nehmt mir nicht mein Baby weg.«
»Bitte, Schätzchen, nur für ein paar Tage«, versicherte ihr Dee Collins beschwichtigend.
Der Teenager legte schützend die Arme um das Baby, das offenbar spürte, dass etwas nicht stimmte, und anfing zu weinen.
»Mach keine Szene, Angela«, warnte die Sozialarbeiterin. »Du weißt, wie es abläuft.«
Sie ging auf Angela zu. Diese sprang vom Stuhl auf. Mit einem Arm presste sie das Baby an sich, in der rechten Hand hielt sie ein Glas Saft, aus dem sie getrunken hatte.
Mit blitzschneller Bewegung schlug sie das Glas gegen den Tisch, sodass es zersprang und sie nur den unteren Teil mit dem gezackten scharfen Rand hielt.
»Angela.« Ich stand auf. »Leg das Glas hin. Niemand wird dir dein Baby wegnehmen, wenn du es nicht willst.«
»Dieses Miststück will mein Leben ruinieren.« Sie blickte wütend um sich. »Erst lässt sie mich noch drei Tage nach meiner Entlassung in Claymore sitzen, dann kann ich endlich nach Hause zu meiner Mom gehen. Und jetzt will sie mir meine Tochter wegnehmen.«
Ich nickte und schaute ihr fest in die Augen. »Als Erstes musst du jetzt das Glas weglegen«, sagte ich. »Das verstehst du doch, Angela, richtig?«
Die Sozialarbeiterin trat einen Schritt vor, aber ich schob sie zurück und ging langsam zu Angela. Ich nahm ihr das Glas weg und dann behutsam auch das Baby.
»Sie ist alles, was ich habe«, flüsterte das Mädchen und brach in Schluchzen aus.
»Ich weiß.« Ich nickte. »Deshalb musst du ein paar Dinge in deinem Leben ändern, damit du sie zurückbekommst.«
Dee Collins wickelte ein Tuch um die blutende Hand des jungen Mädchens, dann nahm sie sie in die Arme. Die Sozialarbeiterin bemühte sich vergeblich, den weinenden Säugling zu beruhigen.
Ich ging zu ihr. »Das Baby wird hier in der Nachbarschaft untergebracht, mit täglichem Besuchsrecht. Übrigens habe ich hier nichts gesehen, was so erwähnenswert wäre, um in die Akte aufgenommen zu werden. Sie etwa?« Sie warf mir einen empörten Blick zu und drehte sich um.
Plötzlich meldete sich mein Piepser. Dreimal durchbohrte der hässlich quäkende Ton die angespannte Atmosphäre. Ich holte den Piepser heraus und las die Nummer. Jacobi, mein Expartner bei der Mordkommission. Was wollte der denn?
Ich entschuldigte mich und ging ins Büro der Heimleitung. Ich erreichte ihn in seinem Auto.
»Es ist etwas ziemlich Schlimmes geschehen, Lindsay«, verkündete er bedrückt. »Ich dachte, dass du Bescheid wissen solltest.«
Er berichtete mir von der schrecklichen Schießerei bei der La-Salle-Heights-Kirche. Ein elfjähriges Mädchen war getötet worden.
»O mein Gott«, stieß ich hervor. Mir wurde schwer ums Herz.
»Ich dachte, du wolltest vielleicht bei diesem Fall mitarbeiten«, sagte Jacobi.
Ich holte tief Luft. Seit drei Monaten war ich nicht mehr am Tatort eines Mordes gewesen. Nicht seit dem Tag, an dem der Brautpaar-Fall geendet hatte.
»Und? Ich höre nichts«, drängte Jacobi. »Willst du mitmachen, Lieutenant?« Zum ersten Mal sprach mich jemand mit meinem neuen Rang an.
Da wurde mir bewusst, dass meine Ferien vorüber waren. »Jawohl, natürlich will ich mitmachen«, stammelte ich.
2 Es begann zu regnen, als ich mit meinem Explorer vor der La-Salle-Heights-Kirche an der Harrow Street hielt, einem überwiegend von Schwarzen bewohnten Viertel von Bay View. Eine aufgebrachte Menge hatte sich versammelt – eine Mischung aus entsetzten Müttern aus der Umgebung und den üblichen Gruppen von Jugendlichen in aufreizender, schriller Kleidung – alle drängten sich um eine Hand voll Polizisten in Uniform.
»Hey, wir sind hier nicht im beschissenen Mississippi«, brüllte jemand, als ich mir den Weg durch die Menge bahnte.
»Wie viele denn noch?«, rief eine ältere weinende Frau. »Wie viele noch?«
Mit Hilfe meiner Dienstmarke gelangte ich an etlichen nervösen Polizisten vorbei nach vorn. Bei dem, was ich als Nächstes sah, stockte mir der Atem.
Die Fassade der weißen Holzkirche war durch ein groteskes Muster von Einschusslöchern und Rissen verunstaltet. In einer Wand gähnte ein riesiges Loch, wo ein großes Glasfenster herausgeschossen worden war. Bunte Glasscherben hingen wie Eiszapfen herab. Überall auf dem Rasen standen Kinder, offensichtlich unter Schock. Ein Notarztteam kümmerte sich um sie.
»O mein Gott«, stieß ich kaum hörbar hervor.
Ich sah den Polizeiarzt in der schwarzen Windjacke, der sich an der Vordertreppe über den Körper eines Mädchens beugte. Es waren auch etliche Beamte in Zivil in der Nähe. Einer von ihnen war mein Expartner Warren Jacobi.
»Willkommen zurück in der Welt, Lieutenant«, sagte Jacobi und betonte meinen neuen Rang.
Der Klang dieses Wortes versetzte mir immer noch einen leichten Schock. Von Anfang an hatte ich bei meiner Karriere das Ziel vor Augen gehabt, Leiterin der Mordkommission zu werden. Die erste weibliche Mordkommissarin in San Francisco, jetzt erster weiblicher Lieutenant. Nachdem mein alter Chef, Sam Roth, sich auf eigenen Wunsch auf einen bequemen Posten oben in Bodega Bay hatte versetzen lassen, hatte Chief Mercer mich zu sich gerufen. Ich habe die Wahl zwischen zwei Dingen, hatte er erklärt. Ich kann Ihnen einen langen unbezahlten Urlaub geben, damit Sie herausfinden, ob Sie imstande sind, unsere Arbeit wieder aufzunehmen. Oder ich kann Ihnen das geben, Lindsay. Damit schob er mir ein goldenes Abzeichen mit zwei Streifen über den Tisch. Ich glaube, ich hatte bis zu diesem Moment Mercer noch nie lächeln sehen.
»Das Lieutenant-Abzeichen macht es nicht leichter für dich, Lindsay, richtig?«, meinte Jacobi und spielte darauf an, dass sich unsere dreijährige partnerschaftliche Beziehung verändert hatte.
»Was liegt an?«, fragte ich ihn.
»Sieht so aus, als hätte ein einzelner Schütze von diesen Büschen aus gefeuert.« Er deutete auf ein dichtes Gebüsch neben der Kirche, etwa vierzig Meter entfernt. »Das Schwein hat die Kinder erwischt, als sie herauskamen. Hat aus vollen Rohren geschossen.«
Ich betrachtete die weinenden, unter Schock stehenden Kinder. »Hat jemand den Kerl gesehen? Mit Sicherheit, oder?«
Er schüttelte den Kopf. »Alle haben sich auf den Boden geworfen.«
Neben dem erschossenen Mädchen schluchzte eine verzweifelte Afroamerikanerin an der Schulter einer Freundin. Jacobi sah, dass ich auf das tote Mädchen starrte.
»Heißt Tasha Catchings«, sagte er leise. »Fünfte Klasse, drüben in St. Anne’s. Liebes Mädchen. Die Jüngste im Chor.«
Ich kniete mich neben die blutüberströmte Leiche. Ganz gleich, wie oft man es schon gemacht hat, es ist jedes Mal wieder ein herzzerreißender Anblick. Tashas weiße Schulbluse war voller Blut, gemischt mit Regen. Nur wenige Schritte neben ihr lag ihr regenbogenfarbener Rucksack im Gras.
»Nur sie?«, fragte ich ungläubig und betrachtete den Tatort. »Nur sie wurde getroffen?«
Überall waren Einschusslöcher, Glasscherben und zersplittertes Holz. Dutzende von Kindern waren hinaus auf die Straße gelaufen. So viele Schüsse und nur ein Opfer.
»Unser Glückstag, was?«, meinte Jacobi.
3 Paul Chin, einer meiner Männer bei der Mordkommission, befragte gerade auf der Treppe vor der Kirche einen großen Afroamerikaner in einem schwarzen Rollkragenpullover und Jeans. Ich hatte den Mann schon in der Nachrichtensendung gesehen, kannte sogar seinen Namen. Aaron Winslow.
Selbst unter Schock sah Winslow blendend aus – glattes Gesicht, das rabenschwarze Haar oben kurz geschnitten, gebaut wie ein erstklassiger Footballspieler. In San Francisco wusste jeder, was er für diese Nachbarschaft tat. Angeblich war er ein echter Held, und ich muss gestehen, so sah er auch aus.
Ich ging hinüber.
»Das ist Reverend Aaron Winslow«, stellte Chin ihn mir vor.
»Lindsay Boxer«, sagte ich und streckte die Hand aus.
»Lieutenant Boxer«, erklärte Chin. »Sie wird diesen Fall leiten.«
»Ich weiß, wie viel Arbeit Sie in dieser Nachbarschaft geleistet haben. Es tut mir sehr Leid. Mir fehlen schlichtweg die Worte.«
Seine Augen glitten zu dem ermordeten Mädchen. »Ich kenne sie von klein auf.« Seine Stimme war unvorstellbar sanft. »Ihre Mutter… hat Tasha und ihren Bruder allein erzogen. Sie ist ein verantwortungsvoller Mensch, wie die meisten hier in der Gegend. Und das sind alles Kinder. Chorprobe, Lieutenant.«
Ich wollte ihn nicht unterbrechen, aber ich musste. »Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Bitte.«
Mechanisch nickte er. »Selbstverständlich.«
»Haben Sie jemanden gesehen? Jemanden, der weggelaufen ist? Einen Schatten vielleicht, oder Umrisse?«
»Ich habe gesehen, woher die Schüsse kamen«, antwortete Winslow und deutete auf dasselbe Gebüsch, zu dem Jacobi gegangen war. »Ich habe das Mündungsfeuer gesehen und habe dafür gesorgt, dass sich alle auf den Boden warfen. Es war Wahnsinn.«
»Hat in letzter Zeit jemand gegen Sie oder Ihre Kirche Drohungen geäußert?«, fragte ich.
»Drohungen?« Winslow runzelte die Stirn. »Vor etlichen Jahren, als wir die ersten Zuschüsse für die Renovierung dieser Häuser erhielten.«
In diesem Moment schrie Tasha Catchings Mutter laut auf, als die Leiche der Kleinen auf eine Trage gehoben wurde. Alles war so unendlich traurig. Die Leute um uns wurden zunehmend nervöser. Beschimpfungen und Anklagen wurden laut. »Was steht ihr hier rum? Los, fangt den Mörder!«
»Ich gehe lieber mal rüber«, meinte Winslow. »Ehe die Sache aus dem Ruder läuft.« Er machte einen Schritt, drehte sich dann mit traurigem Gesicht um. »Vielleicht hätte ich das arme Kind retten können. Ich habe die Schüsse gehört.«
»Sie hätten unmöglich alle retten können«, versicherte ich ihm. »Sie haben getan, was Sie konnten.«
Er nickte. Dann sagte er etwas, das mich total schockierte. »Es war ein M-Sechzehn, Lieutenant. Dreißig-Schuss-Magazin. Das Schwein hat zweimal nachgeladen.«
»Woher wissen Sie das so genau?«, fragte ich.
»Desert Storm«, antwortete er ausweichend. »Ich war Feldkaplan. Nie und nimmer werde ich dieses schreckliche Geräusch vergessen. Niemand kann das.«
4 Ich hörte trotz des Lärms der aufgebrachten Menge, wie jemand meinen Namen rief. Es war Jacobi. Er stand bei den Büschen hinter der Kirche.
»He, Lieutenant, sieh dir das mal an!«
Während ich hinüberging, fragte ich mich, was für ein Mensch eine derartig schreckliche Tat begehen konnte. Ich hatte über hundert Morde bearbeitet. Für gewöhnlich ging es dabei um Drogen, Geld oder Sex. Aber das hier… sollte absichtlich ein Schock sein.
»Lass das überprüfen«, sagte Jacobi. Er stand vorgebeugt über einer Patronenhülse.
»M-Sechzehn, wette ich«, sagte ich.
Jacobi nickte. »Aha, die junge Dame hat sich im Urlaub schlau gemacht. Remington, zweidreiundzwanziger Kaliber.«
»Lieutenant junge Dame, für dich.« Ich grinste. Dann sagte ich ihm, weshalb ich Bescheid wusste.
Überall lagen leere Patronenhülsen herum. Wir standen im Gebüsch und zwischen den Bäumen und waren von der Kirche aus nicht zu sehen. Die Patronenhülsen lagen an zwei Stellen, im Abstand von ungefähr vier Metern.
»Man kann sehen, wo er anfing zu schießen«, sagte Jacobi. »Ich schätze mal, von hier aus. Dann hat er die Stellung gewechselt.«
Vom ersten Patronenhaufen zog sich eine deutliche Linie zur Seite der Kirche. Direkt vor uns das bunte Glasfenster… all die Kinder, die zur Straße gehen… Jetzt war mir klar, weshalb niemand den Täter gesehen hatte. Sein Versteck war absolut sicher.
»Als er nachgeladen hat, ist er hierher gegangen«, erklärte Jacobi.
Ich ging hinüber und hockte mich neben den zweiten Haufen leerer Patronenhülsen. Irgendetwas ergab keinen Sinn. Von hier konnte ich die Fassade der Kirche sehen, auch die Treppenstufen, auf denen Tasha Catchings gelegen hatte – aber nur mit Mühe.
Ich blickte durch ein imaginäres Zielfernrohr auf die Stelle, wo Tasha gewesen sein musste, als sie getroffen wurde. Man konnte sie kaum klar erkennen. Auf gar keinen Fall konnte er die Kleine absichtlich aufs Korn genommen haben. Sie war aus einem höchst ungewöhnlichen Winkel getroffen worden.
»Ein Zufallstreffer«, meinte Jacobi. »Ein Querschläger?«
»Was liegt dahinter?«, fragte ich und blickte auf die Büsche. Dann bahnte ich mir einen Weg, von der Kirche weg, durchs Gebüsch. Niemand hatte den Schützen gesehen, daher war er offensichtlich nicht über die Harrow Street entkommen. Das Gebüsch war ungefähr sieben Meter tief.
Am Ende stand ich vor einem ein Meter fünfzig hohen Maschendrahtzaun, der Begrenzung des Kirchengrundstücks. Der Zaun war nicht hoch. Ich kletterte mühelos darüber.
Ich befand mich vor den eingezäunten Gärten hinter kleinen Reihenhäusern. Einige Menschen hatten sich dort versammelt und schauten neugierig zu mir herüber. Rechts von mir war der Spielplatz der Whitney-Young-Siedlung.
Jacobi hatte mich inzwischen eingeholt. »Nicht so schnell, Lou«, sagte er keuchend. »Da steht Publikum. Du lässt mich schlecht aussehen.«
»Warren, so muss der Kerl entkommen sein.« Wir blickten in beide Richtungen. Die eine führte zu einer schmalen Seitenstraße, die andere zu Reihenhäusern.
»Hat von Ihnen jemand irgendwas gesehen?«, rief ich einer Gruppe Schaulustiger auf einer Terrasse zu. Keine Antwort.
»Jemand hat auf die Kirche geschossen«, brüllte ich. »Ein kleines Mädchen wurde getötet. Bitte, helfen Sie uns. Wir brauchen Ihre Hilfe.«
Alle standen da und hüllten sich in das abweisende Schweigen von Menschen, die nicht mit der Polizei reden wollen.
Dann trat langsam eine Frau vor. Sie war um die dreißig und schob einen Jungen vor sich her. »Bernard hat was gesehen«, sagte sie mit gepresster Stimme.
Bernard schien ungefähr sechs Jahre alt zu sein. Er hatte runde misstrauische Augen und trug ein gold-lilafarbenes Kobe-Bryant-Sweatshirt.
»Es war ein Van«, erklärte er. »Wie der von Onkel Reggie.« Er deutete auf den Weg, der zur Seitenstraße führte. »Da unten hat er geparkt.«
Ich kniete mich hin und schaute dem verängstigten Jungen in die Augen. »Welche Farbe hatte der Van, Bernard?«
»Weiß.«
»Mein Bruder hat einen weißen Dodge Minivan«, sagte Bernards Mutter.
»Und er hat wie der von deinem Onkel ausgesehen, Bernard?«, fragte ich.
»So ähnlich. Aber eigentlich nicht.«
»Hast du den Mann gesehen, der ihn gefahren hat?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich hab den Müll rausgetragen. Ich hab nur gesehen, wie er weggefahren ist.«
»Meinst du, du würdest das Auto wieder erkennen, wenn du es noch mal siehst?«
Bernard nickte.
»Weil es so wie das von deinem Onkel ausgesehen hat?«
Er zögerte. »Nein, weil hinten ein Bild drauf ist.«
»Ein Bild? Du meinst wie eine Reklame?«
»Nein.« Er schüttelte den Kopf. Die Vollmondaugen blickten suchend umher. Dann leuchteten sie auf. »Wie das da!« Er deutete auf den Pick-up in der Einfahrt des Nachbarn. Auf dessen hinterer Stoßstange klebte ein Band mit der Aufschrift: »Cal Golden Bear.«
»Du meinst so ein Aufkleber?«, bohrte ich nach.
»Ja, aber auf der Tür.«
Ich legte dem Jungen die Hände auf die Schultern. »Wie hat dieser Aufkleber ausgesehen, Bernard?«
»Wie Mufasa, der König der Löwen.«
»Ein Löwe?« In Gedanken ging ich sämtliche Möglichkeiten durch, die mir auf die Schnelle einfielen: Sportclubs, College Logos, Firmen…
»Ja, wie Mufasa«, wiederholte Bernard. »Nur, dass er zwei Köpfe gehabt hat.«
5 Weniger als eine Stunde später drängte ich mich durch die Menge, die sich vor dem Polizeipräsidium, der Hall of Justice, versammelt hatte. Ich war erschöpft und grauenvoll traurig, aber ich wusste, hier durfte ich das nicht zeigen.
In der Eingangshalle des mausoleumartigen grauen Granitbaus, wo ich arbeitete, wimmelte es von Reportern und Fernsehleuten, die jedem, der irgendein Abzeichen trug, ein Mikrofon vors Gesicht hielten. Die meisten Polizeireporter kannten mich, doch ich winkte ab und ging die Treppe nach oben.
Aber da packte mich jemand an der Schulter, und eine vertraute Stimme sagte: »Linds, wir müssen reden…«
Es war Cindy Thomas, eine meiner engsten Freundinnen, obgleich sie die führende Polizeireporterin beim Chronicle war. »Ich will dich jetzt nicht nerven, aber es ist wichtig«, sagte sie. »Wie wär’s um zehn bei Susie’s?«
Cindy hatte als kleine Reporterin bei der Lokalredaktion angefangen und es geschafft, sich durch List und Tücke in die Ermittlungen bei den Honeymoon-Morden einzuschleichen und anschließend maßgeblich zur Aufklärung beigetragen. Ich hatte Cindy, ebenso wie den anderen, das Gold auf meiner Polizeimarke zu verdanken.
Mir gelang ein Lächeln. »Ich komme.«
Im zweiten Stock betrat ich den Raum, der von Leuchtstoffröhren erhellt wurde und den die zwölf Leute der Mordkommission ihr Zuhause nannten. Lorraine Stafford wartete auf mich. Sie hatte sechs erfolgreiche Dienstjahre bei der Sittenpolizei hinter sich und war die Erste, die ich zu meiner Mitarbeiterin machte. Cappy McNeil war ebenfalls gekommen.
»Was kann ich tun?«, fragte Lorraine.
»Fragen Sie in Sacramento an, ob ein weißer Van als gestohlen gemeldet ist. Jedes Modell. Kalifornisches Nummernschild. Und eine allgemeine Anfrage wegen eines Aufklebers für die Stoßstange, auf dem ein Löwe, ganz gleich wie, abgebildet ist.« Sie nickte und wollte gehen.
»Moment, Lorraine«, hielt ich sie zurück. »Ein Löwe mit zwei Köpfen.«
Cappy kam mit, als ich mir eine Tasse Kaffee machte. Er war seit fünfzehn Jahren bei der Mordkommission, und ich wusste, dass er sich positiv über mich geäußert hatte, als Chief Mercer ihn wegen meiner Beförderung zum Lieutenant befragt hatte. Er schaute traurig und deprimiert drein. »Ich kenne Aaron Winslow. Ich habe mit ihm in Oakland Football gespielt. Er hat sein Leben diesen Kindern gewidmet. Er ist wirklich ein guter und großartiger Mensch, Lieutenant.«
Plötzlich steckte Frank Barnes vom Autodiebstahl den Kopf durch die Tür in unser Büro. »Achtung, Lieutenant. Schwergewicht ist auf dem Weg.«
Schwergewicht wurde im Polizeijargon der Polizeipräsident von San Francisco, Chief Earl Mercer, genannt.
6 Mercer stampfte herein, mit seinen ganzen hundertfünfzehn Kilo, gefolgt von Gabe Carr, einem bösartigen kleinen Wiesel, dem Pressesprecher der Polizei, und Fred Dix, der für die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung zuständig war.
Der Chief trug sein Markenzeichen, den dunkelgrauen Anzug, das blaue Hemd und die glänzenden goldenen Manschettenknöpfe. Ich hatte miterlebt, wie Mercer eine Reihe heikler Situationen gemeistert hatte – Bombenattentate in öffentlichen Verkehrsmitteln, behördeninterne Skandale, Serienmorde –, aber noch nie hatte ich sein Gesicht so angespannt gesehen. Er winkte mich in mein Büro und schloss wortlos die Tür hinter sich. Fred Dix und Gabe Carr waren bereits da.
»Gerade habe ich mit Winston Gray und Vernon Jones telefoniert« – zwei berühmte Stadträte –, »sie haben mir zugesichert, Zurückhaltung zu üben und uns etwas Zeit zu geben, um herauszufinden, um welche Sauerei es sich handelt. Aber ich muss eines klarstellen: Mit Zurückhaltung meinen sie: Bringt uns die Person oder Gruppe, die dafür verantwortlich ist, sonst haben wir zweitausend wütende Bürger im Rathaus.«
Sein Gesicht entspannte sich kaum sichtbar, als er mich anschaute. »Deshalb hoffe ich, Lieutenant, Sie haben uns etwas mitzuteilen…«
Ich berichtete ihm, was ich bei der Kirche ermittelt hatte und dass Bernard Smith das mutmaßliche Fluchtfahrzeug gesehen hatte.
»Van oder nicht«, mischte sich Fred Dix, der Mann des Bürgermeisters ein, »Sie wissen, wo Sie anfangen müssen. Bürgermeister Fernandez geht scharf gegen jeden vor, der in dieser Gegend rassistische oder sonstige Parolen gegen die Integration verbreitet. Derartige Bestrebungen müssen radikal ausgemerzt werden.«
»Sie scheinen ja ziemlich sicher zu sein, dass es sich um eines der üblichen Kraut-und-Rüben-Verbrechen handelt«, sagte ich.
»Eine Kirche zusammenschießen, ein elfjähriges Kind ermorden? Wo würden Sie denn anfangen, Lieutenant?«
»Das Gesicht des toten Mädchens wird in jeder Nachrichtensendung des Landes zu sehen sein«, warf der Pressesprecher ein. »Die Verbesserungen im Bay-View-Bezirk sind eine der Leistungen, auf die der Bürgermeister äußerst stolz ist.«
Ich nickte. »Hat der Bürgermeister etwas dagegen, wenn ich meine Augenzeugenbefragung vorher abschließe?«
»Machen Sie sich wegen des Bürgermeisters keine Sorgen«, erklärte Mercer scharf. »Im Augenblick haben Sie es nur mit mir zu tun. Ich bin in diesen Straßen aufgewachsen. Meine Eltern leben immer noch in West Portal. Ich brauche keine Nachrichtensendung, um das Gesicht dieses Kindes vor mir zu sehen. Sie leiten die Ermittlungen, wohin auch immer sie führen. Aber schnell. Und, Lindsay… mit absolutem Vorrang, verstehen Sie?«
Er wollte aufstehen. »Und was das Wichtigste ist – ich verlange absolute Geheimhaltung. Ich will über diese Ermittlungen nichts auf einer Titelseite lesen.«
Alle nickten. Mercer erhob sich, Dix und Carr ebenfalls. Er stieß lautstark die Luft aus. »Und jetzt müssen wir diese beschissene Pressekonferenz heil überstehen.«
Dix und Carr gingen hinaus, Mercer blieb noch im Raum. Er stützte die molligen Hände auf meinen Schreibtisch. Ich blickte zu dem Fleischberg auf.
»Lindsay, ich weiß, dass Sie nach dem letzten Fall viel auf dem Tisch zurückgelassen haben. Aber das ist alles vorbei und vergessen. Ich brauche Ihre geballte Einsatzkraft für diesen Fall. Eines der Dinge, die Sie zurückgelassen haben, als Sie sich für die Marke entschieden, war die Freiheit, wegen Ihrem persönlichen Schmerz die Arbeit zu vernachlässigen.«
»Sie brauchen sich deshalb keine Sorgen zu machen.« Ich blickte ihm fest in die Augen. Im Laufe der Jahre hatte ich mit diesem Mann Differenzen gehabt, aber jetzt war ich bereit, ihm alles zu geben, was ich nur konnte. Ich hatte das tote kleine Mädchen gesehen. Ich hatte die kaputte Kirche gesehen. Mein Blut kochte. So hatte ich mich nicht gefühlt, seit ich meine »Auszeit« genommen hatte.
Chief Mercer schenkte mir ein verständnisvolles Lächeln. »Schön, dass Sie wieder bei uns sind, Lieutenant.«
7 Nach einer recht stürmischen Pressekonferenz, die auf den Stufen des Präsidiums durchgeführt worden war, traf ich – wie abgemacht – Cindy bei Susie’s. Nach der Hektik im Präsidium war die entspannte, zum Zurücklehnen einladende Atmosphäre unseres Lieblingstreffpunkts ein wahrer Segen. Cindy schlürfte bereits ein Corona, als ich eintraf.
Hier war schon viel geschehen – direkt an diesem Tisch. Cindy, Jill Bernhardt, stellvertretende Bezirksstaatsanwältin, und Claire Washburn, Leiterin der Gerichtsmedizin und meine beste Freundin. Wir hatten im vergangenen Sommer begonnen, uns zu treffen, weil es so aussah, als hätte das Schicksal uns in Verbindung mit den Honeymoon-Morden zusammengeführt. Im Laufe der Zeit waren wir enge Freundinnen geworden.
Ich gab unserer Kellnerin Loretta das Zeichen, ein Bier zu bringen, und ließ mich mit einem erschöpften Lächeln Cindy gegenüber nieder. »Hallo…«
»Hallo.« Sie lächelte zurück. »Schön, dass du kommen konntest.«
»Bin froh, dass ich da bin.«
Über der Bar strahlte der Fernseher die Übertragung von Chief Mercers Pressekonferenz aus. »Wir gehen davon aus, dass es sich bei dem Schützen um einen Einzeltäter handelt«, erklärte Mercer unter einem Blitzlichtgewitter.
»Warst du da noch dabei?«, fragte ich Cindy und trank einen Schluck von dem eiskalten Bier.
»Ja, da war ich dabei«, antwortete sie. »Stone und Fitzpatrick waren auch da. Sie schreiben die Meldung.«
Verblüfft schaute ich sie an. Tom Stone und Suzie Fitzpatrick waren auch Polizeireporter und Cindys Konkurrenten. »Verlierst du den Biss? Vor sechs Monaten wärst du vor Aufregung noch fast geplatzt.«
»Ich gehe mit einem anderen Blickwinkel dran.« Sie zuckte die Schultern.
Eine Hand voll Menschen drängte sich vor der Bar, um die Sendung zu sehen. Ich trank noch einen Schluck Bier. »Du hättest das arme kleine Mädchen sehen sollen, Cindy. Elf Jahre alt. Sie hat im Chor gesungen, und dann lag da ihr regenbogenfarbener Rucksack mit dem Schulkram im Gras.«
»Du weißt doch, wie’s ist, Lindsay.« Cindy schenkte mir ein ermunterndes Lächeln. »Schlichtweg eine Sauerei.«
»Ja.« Ich nickte. »Aber es wäre zur Abwechslung mal schön, einem Opfer auf die Beine helfen und es nach Hause schicken zu können. Nur ein einziges Mal möchte ich so einer Kleinen ihren Rucksack überstreifen.«
Cindy tätschelte liebevoll meinen Handrücken. Dann strahlte sie. »Ich habe heute Jill getroffen. Sie hat Neuigkeiten für uns. Sie ist ganz aufgeregt. Vielleicht geht Bennet in Pension, und sie kriegt den Chefsessel. Wir sollten uns alle mit ihr treffen.«
»Unbedingt, wolltest du mir das sagen, Cindy?«
Sie schüttelte den Kopf. Im Hintergrund war bei der Pressekonferenz der Teufel los. Mercer versprach eine schnelle und effektive Ermittlung. »Du hast ein Problem, Linds…«
»Nein, ich kann dir nichts geben, Cindy. Mercer hält alle Fäden in der Hand. Ich habe ihn noch nie so aufgebracht erlebt. Tut mir Leid.«
»Ich habe dich nicht hergebeten, um etwas zu bekommen, Lindsay.«
»Cindy, wenn du etwas weißt, sag’s mir.«
»Ich weiß, dass dein Boss den Mund nicht so voll nehmen und solche Versprechen machen sollte.«
Ich blickte auf den Fernsehschirm. »Mercer…?«
Im Hintergrund hörte ich seine Stimme. Er versicherte, dass die Schießerei ein Einzelfall sei und wir bereits Anhaltspunkte hätten und dass jeder zur Verfügung stehende Polizist an diesem Fall mitarbeiten würde, bis wir den Mörder zur Strecke gebracht hätten.
»Er teilt der Welt mit, dass ihr diesen Kerl fasst, ehe er wieder zuschlägt.«
»Ja und?«
Unsere Blicke trafen sich. »Ich glaube, er hat es bereits getan.«
8 Der Mörder spielte Desert Command, und er war ein Meister darin.
Peng, peng, peng… peng, peng.
Leidenschaftslos schaute er durch das beleuchtete Infrarot-Zielfernrohr, als vermummte Gestalten in Sicht kamen. Auf seinen Fingerdruck hin gingen die dunklen, labyrinthähnlichen Gänge des Bunkers der Terroristen in orangeroten Flammen auf. Schemenhafte Gestalten stürzten durch die engen Gänge. Peng, peng, peng.
Er war der Champion in diesem Spiel. Phantastische Hand-Auge-Koordination. Niemand konnte ihm das Wasser reichen.
Sein Finger zuckte am Abzug. Aasfresser, Sandwürmer, Kameltreiber. Na los, komm schon her!… Peng, peng… Die dunklen Korridore hinauf… Er brach durch eine Eisentür und stieß dahinter auf eine ganze Gruppe. Sie spielten Karten und rauchten eine Wasserpfeife. Seine Waffe spuckte einen todbringenden orangefarbenen Strahl aus. Gesegnet seien die Friedensbringer! Er grinste.
Wieder setzte er das Zielfernrohr ans Auge und spielte geistig noch mal die Szene vor der Kirche durch. Ja, da war das Gesicht des kleinen Schokoladentörtchens, die Zöpfe und der regenbogenfarbene Rucksack.
Peng. Peng. Auf dem Bildschirm explodierte die Brust einer Gestalt. Noch ein tödlicher Treffer, dann hatte er den Rekord! Geschafft! Er blickte auf den Spielstand. Zweihundertsechsundsiebzig tote Feinde!
Er trank einen großen Schluck Corona und grinste. Ein neuer persönlicher Rekord. Dieses Ergebnis war es wert, festgehalten zu werden. Er gab seine Initialen ein: F.C.
Er stand vor dem Spielautomaten der Playtime Arcade in West Oakland und drückte noch auf den Abzug, als das Spiel längst beendet war. Er war der einzige Weiße in der Spielhalle, der Einzige. Deshalb kam er hierher.
Plötzlich erschien oben auf den vier großen Fernsehmonitoren dasselbe Gesicht. Ihm lief es eiskalt über den Rücken, Wut stieg in ihm auf.
Es war Mercer, dieses großmäulige Arschloch, der Boss sämtlicher Bullen in San Francisco. Er tat, als hätte er alles genau durchschaut.
»Wir sind der Ansicht, dass es sich um einen Einzeltäter handelt«, verkündete Mercer. »Ein isoliertes Verbrechen…«
Du hast ja keine Ahnung. Er lachte.
Warte bis morgen … dann wirst du schon sehen. Warte nur!
»Ich möchte betonen, dass wir unter keinen Umständen dulden werden, dass unsere Stadt durch rassistische Angriffe terrorisiert wird«, fuhr der Polizeipräsident fort.
Unsere Stadt! Verächtlich spuckte er auf den Boden. Was weißt du schon über diese Stadt? Du gehörst nicht hierher.
Er befühlte die C-1-Granate in seiner Jackentasche. Wenn er wollte, könnte er hier alles in die Luft jagen. Hier und jetzt!
Aber es gab Arbeit, die getan werden musste.
Morgen.
Er war auf der Jagd nach einem weiteren persönlichen Rekord.
9 Am nächsten Morgen untersuchten Jacobi und ich noch mal den Tatort bei der La-Salle-Heights-Kirche ab.
Die ganze Nacht hindurch hatte ich mich hin und her gewälzt und mir wegen eines Falls Sorgen gemacht, von dem mir Cindy erzählt hatte, weil er auf ihrem Schreibtisch gelandet war. Es ging um eine ältere allein stehende Afroamerikanerin, die in der Gustave-White-Siedlung gewohnt hatte. Vor drei Tagen hatte die Polizei in Oakland sie unten in der Waschküche gefunden. Sie hing an einem Rohr, ihre Kehle war von einem Elektrokabel zugeschnürt.
Anfänglich vermutete die Polizei Selbstmord. An der Leiche waren keine Abschürfungen oder Spuren eines Kampfes zu erkennen. Aber am nächsten Tag fand man bei der Obduktion unter den Fingernägeln flockenartige Rückstände. Es handelte sich um winzige Fetzen menschlicher Haut. Die arme Frau hatte verzweifelt jemanden gekratzt.
Laut Cindy hatte sie sich nicht selbst aufgehängt.
Man hatte die Frau gelyncht.
Als ich am Tatort bei der Kirche stand, hatte ich das ungute Gefühl, Cindy könnte Recht haben. Vielleicht handelte es sich hier nicht um den ersten, sondern den zweiten Mord aus Rassenhass.
Jacobi kam zu mir. Er hielt den zusammengerollten Chronicle hoch. »Schon gesehen, Boss?«
Die Titelseite wurde von einer schrillen Schlagzeile beherrscht: ELFJÄHRIGEVORKIRCHEERMORDET – POLIZEIRATLOS
»Deine Freunde!«, stieß Jacobi wütend aus. »Immer auf unsere Kosten!«
»Nein, Warren.« Ich schüttelte den Kopf. »Meine Freunde haben so billige Tricks nicht nötig.«
Hinter uns war Charlie Clappers Mannschaft der Spurensicherung tätig. Sie suchten sorgfältig den Boden ab, auf dem sich der Scharfschütze bewegt hatte. Sie fanden etliche Fußabdrücke, die jedoch nicht zu identifizieren waren. Jede leere Patronenhülse musste auf Fingerabdrücke untersucht werden. Sie würden auch jedes Staubkörnchen und jede Stofffaser von der Stelle einsammeln, wo das mutmaßliche Fluchtfahrzeug geparkt hatte.
»Irgendwelche neuen Ergebnisse zum weißen Van?«, fragte ich Jacobi. Eigenartigerweise war es ein schönes Gefühl, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten.
Er schüttelte den Kopf. »Ein Hinweis war, dass ein paar Penner an dem Abend in dieser Ecke ein Kaffeekränzchen gehabt haben. Bis jetzt haben wir nur das.« Er entfaltete das Phantombild von Bernard Smiths Beschreibung: Ein zweiköpfiger Löwe, der Aufkleber auf der Hintertür des Vans.
Jacobi verzog die Lippen. »Sind wir hinter dem Pokémon-Killer her, Lieutenant?«
In diesem Moment sah ich Aaron Winslow aus der Kirche kommen. Eine Gruppe von Demonstranten, die hinter der Polizeiabsperrung vierzig Meter entfernt stand, wollte zu ihm. Als er mich sah, spannten sich seine Züge an.
»Die Leute wollen unbedingt helfen. Die Einschusslöcher übermalen, eine neue Fassade bauen«, sagte er. »Sie wollen diesen scheußlichen Anblick nicht ertragen.«
»Tut mir Leid«, sagte ich. »Aber die Tatortermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.«
Er holte tief Luft. »Ich verstehe das nicht. Ich habe genau in der Schusslinie gestanden, Lieutenant, und war viel besser zu sehen als die kleine Tasha. Wenn der Schütze jemandem wehtun wollte, warum hat er nicht auf mich geschossen?«
Winslow kniete nieder und hob eine rosa Haarspange vom Boden auf. »Irgendwo habe ich gelesen, dass ›Mut im Überfluss vorhanden ist, wo Schuld und Wut ungehindert ausströmen‹.«
Winslow nahm es sehr schwer. Er tat mir Leid. Ich mochte ihn. Er rang sich ein Lächeln ab. »Aber dieser Dreckskerl schafft es nicht, unsere Arbeit zunichte zu machen. Wir geben nicht klein bei. Wir werden den Gottesdienst für Tasha hier in dieser Kirche abhalten.«
»Wir wollen der Familie unser Beileid aussprechen«, sagte ich.
»Sie wohnt da drüben. Haus A.« Er deutete zur Siedlung. »Ich nehme an, man wird Sie herzlich aufnehmen, da einer von ihnen zu Ihren Leuten gehört.«
Verblüfft schaute ich ihn an. »Entschuldigung, wie war das?«
»Haben Sie nicht gewusst, Lieutenant, dass Tasha Catchings Onkel Polizist ist?«
10 Ich besuchte die Catchings in ihrer Wohnung, sprach ihnen mein Beileid aus und fuhr zurück ins Präsidium. Das Ganze war unglaublich deprimierend.
»Mercer sucht Sie«, rief Karen, unsere langjährige Sekretärin, als ich ins Büro kam. »Er klingt stinksauer. Aber so klingt er eigentlich immer.«
Ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie die Falten im Doppelkinn des Chiefs immer tiefer wurden, während er die Schlagzeilen vom Nachmittag las. Das ganze Präsidium sprach schon darüber, dass das Mordopfer von La Salle Heights mit einem unserer Kollegen verwandt war.
Auf meinem Schreibtisch warteten mehrere Nachrichten auf mich. Bei den Telefonnotizen stieß ich ganz unten auf Claires Namen. Tasha Catchings Obduktion müsste inzwischen abgeschlossen sein. Ich wollte Mercer hinhalten, bis ich etwas Konkretes zu melden hatte, deshalb rief ich Claire an.
Claire Washburn war die klügste und gewissenhafteste Pathologin, die die Stadt je gehabt hatte, und außerdem war sie zufällig meine beste Freundin. Das wussten alle, die mit der Polizei zu tun hatten, und auch, dass sie die Abteilung reibungslos leitete, während der Chefgerichtsmediziner Righetti, ein vom Bürgermeister ernannter Bürohengst, im ganzen Land zu forensischen Tagungen reiste und an seinem politischen Profil arbeitete. Wenn man wollte, dass in der Pathologie etwas getan wurde, ging man zu Claire.
Und wenn ich jemanden brauchte, der mir den Kopf wusch oder mich zum Lachen brachte, oder nur eine Schulter zum Ausheulen, dann ging ich ebenfalls zu ihr.
»Wo hast du dich denn versteckt, Baby?«, begrüßte mich Claire. Ihre Stimme klang immer fröhlich, wie poliertes Messing.
»Normale Routinearbeit.« Ich zuckte die Schultern. »Personalbeurteilungen, Schreibkram… Morde mit rassistischem Hintergrund, die die Stadt spalten…«
»Darin bin ich Expertin.« Sie lachte. »Ich wusste, dass du kommst. Meine Spione haben mir berichtet, dass du einen selten beschissenen Fall übernommen hast.«
»Arbeitet einer dieser Spione vielleicht für den Chronicle und fährt einen ramponierten silberfarbenen Mazda?«
»Oder in der Staatsanwaltschaft und hat einen BMW fünfhundertfünfunddreißig. Wie, zum Teufel, soll denn sonst deiner Meinung nach irgendeine Information nach hier unten kommen?«
»Ich hab eine für dich, Claire. Es hat sich herausgestellt, dass der Onkel des toten Mädchens unsere Uniform trägt. Er gehört zum Nordrevier. Und das kleine Mädchen war ein Poster-Kind für das La-Salle-Heights-Projekt. Einserschülerin, nicht ein einziges Mal in Schwierigkeiten. Das ist Gerechtigkeit, ha! Dieses Schwein schießt hundert Löcher in die Kirche, und eine Kugel trifft ausgerechnet dieses Kind.«
»Irrtum, Schätzchen«, unterbrach mich Claire. »Es waren zwei.«
»Zwei…? Sie wurde zwei Mal getroffen?« Der Polizeiarzt hatte die Leiche doch genau untersucht. Wie konnte uns das entgangen sein?
»Wenn ich dich richtig verstehe, glaubst du, dass dieser Schuss so eine Art Unfall war, oder?«
»Was willst du mir schonend beibringen?«
»Schätzchen, ich glaube, du solltest mir hier unten einen Besuch abstatten.«
11 Die Pathologie befindet sich im Erdgeschoss des Präsidiums, und man erreicht sie durch einen Hintereingang der Eingangshalle und über einen asphaltierten Weg. Ich brauchte keine drei Minuten, um vom zweiten Stock die Treppen hinabzulaufen.
Claire wartete auf mich im Empfangsbereich vor ihrem Büro. Ihr sonst so strahlendes fröhliches Gesicht war besorgt, aber kaum sah sie mich, lächelte sie und schloss mich in die Arme.
»Wie geht’s denn so, Fremde?«, fragte sie, als sei der Fall Tausende von Meilen entfernt.
Claire besaß das Geschick, selbst in den kritischsten Situationen die Lage zu entschärfen. Ich habe stets bewundert, wie sie – allein durch ihr Lächeln – mich dazu brachte, ein Problem etwas lockerer und nicht so verbissen zu sehen.
»Bestens, Claire. Aber Berge von Arbeit.«
»Seit du Mercers Lieblingssklavin bist, sehe ich nicht mehr viel von dir.«
»Sehr witzig.«
Sie schaute mich mit ihren großen Augen an, die sagten: He, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht auch weit mehr. Du musst dir für die Menschen, die dich lieben, Zeit nehmen, Mädchen. Aber ohne ein tadelndes Wort führte sie mich den langen sterilen, mit Linoleum ausgelegten Korridor zum Arbeitsraum der Pathologie hinunter, auch die Gruft genannt.
Sie schaute zu mir zurück und sagte: »Du hast so geklungen, als wärst du sicher, dass Tasha Catchings von einer verirrten Kugel getötet wurde.«
»Ja, das habe ich gedacht. Der Schütze hat drei Magazine auf die Kirche abgefeuert, und Tasha wurde als Einzige getroffen. Ich bin sogar an der Stelle gewesen, von der aus er geschossen hat. Vollkommen unmöglich, dass er auf sie freie Schusslinie hatte. Aber du hast doch gesagt, zwei…«
»Ja.« Sie nickte. Wir gingen durch die Kompressionstür in die kalte trockene Luft der Gruft. In der Eiseskälte und beim Geruch nach Chemikalien bekam ich immer eine Gänsehaut.
Auch dieses Mal. Man sah nur eine einzige Bahre. Und darauf lag ein kleines Häuflein, von einem weißen Laken bedeckt. Es nahm kaum die Hälfte der Bahre ein.
»Dann wappne dich!«, warnte Claire. Nackte Opfer nach der Obduktion sind nie ein schöner Anblick, starr und schrecklich blass.
Sie zog das Laken weg. Ich blickte dem Kind direkt ins Gesicht. Mein Gott, war die Kleine jung…
Ich betrachtete die zarte ebenholzfarbene Haut, so unschuldig, so völlig fehl am Platz in dieser kalten sterilen Umgebung. Am liebsten hätte ich ihre Wange gestreichelt. Sie hatte so ein niedliches Gesichtchen.
In der rechten Brust des Kindes war eine große runde Wunde zu sehen, jetzt allerdings von Blut gereinigt. »Zwei Kugeln«, erklärte Claire. »Praktisch eine direkt auf die andere, blitzschnell abgefeuert. Mir ist klar, weshalb der Polizeiarzt das nicht gesehen hat. Sie sind fast durch ein einziges Einschussloch eingedrungen.«
Wie grauenvoll. Mir wurde beinahe schlecht.
»Die erste Kugel ist durch das Schulterblatt ausgetreten.« Claire drehte behutsam den kleinen Leichnam auf die Seite. »Die zweite ist vom vierten Brustwirbel abgeprallt und hat sich in ihr Rückenmark gebohrt.«
Claire nahm eine Petri-Schale von einem Tisch und entnahm mit der Pinzette ein flaches rundes Bleistück, ungefähr so groß wie ein Vierteldollars. »Zwei Schüsse, Linds… der erste durchbohrte die rechte Herzkammer. Das reichte bereits. Wahrscheinlich war sie schon tot, als der zweite sie traf.«
Zwei Schüsse… die Chancen, dass beide Querschläger waren, standen eins zu einer Million. Ich rief mir den Tatort ins Gedächtnis zurück, wo Tasha vermutlich gestanden hatte, als sie die Kirche verlassen hatte, und die Schusslinie des Mörders im Gebüsch. Ein Querschläger war möglich, aber zwei…
»Haben die Leute von Charlie Clapper in der Kirche Spuren von Kugeln oberhalb der Kleinen gefunden?«, fragte Claire.
»Das weiß ich nicht.« Bei allen Mordermittlungen wurden die Einschusslöcher mit den entsprechenden Kugeln genauestens verglichen. »Ich werde es überprüfen.«
»Aus welchem Material war die Kirche gebaut? Holz oder Stein?«
»Holz.« Jetzt kapierte ich, worauf sie hinauswollte. Nie und nimmer würde eine Kugel aus einem M-16 von Holz abprallen.





























