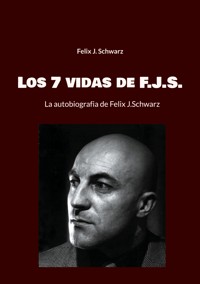Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Felix J.Schwarz, geb.1927 in der CSR, zeichnet in diesem Buch seine ungewöhnliche Lebensgeschichte auf. Im Verlauf seines fast 100-jährigen Lebens durchlebte er im Krieg als Soldat, aber auch danach im Zivilleben, u.a.auf seiner Einhand-Weltumseglung viele lebensbedrohliche Situationen, die ihn letztlich in eine pathologisch schwierige Situation brachten. Die vorliegenden Aufzeichnungen waren ein Teil der Therapie, um die schweren Depressionen zu heilen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felix J.Schwarz 14 J 3
Bernsdorf (Bernartice),um 1930.
Soldat, Musiker, Gastronom, Weltumsegler Felix J. Schwarz zeichnet hier seinen ungewöhnlichen Lebensweg auf. Es sind mehr als sieben Mal, wo die Überlebenschancen denkbar knapp waren und es scheint, als hätten eine große Zahl von Schutzengeln diesen Weg begleitet. Wie sonst wäre es zu erklären, wenn es immer mal wieder hieß:
“Wieder einmal davongekommen”.
Inhaltsverzeichnis:
Herkunft und Jugend
Russische Gefangenschaft
Nach dem Krieg
Zu neuen Ufern
Der Lebensabend
Herkunft und Jugend.
Felix J.Schwarz wurde Mitte 1927 in Bernsdorf bei Trautenau in der damaligen Tschechoslowakischen Republik geboren.
1918,nach dem Ersten Weltkrieg, entstand aus dem Zusammenschluss mehrerer Volksgruppen,Tschechen,Slowaken und Sudetendeutschen, der Staat Československa Republika. Der erste Präsident war Thomas G. Masaryk, der seinen Amtssitz in Prag auf dem Hradschin hatte.
Die Regierung war demokratisch-republikanisch, mit einer gewissen Dominanz der tschechischen Volksgruppe. Meine Heimat lag in einem der schönsten Urlaubsgebiete der Republik, dem Riesengebirge. Trautenau, oder Trutnow, wie es die Tschechen nannten, war die administrative Provinzstadt der Region. Die höchste Erhebung, die Schneekoppe, lag direkt vor unseren Augen, einen Tagesmarsch von Bernsdorf (tschechisch Bergartice) entfernt. Dieser Ort hatte in seiner Blütezeit 1.800 Einwohner. Man lebte von den Erträgen der Landwirtschaft oder arbeitete als Tagelöhner in den nahegelegenen Kohlegruben. Als Kleinindustrie gab es im Ort noch eine Jutefabrik und eine Fischfabrik, die Konserven und Halbkonserven herstellte.
Wohlhabende Leute gab es zur Zeit meiner Geburt nur wenige. Verwaltung und Polizei im Ort waren Tschechen, die sich aber nur schwer in die Struktur der deutschsprachigen Gesellschaft einfügten. Es gab eine tschechische Volksschule im Ort, die aber nur von den Kindern der Tschechen besucht wurde, die dort als Polizisten (Finanzbeamte) oder andere Beamte arbeiteten. Die deutsche Schule reichte für die damaligen Verhältnisse aus, um der Dorfjugend ein mittleres Grundwissen zu vermitteln. Tschechisch war Pflichtfach, Deutsch wurde als Hauptfach unterrichtet. Mittelpunkt des kulturellen Lebens war die römischkatholische Kirche. Alles, was sich auf dieser Ebene im Ort bewegte, musste den Segen des Pfarrers haben. So war die Moral eine Kirchenmoral, Ausschweifungen jeglicher Art kamen gar nicht erst auf. Kriminalität gab es - trotz zum Teil bitterster Armut.so gut wie nicht. Man lebte sehr einfach, niemand verhungerte; in der Not half der Nachbar dem anderen und gab von dem Wenigen, was er hatte.
Meine Grossmutter, mütterlicherseits, stammte aus dem inneren Teil der Republik, dem sogenannten Tschechischen. Sie sprach fliessend Deutsch, hatte aber ihr ganzes Leben lang immer Schwierigkeiten mit der deutschen Schrift. Ihr Geburtsname Shintag klingt jüdisch, aber sie war eine reine Tschechin. Wir wissen das, weil sie in der Hitlerzeit einen „Ariernachweis“ erbringen musste.1895 heiratete sie meinen Großvater Josef Kopper
Mein Grossvater war ein sehr begabter Musiker, der mehrere Instrumente spielte. Er komponierte und arrangierte für den Kirchenchor und die grosse Musikkapelle des Ortes; in der Kirche spielte er die Orgel; ihm unterstand auch der grosse Chor des gemischten Gesangvereins. Seinen Lebensunterhalt verdiente er aber als Landwirt. Ein Mann von stattlicher Erscheinung und Bärenkräften, der den vollen Wagen mit den Zugtieren schieben konnte, wenn diese wieder einmal nicht wollten. Vom Charakter her war er der gutmütigste Mensch, den man sich vorstellen kann. So wurde er von dem Ortspfarrer um jahrelange, natürlich unentgeltliche Tätigkeit betrogen, indem man ihn kurz vor der Pensionierung kurzerhand entliess, um ihm die winzige Pension, die ihm dann zugestanden hätte, nicht auszuzahlen. Einer der Gründe für meinen Kirchenaustritt nach meiner Volljährigkeit und die kritische Auseinandersetzung mit Religionen im Allgemeinen.
Die Eltern meines Vaters, meine Grosseltern, habe ich nie kennengelernt. Sie starben vor meiner Geburt und wohnten in Albendorf,4 Kilometer entfernt von meinem Heimatort. Dazwischen lag die deutsch-tschechische Grenze. Schlesien war auf der anderen Seite. Sie betrieben einen Kolonialwarenhandel, wurden aber nie reich. Sowohl mein Vater als auch sein Bruder Paul mussten auswärts Arbeit und Brot verdienen. Wegen der grossen Armut starben viele an Tuberkulose. Auch die Familie meines Vaters litt unter dieser Krankheit; viele starben schon in jungen Jahren.
Meine Mutter wurde 1901 geboren. Sie erlernte das Schneiderhandwerk und brachte es bis zur Schneidermeisterin. Schon in jungen Jahren nahm sie an den kulturellen Möglichkeiten des Dorfes teil, denn sie war ausserordentlich begabt. Musik und Gesang lagen ihr so sehr, dass sie bei vielen Veranstaltungen durch ihr Können eine tragende Rolle spielte. Dadurch war sie im Dorf sehr beliebt und ihre Freunde gehörten allesamt zur Dorfprominenz. So wollte niemand verstehen, dass sie den arbeitslosen Hilfsarbeiter aus Schlesien heiratete.
Mein Vater,11 Jahre älter als meine Mutter, war bereits verheiratet und hatte drei Kinder in Hamburg. Ein Draufgänger, der zu dieser Zeit hauptsächlich vom Schmuggel lebte, eine nicht ungefährliche Verdienstmöglichkeit, denn an der Grenze wurde scharf geschossen, ab und zu gab es auch mal einen Toten im Wald. Als Soldat im Ersten Weltkrieg wurde er verwundet und mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet. Er war Obermat der Marineinfanterie (Unteroffizier) an der Westfront und hatte das grosse Glück, dieses Inferno zu überleben. Kurz nach dem Krieg heuerte er als Stuart auf einem Überseeschiff an und war auf grosser Fahrt bis nach Brasilien und Südamerika. Kein besonderes Renomé für ein so kleines Dorf, wo allein die Tatsache, dass er kein Einheimischer war, ausreichte, um ihn von der Arbeit auszuschliessen. Als meine Schwester Mira geboren wurde, noch unehelich, liess er sich in Hamburg von seiner Frau scheiden und heiratete meine Mutter. Mira starb aber schon nach wenigen Wochen an einer nicht genau festgestellten Krankheit. Es gab zwar einen Arzt im Dorf, aber es war einfach kein Geld da, um ihn zu bezahlen; die Not liess die Armen eben schneller sterben.
Meine Grossmutter, eine kleine, zierliche Person, war von einer unermüdlichen geschäftlichen Unruhe getrieben. Leider fehlten ihr die fachlichen, aber sicher auch die finanziellen Möglichkeiten, um jemals etwas Gewinnbringendes auf die Beine zu stellen. So pachtete sie ein Gasthaus im Ort und wollte dort, neben acht anderen Gasthäusern, am gastronomischen Wettlauf um die wenigen noch zahlungskräftigen Gäste teilnehmen. Das Scheitern war offensichtlich; schon nach kurzer Zeit verlor sie die Lust daran. Was blieb meiner Mutter anderes übrig? Sie übernahm die Pacht und versuchte die Gaststätte so gut es ging zu führen. Ihre sehr grosse Beliebtheit im Ort half ihr dabei; auch mein Vater hatte sein Betätigungsfeld. Bedauerlicherweise stand die gefüllte Schnapsflasche immer gut erreichbar im Regal und die damalige Moral versank manchmal im Alkoholrausch. Der Konkurs war vorprogrammiert. Drei Jahre konnten sie sich halten, dann war Schluss mit dem gastronomischen Abenteuer. Die kleine Wohnung im ersten Stock des Hauses durften wir aber behalten. Dort wurde ich geboren und verbrachte die ersten acht Jahre meines Lebens.
Im Vergleich zu heute herrschten paradiesische Zustände. Die Luft war rein, die Wälder und Felder grün. Die Natur mit ihrer überaus reichen Flora und Fauna war unser Spielplatz. Wenn ein Auto die Dorfstrasse entlang fuhr,lief das ganze Dorf zusammen. Der Bach und der angrenzende Wald waren unser täglicher Aufenthaltsort. Die Ernährung war einfach. Fleisch gab es selten, man lebte von dem, was um das Haus herum wuchs. Tomaten, Paradeiser genannt, galten schon fast als exotische Früchte.
Mein Vater erzählte oft von seinen Schiffsreisen und spielte dazu auf seiner Ziehharmonika meistens das gleiche Lied." Im Schwarzwald steht'ne Mühle". Die finanzielle Basis der Familie Schwarz war schlecht, um nicht zu sagen katastrophal. Das Licht war uns wegen Zahlungsunfähigkeit abgedreht worden; eine Petroleumlampe musste den mehr als dürftigen Komfort erhellen. Bargeld war Mangelware. Meine Mutter verdiente mit ihrer Schneiderei gerade das Nötigste zum Überleben, meist in Naturalien wie Milch, Butter, Mehl oder Kartoffeln. Mein Vater versuchte mit allen Mitteln, Arbeit zu bekommen. Er schreckte vor keiner noch so schweren Arbeit zurück, aber für ihn als Ortsfremden gab es im Ort einfach keine Möglichkeit, irgendeine Arbeit zu bekommen. So arbeitete er in seinem Heimatdorf in einer Kalkbrennerei. Nach einem halben Jahr kam er mit vielen schweren Verbrennungen am ganzen Körper ins Krankenhaus und lag dort von Kopf bis Fuss in Mullbinden eingewickelt.
1929 wurde mein Bruder Horst geboren,1931 meine Schwester Ilina. Das Elend wurde nicht weniger. Ich erinnere mich an einen Silvesterabend, als meine Mutter am Herd stand und bitterlich weinte. Es gab nur ein paar Kartoffeln, die in Scheiben geschnitten und ohne Fett auf dem Herd gebraten wurden; das war unser „Silvestermenü“.
Mein Grossvater gab mir Violinunterricht; in unserer Familie wurde musiziert. Es war die einzige Form, sich kulturell zu betätigen. Kultur fand damals im kleinen Kreis statt. Als mein Onkel Josef 1933 heiratete, sang ich in der Kirche das „Ave-Maria“. Mein Grossvater begleitete mich auf der Orgel, ich war gerade einmal 6 Jahre alt und es schien so, als ob damit damals schon die Weichen für mein späteres Leben gestellt wurden.
1933 kam Hitler im "Reich" an die Macht und in unserem kleinen Dorf änderte sich vieles. Die Tschechen wurden unfreundlicher, Grenzbefestigungen wurden gebaut und überall standen spanische Reiter mit Stacheldraht; man sprach von Krieg. An einem ersten Mai pilgerten wir über die Grenze nach Schlesien in das Städtchen Liebau. Dort hörten wir aus einem Lautsprecher Hitler sprechen. Ich verstand natürlich nicht viel davon, aber ich war beeindruckt von den Arbeitsdienstmännern, die dort stramm standen und mit ihren blank geputzten Spaten exerzierten. Natürlich auch die Soldaten an der Gulaschkanone. Nach der Hitler Rede gab es Eintopf für alle. Ein Festtag, wie ich ihn noch nicht erlebt hatte.
Parolen schwirrten durch die Köpfe der Menschen. Der Westwall wurde gebaut, Autobahnen entstanden und dafür wurden massenhaft Arbeiter gebraucht. Mein Vater meldete sich, er ging nach Pirmasens zum Westwallbau. Endlich verdiente er etwas Geld. Er schickte Pakete nach Hause mit uns völlig unbekannten Köstlichkeiten. Es ging aufwärts, dachten wir.
Damals lief eine Aktion der deutschen Reichsregierung, nach der sudetendeutsche Kinder, deren Eltern einen reichsdeutschen Pass hatten, zu Familien nach Deutschland geschickt werden konnten. Meine Mutter stellte den Antrag und er wurde positiv beschieden. Meine Ferien 1936 verbrachte ich in Recklinghausen im Rheinland. Reiche Hoteliers hatten mich aufgenommen. In dieser für mich grossen Stadt, weit weg von zu Hause, bekam ich zum ersten Mal den Eindruck einer ganz anderen Welt. Es gab ein Kaufhaus, einen Tierpark, Strassenverkehr und Geschäfte aller Art; reiche Leute mit ihren Autos in prächtigen Villen waren die Freunde meiner Gastgeber. Sechs Wochen lang lebte ich das Leben einer wohlhabenden Familie, als wäre ich dort hineingeboren worden. Wenn das Heimweh nicht so stark gewesen wäre, hätte es noch lange so weitergehen können. Aber die Zeit ging zu Ende, über die Reichshauptstadt ging es zurück in die Heimat. Hatte mich dieser Ort schon stark beeindruckt, so war Berlin einfach phänomenal. Hier zu leben, erschien mir wie ein Märchen aus einer anderen Welt.
Meine Heimat erschien mir wie ein Albtraum. Plumpsklos und ungepflasterte Strassen, Pferdefuhrwerke statt Autos und die schon bekannte Armut verstärkten den grossen Unterschied zwischen dem Schlaraffenland im Westen und der heruntergekommenen Bruchbude, in der wir lebten. Selbst die Dorfprominenz beeindruckte mich nicht mehr; der so bewunderte Radioapparat bei meiner Patentante verlor seine Faszination. In der Schule versammelten sich viele Freunde, wenn ich von meinem Ausflug erzählte. Aber der Lehrer meinte, ich solle mich lieber aufs Lernen konzentrieren, als da zu fabulieren. Ab und zu krachte mir der Rohrstock auf meinen Hintern, um dem auch Nachdruck zu verleihen. Ich war sowieso nicht der Beste in meiner Klasse, ausser in Musik, Gesang und Tschechisch waren meine Leistungen nicht hervorzuheben.
Das Jahr verging, als die Sommerferien nahten, versuchte meine Mutter wieder eine solche Reise zu organisieren und auch diesmal hatte sie Erfolg. Es ging nach Norddeutschland über Hamburg nach Dithmarschen in einen neuen Koog (Landgewinnung durch Eindeichung der Marsch und Wattlandschaft an der Elbmündung), in den Adolf Hitler Koog. Kurz vor meiner Ankunft wurde der Name von Hitler persönlich vergeben. Ausgewählte Parteimitglieder bekamen von der Regierung Haus und Grundstück zu Vorzugspreisen. Die Familie, die mich aufnahm, betrieb den einzigen Kolonialwarenladen mit Kneipe. Die Leute hatten keine Kinder und wünschten sich so sehr einen Sohn; ich war zwar nur ein schwacher Ersatz, aber sie mochten mich. Es fehlte mir an nichts. Ich wurde eingekleidet und lebte dort in meinem Reich, Strand, Angeln, Schwimmen und auch Wattwandern. Mein Heimweh plagte mich auch nicht mehr so sehr. Als die Ferien zu Ende waren, einigten sich die Pflegeeltern mit meiner Mutter, ich sollte dort bleiben und auch zur Schule gehen. So blieb ich über den Winter, während meine Mutter den Umzug nach Berlin organisierte.
Mein Vater hatte inzwischen Arbeit als Hilfsarbeiter bei einer Baufirma in Berlin gefunden. Eine Wohnung hatten wir noch nicht, aber Tante Mieze, die verwitwete Schwägerin meines Vaters, hatte noch ein Zimmer für uns frei. Mit Sack und Pack zog meine Mutter mit meinem Bruder und meiner Schwester in die Hauptstadt. Sobald sie sich dort eingelebt hatten, sollte ich nachkommen. Mein Ziehvater, Onkel Andersen, nannte ich ihn, brachte mich nach Berlin. An einem kalten Frühlingsabend kamen wir an und ich sah meine Lieben nach langer Trennung endlich wieder.
Wohnten wir in der Heimat in ärmlichen Verhältnissen, aber hier war es ein primitives, kahles und auch winziges Zimmer, in dem zu allem Überfluss unser ganzes Hab und Gut untergebracht war. Die Wohnung war schmutzig und die Wanzen liefen an den Wänden hoch und runter. Da wir uns keine eigene Wohnung leisten konnten, blieb uns nichts anderes übrig, als dieses triste Verlies als vorübergehende Bleibe anzusehen. Gott sei Dank hatte mein Vater Arbeit und auch unsere Mutter machte sich nützlich und besserte für wenig Geld die Garderobe der Hausbewohner aus. Irgendwann gelang es meiner Mutter, uns eine Wohnung im Erdgeschoss eines Nachbarhauses zu besorgen. Die Miete war so gering, dass auch wir sie bezahlen konnten. Der Grund für die Miete lag auf der Hand: Vor dem Haus war eine Endhaltestelle der Strassenbahn. Dort rangierten die Strassenbahnen unter ohrenbetäubendem Lärm, vom frühen Morgen bis spät in der Nacht. Welch ein Wunder, es gab sogar eine Toilette mit Wasserspülung. Als Badewanne diente ein Holztrog, den wir als Sitzbank benutzten, wenn er nicht gebraucht wurde.
Manchmal gingen wir auch „shoppen“, natürlich ohne etwas zu kaufen, denn das Geld war mehr als knapp. Eines Abends, es war in der Bergstraße in Neukölln gleich um die Ecke, hielten wir vor einem Radiogeschäft, dort wurde ein Radio der Marke "Volksempfänger" angeboten. Hitler hatte angeordnet, dass jeder Volksgenosse, wie die einfachen Bürger damals genannt wurden, ein Radio zu Hause haben sollte. Der Sinn war klar: Es sollte eine ständige Berieselung des Volkes mit Propaganda erreicht werden. Alle möglichen Erleichterungen bei der Abzahlung wurden angeboten; nur 3 Reichsmark im Monat mussten wir für das gute Stück bezahlen. Meine Eltern überlegten, ob wir uns das leisten könnten, und schliesslich willigte mein Vater ein. Im Triumphzug wurde dieser Inbegriff des Luxus nach Hause gebracht. Andächtig lauschten wir den Klängen, die aus dem Lautsprecher des Bakelitkastens drangen. Endlich waren wir "WER" und standen fast auf einer Stufe mit den "Reichen" unseres Heimatdorfes.
Ich fuhr wieder nach Dithmarschen, blieb dort fast ein halbes Jahr, und als ich zurückkam, sprach ich fliessend Platdütsch wie die Dithmarscher. Inzwischen waren meine Eltern in einen Neubaublock im Nordosten Berlins gezogen, eine moderne Wohnung mit eigenem Bad, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Küche, mit Grünflächen, Sandkasten für die Kinder zum Spielen in einer ruhigen Seitenstrasse. Verglichen mit unserer Wohnung in Neukölln die reinste Luxusherberge. Und das alles hat uns Hitler gebracht. Meine Eltern liessen nichts, aber auch gar nichts auf diesen Herrn kommen. Seine Reden im Radio wurden andächtig angehört, und wehe, einer von uns Kindern wagte zu stören. Auf die Juden wurde geschimpft, auf die Plutokraten vor allem in England, allen voran Churchill, das waren alles Schurken. Wen wundert's, wenn man so in bitterster Armut ein Licht am Horizont sieht, auch wenn es blutrot dahinter leuchtet. Wie alle Jungen musste ich in die Hitlerjugend. Ich bekam die Uniform geschenkt, als ich gerade 12 Jahre alt war, und marschierte im Gleichschritt und sang Nazilieder.
Meine Mutter war eine Löwin, wenn es darum ging, ihren Kindern irgendwo einen Vorteil zu verschaffen. So hörte sie im Radio, dass Jungen und Mädchen gesucht wurden, die in die Rundfunkspielschar der Hitlerjugend eintreten sollten. Als wir dort ankamen, waren etwa 300 Leute mit ihren Kindern versammelt; sie wollten alle „in den Rundfunk“, wie es hiess. Aber nur ein Dutzend sollte durch eine Prüfung mit Vorsingen ausgewählt werden. Als ich die Menge der Anwärter sah, bekam ich es mit der Angst zu tun." Mama, das schaffe ich nie. Die sind alle viel klüger, viel schöner und viel besser angezogen als ich, die können bestimmt alle singen wie die Nachtigallen, lass uns nach Hause gehen, bleib hier und wag es nicht, daneben zu singen, dein Grossvater ist ein grosser Musiker, was soll er denken?.
Als ich an der Reihe war, sang ich irgendein Volkslied. Ein Mann fragte mich, ob ich noch etwas anderes singen könnte." Na, vielleicht das Ave-Maria.“ Dann singe mal los“. Ein Pianist schlug mir den Akkord vor und ich begann vor dem ganzen Auditorium zu singen. Es muss sehr schön gewesen sein, denn meine Mutter weinte und die Leute klatschten wie bei einem Konzert. Für die anderen Jungen und Mädchen war es nur eine Vorentscheidung; ein Teil von ihnen musste noch einmal antreten. An diesem Abend entschied sich fast alles, was später mit meiner musikalischen Laufbahn zu tun hatte. Vielleicht sogar mein Leben, denn die Musik trug nicht unwesentlich dazu bei, dass ich später die Gefangenschaft gerade mal überlebte.
In der nächsten Zeit hatte ich zweimal in der Woche Dienst im Funkhaus in der Masurenallee. Die fremde Atmosphäre dort und auch die neuen Eindrücke erhoben mich. Eine besondere Uniform, die so ganz anders war als die normale Uniform der Hitlerjugend, fiel auf, wenn ich mit der S-Bahn zum Dienst fuhr.
Mein Alltag spielte sich zwischen der Schule, die mir überhaupt nicht lag, dem Dienst in der Rundfunkspielschar und am frühen Abend auf der wenig befahrenen Strasse mit den Nachbarskindern, meinem Bruder und meiner Schwester ab.
Wir träumten von einem Paddelboot. Aber das Geld dafür war in der Familienkasse nicht aufzutreiben. Mein Vater war strikt gegen eine solche Ausgabe und Mama meinte, dafür sei einfach kein Geld da. In einer Zeitungsfiliale in unserer Nähe wurden Zeitungs-austräger gesucht. Morgens und abends gab es an die 100 Zeitungen auszutragen. Etwas für Leute, denen das viele Treppensteigen nicht schwerfiel. Im Monat konnte man so etwa 30 Reichsmark verdienen. Ein magerer Lohn für das viele Treppensteigen, aber so rückte wenigstens der Traum vom eigenen Boot in greifbare Nähe. Ich organisierte diese nicht einfache Aufgabe und alle mussten mithelfen. Mein Bruder, meine Schwester und auch Freunde, die im Haus wohnten, junge Deutsche aus Brasilien. Die Hälfte des Geldes ging in unsere Familienkasse, einen Teil bekam der Hausnachbar und 5 Reichsmark blieben übrig, um die monatliche Rate für ein gebrauchtes Paddelboot zu bezahlen, das wir bei einer Gelegenheit für 30 Reichsmark gekauft hatten. So verdienten wir unser erstes eigenes Geld. Müde kamen wir abends von der Zeitungstour zurück, das Spielen auf der Strasse trat in den Hintergrund. Das Boot lag in Tegel am Tegeler See. Die Miete dort im Bootshaus war sehr gering und wir arbeiteten an den Wochen-enden mit grossem Eifer an dem Holzboot. Mutter nähte uns aus einem alten Bettlaken ein Segel, so hatten wir eine Beschäftigung und kamen nicht auf dumme Gedanken, wie unser Vater immer sagte.
Im Sommer 1939 fuhr die Rundfunkspielschar in ein Zeltlager an die Ostsee. Gesungen und gespielt wurde wenig, dafür gab es Geländespiele und militärischen Drill. Nicht zu meiner Begeisterung, aber man konnte sich auch nicht aus der Gemeinschaft ausschliessen. Im August kam der Krieg, wir erfuhren es beim Morgenappell von unserem Lagerführer. Niemand war begeistert, es herrschte eine Stimmung wie vor einem Gewitter. Die Erfolge der Wehrmacht in Polen machten es nicht besser und es hiess, die Älteren von uns sollten sich schon mal darauf vorbereiten, das Vaterland mit der Waffe zu verteidigen. Von Ehre und Ruhm war die Rede und da wir diesen Krieg sowieso gewinnen würden, wagte niemand daran zu zweifeln.
In Berlin begann man, die Keller zu Luftschutzkellern auszubauen, die Fenster mit Papierrollen zu verdunkeln und sich mit Notverpflegung einzudecken. Der Sinn all dieser Dinge wollte sich mir nicht erschliessen, wenn ich die täglichen Berichte im Radio hörte. Hitler und Goebbels sprachen vom baldigen Endsieg, wozu also all diese Anstrengungen, wenn doch alles so sicher war. In der Straßenbahn und auf der Strasse tauchten Menschen auf, die krampfhaft versuchten, einen gelben Judenstern mit der Aufschrift JUDE mit einer Zeitung zu verdecken. Ältere Juden standen manchmal vor Kindern in der Straßenbahn auf und boten ihnen ihren Platz an. Man konnte sich über all diese Dinge nicht freuen, denn wir hatten Bekannte, die Juden waren, ganz normale und nette Menschen.
Meine Eltern hingen am Lautsprecher, wenn Hitler seine Reden hielt, die immer aggressiver und bösartiger gegen seine Feinde wurden. Es wurden Schiffe versenkt und Städte in England bombardiert. Jedes Mal danach gab es Sondermeldungen im Radio, die mit lauter Fanfarenmusik eingeleitet wurden. Da alles nach Sieg aussah, kam ich gar nicht auf die Idee, dass sich das Blatt wenden könnte und besonders wir hier in der Hauptstadt Berlin Bomben auf den Kopf bekommen könnten. Meine Freundin, Edith aus dem Nachbarhaus, flüsterte mir manchmal ins Ohr, dass sie Angst hätte, weil ihre Eltern meinten, dass wir diesen Krieg verlieren würden. Wir wussten es alle, es waren Kommunisten, diese Familie G... Nur nicht darüber reden, wir wollten die netten Leute von nebenan auf keinen Fall verraten. Viel später, als der Krieg zu Ende war, hat gerade Edith viel dazu beigetragen, dass ich nach der Gefangenschaft viele Schwierigkeiten vermeiden konnte. Sie wurde Sekretärin beim Präsidenten der DDR, Wilhelm Pieck.
Es dauerte nicht lange, bis uns die ersten Bomben um die Ohren flogen. Meistens nachts heulten die Sirenen und wir mussten schnell in den Luftschutzkeller, aber wenn es dann in der Nähe einschlug, duckten wir uns und hatten Angst. Grosse Bomben, Luftminen genannt, rissen ganze Häuserblocks weg und töteten die Menschen, vor allem Frauen und Kinder, denn die Männer waren alle an der Front. Nach der Entwarnung gingen wir "Splitter suchen". Bomben und Granatsplitter wurden untereinander getauscht, je grösser der Splitter, desto wertvoller war er.10 kleine gegen einen grossen, ein Spiel mit den Helfern des Todes. Eines Nachts wurde ein Flugzeug abgeschossen und der Bomberpilot landete mit seinem Fallschirm in einem Schrebergarten ganz in unserer Nähe. Die Leute, die dort wohnten, waren so wütend, dass sie ihn umbrachten; was konnte das arme Schwein dafür; er hätte sicher lieber seine Füsse unter den heimischen Tisch gesteckt, als Städte in Schutt und Asche zu legen.
Besonders dramatisch war die Lage in Berlin. Hier konzentrierten sich die Bemühungen der Alliierten, diesem totalen Kriegsvolk der Germanen das Grauen zu lehren. Pausenlose Luftangriffe zerbombten die Stadt, egal wo man wohnte. Freunde meiner Mutter aus der Heimat rieten ihr, doch wenigstens eines ihrer Kinder zu ihnen zu schicken und so kam ich in den Sudetengau der inzwischen ins Reich "heimgeholt" worden war. In einem Dorf in der Nähe meines Geburtsortes kam ich zur Familie von Oberlehrer Mann. War ich bis dahin ein eher mittelmässiger Schüler gewesen, der gerade mal von einer Klasse in die nächste versetzt wurde, konnte es so natürlich nicht so weitergehen. Der in die Lehrerfamilie integrierte Junge aus Berlin war natürlich ein besonderes Vorbild und musste ausserordentlich sein. Schule schwänzen oder Hausaufgaben nicht machen kam nicht infrage. Ich lernte, wie es sich für ein Mitglied der Lehrerfamilie gehörte; war zwar nicht der Beste in der Schule, aber mein Zeugnis konnte sich sehen lassen. Leider wurde ich krank. Eine Lungen-Rippenfellentzündung liess mich wochenlang am Rande des Todes leben. Meine Grossmutter kam und sass viele Tage und Nächte bei mir. Sie war eine Kräuterkundige Frau und hatte für fast jede Krankheit ein Kraut, einen Umschlag oder eine Salbe, die sie selbst aus Baumharz, Arnika, Honig und wer weiss was noch für Zutaten herstellte. Als ich wieder gesund war, dauerte es noch lange, bis ich meine Kräfte wieder hatte.
Meine Mutter gab nicht auf, ihre Weitsicht liess sie nicht ruhen. Gegen den ausdrücklichen Willen meines Vaters, der absolut dagegen war, meldete sie mich an der Orchesterschule der Hochschule für Musik in Berlin an. Im Sommersemester 1941 sollte es losgehen. Doch vorher musste ich noch eine Prüfung ablegen. Viel mehr als meine Musikalität brachte ich nicht mit und mein Vater meinte, sie würden mich mit einer Tracht Prügel auf die Strasse werfen, weil ich mit meinem dürftigen Geigengekratze die Ohren der gelehrten Professoren beleidigen würde.
Obwohl meine instrumentale Darbietung nicht gerade Konzertformat hatte, bestand ich die Prüfung. Es war von vornherein klar, dass jedes Semester Prüfungen stattfinden; wer sich nicht anstrengt, fliegt raus. Meiner Mutter fuhr der Schreck in die Glieder. Das nach der strengen Meinung meines Vaters zum Fenster hinausgeworfene Geld, von dem es zu Hause doch so wenig gab, musste sich doch lohnen. Das erste Semester konnte gerade noch bezahlt werden, danach musste auf jeden Fall ein Stipendium her, denn mein Vater war nicht bereit, sein Geld für diesen Quatsch auszugeben. Musiker war für ihn kein Beruf, sondern eher ein Vergnügen. Ich sollte Geld nach Hause bringen, irgendwie, aber so schnell wie möglich.
Er ging zum Militär und seine Kommentare über seinen ältesten Sohn 2"2Bubi nannte er mich immer", klangen aus der Ferne nicht mehr ganz so beängstigend. Als Hauptfach wurde mir Fagott empfohlen. Fagottisten gäbe es nur wenige, meinte der Fagottlehrer. Streicher, Geige, Bass und Bratsche gäbe es wie Sand am Meer. Als Nebenfach nahm ich Geige und als Pflichtfach musste ich auch noch Klavier pauken, das mir nicht besonders lag.
Die wichtigste Person für mich an der Schule war Professor Glass. Er unterrichtete nicht nur Fagott an der Schule, sondern war auch erster Fagottist an der Berliner Staatsoper. Er war der Meinung, dass ich sehr begabt für dieses Instrument sei und es bestimmt zu etwas bringen würde, denn nach dem Endsieg stünde uns Deutschen die ganze Welt offen. Er war ein absolut überzeugter Nazi und lief ständig mit seinem Parteiabzeichen herum.„Guten Tag" wollte er nicht hören, "Heil Hitler" musste ich ihn begrüssen. Kein Wunder, mit meiner Mama verstand er sich von Anfang an blendend. Sie war zwar nicht in der Partei, hatte aber keinen Zweifel daran, dass die braune Partei genau das Richtige für einen Menschen ist.
Für mich war sie die beste Mutter der Welt und sehr stolz auf das Mutterkreuz, das sie vom Staat bekommen hatte. Sie wollte mich zum Aushängeschild der Familie machen. So sehr sie mich auch liebt, von dem Moment an, als ich in die Orchesterschule kam, hatte ich keine Ruhe mehr. Ich musste üben, bis mir die Musik aus Hals, Nase und Ohren herauskam. Bei der Semesterprüfung musste ich unter den zehn Besten sein, denn nur die bekamen ein Stipendium. Mein Vater hatte mir klar zu verstehen gegeben, wenn ich kein Stipendium bekäme, müsste ich die Schule verlassen. Meine Mutter sagte es meinem Lehrer, der wiederum wollte, auf keinen Fall einen aus seiner Fagott klasse verlieren; sie waren sich einig, auch wenn ich Blut und Wasser geschwitzt habe, ich musste dadurch. Meine Mutter sperrte mich in mein Zimmer ein und da mein Tun mit Geräuschen verbunden war, konnte sie genau kontrollieren, wann ich mal eine Pause machte.
Professor Glass gab sich grosse Mühe; er wollte, dass mir das Studium bezahlt wurde und wenn er selbst noch etwas dazulegen musste. Um ehrlich zu sein, tat meine Mutter viel, um den grossen Musiker bei Laune zu halten. Da mein Vater als Kurier fast jede Woche einmal aus Belgien nach Berlin kam, brachte er immer allerlei Leckereien wie Kaffee und Tabak mit, die meine Mutter dann auf dem Schwarzmarkt verkaufte. So fiel auch manchmal etwas für den Professor ab, der zwar gut verdiente, aber wie alle anderen mit seiner Lebensmittelkarte auskommen musste. Gute Beziehungen waren in dieser Zeit alles. Mein Stipendium war gesichert, jetzt musste ich nur noch fleissig sein und in meinen Leistungen nicht nachlassen.
Mit der Rundfunkspielschar war es auch vorbei, denn in der Schule gab es das Stabsorchester der Hitlerjugend, ein Blasorchester erster Klasse. In diesem Orchester spielten die schon reiferen Jahrgänge der Schule, die alle besser waren als die Musiker in den Blasorchestern der Wehrmacht, die nicht immer diesen Beruf gelernt hatten.
Sobald ich mein Instrument gut beherrschte, kam ich in den schneidigen Haufen. Drill und Exerzieren im Musikchor, Parademarsch,Naziblasmusik, darauf kam es an. Es war ein Muss, dabei zu sein, wehe dem, der versuchte, sich zu drücken. Kapellmeister Linnemann war ein nicht gerade beliebter Mitbürger, den wir, auch wenn wir ihm nicht in Uniform begegneten, mit dem Hitlergruss zu grüssen hatten. Er war einer der wenigen Nazis, an die ich mich erinnere, der sich am Ende, nach Kriegsende, mit Frau und Kindern das Leben nahm. Mangels der immer knapper werdenden Reserven der Wehrmachtskapellen spielten wir auch damals bei jeder Gelegenheit, unter anderem im Sportpalast, wo Goebbels zum totalen Krieg aufrief. Aber auch in der Reichskanzlei bei Hitler. Der Dank, ein Händedruck vom Diktator.
Opposition gab es im Hitler-Reich nicht. Die angehenden Künstler an der Musikhochschule äusserten ihren Unmut über den militärischen Drill eher leise. Marschmusik gefiel uns nicht besonders, und nur wenige hatten die Absicht, später einmal in einem Blasorchester zu spielen. Man liebäugelte eher mit dem Jazz, der damals als "Negermusik" verpönt war. Eine kleine