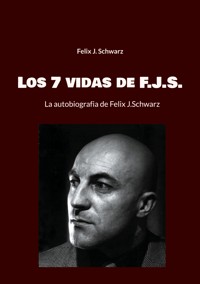Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Fünf Jahre allein an Bord der S/Y ALTAIR. Nicht um Rekorde zu brechen, sondern die Wunder dieser Welt dort zu erleben, wo man unter normalen Umständen nicht hinkommen kann. Entbehrungen und Triumph des Ankommens, damals noch mit Sextant und Seekarten. Sturm und traumhaftes Dahingleiten sind die Begleiter einer Freiheit, die so nur noch auf den Weiten des Meeres zu haben sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT.
Prolog
Wie alles begann
Abschied vom Festland
Ein Traum wird wahr
AMERIKA
Die Karibik
Der Pazifik
Der lange Trip
Polynesien
Das Korallenmeer
Indischer Ozean
Arabisches Meer
Suez Kanal
Nach Hause.
Epilog
Gewidmet meinem ältesten Sohn Peter. Er hat die Grundlage dafür geschaffen, dass ich ohne finanzielle Sorgen dieses Unternehmen beginnen und zu Ende führen konnte. Auch meine Frau, die auf ihre Weise einen wichtigen Anteil am Erfolg hatte, indem sie mein treuer Begleiter per Funk war und wann immer es ihr möglich war, mich unterwegs besuchte, danke ich. Letztlich war es meine Familie, die mir half, die zum Teil schwierigen psychologischen Probleme in der Einsamkeit des Meeres zu überstehen.
Fünf Jahre allein an Bord der „S/Y ALTAIR.“ Nicht um Rekorde zu brechen, sondern die Wunder dieser Welt dort zu erleben, wo man unter normalen Umständen nicht hinkommen kann. Entbehrungen und Triumph des Ankommens, damals noch mit Sextant und Seekarten. Sturm und traumhaftes Dahingleiten sind die Begleiter einer Freiheit, die so nur noch auf den Weiten des Meeres zu haben sind.
Die vorliegenden Aufzeichnungen waren ein Teil der Therapie, um die schweren Depressionen in den 90er Jahren, zu heilen. Diese Therapie war erfolgreich. Heute ist die Krankheit überwunden.
Prolog.
Dieses Buch soll mich an mich erinnern, soll den Zweck dieser Erlebnisse herausstellen, als das, was es für mich war, erleben, um es weiterzugeben.
Mir war das Glück nicht vergönnt, diese Erfahrungen in meiner Jugend sammeln zu können, um ein Leben lang davon Nutzen zu haben. Die Familie brauchte mich als Motor, um einen Prozess in Gang zu setzen, der heute seine Früchte trägt. Das ist der Grund, warum ich 63 Jahre alt werden musste, um so eine Reise, die in ihrer Art einmalig war, zum Abschluss zu bringen. Falls es den Anschein hat, dass ich ein besonders mutiger Mann bin, so trügt der Schein. Ich war oft von Zweifeln geplagt und wollte mehr als ein Mal das Vorhaben aufgeben. Um mich zu charakterisieren, könnte man eher meinen, dass ich ein Feigling bin, der viele Male seine Feigheit überwinden musste, um seine Reise letztendlich bis nach Hause fortzusetzen.
Wie alles begann.
Schon immer war der Wassersport schlechthin meine Freizeitbeschäftigung. Meine früheste Jugend verbrachte ich oft an dem Bach, der an unserem Haus vorbei gluckerte. Freilich waren es in erster Linie die Forellen, die mir ins Auge stachen. Gebraten waren sie eine Köstlichkeit und weil das Angeln verboten war, schmeckten sie umso besser. Der hölzerne Waschtrog unserer Mutter diente dazu, die ersten Erfahrungen mit dem nassen Element zu machen. So stakten wir, mein Bruder und ich, manchmal auch zu dritt, mit meiner kleinen Schwester als «Passagier», 10 m hinauf und wieder runter auf dem Bach.
Die Zeiten änderten sich und wir zogen nach Berlin, eine Stadt, die für den Wassersportliebhaber alles zu bieten hatte, was das Herz begehrte. Für 35 Reichsmark erstanden wir ein gebrauchtes Paddelboot. Bald merkten wir aber, dass die Paddelei nicht so ganz unser Fall war. So musste Mutters ausgedientes Bettlaken dazu dienen, das Schifflein in ein Segelboot zu verwandeln. Damit waren wir zwar noch keine Segler, aber irgendwie war es ein Anfang, ein Gefühl für den Wind zu bekommen.
Der Krieg kam und ging. Mein Bruder überlebte schwer verletzt und ich verbrachte 5 harte Jahre in russischer Gefangenschaft. Unser Paddelboot verbrannte bei einem Bombenangriff so wie auch unser gesamtes Hab und Gut. Glücklicherweise überlebten wir alle.
Nach meinem Studium, praktisch von meinem ersten sauer verdienten Geld, wurde Ausschau nach einem Boot gehalten. Mein Jugendfreund, der inzwischen mit der Tochter des Besitzers einer kleinen Bootswerft verheiratet war, besorgte mir ein Boot, welches wir «Autoboot» nannten. Es war ausgestattet mit einem 4-PS-Motor, Jahrgang 1928. Zum Starten von Hand mussten wir immer in den Bug kriechen. Die Zeit, wo der Motor uns fortbewegte und die Zeit, die wir da vorne zubrachten, hielt sich die Waage. So ging die Zeit ins Land. Meine Familie war mir wichtiger als all meine Erfolge im Showbusiness, die es mit sich brachte, dass ich in Europa ständig unterwegs war. Es wurde Zeit, sesshaft zu werden.
Ein guter Freund bot mir an, in einem seiner Betriebe die Stelle eines Geschäftsführers zu übernehmen in einem Gasthof am Ende der Welt, wie es mir vorkam, in dem schönen Fischbachau in Oberbayern, 60 km südlich von München. Meine Tätigkeit war äusserst umfangreich: Diskjockey, Kellner, Koch und Manager in einem. So hatte ich gleich die ganze Palette der Gastronomie zu erlernen. Es funktionierte nicht zuletzt deshalb, weil ich speziell im Raum München durch meine musikalische Tätigkeit recht bekannt war und daher eine Menge «Fans» zu uns kamen. Auch ehemalige Kollegen wie Fred Bertelmann, Angel Durand, Lou van Burg und viele andere kamen und machten Stimmung – umsonst.
Mein Erfolg brachte es mit sich, dass wir mehr Personal brauchten. So wurde ich entlastet und hatte mit einem Mal eine Menge Freizeit. Für meinen Tatendrang brauchte ich eine Beschäftigung. Da kam mir mein alter Traum wieder in den Sinn: der Drang nach dem Meer. Und das in alpiner Umgebung,650 Meter über dem Meeresspiegel und weit und breit kein vernünftiges Gewässer in Sicht.
Bücher wurden gewälzt und Berechnungen angestellt, auch finanzieller Art. Danach wurde Material bestellt und schon konnte es losgehen mit dem Schiffsbau, denn darum ging es. Doch halt, es fehlte noch ein Raum, in dem das 10 Meter lange und dreieinviertel Meter breite Boot gebaut werden sollte. Der einzige Raum, der sich anbot, war unsere «Fuchslochbar», die zu dieser Zeit nicht in Betrieb war. Nachdem ich die Inneneinrichtung entfernt hatte, ging das geplante Boot gerade hinein. Erst wurde eine Negativform aus Holz und Pappe gebaut. Danach wurde im Handauflage Verfahren mit Polyester und Glasfasermatte der Rumpf geformt. Wochenlang stank ich aus allen Knopflöchern nach Styrol. Meine Gäste haben es überstanden, nur wunderten sie sich so manches Mal, wie ich das Riesending aus der nur 70 cm breiten Tür herausbekommen wollte. Nach 3 Monaten war ich so weit, dass der Rumpf im Rohbau fertig war. Ich besorgte mir einen Maurer; wir brachen den gesamten Giebel des Gebäudes heraus, nahmen den Bootskörper heraus und mauerten das Gebäude wieder zu. Nach 2 Tagen war das Boot draussen und der Giebel wieder hergestellt. Alle Welt rätselte, wie ich diese Mords-Konstruktion da herausbekommen hatte.
Jetzt hatte ich also einen Bootsrumpf, der – wenn er fertig war – gerne auf grösseren Gewässern herum schippern konnte, sofern man einen entsprechenden Tümpel vor der Türe hat.
In Spanien, direkt am Mittelmeer, wo ich schon längst mein Haus hatte, könnte mein Traum in Erfüllung gehen. Gesagt – getan. Wir packten unsere Klamotten in den Schiffsrumpf. Die Bahn machte es möglich, mit einem Spezialtransport wurde das zukünftige Boot 1 500 Km nach dem Süden transportiert. Bis das Boot allerdings in seinem Element war, sollten weitere 4 Jahre vergehen, solange dauerte der Ausbau. Mit dem darauf folgenden Stapellauf und der ersten Probefahrt war ein Freizeitkapitän mehr auf dem Wasser.
Nur langsam setzte sich bei mir die Gewissheit durch, dass mit diesem Boot keine grössere Reise zu unternehmen war. Schon 50 Seemeilen über das Mittelmeer nach der Insel Ibiza nagten an den Grenzen des Machbaren. Mit der Familie machten wir einige schöne Törns an der Küste entlang. Das war’s auch schon. Mein Traum von der Weltumseglung landete wie bei so vielen in vagen, illusionären Vorstellungen. Zudem musste auch die Kasse stimmen, denn ich hatte genug damit zu tun, mir mein Leben in Spanien einzurichten.
Meine Kinder wuchsen heran und kamen in das Alter, einen Beruf zu erlernen. Für meinen Peter war klar, er wollte nicht studieren. Mit etwas Glück kam er dann bei einem alten Freund und Nachbarn in Deutschland unter. Nach anfänglichem Zögern stellte er ihn als Lehrling im Konditorhandwerk in dem berühmten Café «Winklstüberl» ein. Drei Jahre gingen schnell vorbei und ein kleiner Konditor kam aus dem fernen Lande zurück um gleich als Jung-Unternehmer einzusteigen. Es funktionierte von Anfang an und so war er mit 17 Jahren «Jefe» von zwei Angestellten in unserer kleinen Pizzeria im Ort.
Unsere Tochter wollte Sprachen erlernen ging nach London und nach Avignon als Au-pair-Mädchen. Als unser Jüngster soweit war, bekam ich auch für ihn in Deutschland eine Lehrstelle als Koch in unmittelbarer Nähe seiner bayrischen Heimat.
Irgendwann in diesen Jahren kam ein Nachbar auf die Idee, mit seinem 16-Meter-Segelschiff eine Reise um die Welt zu organisieren. Er sprach mich an, ob ich nicht Lust hätte, dabei zu sein. Meine Familie war einverstanden und ich – man kann es sich vorstellen – meinte, ein Geschenk des Himmels ist auf mich herabgekommen. Mit der Zeit allerdings erkannte ich, dass an der Geschichte auch Haken und Ungereimtheiten waren. Einige Dinge waren mir nicht ganz geheuer. Jede Menge Propaganda wurde da in Szene gesetzt. Immer war der gute Mann, der überhaupt nicht daran dachte, die Reise an Bord mitzumachen, im Vordergrund. Es entstand der Eindruck, dass er der grosse Macher mit seiner Immobilienfirma war. Die dann wirklich an Bord werkelten, waren mehr oder weniger wichtiges Beiwerk. Der Kapitän war ein Säufer und wie sich später herausstellte absolut untauglich, solch ein Unternehmen zum Erfolg zu führen. Das Schiff, in Formosa gebaut, war vom Lateralplan und der Ausstattung her einfach ungeeignet. Dafür waren einige Kinkerlitzchen an Bord, die kein ernsthafter Seemann gebraucht hätte. Hinzu kam der Verein, der die Mannschaft an Bord stellen sollte. Zusammengewürfelt waren da alle möglichen Staatsangehörigkeiten vertreten, sogar eine Köchin aus Rumänien war an Bord. Das einzige, was ich je versucht habe, von ihr zu essen, war eine Fischsuppe, die so abscheulich schmeckte, dass es einem grausen konnte. Danach war sie seekrank und wurde erst in der Karibik wieder gesehen, als sie aus Ihrer vollgekotzten Kajüte heraus kroch. Die Tatsache, dass sie die Freundin von unserem Säuferkapitän war, legitimierte sie offensichtlich zu diesem Job. Nachdem mir all diese Dinge so allmählich zum Bewusstsein gekommen waren, wollte ich kurz vor unserer Abreise schnell noch aussteigen. Mein guter Nachbar bat mich händeringend, doch dabei zu bleiben. Offensichtlich dämmerte es ihm bereits, dass von mir letztlich Wohl und Wehe der Reise abhing.
Mit dem Geldüberweisen funktionierte es auch nicht so perfekt, sodass ich mehrere Male auch noch als Finanzier meine Scheckkarte benutzen musste um Diesel und andere Dinge zu besorgen.
Unter der Bedingung, dass ich vorerst einmal über den Atlantik mitgehen werde und mich dann dort drüben in der Karibik endgültig entscheide, ob ich weiter mache, ging ich mich mit einem unguten Gefühl im Bauch an Bord. Für mich war damals schon klar, wenn der Säufer bleibt, verschwinde ich. Und so ist es dann auch gekommen. Im ersten Hafen auf der anderen Seite des Atlantiks, in Englischharbour auf Antigua, besorgte ich mir ein Flugticket und flog nach Hause. Einige Dinge, die ich auf Wunsch des Schiffseigners an Bord gelassen hatte, wie meine Hochseeangel, habe ich dann auch nie mehr wieder gesehen.
Mein Verschwinden von Bord läutete auch schon das Ende dieser Seefahrt ein. Kurze Zeit später war das Schiff verkauft und der Traum des «Alround the World» wie eine Seifenblase geplatzt.
Nur langsam setzte sich bei mir die Gewissheit durch, dass mit diesem Boot keine grössere Reise zu unternehmen war. Schon 50 Seemeilen über das Mittelmeer nach der Insel Ibiza nagten an den Grenzen des Machbaren. Mit der Familie machten wir einige schöne Törns an der Küste entlang. Das war’s auch schon. Mein Traum von der Weltumseglung landete wie bei so vielen in vagen, illusionären Vorstellungen. Zudem musste auch die Kasse stimmen, denn ich hatte genug damit zu tun, mir mein Leben in Spanien einzurichten.
Meine Kinder wuchsen heran und kamen in das Alter, einen Beruf zu erlernen. Für meinen Peter war klar, er wollte nicht studieren. Mit etwas Glück kam er dann bei einem alten Freund und Nachbarn in Deutschland unter. Nach anfänglichem Zögern stellte er ihn als Lehrling im Konditorhandwerk in dem berühmten Café «Winklstüberl» ein.
Drei Jahre gingen schnell vorbei und ein kleiner Konditor kam aus dem fernen Lande zurück, um gleich als Jungunternehmer einzusteigen. Es funktionierte von Anfang an und so war er mit 17 Jahren «Chef» von zwei Angestellten in unserer kleinen Pizzeria im Ort.
Unsere Tochter wollte Sprachen erlernen, ging nach London und nach Avignon als Au-pair-Mädchen. Als unser Jüngster so weit war, bekam ich auch für ihn in Deutschland eine Lehrstelle als Koch in unmittelbarer Nähe seiner bayrischen Heimat. Irgendwann in diesen Jahren kam ein Nachbar auf die Idee, mit seinem 16-Meter-Segelschiff eine Reise um die Welt zu organisieren. Er sprach mich an, ob ich nicht Lust hätte, dabei zu sein. Meine Familie war einverstanden und ich – man kann es sich vorstellen – meinte, ein Geschenk des Himmels ist auf mich herabgekommen.
Mit der Zeit allerdings erkannte ich, dass an der Geschichte auch Haken und Ungereimtheiten waren. Einige Dinge waren mir nicht ganz geheuer. Jede Menge Propaganda wurde da in Szene gesetzt. Immer war der gute Mann, der überhaupt nicht daran dachte, die Reise an Bord mitzumachen, im Vordergrund. Es entstand der Eindruck, dass er der grosse Macher mit seiner Immobilienfirma war. Die dann wirklich an Bord werkelten, waren mehr oder weniger wichtiges Beiwerk. Der Kapitän war ein Säufer und wie sich später herausstellte absolut untauglich, solch ein Unternehmen zum Erfolg zu führen. Das Schiff, in Formosa gebaut, war vom Lateralplan und der Ausstattung her einfach ungeeignet. Dafür waren einige Kinkerlitzchen an Bord, die kein ernsthafter Seemann gebraucht hätte. Hinzu kam der Verein, der die Mannschaft an Bord stellen sollte. Zusammengewürfelt waren da alle möglichen Staatsangehörigkeiten vertreten, sogar eine Köchin aus Rumänien war an Bord. Das einzige, was ich je versucht habe, von ihr zu essen, war eine Fischsuppe, die so abscheulich war, dass es einem grausen konnte. Danach war sie seekrank und wurde erst in der Karibik wieder gesehen, als sie aus Ihrer vollgekotzten Kajüte heraus kroch. Die Tatsache, dass sie die Freundin von unserem Säuferkapitän war, legitimierte sie offensichtlich zu diesem Job.
Nachdem mir all diese Dinge so allmählich zum Bewusstsein gekommen waren, wollte ich kurz vor unserer Abreise schnell noch aussteigen. Mein guter Nachbar bat mich händeringend, doch dabei zu bleiben. Offensichtlich dämmerte es ihm bereits, dass von mir letztlich Wohl und Wehe der Reise abhing. Mit dem Geldüberweisen funktionierte es auch nicht so perfekt, sodass ich mehrere Male auch noch als Finanzier meine Scheckkarte benutzen musste, um Diesel und andere Dinge zu besorgen.
Unter der Bedingung, dass ich vorerst einmal über den Atlantik mitgehen werde und mich dann dort drüben in der Karibik endgültig entscheide, ob ich weiter mache, ging ich mich mit einem unguten Gefühl im Bauch an Bord. Für mich war damals schon klar, wenn der Säufer bleibt, verschwinde ich. Und so ist es dann auch gekommen. Im ersten Hafen auf der anderen Seite des Atlantiks, in Englisch Harbour auf Antigua, besorgte ich mir ein Flugticket und flog nach Hause. Einige Dinge, die ich auf Wunsch des Schiffseigners an Bord gelassen hatte, wie meine Hochseeangel, habe ich dann auch nie mehr wieder gesehen.
Mein Verschwinden von Bord läutete auch schon das Ende dieser Seefahrt ein. Kurze Zeit später war das Schiff verkauft und der Traum des «Alround the World» wie eine Seifenblase geplatzt. Eines wurde mir dabei klar: So geht es nicht, man gefährdet sich und andere, wenn, wie in diesem Falle, «Landratten» die Planung übernehmen und kommerzielle Wünsche im Vordergrund stehen, Termine eingehalten werden sollen und es auch noch nichts kosten darf. Zum Fahrtensegeln braucht man Zeit … viel Zeit.
Ich sass inzwischen wieder zu Hause, ein bisschen blamiert, aber heil bis auf den «Virus», den ich mir auf dieser Reise eingefangen hatte. Jetzt erst recht wollte ich diese Weltumseglung unternehmen.
Mein Sohn Peter, der mir die Sehnsucht nach dem Meer ansah, sagte zu mir: «Vater, kaufe dir einen Kutter!» Damit meinte er, um die Dinge, die dann zu Hause ablaufen, sollte ich mir keine Sorgen machen. Er macht das schon. Nun musste ich noch meine Frau überzeugen, dass meine Motoryacht überhaupt nicht geeignet ist, um ein bisschen mehr als nur Küstenskipperei zu betreiben.
Der Zufall wollte es, als wir mit unserer Motoryacht einen Kurztrip nach Cambrils bei Tarragona übers Wochenende machten. Dort lagen wir neben meinem «Traumschiff». Es war Liebe auf den ersten Blick. Nicht dass das Schiff dem Schönheitsideal der Hafenschickeria entsprach, aber es war, wie man unter Seglern sagt, «schiffig».An Bord wohnten zwei junge Leute, die sich selber als Aussteiger bezeichneten. Sie waren im letzten Jahr so im Umkreis von 300 Meilen herumgefahren und haben auch mal einen auf die Nase bekommen. Man sah es ihnen an, die Luft war heraus und die Mühsal, auf einem kleinen Boot ihr weiteres Leben zu verbringen, nicht mehr so ganz ihr Fall. Sie waren bereit, das Schiff, die «Altair» - zu verkaufen. War ich vorher schon halb entschlossen, als ich dann im Innern des Schiffes herumkramen konnte, stellte sich heraus, dass für ein Vorhaben, wie ich es mir erträumte, ich keine bessere Wahl hätte treffen können.
Die Yacht war ausgerüstet für eine Einhand-Weltumseglung. Der Mann, der es hatte bauen lassen, war ein Ingenieur aus Österreich, der alleine rund um den Globus segeln wollte. Das Kartenmaterial alleine hat gut über 10.000 DM gekostet. Es war einfach alles nur zum los Segeln an Bord. Nicht nur, dass dieses alles ein Vermögen gekostet hat. Die Zeit, um es zu besorgen – denn vieles Zubehör war spezial angefertigt – ist nicht so einfach, «nur um die Ecke» zu bekommen. Wir waren uns schnell einig, sie wollten Bargeld und ich das Schiff. Meine Frau hatte natürlich Bedenken, denn mittlerweile legte ich mir so langsam eine ganze Flotte zu. Aber wir einigten uns, als Äquivalent bekam sie mein Versprechen, dass – wo immer ich bin, sie per Flugzeug nachkommen kann. Es war nicht nur ein Versprechen, sondern sollte über die Jahre meiner Reise hinweg hervorragend funktionieren. Beide haben davon profitiert. Die schönsten Stunden dieser langen Reise waren immer die, wenn wir die Wunder dieser Welt gemeinsam erleben durften.
Die «Altair» wurde nach einem Stern benannt, der schon von alters her bei Seefahrern seine Bedeutung hatte, weil er auch manchmal in der Dämmerung da ist, dann wenn der Horizont noch zu sehen ist und so zur stellaren Navigation tauglich ist. Heute verblasst diese echt seemännische Art der Positionsbestimmung mit der Satellitentechnik immer mehr. Der Sextant bleibt in der Regel im Schrank. Schade!
Obwohl das Schiff für meine Zwecke wie geschaffen war, verging doch noch ein ganzes Jahr, bis ich die Anker endgültig lichtete. Zu viele Dinge waren zu organisieren. Auch ich sammelte Kraft, nicht körperlicher, eher seelischer Art. Wenn ich anfing, nachzudenken, was da alles auf mich zukommen wird, konnte es einem angst und bange werden. Bücher wurden gelesen und Themen wie «Wie überlebe ich einen Orkan?» gewälzt. Wenn ich manchmal des Morgens in der Dunkelheit erwachte, war ich von Albträumen schweissgebadet. Aber was soll's? Ich konnte nicht noch einmal einen Rückzieher machen. Zu viele Leute hatten schon von meinem Vorhaben gehört und die Investition in das Segelschiff sollte auch nicht in den Wind gesetzt worden sein. Mit meiner Frau fuhr ich noch einmal in den Urlaub nach Ungarn. Dann stand der Abreisetermin fest. Es sollte der 11.11.2011 um 11 Uhr 11 sein. Das Schiff lag im Club Nautico in Villanueva (Barcelona). Als dann der Tag herankam, wurden die letzten persönlichen Sachen verladen und Lebensmittel gebunkert; meine Frau brachte mich noch zum Schiff und da noch viel Zeit bis 11 Uhr 11 übrig war, fuhr sie schon mal nach Hause.
Als dann an diesem trüben Morgen der Zeitpunkt herankam, ging alles sang- und klanglos vonstatten. Kein Mensch war dabei, wie ich mir selber die Leinen einholte, kein Winken oder «Ahoi!» von irgendeinem dienstbaren Geist im Club, so als ob ich eben mal einen Probetörn im Hafenbecken machen wollte. Ich war alleine mit mir … - Einhandsegler eben.
Als ich dann aus dem Hafen Richtung Südwesten meinen Kurs aufnahm, schaute ich noch einmal gegen Ost und sagte zu mir: «An irgendeinem fernen Tage werde ich aus dieser Richtung wieder zum Hafen hineinfahren.» Wenn sich dann der Kurs kreuzt, werde ich den Globus umrundet haben. Aber so hundertprozentig sicher war ich mir da doch auch wieder nicht.
Die erste Nacht dümpelte ich am Ebro delta vorbei. Es war feucht und kalt. Von einer Ölbohrplattform schimpfte man hinter mir her; ich war wohl zu dicht herangefahren. Als ich mir am nächsten Morgen die Seekarte genauer ansah, war das ein Sperrgebiet. Ich musste noch viel lernen. Castellon kam in Sicht und aus dem Radio hörte ich etwas von Frontdurchzug, aber vielleicht hatte ich mich auch verhört. Mein Kurs war nun weg vom Land direkt auf das Cabo de la Nao zu, dann wollte ich weiter bis Alicante.
Gegen Mittag frischte der Wind auf und ich bekam ihn immer mehr auf die Nase. Er kam direkt daher, wo ich hin wollte. Und es fing an zu blasen, wie ich es noch nicht erlebt hatte. Ich hatte das Cabo direkt vor mir. Durch das schlechte Wetter, das da aufzog, kam es mir wie zum Greifen nahe vor. Wasser brach ein, über die eleganten Windhuizen ergoss sich das salzige Nass direkt auf meinen Kartentisch und weichte meine Karten ein. Mein Funkpeilgerät bekam auch ein Bad und damit verabschiedete sich auch schon mein erstes elektronisches Spielzeug.
Es ging mir miserabel, vor allem wenn ich das Desaster in der Kajüte sah, wo Spaghetti, Marmelade und allerlei nicht Festgezurrtes meinem Fussboden einen Besuch abstatteten und dort für einen zwar gleichmässigen, aber durchaus nicht wünschenswerten Bodenbelag sorgten.
Ich bekam es mit der Angst zu tun und drehte mein Boot in den Wind. Mit dieser Wettersituation konnte man meiner Meinung nicht anders fertig werden, als vor dem „Sturm“ abzulaufen. Um Mitternacht war ich dann nass wie eine Maus, die in einen Bottich gefallen war im Hafen von Castellon. Ein Schritt vor und zwei zurück … das kann ja heiter werden!
Zwei Tage im Hafen und besseres Wetter trockneten mir die Seekarten und machten aus dem Boot und mir wieder ein präsentables Team. Der Wetterbericht war auch beruhigend, so konnte ich es wagen. Allerdings sollte der nächste Hüpfer nur bis Javea am Cabo de la Nao gehen. Prima, es ging schon besser. Als ich am Abend meinen Anker in das Hafenbecken dicht neben einem alten Fischkutter fallen liess, fühlte ich mich schon als richtiger Seemann. Am nächsten Morgen sah die Sache schon nicht mehr so gut aus. Mein Anker hatte sich in dem Gerümpel aus alten Trossen und Ankerketten des Hafens verfangen. Nach einer Stunde war ich dort, wo ich angefangen hatte, überhaupt nicht weiter. Mein schöner CQR Anker.
Ein anderer Segler, mit dem ich über Funk im Kontakt war, sagte mir, er bringt mir den Anker nach, weil er 3 Tage später in Javea vorbeischauen wollte. Ein junger Mann mit einem Schlauchboot vom Tauchcenter im Hafen versprach mir, den Anker zu bergen und ihn meinem Bootsfreund gegen eine Bergungsgebühr auszuhändigen. Ich konnte also unbesorgt weiterziehen.
Es ging an diesem Tag bis Alicante. Den Hafen kannte ich schon. Dort war ich bereits mit meinem Motorschiff und dorthin sollte auch meine Frau kommen, um mit mir ein Stück des Weges zu ziehen. Meine Kommunikation mit meinem Zuhause war ideal gelöst. Schon seit 20 Jahren hatte ich die Amateurfunk-Lizenz, beherrschte auch die Telegrafie und war in der Welt der Funkamateure bestens eingeführt. Meine Frau hatte ebenfalls die begehrte Lizenz erworben. Mit meiner Kurzwellenrichtantenne und einer Sendeleistung von über 2 kW war sie nicht zu überhören. An Bord hatte ich eine Icom Station für alle weltweiten Kurzwellenfrequenzen; auch Seefunk war möglich. So konnte ich meiner Tochter in London per Norddeich-Radio über Telefon einen Geburtstagsglückwunsch mitten vom Atlantik übersenden. Meine Frau war immer über Kurzwelle mit mir auf der Altair verbunden und kannte in der Regel meine Position. Wen wundert es, wenn ich zum Beispiel in Fiji wusste, was in Tarragona für Wetter war und was gerade zum Abendbrot gespeist wurde. Bei mir war dann gerade Frühstückszeit bei 12 Stunden Zeitunterschied.
Ferner waren da weltweit sogenannte maritim Mobil Net's Funkfreunde, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, über starke Landstationen mit Amateur funkenden Skippern in Kontakt zu treten. Eine nützliche Einrichtung, weil man da auch zum Teil sogar ausgezeichnete Wetterinfos bekam. Selbst Ersatzteile für Motoren und andere Dinge gingen über den Ozean, organisiert von Freunden, die gelegentlich sogar die Finanzierung erledigten.
Viele der Yachties hatten natürlich nicht daran gedacht, vorher eine entsprechende Amateurfunkprüfung abzulegen und sahen nun, welch günstige Gelegenheit sie da verpasst hatten.
Diese Prüfungen sind schwierig und nicht so nebenbei mal eben zu machen. Wen wundert es, wenn sich da so etliche Funkpiraten betätigten, oft verfolgt von dem Band überwachende Amateurfunk Fanatiker, die die Frequenzen «sauber» halten wollten. Ein anderer Vorteil war, wenn man ein anderes Land ansteuerte, konnte man leicht eine Verbindung zu dortigen Funkamateuren herstellen. Lief man dann in den dortigen Hafen ein, stand nicht selten der Funkfreund an der Mole und in der Regel wurde einem jeder nur erdenkliche Wunsch erfüllt. Selbstverständlich lernt man so leicht Land und Leute kennen. Ich hatte da besonderes Glück, weil ich mehrere Fremdsprachen spreche und so die Hemmschwe lle der Sprachbarriere wegfällt.
Je weiter ich nach dem Süden vorankam, umso angenehmer wurden die Temperaturen. Alicante ist eine schöne Stadt. Als meine Frau kam, verbrachten wir viele wunderbare Stunden in dem noch angenehmen Klima dieser mediterranen Hafenstadt.
Sie brachte mir allerdings auch ein Problem mit an Bord: Ihren Ausweis hatte sie in der Wohnung vergessen, weil sie glaubte, in Spanien braucht sie ihn nicht. Dabei hatte sie übersehen, dass zum Unterschied einer Landreise Häfen immer unter besonderer Kontrolle sind. Läuft man einen Hafen von See aus an, kann man theoretisch aus dem nächsten Hafen kommen oder direkt über See aus der Türkei oder Tunesien. Möglicherweise mit einer Tonne Schmuggelware an Bord … Klar, dass die Zollfahndung und die Polizei wissen will, wer da ein- und ausfährt. So hatten wir Ärger und ich war heilfroh, als sie dann in Puerto Bañus per Bahn in Richtung Heimat abdriftete. Es war kurz vor Weihnachten und ich hatte sowieso vor, über die Festtage bei meiner Familie zu Hause zu sein. So war die Trennung nur kurz. Mein Schiff «parkte» ich in Estepona im Yachthafen. So richtig fühlte ich mich auch noch nicht als Seebär, waren wir doch immer in Landsichtweite die Küste entlanggefahren. Navigation wurde da noch kleingeschrieben und die Sache mit dem Sextanten vorläufig hinausgeschoben, weil ich einen ungeheuren Respekt vor dem Ding hatte. Übrigens, ein exzellentes Exemplar bester deutscher Wertarbeit, ein «Cassen und Plath», dazu eine genau gehende elektronische Digitaluhr, die allerdings als Erstes wegen der zunehmenden Feuchtigkeit ihren Geist aufgeben sollte.
Wieder zurück von dem Weihnachttrip ging es nun ernsthaft auf grosse Fahrt. Von Estepona waren es nur wenige Meilen nach Alceciras/Gibraltar. Den Ernst der Lage begreift man in der Regel erst dann, wenn man buchstäblich auf die Nase fällt. Meine Automatik lenkt und der Skipper hängt am Funkgerät unten in der Kabine. Bei dem schwachen Wind hatte ich alles, was an Segeltuch da war, an den Mast gehängt. Hinterher kamen auch die hämisch gutgemeinten Ratschläge. Jeder wusste, dass man dort, unterhalb des Gibraltar-Felsens, vorsichtig sein sollte. Fallwinde drückten meine Saling auf das Wasser und da, wo eben noch die Bordwand war, befand sich der Fussboden. Wie ein Stehaufmännchen richtete sich das Boot wieder auf, als ob nichts gewesen wäre.
Nachdem mein erster Schreck verflogen war und ich dem Schöpfer gedankt hatte, wusste ich wenigstens, dass meine Lastverteilung richtig dimensioniert war und ich auch weiterhin damit rechnen konnte – zumindest vor einem Überkopfgehen – einigermassen sicher zu sein. In Alceciras wartete ich dann auf meinen Bootsfreund Walter, der mir den Anker mitbringen wollte. Die Firma in Javea existierte gar nicht und der Anker war «perdue», welch ein Desaster!
Abschied vom Festland
Alceciras, eine Stadt zwischen Afrika und Europa, die nördlichste Stadt in Afrika oder die südlichste Europas. Hier kommen die Ferrys über die Strasse von Gibraltar und schütten dunkelhäutige Menschen aus. Von Tanger kommen sie weiter aus dem afrikanischen Inland oder aus den Enklaven Ceuta oder Melilla. Viele dieser Leute verteilen sich über ganz Europa oder arbeiten als billige Arbeitskräfte in der spanischen Landwirtschaft.
Im kleinen Yachthafen liegen die Fahrtensegler dicht an dicht, bis sie dann meistens Richtung Westen ziehen. Die Hafenpolizei sorgt schon dafür, dass der Aufenthalt nicht zu lange dauert. Anders als im gegenüberliegenden Gibraltar, wo in den dortigen Marinas schon so mancher Weltumseglungs-Traum sein Ende gefunden hat. Wer weiss, warum sich ausgerechnet dort all jene versammeln, denen der Mut oder auch die Lust fehlt, nun doch endlich die Leinen zu kappen, um die lange Dünung des Atlantiks unter den Hintern zu bekommen.
Mein Freund Walter, der mit seiner S/Y «YIN YAN» inzwischen neben mir lag, hatte jedenfalls nicht vor, hier zu bleiben. Er wollte so eben mal um die Huk nach Tarifa, um von dort den Absprung auf die Kanaren zu startenTarifa ist berüchtigt für Wind und Dünung, die auch im Hafen für Bewegung sorgt und das gewaltig. Nicht umsonst haben die erfahrenen Fischer dieses Städtchens ihre Fischerboote in verschliessbaren Boxen hoch auf der Mole untergebracht. Walter wusste sicher nichts davon. Mit einem total demolierten Schiff und einem Loch im Bug kam er zerknirscht zwei Tage später wieder zurück. Bis alles wieder gerichtet war, sollten drei Monate vergehen. Fast hatte es den Anschein, als wollte er sich um einen Dauerliegeplatz bemühen. Über Funk wurde er schon gehänselt, dass ihm der Bürgermeister die Ehrenbürgerschaft verleihen würde.
Irgendwann legte er dann doch ab, wir sahen uns später auf Gran Canaria. Für ihn endete die Weltumseglung in Argentinien, er hatte die Lust verloren. Schade, dass die vielen Karten, die er vor Antritt der Reise hatte drucken lassen, mit seiner Route um die Welt, dann wahrscheinlich in irgendeinem Papierkorb endeten. Ich nutzte die Tage, um mich mit dem Sextanten zu beschäftigen. Nach drei Tagen war mir so einigermassen klar, worum es da ging. Aber sicher war ich mir da noch nicht. Bis nach Madeira werde ich es wohl schaffen, sagte ich mir in meinem grenzenlosen Optimismus. Dann sind es nur noch 200 Meilen bis nach Teneriffa. Dort kann ich mir immer noch einen Satelliten Navigator, der gerade in dieser Zeit in Mode kam, zulegen. Die Strasse von Gibraltar ist berüchtigt durch seine Tiden, Ströme und das ständig ins Mittelmeer fliessende Atlantikwasser. Es kommt daher, weil im Mittelmeer mehr Wasser verdunstet als durch Regen und Flüsse als Ausgleich hineingelangt. Besondere Tabellen geben die Situation zu jeder Zeit an. Für einen Segler, mit seinem üblicherweise schwachen Motor, ist es ein Muss, sich damit zu beschäftigen, weil man gegen diese zum Teil sehr starke Strömung keine Chance hat.
Ich machte mich an einem besonders schönen Tag auf den Weg. Dank meiner Tabellen klappte es besser, als ich gedacht hatte; gegen Mitternacht passierte ich den Leuchtturm von Tanger und mein Schifflein spürte zum ersten Mal den Atlantik; hohe weiche Dünung empfing mich im Golf von Cadiz. Zu meinem Leidwesen befand ich mich in einem der fischreichsten Gewässer Europas. Massenhafte Fischer und ich da mitten mang.es dauerte Stunden, bis ich da durch war. Mein UKW-Telefon traute ich mich gar nicht erst einzuschalten. So konnte ich wenigstens den Schimpf Kanonaden der Fischer entgehen. Irgendwie wurden dann die Lichter immer kleiner und ich war alleine in stockdunkler Nacht. An Schlaf war nicht zu denken, zu neu war für mich das Gefühl, alleine im Ozean zu schwimmen. Keinen konnte ich um Rat fragen und niemandem mitteilen, wie komisch das Gefühl im Bauch ist, welches mit dem Wort Angst nicht richtig wiedergegeben ist.
Gott sei Dank war auch keiner da, der meine ersten Gehversuche unter die Lupe nahm. Es war sicher nicht alles astreine Seemannschaft, was sich da tat. So war es auf der ganzen Reise. Eine Mischung meiner Gefühle aus Angst, Stolz und Sehnsucht nach dem Morgengrauen, welche mich immer wieder hauptsächlich in den ersten 3 Tagen nach dem Auslaufen, immer des Nachts nach einem längeren Hafenaufenthalt, heimsuchte. Deshalb waren mir auch Kurztrips von 300 bis 400 Meilen immer unangenehm. Die Seekrankheit in ihrer typischen Erscheinungsform des unfreiwilligen «Fische Fütterns» ist mir auf der Reise erspart geblieben. Manchmal hatte ich Kopfschmerzen, oftmals keinen Appetit, auch eine Art Seekrankheit.
Der Morgen kam, die Sonne ging auf und der Tagesablauf begann: Zähneputzen, waschen und rasieren; inzwischen kochte das Teewasser, Frühstücken. All diese Dinge dauern länger als am Festland oder im Hafen, je nach Wetterlage manchmal bis zu 2 Stunden. Wenn es zu arg schaukelte, landeten schon mal die Marmelade, der Zucker oder das gesamte Frühstück auf dem Fussboden. Man wird jedoch erfinderisch und mit der Zeit hatte ich diese Dinge auch bei stürmischem Wetter im Griff.
Der Kurs lautete Madeira, die grüne Insel im Atlantik. Logge und Kompass halfen mir beim Koppeln. Jetzt war es an der Zeit, den Sextanten aus seiner Kiste zu holen und den ersten Versuch zu starten. Ich muss gestehen, kein Resultat. Nach meinen Berechnungen befand ich mich irgendwo auf dem Land. Obwohl ich arge Bedenken hatte, an der Insel Madeira vorbeizufahren, beruhigte ich mich jedoch. Es fehlten immerhin noch 500 Meilen bis zum Landfall. Im Zweifel ist irgendwo im Westen Land und wenn es Amerika ist.
Das Wetter war gut, Windstärke 3 bis 4 und ruhige See. So hatte ich Zeit, mich bis zum Mittag mit meinem Problem zu beschäftigen. Ich kam nicht dahinter, wo ich was verkehrt gemacht hatte. Das nautische Jahrbuch war von diesem Jahr, sowohl Tabellen als auch die Winkelmessung stimmten einigermassen. Ich habe immer mehrere Winkel genommen und dann einen Mittelwert herausgerechnet. Wir hatten zwar auf der Uni auch höhere Mathematik und mir war der pythagoräische Lehrsatz auch heute noch geläufig – aber hier half mir das alles nichts.
Irgendwann kommt vielleicht ein Schiff vorbei und per Funk, da lacht man gerne in Segler kreisen über diese und andere Segler Witze und siehe da, schneller, als man glaubt, wird man selber zum Hauptdarsteller – also Koppelnavigation. Der nächste Tag brachte Regen und Gewitter – keine Sonne – also auch kein Astrobesteck. Irgendwie war ich heilfroh, ich hatte einen weiteren Tag Galgenfrist. Man könnte ja mal sehen, ob ein Dampfer in der Runde ist. Also Radar angeschaltet und … hallo in 5 Seemeilen Land auf dem Radarschirm! Das ist doch unmöglich! Wo bin ich bloss? Bin ich im Kreis gefahren und jetzt dicht vor der spanischen Küste? Ob der Kompass nicht funktioniert? Immerhin habe ich ein Stahlschiff. Des-Kompensation und alle möglichen Fragen stürmten auf mich ein. Der kalte Schweiss brach mir aus und ich sah mich als totalen Versager, zum Seemann einfach ungeeignet, die Geschichte an den Nagel hängen.
Inzwischen war das Land rasend schnell auf mich zugekommen. Ich stürzte an Deck und da krachte es auch schon. Eine Gewitterfront war über mir. Mein Radar hatte mich genarrt. Ab jetzt wusste ich, dass dieser Geselle auch Gewitterwolken anzeigt. Welch eine spontane Erkenntnis. In der Gebrauchsanweisung stand nichts davon. Drei Tage war ich nun auf See, die Temperaturen waren mild, obwohl es doch Januar war. Sicher ist der Golfstrom in der Nähe. Mal sehen, was die Karten dazu sagen. Jetzt schien auch wieder die Sonne. Ich kramte meinen Sextanten hervor. Oh Jubel, ich war ca. 300 SM von Gibraltar entfernt und bis zum Koppelort waren es nur 22 SM. Jetzt alles festhalten und nach dem Fehler suchen, den ich vorgestern gemacht hatte. Ich hab’s: Anstatt abzuziehen, hatte ich hinzugezogen. In den Tuamotus wäre ich auf einem Riff gestrandet.
Irgendeiner hat mir einmal gesagt: «Der Atlantik ist eine Autobahn.» Hinüber nach Amerika kommt man immer. Das wusste schon der alte Columbus, der hätte mich sicher um meinen guten Sextanten beneidet und ihn gegen eine halbe Goldladung eingetauscht. Nachts kam ein Dampfer dicht an meinen Kurs heran, ein Russe.“ Gospodin Kapitan poschalusta daite minja Koordinati, minja Sextant ni rabotait“. Scheinheiliger ging’s nimmer. Es war zwar nicht der Kapitän, sondern irgendeiner von der Wache. Aber der brauchte nur seinen Satellitennavigator abzulesen und mir war, als ob ich einen Buddel-Schampus auf einmal ausgetrunken hätte. Nur 5 SM von meinem Koppelort entfernt, 120 Meilen bis zu meinem Zielort.
Es wurde Tag ein bedeutender für mich. Zum ersten Mal könnte ich aus vollem Herzen «Land in Sicht!» rufen. Aber es dauerte noch. Man stiert zum Horizont und glaubt da etwas zu sehen. Starrt so lange, bis man leichte Umrisse erkennen kann. Aber hier war der Wunsch, etwas zu sehen, zu stark, es war eine Täuschung. Erst 2 Stunden später kommt tatsächlich Land in Sicht, undramatisch einfach so. Um Mitternacht fuhr ich in den Hafen von Funchal ein. Müde war ich und einen gewaltigen Hunger hatte ich auch. Die Anspan-nungen der letzten für mich so wichtigen Tage forderten ihr Recht. Mit diesem Sprung nach der Insel wurde mir klar, dass, wenn es nicht anders geht, ich die Reise Einhand also alleine machen kann.
Vergeblich hatte ich versucht, einen geeigneten Partner zu finden, aber die Möglichkeiten waren gering. Meine Frau kam nicht infrage. Sie war zu ängstlich und hatte erhebliche Schwierigkeiten mit der Seekrankheit. Ausserdem konnte nur sie unseren Besitz verwalten und die Verpflichtungen für die Familie regeln. Meine Kinder waren im Aufbau ihrer Existenz und mussten meine Betriebe weiterführen. Freunde, die sich für längere Zeit von ihren Geschäften frei machen konnten, waren nicht im Angebot und Fremde, die ich nicht wirklich gut kannte, kamen aus verschiedenen Gründen nicht infrage.
Im Yachthafen von Funchal – damals noch nicht ganz fertig – konnte ich im Päckchen an einer anderen Segelyacht festmachen. Nachdem mein Hunger gestillt war, kroch ich in meine Koje und schlief tief und fest, bis mich lautes Klopfen aus dem Schlaf herauskatapultierte. Die hohen Herren der Hafenbehörde wollten sehen, wer da nach Feierabend um mitternächtliche Stunde Einlass begehrte. Sie waren aber freundlich und die Verständigung klappte hervorragend. Sie sprachen Portugiesisch und ich antwortete Spanisch … No Problem.
Zu Madeira selbst ist nicht viel zu sagen: Schön, warm und billig, zudem hat die Insel einen sehr hübschen Markt. In der Fischabteilung werden hauptsächlich schwarze Schwertfische angeboten. Dieser Fisch wird aus über 1.000 Metern Wassertiefe heraufgeholt und schmeckt in reiner Butter gebraten, mit neuen Kartoffeln und Spargel angerichtet köstlich. Natürlich habe ich mir die Insel angesehen, mit dem Autobus einmal rundherum. Der Flughafen ist etwas ganz Besonderes, er liegt auf einem Hochplateau. Die Landung der Flieger ist ein Erlebnis, nur ausgesuchte, speziell geschulte Piloten bringen das Kunststück fertig, den Vogel, ohne Bruchlandung, auf dieser Handtuch grossen Piste zu landen.
Viel Zeit blieb mir nicht, meine Frau hatte schon ihren Flugschein nach Teneriffa, denn sie wollte unbedingt beim Karneval dabei sein. Eine Woche war auch genug, die Unruhe hinüber zu den Kanaren zu kommen war in mir. Die Ausklarierung ging schnell vonstatten. Auf die Frage, wann ich auslaufen will, antwortete ich mit mañana.Über Nacht kam Wind auf und es heulte in den Masten, aber auf der Comandancia waren noch zwei andere Yachten, die auch auslaufen wollten, also kann es so schlimm ja nicht kommen.
Die anderen waren früher dran. Während ich noch beim Frühstück sass, liefen beide Yachten aus, eine halbe Stunde später ich hinterher. Um die Mole herum ging’s dann auch schon los. Hohe Dünung und erheblicher Wind.
Mein Plastimo Autopilot sagte krrrrrrnirsch und hin war er. Der Ruderdruck war wohl zu viel für das zerbrechliche Ding. 400 m weiter kam der erste Kamerad wieder zurück und etwas später die andere vor mir ausgelaufene Yacht. Das Wetter…! Ich hatte mein Boot gerade auf Kurs gebracht, 2 Reffs im Gross und die kleine Foque als Vorsegel stehen. Jetzt das alles noch mal einholen und zurück in den Hafen… - niemals. An die Schaukelei am Nachmittag konnte ich mich gewöhnen. In der Nacht fuhr ein Dampfer eine Weile neben mir her, der dachte wohl, dass viellleicht mit mir etwas nicht stimmte. Als ich ihn über Kanal 16 anrief, fragte er mich, ob ich Hilfe brauche.
Der nächste Tag begann mit Regen, aber im Laufe des Tages kam die Sonne heraus und der Rest der Reise war Schönwettersegeln. Leider hatte ich Ärger mit meiner mechanischen Windsteuerung, ich kam mit dem Ding nicht zurecht. Da die elektronische Steuerung ausgefallen war, blieb mir nichts anderes übrig: Ich musste mich selber an die Pinne klemmen, ein ermüdendes Geschäft. 2 Tage und 11 Stunden brauchte ich für die 220 Meilen nach Santa Cruz de Tenerife und als ich meinen Anker in den Modder des Darsena Hafens fallen liess, war es kurz vor 1 Uhr in der Nacht.
Santa Cruz de Tenerife welch eine Stadt! Mit besonderer Bedeutung für den Fahrtensegler als Absprungbasis ideal gelegen. Von dort erwischt man den NO Passat und den günstigen Kanaren-Strom. Beide tragen dazu bei – fast so sicher wie das Amen in der Kirche – über den Atlantik zu schwimmen. Immer vorausgesetzt, man geht zum richtigen Zeitpunkt diesen Weg. In der Hurrikan-Saison ist es nicht ratsam, diesen Törn zu machen, weil die meisten tropischen Depressionen sich in der Nähe der Kapverdischen Inseln entwickeln und daran muss man vorbei. So ab Oktober versammeln sich in den grossen Häfen Las Palmas und Santa Cruz eine Menge Segelyachten, um in die Karibik oder nach Südamerika zu starten. Es sind die richtigen Orte, um bei den anderen Segelfreunden Rat einzuholen oder Erfahrungen auszutauschen. Immer trifft man solche, die diese Reise schon einmal gemacht haben. So bekommt man wertvolle Tipps und kann sich dort in Ruhe sein Reiseziel aussuchen. Auch mir ging es so. Dort entstand der Plan, nicht gleich in die Karibik zu gehen, sondern erst einmal einen Abstecher nach Brasilien zu machen. Zudem wollte meine Frau unbedingt einmal einen Karneval in Brasilien erleben, doch bis dahin war noch eine Weile Zeit.
Es war inzwischen Februar und im Juli wollte ich noch einmal nach Hause, um in der Saison im Geschäft zu helfen, denn ich hatte das meinem Jungen versprochen. Aber jetzt war erst einmal Karneval in Santa Cruz. Meine Frau kam in diesen Tagen vom Festland, um mit mir eine Zeit lang zusammen zu sein. Der Hafen selbst war sicher nicht der schönste; ganz am Ende des Fischerhafens war der Platz für uns Yachten. Dicht an dicht liegen hier die Boote. In meinem Falle dauerte es 2 Tage, ehe ich einen frei werdenden Platz ergattern konnte. Bis dahin lag ich vor Anker im Hafen. Das hat aber auch seinen Vorteil, man ist ausser Reichweite der Ankergeschirre der anderen Yachten und hat beim Einholen des Ankers keinen Ankersalat zu befürchten. Es ist keine angenehme Aufgabe, seinen Anker von Ketten und Tauen zu befreien und dabei den Nachbarn auch noch die vermeintlich festsitzenden Anker unklar zu machen, von den dicken Klumpen stinkendem Hafenmodder, der dann am Anker klebt, ganz zu schweigen. Aber bequemer ist es schon, wenn man direkt vom Schiff aus an Land entern kann. Allerdings ist es wichtig, lange Leinen zu stecken, denn der Tidenhub ist dort gewaltig. Man ankert römisch-katholisch, das heisst, Buganker und Heckleine zum Land.
Nun hat man Nachbarn aus allen Ländern der Welt, nicht nur aus Europa, sondern auch aus Asien, Australien, Amerika und Afrika; am wenigsten waren Spanier vertreten. Auch auf meiner gesamten Reise habe ich nur ein Mal Spanier aus Barcelona getroffen – unangenehme Leute, diese jedenfalls. Dann kam mit der nächsten Maschine auch schon meine Frau vom Festland herüber und wir verbrachten eine wunderbare Zeit beim Karneval.
Nun bin ich nicht gerade ein Freund rheinischer Fröhlichkeit, mit Helau und Alaaf, aber dieser fröhliche Karneval dort begeisterte mich, hatte ich doch ausser der in Deutschland und anderen Ländern üblichen Klamotten-Fröhlichkeit nichts Derartiges bislang zu Gesicht bekommen. Um den Karnevalszug besser verfolgen zu können, kletterte ich zusammen mit ungefähr 20 anderen Männern auf eine Baubude; dieses Gewicht wollten die Balken nicht tragen. Mit einem gewaltigen Krach stürzte der Logenplatz ein. Passiert ist, Gott sei Dank, nichts.
Wir genossen die Wärme im Februar und die darauf folgenden Monate. Auch sahen wir uns die Nachbarinseln Fuerteventura und Gran Canaria, La Palma und Gomera an. Dann flog meine Frau wieder nach Hause und ich bereitete mein Boot darauf vor, über den Sommer in einem sicheren Hafen versorgt zu sein.
M In Corralejo am nördlichsten Zipfel von Fuerteventura fand ich ein ruhiges Plätzchen und (Funk-)Freunde, die aufpassten; nach meiner Rückkehr von zu Hause wollte ich mich dann endgültig auf die Socken machen. Wieder zurück auf Fuerteventura, fand ich mein Schiff fast unversehrt vor. Eine Kleinigkeit aber sollte mich noch vor grössere Probleme stellen. Irgendwie war es einer Ratte gelungen, sich an Bord einzunisten; die untrügbaren Spuren von Rattenkot waren überall zu sehen. Freilich zu hören und zusehen war am Tage noch nichts. Nachts aber liess mich das Rattenvieh nicht mehr schlafen; ich glaube, ihr bevorzugter Aufenthaltsort war in der Gegend meines Kopfkissens. Vier Tage ging das so dahin, dabei kam ich kaum zum Schlafen. Das Tier war so gross, dass es die Rattenfalle, die ich sofort aufstellte, in der Nacht durch die Gegend zog und sich daraus befreite. Es schepperte gewaltig und die Ratte hatte ich immer noch nicht. Ein zweites Mal, das konnte ich mir ausrechnen, ging sie bestimmt nicht da hinein. Also musste ich mir etwas anderes einfallen lassen.
Meine Schrotflinte hatte ich mir schon zurechtgelegt; zusammen mit der Taschenlampe wollte ich der Ratte den Garaus machen. In der vierten Nacht, so gegen 5 Uhr morgens, hörte ich sie wieder nach etwas Essbarem suchen. Alle Lebensmittel hatte ich ausser Bord gebracht, sodass mein Mitbewohner langsam Hunger bekommen musste. Ich schlich mich also vorsichtig aus meiner Schlafkoje im Vorschiff in den Salon. Auf den ersten Blick sah ich nichts, aber dann entdeckte ich sie in meiner unmittelbaren Nähe auf der Sofalehne. Geblendet von meiner Taschenlampe verharrte sie regungslos vor mir. Jetzt das Gewehr nehmen, und die Ratte ist weg, schoss es mir durch den Kopf. Alle Mühe wäre umsonst gewesen. Also schlug ich mit der Taschenlampe so stark zu, dass diese kaputtging und nicht mehr leuchtete. Jetzt machte ich das Kabinenlicht an und sah den Nager auf dem Fussboden betäubt, aber nicht tot. Der Rest war einfach: Mit dem Stumpf der Taschenlampe veranstaltete ich ein Schlachtefest. Dann hing ich sie am Schwanz an den Grossbaum … Ich war das Biest los! Inzwischen hatte sich die Story bei den anderen Yachties im Hafen herumgesprochen und jeder sollte sehen, dass ich den Plagegeist erledigt hatte.
Es wurde Herbst und so langsam trudelten die Blauwassersegler in diesen Gefilden ein. November bis Januar ist die Zeit, in der man die günstigen Passatwinde erhofft. Es ist die Zeit der Fahrtensegler, die die Sehnsucht über den Atlantik treibt. Meine Frau kam auch noch einmal, um Abschied zu nehmen, bevor ich auf die lange Reise ging. Ich wollte über den Äquator nach Süden, Brasilien war mein Ziel. Freunde hatten mir Wunderdinge über dieses Land erzählt.
Der “Saloon” der Altair.
Ein Traum wird wahr.
In Corralejo traf ich einen Ungarn, der erst einmal über den Atlantik wollte. Er kam bis zu den Kapverdischen Inseln. Welch Gründe er auch immer hatte, so richtig schlau bin ich aus seinen Erzählungen nicht geworden. Jedenfalls hat er von dort aus die Rückreise angetreten und ist unter allergrössten Schwierigkeiten gegen Wind und Strom zurück nach Teneriffa und später dann nach Fuerteventura gesegelt. Er war, wie man so schön sagt, fix und fertig. Sein Schiff wollte er auf irgendeine Weise loswerden – aus dem Traum.
Jetzt, wo ich so vor dem Passatwind dahin segele.es rauscht mit achterlichen Winden nur so dahin, fange ich an zu begreifen, was der Arme da durchgemacht haben muss. Diesen Wind möchte ich nun um Gotteswillen nicht gegen mich haben. Zu unerfahren und als Einhandsegler komplett unbeholfen ist man nach den paar Seemeilen im Atlantik. Vielleicht hat ihn die Panik gepackt, wenn er daran dachte, den Hüpfer über den Atlantik nicht 800 wie nach den Kapverden, sondern gute 2.000 Meilen durchstehen zu müssen – das alleine und mit dem klapprigen «Plastikeimer», den er sein Eigentum nannte. Wahrscheinlich hat er es richtig gemacht, er hatte es jedenfalls versucht.
Wenn man so auf der Darsena in Santa Cruz (Teneriffa) mit anderen Yachties ins Gespräch kommt, gibt es eine grosse Menge – möglicherweise die Mehrzahl – die den Globus ganz nehmen wollen. Am Ende meiner Reise kann ich nur in den Refrain einstimmen: «Wo sind sie geblieben?» Gibraltar, die Kanaren, Kapverden und die Karibik sind so die Aussteigeetappen. Jeder der Dortgebliebenen singt sein Lied. Einer sagte gar: Mir gefällt’s hier so gut, nahm sich ein Flugticket und flog nach Tahiti.
Er meinte meinte dann, dort ist es auch nicht anders. Hier werden mal wieder Äpfel mit Birnen verglichen, beide schmecken irgendwie süss. Um Kokospalmen zu sehen und aus deren grünen Früchten den köstlichen Saft zu schlürfen, braucht man nicht in die Südsee zu segeln. Die gibt’s schon in Point a Pitre oder ebenso in Martinique. Es ist die Perversion des Leidens und der oftmals schmerzhaften Höhepunkte, die Ungewissheit des Ankommens, die Entbehrung, die Erfahrungen und so vieles mehr, was uns von einer Luxussuite auf einem Musikdampfer trennt.
Ich habe keinen Neid auf die Gold betressten Smoking Schiffer auf den Luxuslinern oder den unter Billigflaggen fahrenden Seelenverkäufern mit ihrer noch billigeren Besatzung und dem Drittweltpatent des Skippers. Umgekehrt bin ich mir nicht so sicher, ob diese Herren uns überhaupt mögen. Gelegentlich hörte man über UKW nicht immer nur freundliche Konversationen, manchmal bekam man auch nicht unbedingt Zivilisiertes zu hören. Ich sehe darüber hinweg, weil bisweilen der Duft von Alkoholika so nebenbei mit durch schepperte.
Ein Kapitän, der mir in mein Bordbuch eine Widmung gönnte und mich zwar in Gänsefüsschen, aber immerhin als «Kollegen» bezeichnete, konnte mir auf meine Frage, welchen Sextanten er denn nun an Bord habe – ich meinte die Herstellerfirma – keine Antwort geben. Wer weiss, wie viele Jahre er so ein Ding schon nicht in der Hand hatte. Dafür konnte er aber mit einer blitzsauberen Elektronik aufwarten – alles vom Feinsten und für die Reserve bei Ausfall eine Reserve und noch eine Reserve usw.
Wo sind sie alle geblieben, die richtigen Seeleute? Bis Fiji habe ich wenigstens durchgehalten und mich von hochfrequenter Navigation via Satellit zurückgehalten. Dann erlag ich der Verlockung und legte mir auch so einen modernen Satnav zu.
Einen gewaltigen «Bammel» hatte ich vor der Torres Strasse, diesem Prüfstein präziser Navigation. Warum sollte ich unnütz mein Leben in Gefahr bringen, wenn es auch anders geht? So kaufte ich mir nach dem 180ten dann das bequeme Ding – natürlich mit dem Versprechen für mich auch weiterhin die Sterne zu schießen........nicht eingehalten.
Kein Wunder, bei so viel Himmel und Wasser um einen herum denkt man an Gott und alle Welt. An Bord dann immer das gleichmässige Ritual. Der Tagesablauf wird zum Klischee, ob man will oder nicht. Hier war ich noch am Anfang meiner Reise und doch gab es auch da schon Bewegungsabläufe, die immer gleich waren.
Kaum einen Sonnenaufgang habe ich verpasst und immer war ich «an Deck», wenn die Sonne unterging. Anfangs bastelte ich mir Voraussagen für kommendes Wetter zurecht, später merkte ich dann, dass es einfach anders ist als an Land, wo die Bauernregeln vielleicht noch stimmen, auf See aber komplett versagen. Die Wolken, das Barometer oder lautes Knacken in der Kurzwellenanlage sagen da schon mehr aus; Gewitterfronten machten mich anfangs ängstlich, später sorgte ich mich weniger darum.
Am Beginn meiner Reise geriet ich schon mal in Panik, wenn der Wind in einer durchziehenden örtlichen Front mit einem Mal von vorne kam. Später machte ich mir darüber keine Gedanken mehr. Man segelt halt einmal im Kreise herum und verliert vielleicht eine halbe Stunde. Die Selbststeueranlage – der Windpilot – macht das schon. Die Segel hängt man dann besser eher Mini als Maxi in den Wind.
Das Wetter auf dieser Strecke war nicht nur schön. Bisweilen blies es fast zu kräftig und riesige Wellen surften da schräg von Achtern auf meine Nussschale zu. Solange der Wind bläst, ist alles OK, aber wehe, er lässt nach. In der nachfolgenden Dünung gibt es einen Eiertanz, der vorerst einmal mein Frühstück auf dem Boden platzierte. Wenn ich fluche, dann meistens in Russisch – in der Hoffnung, der liebe Gott versteht diese Sprache nicht. Eine Woche ging vorbei und irgendwann an einem wunderschönen Morgen – der Wind war verschwunden – kam die Silhouette einer Insel in Sicht. In Anbetracht der Nähe zur nächsten Bunkerstation ging’s flott voran mit Dieselwind. Die Kapverden waren erreicht.
Mindelo auf Sao Vicente war mir schon bekannt. Auf meinem ersten Atlantiktrip liefen wir dort ein. Das armselige Nest hatte wenigstens eine gute Bäckerei, wo man des Morgens frisches Brot bekommen konnte.
Den Emigration Officer kannte ich schon. Bei ihm bekam man – zum Wucherpreis, die kapverdische Gastflagge. Ein Muss, sonst schmort man im eigenen Saft, bevor man an Land darf. Dieses Mal hatte ich auch sonst noch einige Kleinigkeiten für das «Empfangskomitee» dabei, damit sie den Felix in Frieden lassen.
Man kann das Schiff nicht alleine im Hafen lassen. Das heisst, man könnte schon, aber eine Horde Jugendlicher betätigt sich als Minimafia und «bewacht» die Schiffe, damit nichts gestohlen wird – eine immer wiederkehrende Absahnerei, die in den armen tropischen Ländern sozusagen als Entree zu verstehen ist. Man tut gut daran, immer etwas Kleingeld für solche Zwecke in der Tasche zu haben, will man nicht erhebliche Schwierigkeiten in Kauf nehmen.
Meine Waffen brauchte ich nicht abzugeben. Eines Nachts – inzwischen hatte ich mich vor Anker gelegt, nachdem ich schon in die Koje gekrochen war – hörte ich leise tapsende Schritte an Bord. Mein Schrotgewehr hatte ich mit grobem Schrot geladen, für alle Fälle lag es griffbereit bei mir. Langsam und geräuschlos schlich ich mich aus dem Bett und pirschte mich an die halb geöffnete Einstiegsluke heran. Draussen war es stockdunkel. Drei Meter vor mir bewegte sich ein Schatten, da polterte ich los: «Hands up and stay where you are!» Die Gestalt erstarrte und fing an zu jammern. Er suche Arbeit ...und das um Mitternacht.
Spanisch sagte ich ihm, dass ich ihn um ein Haar erschossen hätte, er soll sich sofort von Bord scheren, sonst knallt es …Katapluff und weg war er, schwimmen konnte er jedenfalls. Als ich mich am nächsten Tag beim Hafenamt beschwerte, sagte man mir, ich solle ihnen ja keinen Ärger machen. Wenn ich schon einen umlege, soll ich ihn wenigstens mitnehmen und irgendwo weit draussen im Meer versenken. So hart sind dort die Bräuche.
Nebenan lag eine argentinische Segelyacht; zwei junge Leute waren an Bord, gerade frisch verheiratet. Leonardo hat den Törn sozusagen als Heiratskreuzfahrt nach Spanien gemacht. Maria aus Madrid segelte mit ihm nun in ihre neue Heimat nach Buenos Aires. Er war Amateurfunker und begeistert davon, mit mir im Funkkontakt zu bleiben. Denn wir hatten, zumindest bis Brasilien, eine gemeinsame Route.
Es nutzt alles nichts, einmal muss man Abschied nehmen und so schön war der Aufenthalt in diesem bettelarmen Land ja nun auch wieder nicht. Ich wollte ja dort nicht Wurzeln schlagen. Also Diesel und Wasser voll und ab geht es Richtung Westen. Die
Nacht davor, wie üblich, grummeln im Bauch, wird es gut gehen?
Schliesslich wurde es Nachmittag, ehe ich in See stach. Kurz vorher brachten mir zwei Fischer noch einige Seezungen. Genau genommen hatte ich gar keine Lust, auch noch damit anzufangen. Die zwei taten mir aber leid und für 3 Dollar erstand ich ungefähr ein Kilo.
Als ich dann unterwegs war und freies Wasser vor mir hatte, machte ich die Pfanne klar und bald füllte ein köstlicher Duft meine Kajüte. Was Seezunge anbetrifft: Das Beste, was ich je von dieser Fischart meinem Gaumen zugeführt habe. Noch heute habe ich den leckeren, nussartigen Geschmack auf der Zunge. Ein Hoch den beiden Fischerleuten. Dieser Genuss ist mit dem doppelten Preis auch nicht zu teuer bezahlt. Leonardo und Maria blieben noch einen weiteren Tag und folgten mir dann, aber Ihr super schnelles Schiff überholte mich nach 3 Tagen. Da ich ihnen aber keine genaue Position funken konnte, verfehlten wir uns. Von da an war Leonardo mir voraus und konnte mir schon immer das auf mich zukommende Wetter und Windsituation berichten. Bald kam auch der grosse Moment auf mich zu, wo ich über den Äquator surfte. Die Taufe dafür übernahm ich selber an mir. Schampus hatte ich leider nicht an Bord, so musste es ein Eimer Atlantikwasser tun; lauwarm rieselte es mir über den Rücken und ich war auf der südlichen Halbkugel – sofern meine Astroberechnungen stimmen. Bisweilen hatte ich manchmal noch meine Bedenken mit der Position. In den hohen Atlantikwellen schaukelte die Kim (Horizont) oft erheblich.