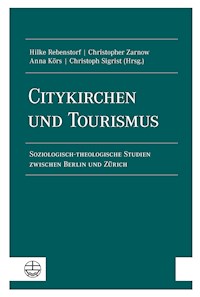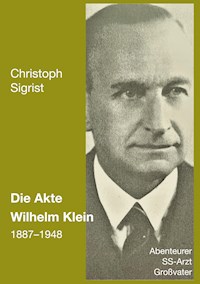
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Über den Sturmbannführer Dr. med. Wilhelm Klein wurde über Jahrzehnte geschwiegen. Dieses Buch beschreibt den Lebensweg eines Mannes, der sich immer weiter radikalisierte. Nach der Machtergreifung Hitlers machte er als Stadtmedizinalrat von Berlin Karriere und verstrickte sich in Intrigen mit der NSDAP und SS. Diese Studie über Aufstieg und Fall eines hohen SS-Funktionärs wertet erstmals Dokumente aus dem Nachlass der Nachkommen Wilhelm Kleins aus und stellt seinen Werdegang in einen historischen Zusammenhang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 221
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1 Jugenderinnerungen und Spurensuche
2 Aus großbürgerlichem Hause
3 Kriegseinsatz in Belgien (1914-16)
4 Abenteurer im Orient (1916-19)
5 Klein wird Nationalsozialist (1919-33)
6 Stadtmedizinalrat Pg. Dr. Klein „säubert das Berliner Gesundheitswesen von den Juden“ (1933-36)
7 Aufstieg und Fall des Dr. med. Wilhelm Klein
8 Siegen: In ruhigerem Fahrwasser? (1937-48)
9 Wilhelm Klein: Was war das für ein Mensch?
Biografische Daten zu Wilhelm Klein (1887-1948)
Dank
Bibliografie
Für alle Nachkommen
1. Jugenderinnerungen und Spurensuche
Ein merkwürdiger Fund
Meine erste Begegnung mit meinem Großvater Wilhelm Klein, dem Vater meiner Mutter Berthild Sigrist, geb. Klein, war reiner Zufall. Persönlich getroffen haben wir uns natürlich nie, denn mein Großvater starb im Dezember 1948. Ich kam erst acht Jahre später zur Welt.
Anfang der 1970er Jahre, ich war 13 oder 14 Jahre alt, stieß ich in einer Abstellkammer im Hause meiner Eltern auf einen Karton mit Briefen meines Großvaters. Zuerst fiel mir ein Brief Wilhelm Kleins aus Konstantinopel aus dem Jahre 1916 in die Hände. Klein erzählt in dem Brief von seinen Erlebnissen in der Stadt. Er findet Konstantinopel „wundervoll, aber nur von außen, innen ist es fabelhaft schmutzig, aber sonder Zweifel sehr malerisch.“ Von den Einwohnern der Stadt hat er nicht die beste Meinung. Denn wie jeder Reisende muss auch er sich um seine Geldangelegenheiten kümmern, und das findet er mühsam: „Papiergeld nehmen diese Lausearaber nicht.“ Dann schreibt Klein unvermittelt:
„Der Jude ist manchmal ganz nett. Tut nichts, der Jude wird verbrannt. Er kommt nach Diabekr, wo man ihm gesagt hat, dass es das übelste sei. Infolgedessen winselt er den ganzen Tag, dass er Fleckfieber bekäme und Malaria und nicht wieder käme, und ähnliche schöne Dinge. Typisch jüdisch, jämmerlich läppisch, feige. Ich behalte meine schlechte Meinung über das Pack bei.“
Damals schon merkte ich, dass mit der Wortwahl des Großvaters etwas nicht in Ordnung war. Ich begann deshalb, den Brief laut im Familienkreis vorzulesen und war auf die Reaktion gespannt. Der Vortrag kam bei meinen Eltern nicht gut an. Die Briefe wurden ohne Diskussion eingesammelt und an einen mir unbekannten Ort verbracht. Mit ihnen verschwand auch mein Großvater wieder für Jahre in der Versenkung. Aber der Samen der Neugier war gesät. Die Briefe und die Reaktion meiner Eltern verrieten, dass irgendetwas besonders gewesen sein muss im Leben meines Großvaters.
Beredtes Schweigen
Als heranwachsender Jugendlicher fiel mir auf, dass im durchaus sprechfreudigen Familienkreis der Kleins über den Vater meiner Mutter besonders konsequent geschwiegen wurde. Vielleicht lag es daran, dass er schon 1948, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, verstorben und schlicht und einfach nicht mehr da war? Oder vielleicht geschah es auch aus Rücksicht gegenüber seiner Frau Martha, unserer geliebten Omi? Auch über Marthas eigene Nazivergangenheit wurde nicht geredet. Sie überlebte ihren Mann immerhin um 31 Jahre und starb erst 1979 in Siegen. Omi sprach mit uns Enkelkindern natürlich nicht über die Vergangenheit. Die interessierte uns auch nicht. Als Kinder wollten wir mit ihr Kanaster spielen. Das tat sie mit unerschöpflicher Geduld und ließ uns immer wieder gewinnen.
Kann es sein, dass auch unsere Eltern nicht über ihre eigene Vergangenheit während des Nationalsozialismus in Deutschland mit uns Kindern sprechen wollten? Von unserer Mutter, die 1925 in Herne/ Westfalen geboren wurde, erfuhren wir eher zufällig, dass sie mit ihrer Familie mal in Rüdesheim, mal in Wiesbaden, mal in Berlin und zuletzt auch in Siegen gewohnt hatte. Wir wussten auch, dass ihr Vater Arzt gewesen war. Als Kinder dachten wir darüber nicht länger nach und brachten die häufigen Umzüge nicht mit dem wechselvollen Berufsleben ihres Vaters in Verbindung.
Auch unser Vater sprach nicht besonders häufig über seine Eltern. Aber wenn er es tat, dann mit großem Respekt und ohne erkennbare Vorbehalte. Seine beiden Eltern starben kurz hintereinander Mitte der 1950er Jahre. Von der Familie meines Vaters wussten wir Kinder vor allem, dass er zwei Brüder im Krieg verloren hatte. Einer starb 1940 in Frankreich, ein zweiter kurz darauf in jungen Jahren bei der Notlandung seiner Wehrmachtsmaschine in seiner Heimatstadt Bamberg. Ein Foto des gemeinsamen Grabes der Eltern und der beiden Brüder hing immer neben dem Schreibtisch unseres Vaters. Er selbst hatte sich in den letzten Jahren des Krieges als Soldat der Wehrmacht in Italien schwere Splitterverletzungen an den Beinen zugezogen. Ein weiterer Bruder hatte Handverletzungen davongetragen. Das war Leid genug. Wir respektierten das und fragten nicht weiter nach.
Der Fall unseres Großvaters mütterlicherseits aber schien anders gelagert zu sein. Unter uns Enkeln, also zwischen den zahlreichen Cousinen und Vettern, kursierten diverse Geschichten, von denen ich aber nicht einschätzen konnte, ob sie Wahrheit oder Legende waren. So wurde zum Beispiel hinter vorgehaltener Hand kolportiert, dass die Nazioberen Wilhelm Klein während seiner Amtszeit in Berlin wegen eines unklaren Ariernachweises seiner Frau Martha aufgefordert hätten, sich von ihr zu trennen und seine vier Töchter sterilisieren zu lassen. Daraufhin habe Klein zugunsten seiner Familie auf eine weitere Parteikarriere verzichtet und eine Stelle als Amtsarzt in Siegen angetreten. Wie wir noch sehen werden, war das allerdings nur die halbe Wahrheit. So kochte das Thema gelegentlich hoch, geriet aber immer wieder in Vergessenheit.
Der Hitler Film
Dann passierte etwas Unvorhergesehenes: 1977 kam der Film von Werner Rieb „Hitler - eine Karriere“ in die Kinos. Es war die Verfilmung der monumentalen Hitlerbiographie von Joachim C. Fest1, die vor allem auf dokumentarischen Filmaufnahmen basierte. Ich erinnere mich, dass sich auch meine Mutter diesen Film angesehen hatte und verstört wieder nach Hause kam. Denn mitten im Film kam plötzlich ihr Vater Wilhelm Klein ins Bild. 30 Jahre nach seinem Tod tauchte er unverhofft wieder auf.
Wie ich später mit Hilfe einer DVD des Films und im Abgleich mit privaten Fotos von Klein rekonstruieren konnte, tritt Klein für ein paar Sekunden in SS-Uniform und kurz danach ein weiteres Mal in einer anderen Einstellung auf. Die Filmszene zeigt im Vordergrund eine Mutter mit neugeborenem Baby, umringt von SS-Offizieren und Beamten in Zivil. Wir hören den kurzen Ausschnitt einer Rede. Ein hoher NS-Vertreter verkündet salbungsvoll: „Die Zukunft Deutschlands und Berlins ruht auf seinen erbgesunden Kindern.“
Bild 1.1: Wilhelm Klein in SS-Uniform, zweiter von rechts mit Dolch, aus: Dokumentarfilm „Hitler – eine Karriere“, 1977
Zur Erläuterung muss ich nun vorgreifen: Klein war in dieser Szene sogenannter Stadtmedizinalrat, also der Leiter des Hauptgesundheitsamtes in Berlin. Er bekleidete dieses Amt von 1933 bis 1936. Was er dort tat, wird in Werner Riebs Film nicht thematisiert. Wir werden uns in diesem Buch jedoch ausführlich damit beschäftigen.
Späte Erinnerungen
Erst als meine Mutter schon über 90 Jahre alt war, kamen wir manchmal auf ihre Familie, ihren Vater und ihre Jugend in der Nazizeit zu sprechen. Als im November 2018 zum 80. Jahrestag der Reichskristallnacht vom 9. auf den 10. November 1938 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Foto der brennenden Synagoge in Siegen veröffentlicht wurde (Bild 2.1), erzählte sie, dass ihre damalige Klassenlehrerin, eine, wie sie sagte, überzeugte Nationalsozialistin, die ganze Klasse zum Schauplatz geführt habe. Meine Mutter war damals 13 Jahre alt und ging in Siegen auf das Gymnasium. Sie machte im Alter auch keinen Hehl daraus, dass ihr Vater ein strammer Nazi gewesen sei, vermied es aber über Details zu sprechen oder den Vater zu verurteilen.
Im Oktober 2019 erzählte ich meiner Mutter von einer Reise durch die Masuren im Nordosten Polens. Meine Frau und ich waren dort im südlichen Teil des ehemaligen Ostpreußens, der heute zu Polen gehört, unterwegs. Meine Mutter erinnerte sich nun, dass sie mit Ihrer Familie Sommerferien im ostpreußischen Seebad Rauschen (heute im russischen Oblast Kaliningrad gelegen) gemacht hatte. Wie ich später herausfand, war das im Sommer 1936.
Auch die Wohnadresse der Familie in Berlin hatte meine Mutter nach über 80 Jahren noch im Kopf: Heinrichstraße, im westlichen Berliner Bezirk Schlachtensee gelegen. Nur die Hausnummer 9a hatte sie vergessen. Wenn man heute diese Adresse googelt, landet man allerdings in einem östlichen Berliner Bezirk in der Nähe des Treptower Parks. Das verwundert nicht, denn in Berlin sind über die Zeitläufte viele Straßennamen verändert worden.
Bild 2.1: Brand der Synagoge in Siegen am 8./9. November 1938 Foto: Nimbus in der FAZ vom 8.11.2018
Die geheimnisvolle jüdische Verwandte
Zurück zum Elternhaus. Im Esszimmer unserer Eltern hing bis zu deren Tod ein Ölbild einer hübschen jungen Dame. Von ihr sagte meine Mutter, sie sei Jüdin und eine entfernte Verwandte. Wer war diese Frau, und hatte sie etwas mit unserem Nazi-Großvater zu tun?
Dass meine Mutter in ihrem Arbeitszimmer immer noch ein ganzes Bündel von Briefen, Fotoalben und Akten ihres Vaters aufbewahrte, erwähnte sie in ihren Erzählungen nie. Das konnte kein Zufall sein. Meine Eltern sind in ihrem Leben unzählige Male umgezogen, und meine Mutter hat deshalb immer gerne alte Sachen großzügig weggeschmissen. Die Erinnerungen an ihren Vater aber wollte sie offenbar behalten. Vielleicht sollten die Unterlagen erst nach ihrem Tod in die Hände der Nachfahren kommen? So geschah es dann auch.
Wissenschaftliche Erkenntnisse
Seit Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich die deutsche und internationale Forschung intensiv mit der Aufarbeitung des Nationalsozialismus beschäftigt. Die Rolle der Ärzte und der Medizin fand allerdings erst relativ spät Aufmerksamkeit. Einer der wenigen Wissenschaftler, die sich schon früh mit diesem Thema befasst haben, ist der Berliner Medizinhistoriker Manfred Stürzbecher (1928-2020). Neben vielen anderen Veröffentlichungen erschien 1991 sein Aufsatz „Dr. med. Wilhelm Klein (1887-1948), Staatskommissar zur Wahrnehmung der Geschäfte des Stadtmedizinalrates (1933/34) und Stadtmedizinalrat (1934-1936)“ in „Der Bär von Berlin. Jahrbuch des Vereins für die Geschichte Berlins“. Dies ist die bislang umfassendste Biographie unseres Großvaters.
Zwanzig Jahre später, im März 2011, hielt der damalige Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Hoppe, auf dem Bundesärztetag eine denkwürdige Rede. Es ging um die Vorstellung einer von Prof. Robert Jütte et al. herausgegebenen Forschungsarbeit zum Thema Medizin und Nationalsozialismus.2 Hoppe räumte in seiner Rede ein, dass sich die deutsche Ärzteschaft „zu spät zu der Schuld von Ärzten im Nationalsozialismus bekannt hat“.3 Und er fügte hinzu: „Die Wahrheit ist: Ärzte haben in der Zeit des Nationalsozialismus Tod und Leiden von Menschen herbeigeführt, angeordnet oder gnadenlos verwaltet.“ Gleich als erstes Beispiel nannte Hoppe den Medizinalrat Dr. Wilhelm Klein.
Weitere sieben Jahre später, im Jahr 2018, erschien die umfangreiche Forschungsarbeit der Autoren Susanne Doetz und Christoph Kopke „‚und dürfen das Krankenhaus nicht mehr betreten‘. Der Ausschluss jüdischer und politisch unerwünschter Ärzte aus dem Berliner Gesundheitswesen 1933-1936“.4 In dieser Schrift dokumentieren die Autoren das Schicksal der entlassenen Ärzte. Der Leser erfährt darüber hinaus Details über die von den Nazis mit Nachdruck verfolgten Veränderungen im Berliner Gesundheitswesen und über die Rolle zeitweilig einflussreicher Akteure im NS-Machtapparat. Der Medizinalrat Dr. Wilhelm Klein war einer von ihnen.
Die Wiederentdeckung der Briefe aus Konstantinopel
Nach meiner ersten Entdeckung in den 1970er Jahren, hielt ich Anfang 2021 den schon erwähnten Brief meines Großvaters an seine Frau Martha erneut in den Händen. Er war Teil des Nachlasses meiner Mutter Berthild, der dritten Tochter von Wilhelm und Martha Klein. Berthild starb im Dezember 2020.
Jetzt erst fiel mir auf, dass dieser und weitere Briefe meines Großvaters aus dem Vorderen Orient von seiner jungen Ehefrau Martha teilweise abgetippt oder handschriftlich abgeschrieben worden waren. Mit Durchschlagpapier produzierte Martha mehrere Kopien und verteilte sie in der Verwandtschaft. Was sie sich wohl bei der Lektüre der zum Teil abenteuerlichen Schilderungen ihres Ehemannes gedacht haben mag? Vor mir lagen nun die vergilbten Abschriften, von einer angerosteten Büroklammer zusammengehalten. Die Originale, die Wilhelm an die junge Gattin schrieb, sind nicht mehr vorhanden. Diesmal schaute ich mir die Briefe sowie eine umfangreiche Fotosammlung aus dem Orient genauer an. Jetzt erst erkannte ich, dass es sich um wertvolle zeithistorische Dokumente handelte, die einen authentischen, wenn auch sehr subjektiven Blick eines deutschen Soldaten auf die Zustände an der Sinai-Front des Deutsch-Osmanischen Heeres im Ersten Weltkrieg vermitteln.
Spurensuche
Der Beginn der Spurensuche nach meinem Großvater beginnt mit seinen biografischen Daten. Wilhelm Ernst Karl Klein wurde im Januar 1887 geboren und starb im Dezember 1948 im 62. Lebensjahr. Persönliche Unterlagen liegen mir aus den Jahren des Ersten Weltkriegs 1914-18 sowie aus seinen Berliner Jahren 1933-36 aus dem Nachlass von Berthild Sigrist vor. Hinzu kommen Berichte von Kleinschen Familienforschern und -angehörigen, manche familiäre Anekdote sowie private Fotografien. Ergänzt wird dies durch zeithistorische Dokumente, Kriegsberichte von Zeitgenossen, wissenschaftliche Veröffentlichungen und Archivunterlagen.
Dieses Buch ist wie folgt gegliedert: Kapitel 2 enthält einen kurzen Rückblick auf die Familiengeschichte der Kleins. Kapitel 3 beschreibt den Einsatz Wilhelm Kleins an der Flandernfront in den ersten beiden Jahren des Ersten Weltkriegs. Kapitel 4 beschäftigt sich mit den Hintergründen des Kriegsgeschehens im Vorderen Orient und Kleins Entsendung nach Palästina von 1916 bis 1919. In Kapitel 5 schauen wir auf die Jahre der Weimarer Republik und beobachten, wie Klein sich immer weiter radikalisierte. Kapitel 6 und 7 behandeln Kleins Berliner Jahre 1933 bis 1936. Wir rekapitulieren, wie die Nazis die Gesundheitspolitik für ihre rassenideologischen Ziele missbrauchten und wie Klein in diesem System zunächst Karriere machte, später aber dann als Leiter des Berliner Hauptgesundheitsamtes scheiterte. Die Jahre von 1937 bis Kriegsende verbrachte Klein als Amtsarzt in Siegen. Diesen Lebensabschnitt zeichnen wir in Kapitel 8 nach und stellen fest, dass Klein auch in dieser Zeit aktiver Nationalsozialist blieb und sein Amt mit Engagement und Härte ausübte.
Es stellen sich viele Fragen: Was für ein Mensch war Wilhelm Klein? Wo kam er her, was trieb ihn an? Was machte ihn zum skrupellosen Nationalsozialisten? Wofür trug er Verantwortung? In Kapitel 9 fasse ich meine Schlussfolgerunen zusammen.
Im Laufe der Zeit ist mir klar geworden: Diese Studie über das Leben Wilhelm Kleins ist von unerwarteter Aktualität. Über 77 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ist die Aufarbeitung nationalsozialistischer Verbrechen noch keineswegs abgeschlossen. Lange wurde geschwiegen, vieles verschwiegen. So gerät vieles in Vergessenheit. Vielleicht braucht es zwei Generationen, um mit unbefangenem Blick zurückzuschauen, umso mehr, wenn es um die eigene Familie geht. Die Geschichte des Antisemitismus und des Fremdenhasses reicht lange zurück, setzt sich vor unseren Augen fort und ist noch lange nicht zu Ende.
1 Joachim C. Fest, Hitler, 1973
2 Jütte et al. 2011
3 Hoppe 2011
4 Doetz und Kopke 2018
2. Aus großbürgerlichem Hause
Die Familie Klein stammt aus dem Siegerland. Die Geschichte ist schnell erzählt und bedarf hier keiner langen Ausführungen, denn damit haben sich schon einige Familienforscher sachkundig beschäftigt.5 Wilhelm Ernst Karl Klein wurde am 31. Januar 1887 in Düsseldorf-Benrath als viertes und jüngstes Kind von Heinrich Adolph August Julius Klein (1849-1908) und seiner Frau Charlotte Caroline Friederike Bernadine Kreutz (18601938) geboren. Laut seiner Geburtsurkunde wurde Wilhelm „vormittags um vier ein halb Uhr“ geboren.6 Er stammte aus einem evangelischen Elternhaus und wurde am 4. April 1887 in der evangelischen Kirchengemeinde Urdenbach (bei Düsseldorf-Benrath) getauft.7 Vater Heinrich Adolph, so der Eintrag im Siegerländer Geschlechterbuch, war Gründer und Teilhaber des Blechwalzwerks Capito & Klein in (Düsseldorf-) Benrath, Rittmeister der Landwehr-Kavallerie a.D. und Teilnehmer des Krieges 1870/71.
Eisen und Stahl seit dem 16. Jahrhundert
Die OHG Capito & Klein wurde 1876 gegründet. 1916 übernahm die Stahlfirma Krupp die Aktienmehrheit. 1976, also hundert Jahre nach Gründung der Firma, wurde die Produktion von Feinblechen auf dem ursprünglichen Betriebsgelände in Benrath eingestellt. Eine Chronik der Firma Capito & Klein findet sich im nachfolgenden Infotext.
Der Vater von Wilhelm Klein, Heinrich Adolph, war das fünfte von neun Kindern des Wilhelm Jacob Klein (1811-1894) und seiner Frau Catharina Louise Heeser (1816-1884). Dieser Wilhelm Jacob war Gründer (1834) und Teilhaber der Eisengießerei und Maschinenfabrik Gebr. Klein zu Dahlbruch. Dahlbruch liegt knapp 20 km nördlich von Siegen. Wilhelms Mutter Charlotte war die Tochter des Königlich Preußischen Kommerzienrats Friedrich Jacob Adolph Kreutz aus Siegen.
Kurzum, Wilhelm Klein kam aus einer erfolgreichen Industriellenfamilie. Die Ahnengalerie der Kleins, so haben Familienforscher ermittelt, lässt sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen. Seit dieser Zeit und bis zum Ende des Ersten Weltkriegs war die Familie in der Eisen- und Stahlbearbeitung engagiert und auf vielfältige Weise mit der Fabrikantenfamilie Dresler geschäftlich und verwandtschaftlich verbunden. Schaut man sich historische Bilder aus der Familiengeschichte an, so sieht man das große Fabrikgelände der Dahlbrucher Eisengießerei mit rauchenden Schloten, aber auch herrschaftliche Häuser und Gartenlandschaften. Auf Ölgemälden und Fotografien präsentiert sich die Familie und ihre männlichen Oberhäupter in ehrwürdigen Gewändern. Die Herren sind in edlen Ausgehuniformen und stolze Träger von glitzernden Militärorden. Ein gewisser Hang zum Militarismus war der Familie Klein nicht fremd. Vielleicht gehörte das damals auch zum guten Ton.
Wilhelm Kleins ältere Geschwister, das sei der Vollständigkeit halber ergänzt, waren Margarete Charlotte Ida Julie Katharine (1881-1975), verheiratet mit Karl Schimmelbusch, Adolf Heinrich (1882-1944) und Anna Karoline Clementine, genannt „Annie“ (1884-1985). Von Margarete („Tante Grete“) gibt es die schönsten Anekdoten. Ihr berühmtester Seufzer war jener hinter der verschlossenen Schlafzimmertür: „Karl, ich kann es nicht!“ Das Geheimnis, was genau sie nicht konnte oder wollte, ist nie gelüftet worden.
Infotext: Chronik der Edelstahl-Verarbeitungsfirma Capito & Klein in Benrath8
1876: Die OHG Capito & Klein wird in Benrath gegründet.
1879: Die ersten Feinbleche verlassen das Werk an der Telleringstraße.
1896/97: Aufnahme der Produktion von Dynamo- und Transformatorenblechen. Es folgte die erste und erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Firma Fried. Krupp, Essen.
1906: Die OHG wird in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.
1908: Heinrich Klein, der Mitbegründer des Unternehmens stirbt, Paul Capito tritt in den Aufsichtsrat ein.
Ab 1909: Es wird ein Platinenwalzwerk mit elektrischem Antrieb gebaut. Es schließt sich der Bau eines Warmwalzwerkes und einer Verzinnerei zur Herstellung von Weißblechen an.
1914-1918: Durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs war eine Ausdehnung und Modernisierung des Betriebes nicht mehr möglich. Die Firma produziert ausschließlich für die Rüstungsindustrie.
1915: Die Firma Fried. Krupp, Essen, übernimmt die Mehrheit des Aktienkapitals.
1928/29: Um konkurrenzfähig zu bleiben, errichtet die Firma Capito & Klein AG - mit Geld der Firma Krupp aus Essen - ein neues Kaltwalzwerk auf dem Gelände Telleringstraße.
1929: Die Weltwirtschaftskrise und ihre Folgen sind auch in Benrath zu spüren. Nur mit Unterstützung der Firma Krupp übersteht man hier die Krise.
1939 - 1945: Das Werk blieb von Bombenangriffen weitestgehend verschont. 250 Zwangsarbeiter müssen helfen, die Produktion aufrechtzuerhalten.
Juli 1945: Die Produktion wird im bescheidenen Umfang wieder aufgenommen.
1948: Die Firma Capito & Klein hat als einzige Firma von Krupp die Erlaubnis bekommen, Edelstahl-Bleche mit dem eingetragenen Warenzeichen "Nirosta" (nichtrostender Stahl) zu versehen. Ein großer Abnehmer der Tafelbleche ist die AEG Elotherm.
1950: Im Herbst wird ein modernes Kaltwalzwerk in Betrieb genommen.
30. September 1976: Die letzten Feinbleche verlassen das Werk an der Telleringstraße, es wird für die Produktion stillgelegt.
______
Hans-Herbert Klein, Abkömmling eines verwandten Familienzweiges, fasst die Familienchronik der Kleins so zusammen: „So hatte sich in mehr als hundert Jahren ein natürlich gewachsener und auch selbstverständlicher großbürgerlicher Lebensstil entwickelt“.9
Bild 1.2: Das Wappen der Familie Klein
Das Familienwappen
Großen Wert legte Familie Klein auf ihr Wappen mit jenem gleich zweimal erscheinenden und in blau gekleideten Mann. In der rechten Hand trägt er eine doppelte blaue Weintraube. Meine Mutter trug ihr ganzes Leben lang einen Siegelring mit diesem Wappen. Der Ursprung des Wappens ist allerdings auch den Ahnenforschern weitgehend verborgen geblieben. Ein Vetter Wilhelm Kleins, Hermann Wilhelm, vertritt in einem Brief an Wilhelm vom 17. November 1934 die These, dass die Vorfahren der Kleins im 16. Jahrhundert „aus dem Neckartale“ ins Siegerland gekommen seien. Daher stammt vielleicht auch die Referenz an die lieblichen Reben. Der Vetter hat noch einen weiteren Knüller im Köcher: „Anbei sende ich Dir“, so schreibt Wilhelm seinem gleichnamigen Cousin, „den Nachweis unserer Verwandtschaft mit [Johann Wolfgang von] Goethe“. Auch dafür muss man bis ins 16. Jahrhundert zurückschauen.10
Wer war Wilhelm Ernst Karl Klein?
Über Wilhelm Ernst Karl Klein, den jüngsten Spross von Heinrich und Charlotte, erfährt man in den Familienchroniken bemerkenswert wenig. Von anderen Familienmitgliedern werden militärische Karrieren in der Wehrmacht und später in der Bundeswehr gewürdigt. Zu Wilhelm Kleins beruflichem Werdegang indes kein Wort. Wir erfahren einige Lebensdaten wie z.B. Namen und Herkunft seiner Frau Martha Heydweiller (1893-1979), einer Fabrikantentochter aus Krefeld. Festgehalten werden in den einschlägigen Chroniken auch die Namen seiner vier Töchter und deren Familien. Von Wilhelm Klein erfahren wir dagegen nur seine letzte Berufsbezeichnung: „Dr. med. Wilhelm Klein, Obermedizinalrat, Amtsarzt zu Siegen“. In den Familienannalen gibt es ein undatiertes Foto von Wilhelm in Zivil (vermutlich aus den 1940er Jahren) sowie von seiner Frau Martha, das um 1970 entstanden ist.11
Bilder 2.2 und 3.2: Wilhelm Klein (1887-1948), um 1940; Ehefrau Martha Klein (1993-1979), um 1970
Die heile Welt der Familie Heinrich Klein
Wilhelm und seine drei Geschwister wurden alle in Düsseldorf-Benrath geboren. Aufgrund des dortigen Geschäftssitzes der Fa. Capito & Klein darf man annehmen, dass die Familie ihren dauerhaften Wohnsitz in Benrath hatte. Es fällt auf, dass Wilhelm immerhin drei Gymnasien in Düsseldorf, Godesberg und Rinteln besucht hat. 1908 macht er dort, nun schon 21, auch Abitur. Wilhelms Vater starb im Dezember des gleichen Jahres, 59-jährig, in Düsseldorf. Von Benrath nach Godesberg ist es eine kleine Reise. Rinteln liegt allerdings viel weiter weg zwischen Minden und Hameln, also über 200 km von Benrath entfernt. Es könnte sein, dass Wilhelm von seinen wohlhabenden Eltern auf das weit über die Stadtgrenze hinaus bekannte humanistische „Königlich Preußische Gymnasium Ernestine“ geschickt wurde. Dort ist er vermutlich in einem Internat untergekommen. Warum wechselte Wilhelm die Schulen zunächst von Benrath nach Godesberg und später nach Rinteln? Wir wissen es nicht. Aus Familienanekdoten ist indes überliefert, dass Wilhelms Schulnoten nicht immer die besten waren.
Vor mir liegt ein sorgsam arrangiertes Foto der Familie Heinrich Klein im Garten ihres Anwesens in Düsseldorf-Benrath aus dem Jahre 1908 (Bild 4.2). Auf der Rückseite dieses Fotos hat ein Chronist vermerkt: „Familie Heinrich Klein 1908 in Düsseldorf (Inhaber der Fa. Capito und Klein, Blechwalzwerk in Düsseldorf-Reisholz). Von links: Else Klein, geb. Compes und Adolf Klein [Bruder von Wilhelm]12, Margarete Klein [Schwester], (spätere Frau Schimmelbusch) und Heinrich Klein [Vater], geb. 13.8.1849, vorne rechts: Annie [geb. Klein, Schwester] und Albrecht Spannagel mit Tochter Bärbel, Charlotte Klein, geb. Kreutz 17.9.1860 [Mutter], Wilhelm Klein (später Dr. med. Kreisarzt in Siegen).“ Wilhelm, ganz rechts im Bild, steht ein bisschen abseits. Streng gescheitelt, blickt er als einziger zur Kamera.
Nach dem Abitur studierte Wilhelm Humanmedizin. Wiederum wechselte er häufig den Studienort. Er besuchte insgesamt vier Universitäten. Zunächst ging es nach Tübingen und München, wo er das Physikum machte. Es folgten Stationen in Berlin und Kiel, wo er 1913 das Staatsexamen ablegte und promoviert wurde. Die Approbation als Arzt erhielt Wilhelm Klein am 1. Juli 1914. Da war er inzwischen 27 Jahre alt. Von Juli bis August 1914 folgte ein kurzer Aufenthalt als Stellvertretender Abteilungsarzt in der Hamburgischen Heilstätte Edmundsthal-Siemerswalde.
Die weitere Biografie Wilhelm Kleins wurde durch die kommenden Kriegsjahre bestimmt. Der Erste Weltkrieg begann am 28. Juli 1914 mit der Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien.13 Der scheinbar lokale Konflikt weitete sich blitzschnell zu einem kontinentalen Krieg aus. Schon am 1. August erklärte das deutsche Kaiserreich Russland und am 3. August 1914 Frankreich den Krieg. Auch Wilhelm ging nun an die Front.
Bild 4.2: Familie Heinrich Klein. Ganz rechts der 21 Jahre alte Wilhelm Klein mit der Hand in der Jackentasche. Fotoquelle: Irmgard Küderling
5 Dresler, H. 2006; Waldschmidt, J. um 2000; Siegerländer Geschlechterbuch 1998.
6 Auszug aus Geburtsurkunde von Wilhelm Ernst Karl Klein, ausgestellt vom Standesamt Benrath am 2.10.1926, aus: Ahnenakte Wilhelm und Martha Klein 1934-37
7 Auszug aus dem Taufregister der Evangelischen Kirchengemeinde Urdenbach, ausgestellt am 6.11.1934, ebenda
8 Chronik: Stahl in Benrath von 1876 bis heute (rp-online.de) vom 23.9.2016
9 Siegerländer Geschlechterbuch 1998, S. 174
10 Brief von Hermann Wilhelm Klein an Vetter Wilhelm Karl Klein vom 17.11.1934, aus: Ahnenakte Wilhelm und Martha Klein
11 Dresler, H. 2006, S. 146/7
12 Eckige Klammern enthalten redaktionelle Ergänzungen des Verfassers.
13 Erster Weltkrieg – Wikipedia
3. Kriegseinsatz in Belgien
Oktober 1914 bis Juli 1916: Kämpfe in Flandern
Am 17. August 1914 wurde Wilhelm zum Kriegsdienst eingezogen und nahm als Militärarzt von Oktober 1914 bis Juli 1916 an den Kämpfen in Flandern teil.14 Die Truppen des Deutschen Reichs waren zwei Monate zuvor, am Morgen des 4. August 1914, in das neutrale Belgien einmarschiert.
Der Einmarsch war ein klarer Rechtsbruch. Denn Deutschland war gemeinsam mit Österreich, Großbritannien, Frankreich und Russland seit 1830 eigentlich eine Garantiemacht für Belgiens Neutralität.15 Der irrsinnige Plan des deutschen Generalstabs: Man wollte Frankreich überraschend von Norden her angreifen, schnell besiegen und anschließend in Russland einmarschieren. Doch das ging mächtig schief. „Meine Herren, das widerspricht den Geboten des Völkerrechts", räumte selbst Reichskanzler Theobald von Bethmann-Hollweg am Tag des Einmarschs vor dem Reichstag in Berlin ein. Aber „Wir sind jetzt in der Notwehr. Und Not kennt kein Gebot".16 Doch die „Not“ ergab sich tatsächlich nur aus dem missglückten Versuch, Belgien mit einem Ultimatum zu erpressen. Darin forderte Deutschland freien Durchzug durch belgisches Gebiet. Der belgische König Albert I. ließ sich jedoch darauf nicht ein. Belgien leistete gegen die deutschen Truppen erbitterten Widerstand. Deutschland hatte sich gehörig verrechnet, denn in Reaktion auf den Einmarsch erklärte nun auch Großbritannien als Schutzmacht Belgiens Deutschland den Krieg.
Die Deutschen gingen mit großer Brutalität vor. Schon im Herbst 1914 war der größte Teil des Landes besetzt. Nur in Westflandern hielt sich der belgische Widerstand, die Front fraß sich fest.
Aus dem Nachlass Wilhelm Kleins sind aus dieser Zeit, bis auf eine wichtige Ausnahme, keine Briefe oder Tagebuchnotizen überliefert. Allerdings liegt uns eine Sammlung von Schwarzweiß-Fotos vor, die Wilhelm in Belgien aufgenommen hat.17 Auf den ersten Blick sieht alles friedlich aus. Wir sehen Bilder aus Brüssel aus den Jahren 1915/16: Auf den Straßen Pferdekutschen, Straßenbahnen, Männer mit Zylinderhüten und Frauen in langen Roben. Und wir sehen Bilder aus der unzerstörten Altstadt von Gent.
Es ist nicht überliefert, wo und wie Klein als junger Militärarzt in Flandern eingesetzt war. Aber es gibt Kriegsfotos. Auf verschiedenen Aufnahmen hat Klein Kolleginnen und Kollegen aus dem Sanitätsdienst festgehalten und die Bilder entsprechend beschriftet. Wir sehen Soldaten entspannt beim Kaffeetrinken, und wir sehen ein offenbar fröhliches Beisammensein von Krankenschwestern, die von einer Musikkapelle unterhalten werden.
Bild 1.3: Grande Place, Brüssel 1916
Bild 2.3: Boulevard Anspach, Brüssel 1916
Bild 3.3: Gent 1916: Ein Dampfschiff passiert eine bewegliche Brücke, links auf der Brücke Soldaten
Bild 4.3: Gent 1916: Altstadthäuser am Kanal
Bild 5.3: „Beim Nachmittagskaffee unter der Blutbuche zusammen mit Oberstabsarzt Dr. Schroeder“
Bild 6.3: „Kaffee mit Musik im Kriegslazarett“: Zu erkennen sind Krankenschwestern, Sanitäter und eine Musikkapelle.
Bilder 7.3 und 8.3: Zerstörte Kirche in Zonnebeke (Westflandern bei Ypern)
Bild 9.3: Zerstörte Mühle in Zonnebeke, rechts ein Soldat
Bild 10.3: Zerstörtes Haus in Flandern, unbekannter Ort
Bild 11.3: Frische Kriegsgräber an unbekanntem Ort in Flandern