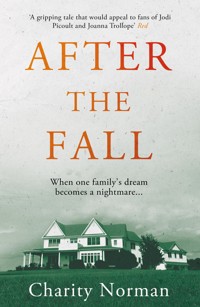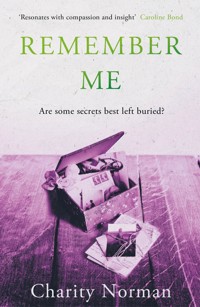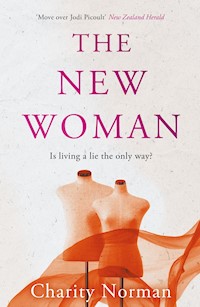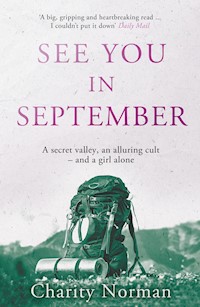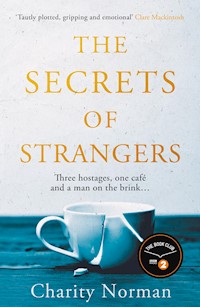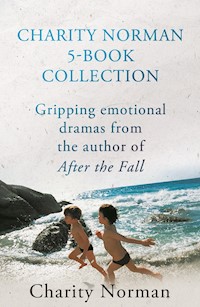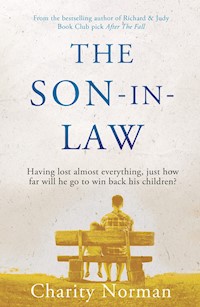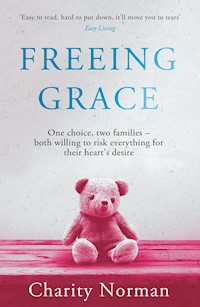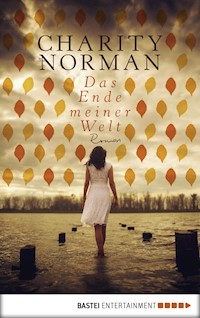4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Drei Jahre saß Joseph wegen Totschlags an seiner Frau im Gefängnis. Nach seiner Entlassung wünscht er sich nichts sehnlicher, als seine drei Kinder wiederzusehen. Doch genau das wollen Josephs Schwiegereltern, bei denen die Kinder seit der schrecklichen Tragödie leben, mit allen Mitteln verhindern. Und auch Scarlet, die Älteste, lehnt jeden Kontakt zu Joseph ab. Schließlich ist es eine unumstößliche Wahrheit, dass er ihre Mutter umgebracht hat. Doch dann entdeckt Scarlet die andere Seite dieser Wahrheit ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Widmung
Leeds, Schwurgerichtssaal
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Elf
Zwölf
Dreizehn
Vierzehn
Fünfzehn
Sechzehn
Siebzehn
Achtzehn
Neunzehn
Zwanzig
Einundzwanzig
Zweiundzwanzig
Dreiundzwanzig
Vierundzwanzig
Fünfundzwanzig
Sechsundzwanzig
Siebenundzwanzig
Achtundzwanzig
Neunundzwanzig
Dreißig
Einunddreißig
Zweiunddreißig
Dreiunddreißig
Vierunddreißig
Fünfunddreißig
Sechsunddreißig
Siebenunddreißig
Achtunddreißig
Neununddreißig
Epilog
CHARITY NORMAN
Die andereSEITEderWAHRHEIT
Roman
Aus dem Englischen von Sylvia Strasser
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe: Copyright © 2013 by Charity Norman Titel der britischen Originalausgabe: »The Son-in-Law« Originalverlag: Allen & Unwin
Für die deutschsprachige Ausgabe:Copyright © 2016 by Bastei Lübbe AG, KölnTextredaktion: Dr. Ulrike Brandt-Schwarze, BonnTitelillustration: © Stockphoto/Claudiad; © shutterstock/schankz; © shutterstock/Aleksandr Makarenko;Umschlaggestaltung: Kirstin OsenauE-Book-Produktion: two-up, Düsseldorf
ISBN 978-3-7325-1462-5
www.bastei-entertainment.dewww.lesejury.de
Für TimDanke für so viel Bananenkuchen
LEEDS, SCHWURGERICHTSSAAL
Strafsache Joseph William Scott
Beweisstück 53: Abschrift des bei der Notrufzentrale eingegangenen Anrufs von Scarlet Scott
Telefonistin: Notrufzentrale?
Scarlet Scott: Äh, können Sie uns bitte helfen? Meine Mum liegt auf dem Fußboden.
T.: Sie liegt auf dem Fußboden? Ist sie bei Bewusstsein?
S.S.: Wir kriegen sie nicht wach.
T.: Atmet sie?
S.S.: Dad, atmet sie?
Joseph Scott (im Hintergrund): Nein, sie atmet nicht, sie atmet nicht … o Gott. Sag ihnen, sie hat keinen Puls.
S.S.: Sie atmet nicht, sie hat keinen Puls.
T.: Okay, der Rettungswagen ist bereits unterwegs.
S.S. (weinend): Sie sollen sich beeilen, bitte sagen Sie ihnen, dass sie sich beeilen sollen. Mit ihr stimmt was nicht.
T.: Wer ist noch bei dir?
S.S.: Mein Dad und meine Brüder.
Joseph Scott (mit lauter Stimme): Tun Sie etwas! Bitte! Sie hat keinen Herzschlag mehr!
T.: Ich hab’s gehört. Der Notarzt ist unterwegs. Ich werde dir jetzt genaue Anweisungen geben, okay?
S.S.: Okay.
T.: Hör gut zu, damit du deinem Vater erklären kannst, was er machen muss.
S.S.: Ist gut.
T.: Liegt deine Mum auf dem Rücken?
S.S.: Nein, sie …
T.: Sag deinem Dad, sie muss auf dem Rücken liegen, ganz flach.
S.S.: Dad, sie sagt, sie muss flach auf dem Rücken liegen. – Er hat sie rumgedreht.
T.: Keine Kissen?
S.S.: Nein, hier sind keine. Wir sind im Wohnzimmer.
T.: Sag ihm, er soll nachsehen, ob sie etwas im Mund hat … einen Bissen Essen vielleicht oder Erbrochenes.
S.S.: Dad, hat sie was im Mund? – Nein, nichts.
T.: Gut. Und jetzt soll er seinen Handballen auf ihr Brustbein legen.
S.S.: Sie sagt, du sollst deinen Handballen auf ihr Brustbein legen.
T.: Und jetzt die andere Hand darüberlegen.
S.S.: Und jetzt die andere Hand darüberlegen.
T.: Hat er das gemacht? Gut. Und jetzt kräftig drücken, ungefähr zweimal pro Sekunde.
S.S.: Sie sagt, du sollst kräftig drücken, ungefähr zweimal pro Sekunde.
Joseph Scott: Zweimal pro Sekunde, okay … O mein Gott, o mein Gott!
T.: Er muss das Brustbein kräftig runterdrücken. Tut er das?
S.S.: Ja, aber sie … sie wacht nicht auf. Warum wacht sie nicht auf?
T.: Du machst das sehr gut, wirklich sehr gut. Wie heißt du denn?
S.S.: Scarlet.
T.: Und wie alt bist du, Scarlet?
S.S.: Zehn.
T.: Du machst deine Sache großartig. Diese Musik ist ganz schön laut, findest du nicht? Kannst du sie vielleicht abstellen?
S.S.: Äh … nein, ich komm nicht an den Knopf ran.
T.: Das macht nichts, kein Problem. Dein Dad darf nicht aufhören, er muss rasch hintereinander ihr Brustbein runterdrücken, bis ich ihm sage, dass er aufhören kann.
S.S.: Sie sagt, du musst rasch hintereinander ihr Brustbein runterdrücken, so lange, bis sie sagt, dass du aufhören kannst.
T.: Sehr gut machst du das. Wie alt ist deine Mum denn, Scarlet?
S.S.: Ich weiß nicht … dreiunddreißig, glaub ich.
T.: Und wie heißt sie?
S.S. (nach einer langen Pause): Sie sieht plötzlich so komisch aus!
T.: Scarlet, hör mir genau zu. Dein Dad drückt immer noch ihren Brustkorb herunter, oder?
S.S.: O nein – ich glaube, sie ist tot! Ich glaube, sie ist tot!
T.: Scarlet, hör zu, es ist wichtig, dass du ganz ruhig bleibst. Dein Dad hat nicht aufgehört, oder?
S.S.: Nein, aber sie wacht einfach nicht auf.
T.: Er muss weitermachen, unbedingt. Okay. Wie alt sind deine Brüder, Scarlet?
S.S.: Theo ist sieben, und Ben ist noch ein Baby.
T.: Ich kann es schreien hören. Es fehlt ihm doch nichts, oder? Hat deine Mum einen Anfall gehabt oder …?
S.S.: Nein, es war kein Anfall.
T.: Was ist denn dann passiert?
S.S.: Mein Dad … (weinend) … mein Dad hat sie geschlagen.
T.: Er hat sie geschlagen?
S.S.: Ja, und da ist sie hingefallen, und jetzt ist sie … (Entsetzensschreie) Da ist Blut auf dem Fußboden!
T.: Du machst deine Sache ganz toll, Scarlet. Glaubst du, Theo könnte zur Tür gehen und nach dem Rettungswagen Ausschau halten?
S.S.: Theo? Nein, er versteckt sich, er hat Angst.
T.: Okay. Kannst du vom Wohnzimmer aus die Straße sehen?
S.S.: Ja.
T.: Ist die Haustür abgeschlossen?
S.S.: Nein, bestimmt nicht. … Sagen Sie ihnen bitte, dass sie sich beeilen sollen!
T.: Der Rettungswagen wird jeden Moment eintreffen und die Polizei auch. Macht dein Dad immer noch die Herzdruckmassage?
S.S.: Die …?
T.: Drückt er immer noch ihren Brustkorb herunter?
S.S.: Ja, aber er weint in einem fort.
T.: Der Notarzt muss jeden Augenblick kommen.
S.S.: Mein Dad weint, und Ben weint auch.
T.: Du bist ein tapferes Mädchen, du kannst stolz auf dich sein.
S.S.: Sie sind da! Ich kann die Lichter draußen sehen.
T.: Kannst du zur Tür gehen und sie reinlassen, Scarlet?
S.S.: Ja … (Zum Notarzt) Kommen Sie schnell, sie ist hier drin!
(Undeutliche Stimmen im Hintergrund)
T.: Scarlet? Der Notarzt ist jetzt da, oder?
S.S.: Ja, und ein paar Polizisten.
T.: Du hast deine Sache großartig gemacht, Scarlet.
S.S. (weinend): Wird meine Mum wieder gesund?
EINS
Scarlet
Meine Mutter hat immer gesagt, ihre Hochzeit sei wie im Märchen gewesen. Der Morgen war golden und blau, und unterhalb der Stadtmauern wiegten sich unzählige Narzissen sanft im Wind. Mein Vater und sie waren jung, schön und verrückt nacheinander.
»Lass dir bloß nicht von den Leuten einreden, mit der Liebe wäre es nicht so wie im Film, Scarlet«, sagte sie. Es war einer jener Augenblicke, in denen sie auf einer schäumenden, glitzernden Woge des Glücks zu reiten schien. »Warum in Gottes Namen sollte es auch nicht? ›Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende‹ – das gibt’s tatsächlich, aber die Leute halten es für cool, sich darüber lustig zu machen.« Sie lachte kurz auf und summte dann wieder zu der Jazzmusik, die im Radio lief. »Arme Socken, nenn ich das!«
Aus irgendeinem Grund gehört dieser Abend zu meinen lebhaftesten Erinnerungen an meine Mutter. Sie roch nach – na ja, nach Mum: nach ihrem besonderen Sandelholzduft und nach Kaffee und vielleicht Wein. Unter meinem Bett liegt eine ihrer weichen Strickjacken, die immer noch nach ihr riecht. Wenn ich sie an mein Gesicht drücke und die Augen zumache, kann ich so tun, als wäre sie es. Ich muss damals ungefähr acht gewesen sein, weil Flotsam und Jetsam noch kleine Kätzchen waren, flauschige weiße Wollknäuel. Ben war noch gar nicht auf der Welt. Theo lag auf dem Fußboden und versuchte, ein Buch für Erstklässler zu lesen. Er hatte die Zunge herausgestreckt.
Unsere Eltern machten sich fertig, um am Abend irgendwohin auszugehen. Mum kam mir zierlich und behände vor, wie eine Elfe. Ihr rotgoldenes Haar war kurz geschnitten und sah schick aus mit dem glänzenden Pony, der auf die eine Seite fiel. Wenn sie glücklich war so wie an diesem Abend, war es, als ob sie alle um sich herum aufleuchten lassen würde. Die Musik floss durch sie hindurch wie elektrischer Strom. Sie fing an zu tanzen, und ihr Kleid funkelte und glitzerte bei jeder Bewegung. Als sie an Dad vorbeifunkelte, zog er sie in seine Arme – »Hab ich dich!«, sagte er –, und dann tanzten sie zusammen. Für mich sahen sie aus wie Filmstars. Ihre Beine bewegten sich gleichzeitig und in die gleiche Richtung, und sie schauten sich in die Augen. Dann küsste er sie.
»Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?«, fragte ich sie, als sie sich an ihren Frisiertisch setzte.
»Natürlich! Bei deinem Dad und mir war es Liebe auf den ersten Blick. Er war mein Märchenprinz, wusstest du das? Er hat mich vor einem bösen Schurken gerettet, für meine Ehre gekämpft und mich davongetragen.«
»Ein böser Schurke?«
Sie lachte in den Spiegel, während sie ihren dunkelrosa Lippenstift auftrug. Wie über einen Scherz, den nur sie und die Dame im Spiegel verstanden. Ich konnte die Augen der Dame im Spiegel sehen. Augen, die nur aus Farbe zu bestehen schienen, wie leuchtendes grünes Glas in einem blassen Gesicht. »Ich hatte auf einer Party ein bisschen Ärger mit einem Typen.«
»Und Dad hat dich davongetragen?«
»Ja, so könnte man sagen.«
»Wie ein richtiger Märchenprinz?«
Dad, der das alles hörte, lachte leise in sich hinein, während er sich die Schnürsenkel band. Mum streckte die Hand aus und berührte sein Gesicht mit ihren langen Fingern.
»Er war einfach umwerfend, dein Dad! Dieser Angsthase konnte ihm nicht das Wasser reichen. Warte, ich zeig dir was.«
Sie tänzelte hinüber zum Schrank und holte ihr Fotoalbum. Dann schob sie die Sachen auf ihrem Frisiertisch zur Seite und klopfte mit der flachen Hand auf den Stuhl neben sich. Dad fuhr durch Theos wirres Haar und sagte, er würde ihm noch eine Geschichte vorlesen, bevor der Babysitter käme. Die beiden zogen davon. Theo war eine Miniaturausgabe von Dad, bis auf die Nase: Theo hatte eine kleine Stupsnase, Dad einen breiten, kräftigen Zinken. Beide sahen sie irgendwie altmodisch aus mit ihren schiefergrauen Augen und ernsten Mienen, die bei jedem Lächeln schlagartig anfingen zu strahlen, als wäre die Sonne aufgegangen.
Mum und ich blätterten in dem Fotoalbum, obwohl ich es schon oft angesehen hatte. Auf meinem Lieblingsfoto standen meine Eltern an einem Brunnen. Sie hatten gerade geheiratet.
»Hier, siehst du?«, sagte sie und betrachtete das Bild lächelnd. »Schau ihn dir an! Ich glaub immer noch, dass er vielleicht ein russischer Prinz ist, ohne es zu ahnen.«
Ich stimmte ihr zu, weil ich sie liebte. Aber ich erinnere mich, wie ich dachte, dass Dad einfach wie Dad aussah und dass auch der schicke Frack, den ich im wirklichen Leben nie an ihm gesehen hatte, nichts daran änderte. Als die Aufnahme entstand, hatte er sie angesehen. Sie sagte irgendetwas, und er musste darüber lachen. Er schob seine Brille ein Stückchen höher und sah wie ein netter, sehr attraktiver Geschichtslehrer aus und überhaupt nicht wie ein Mörder.
Mums Brautkleid lag eng an ihrem Körper an und legte sich in weißen Falten um ihre Füße, wie flüssige Sahne, wenn man sie aus einem Becher gießt. Sie trug einen Spitzenschleier mit einem Kranz aus Blumen. Der Schleier hatte meiner Großmutter Hannah gehört und meiner Urgroßmutter vor ihr, und eines Tages würde ich ihn vielleicht tragen.
Ich lief in mein Zimmer und holte das Buch, das ich mir in der Leihbücherei geliehen hatte, Maid of Sherwood. Die Illustration auf dem Umschlag zeigte Maid Marian, wie sie in den Wald ritt, um Robin Hood zu suchen. Sie trug ein blaues Gewand und über dem Kopf ein weißes Tuch, das von einem Goldband gehalten wurde. Ihre Augen waren riesengroß, und sie hatte ein schmales Gesicht.
»Maid Marian, das bist du«, sagte ich.
Mum drückte mich fest an sich. Eigentlich ein bisschen zu fest. »O Scarlet!« Es klang, als ginge ihr die Puste aus. »Bleib, wie du bist, hörst du? Du darfst niemals so abscheulich und mürrisch werden, wie ich es war. Du musst unbedingt so bleiben, wie du jetzt gerade bist.« Dann küsste sie mich – schmatz, schmatz – auf beide Backen, ziemlich kräftig, fast zornig, und hinterließ dunkelrosa Lippenstiftabdrücke auf meiner Haut.
Ich habe mich später oft gefragt, ob das der Grund war, weshalb sie zugelassen hat, dass er sie tötete. Vielleicht wollte sie uns Kinder nicht aufwachsen sehen. Ich dachte, wenn sie wirklich hätte bei uns bleiben wollen, hätte sie einen Weg gefunden, am Leben zu bleiben. Dann hätten wir nicht bei Hannah und Opa wohnen müssen. Inzwischen weiß ich natürlich, dass das Blödsinn ist. Mum konnte nicht verhindern, dass sie starb. Blut war in ihr Gehirn eingedrungen und hatte es anschwellen lassen.
Das Buch habe ich nie in die Bücherei zurückgebracht. Irgendwann schickten sie mir einen bösen Brief, und ich bezahlte die Strafgebühr von dem Geld, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte. So wurde Maid of Sherwood mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Ich besitze das Buch heute noch, es liegt unter meinem Bett. Da liegt auch das Fotoalbum, aber darin habe ich ein bisschen was verändert.
ZWEI
Joseph
Das Gefängnis war bis ins Detail so gebaut, dass es bedrohlich wirkte. Es ragte über den angrenzenden Straßen auf wie eine grimmige Warnung. An bitterkalten Dezembertagen, wenn der Wind schneidend von den Pennines herunterwehte, hätte es ein düsteres Schloss in einem Horrorstreifen sein können.
An genau so einem Morgen schwang eine Stahltür lautlos auf. Sie führte auf eine freie Fläche voller gelber Hinweisschilder, auf denen Strafvollzugsanstalt Leeds stand, so als ob das Armley Jail eine lustige Touristenattraktion wäre. Ein Mann in den Dreißigern trat hinaus in eine Welt, in der Windböen an ihm rissen und Eiskristalle um ihn herumwirbelten. Er war nicht angezogen für einen Winter in Yorkshire: Er trug einen leichten, zerknitterten Baumwollanzug, dessen Jackett um seine Schultern schlotterte. In der einen Hand hielt er eine Plastiktüte, und seine Finger färbten sich rasch rot in der Kälte. Ein dünner Film aus Schneeregen legte sich auf seine runden Brillengläser.
Die Tür knallte hinter ihm zu und schloss ihn aus. Ein, zwei Sekunden lang schien er unfähig, sich zu bewegen. Er drehte den Kopf und sah dem Gefängnislastwagen nach, der auf das wuchtige Einfahrtstor zurollte. Dann hob er den Zeigefinger, schob die Brille höher auf seine Nase und machte sich auf den Weg in die Straßen der Stadt, vorbei an den gelben Hinweisschildern und den blinden Mauern. Fast wäre er direkt vor ein Auto gelaufen. Der Fahrer hupte und machte einen Schlenker, um ihm auszuweichen. Eine ältere Frau, den Blick abgewandt, eilte an ihm vorbei. Als er schließlich die Straße überquert hatte, suchte er Schutz im Wartehäuschen einer Bushaltestelle.
Vier Mädchen in Schuluniform saßen auf der schmalen Bank, rauchten und schwatzten. Sie musterten den Fremden, der den Fahrplan an der Wand studierte, mit spöttischen Seitenblicken. Eine von ihnen – dem Pferdeschwanz nach zu urteilen, der seitlich von ihrem Kopf abstand, der Clown der Gruppe – flüsterte etwas, und die anderen kicherten los.
Nach einer Weile starrten die rauchenden Mädchen den Neuankömmling mit unverhohlener Neugier an. Er war blass wie ein Vampir und sah eine Spur fremdartig aus mit den hohen, slawischen Wangenknochen, die vor Kälte bläulich schimmerten. Es war Pferdeschwanz, die ihn, von den anderen immer wieder unauffällig ermutigt, schließlich ansprach.
»Wollen Sie eine?«, fragte sie und hielt ihm eine Schachtel Zigaretten hin.
Seine blaugrauen Augen unter den buschigen Brauen waren blutunterlaufen. »Ich rauche nicht, danke.«
»’tschuldigung«, fuhr sie fort und warf ihren Freundinnen einen raschen, wild entschlossenen Blick zu, »aber darf ich Sie was fragen? Wir haben nämlich gewettet. Ohne Quatsch.«
»So, ohne Quatsch«, echote der Fremde trocken. Man konnte schwach den Dialekt eines Nordengländers heraushören. »Dann schieß mal los.«
»Sind Sie gerade aus dem Knast entlassen worden?«
Er nickte. »Bin seit, ooh, zwanzig Minuten ein freier Mann.«
»Wusst’ ich’s doch!«, kreischte sie. »Wie ist es denn da drin? Der Onkel von meinem Freund hat auch gesessen. Er meint, das Essen sei der letzte Fraß.«
Der Fremde zuckte nur mit den Schultern und wandte sich wieder dem Fahrplan zu.
Die Mädchen ließen sich nicht davon abschrecken. Los, frag ihn … Frag du doch … Ich hab vorhin gefragt … Los, Karin, mach schon. Pferdeschwanz stand auf, zog sich ihren gestreiften Schulschal über die Kinnpartie und trat neben den Mann.
»’tschuldigung … ähm, nehmen Sie’s uns nicht krumm oder so, aber wir möchten wissen, warum Sie gesessen haben.«
Er zitterte jetzt vor Kälte. Er hatte den Kopf eingezogen und die Hände in den Hosentaschen vergraben.
»Sie meint, Sie sind ein Pädophiler«, fuhr Pferdeschwanz fort und zeigte auf eins der Mädels. »Aber ich glaub eher …«
Der Fremde erfuhr nie, was sie glaubte, denn in diesem Augenblick bretterte ein schwarzer Geländewagen wild hupend auf den Bürgersteig vor der Haltestelle.
»Scott!«, schrie der Fahrer, als er sich auf die Beifahrerseite beugte, um die Tür zu öffnen. »Scott, du verdammter Wichser, wo zum Teufel willst du denn hin?«
Der Wichser brachte ein gequältes Lächeln zustande. »Hey, Akash, wo hast du denn den Schlitten her? Sag mir jetzt bitte nicht, dass du ihn geklaut hast.«
»Firmenwagen. Und jetzt hör auf, dämliche Fragen zu stellen, und schieb deinen Arsch hier rein. Du frierst dir ja die Eierchen ab da draußen.«
Die Mädchen verfolgten die Szene fasziniert. Pferdeschwanz unternahm einen letzten Versuch. »Jetzt sagen Sie schon! So schlimm kann’s doch nicht gewesen sein. Ich wette, Sie haben keinen umgebracht, oder?«
Der Mann hatte bereits einen Fuß in das Auto gesetzt. Jetzt warf er dem Mädchen einen Blick über die Schulter zu. »Du wettest, dass ich das nicht getan habe?«
»Ja, ich hab grad zwei Pfund gewettet, dass Sie keinen umgebracht haben.«
»Dann bist du jetzt um zwei Pfund ärmer«, erwiderte der Fremde ruhig. Dann stieg er in den Wagen.
*
Die vier Schulschwänzerinnen schauten dem bulligen Fahrzeug nach, als es vom Bürgersteig auf die zweispurige Fahrbahn rumpelte und beschleunigte. Ein nachdenkliches Schweigen war entstanden. Schließlich trat Pferdeschwanz ihre Zigarette auf dem Asphalt aus.
»So ein Schwachsinn. Jede Wette, dass er wegen was total Langweiligem gesessen hat. Der Typ sah doch aus wie ein verdammter Leichenbestatter.«
»Aber sexy Augen hatte er«, sagte die Kleinste und tat so, als müsste sie sich Luft zufächeln. »Phuuh! Ich hab in die heißen Augen eines Mörders geschaut!«
Pferdeschwanz machte eine obszöne Geste. »Jemand mit einer runden Nickelbrille ist doch kein Mörder.«
*
Joseph Scott saß zusammengekauert auf dem Beifahrersitz und blies in seine vor Kälte tauben Hände.
»Du bist so potthässlich wie eh und je, Scott«, bemerkte der Mann hinter dem Steuer gutmütig. Er war jung, hatte weiße Zähne und gegelte Haare. »Warte, ich dreh die Heizung höher … Besser so? Heilige Scheiße, sind das etwa die einzigen Klamotten, die du hast?«
»Der Anzug, den ich im Gericht anhatte, als ich verknackt wurde. Ein Zeichen.«
Joseph schaute aus dem Fenster und zuckte bei jedem vorbeibrausenden Auto unwillkürlich zusammen. Das Tempo der Welt hier draußen machte ihm zu schaffen.
Akash sagte lächelnd: »Verrückt, oder? Du denkst, du würdest total ausflippen. Du malst dir monatelang aus, wie du Weiber aufreißen und dich volllaufen lassen und dir den Bauch mit Mums guter Hausmannskost vollschlagen wirst. Dann gehst du durch dieses Tor und fragst dich: Und jetzt?«
»Fühlt sich an wie ein fremdes Land.« Joseph rieb sich das Gesicht. »Woher wusstest du eigentlich, dass ich heute rauskomme?«
»Ich hab deinen Anwalt angerufen. Am Haupteingang haben sie mir gesagt, du seist schon weg. Also hab ich die ganze verdammte Gegend auf der Suche nach dir abgefahren, du blöder Arsch.«
»Danke.«
»Gern geschehen.«
Joseph drehte sich vom Fenster weg. »Du hast mich vor ein paar richtig grässlichen Mädels gerettet. Die benehmen sich wie Kerle. Müssten sie nicht in der Schule sein?«
»Willkommen in der Gegenwart«, erwiderte Akash mit gespielt affektierter Stimme. »Dieses Land geht echt vor die Hunde … Ich sag dir, daran sind nur die Eltern schuld. Aber jetzt zu dir, Kumpel. Wohin soll’s denn gehen? Die Kneipen sind auf, die Barfrauen stehen da und warten.«
Joseph stellte sich den Geschmack von Bier vor. »Ich bin dabei.« Er zögerte. »Aber erst später. Ich muss zuerst nach York zu meinem Anwalt. Ich wollte den Bus nehmen. Ich habe einen Reiseberechtigungsschein.«
»Hast du sie noch alle? Du willst doch nicht ernsthaft deine ersten Stunden in Freiheit im Büro eines Anwalts verbringen. Ich für mein Teil will keinen von denen jemals wiedersehen. He, hier ist das Prince Albert. Sollen wir …«
Joseph ließ ihn nicht ausreden. »Nachdem ich bei meinem Anwalt war. Er erwartet mich.«
»Geht’s um deine Kinder?«
»Natürlich geht’s um die Kinder.«
»Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Kumpel. Du bist vorzeitig auf Bewährung entlassen worden, richtig? Ich wette, eine Auflage war, dass du keinen Kontakt zu deiner Familie aufnimmst.«
»Stimmt.« Joseph trug eine Kopie der Auflagen für seine vorzeitige Haftentlassung bei sich. »Ich darf mich ihrem Haus nicht nähern. Zugegeben, das Haus befindet sich in York, aber es steht nirgends, dass ich meinen Anwalt dort nicht aufsuchen darf.«
»Wir besorgen dir erst mal was Anständiges zu essen und ein Bierchen dazu. Du solltest dir die Sache in Ruhe durch den Kopf gehen lassen.«
»Du kannst mich meinetwegen mit Kaviar und Champagner abfüllen oder mich in Eselsmilch baden, aber das wird nichts an meinem Entschluss ändern.«
»Du hast so lange gewartet, Scottie. Da kommt’s auf ein paar Tage mehr oder weniger doch auch nicht an.«
Josephs Kiefermuskeln spannten sich gefährlich an. »Ich hab die Stunden bis zu meiner Entlassung gezählt, bis ich in das Büro dieses Anwalts marschieren kann. Das war das Einzige, was mich aufrecht gehalten hat. Du weißt doch selbst, wie es da drin ist, Akash – man hat viel zu viel Zeit zum Nachdenken. Wenn dir der Weg nach York zu weit ist, kein Problem, dann nehm ich den Bus.«
Akash kapitulierte. »Na schön. Auf nach York. Weißt du schon, wo du heute Nacht schlafen wirst?«
»Ich hab meinem Bewährungshelfer erzählt, dass ich meine Schwester in Gateshead besuche«, erwiderte Joseph ohne Begeisterung. »Spätestens Freitag will er meine neue Adresse wissen.«
»Hast du sie angerufen?«
»Nein. Wenn sie könnte, würde sie mit Freuden auf meinem Grab tanzen.«
»Keine anderen Angehörigen?«
»Nur meinen Alten. Das Letzte, was ich von ihm gehört hab, war, dass er es sich an der Costa Blanca gut gehen lässt.«
»Ich hab ein Sofa. Du kannst gern drauf schlafen, solange du willst.«
»Danke«, murmelte Joseph. »Das wäre wirklich … Danke.« Er starrte auf seine Hände, und nach einem Augenblick stellte Akash das Radio an. Eine Boyband spielte.
Joseph schwieg, bis sie den Stadtrand von York erreicht hatten. »Tut mir leid. Entschuldige. Danke, dass du mich abgeholt hast.« Er zog ein paar Geldscheine aus der Tasche. »Mein Entlassungsgeld. Ich geb nachher einen aus.« Er blickte sich flüchtig in dem Wagen um. »Das ist also deiner, hm?«
»Ja … na ja, eigentlich gehört er meinem Dad. Er hat mir einen Job in seinem Laden besorgt. Du hast den Geschäftsführer der Squeaky-Clean-Gebäudereinigung vor dir. Die gute Nachricht ist, dass ich ein ganzes Heer von Frauen herumkommandieren kann. Die schlechte Nachricht ist, dass ich die halbe Nacht arbeiten muss.« Der junge Mann drängte sich zwischen zwei Fahrzeuge auf die Überholspur und gestikulierte wild, als sein Hintermann die Lichthupe betätigte.
Der Wind hatte sich inzwischen gelegt, und es war noch kälter geworden, als sie ihr Ziel erreicht hatten.
»Ich warte in der Kneipe da drüben«, sagte Akash. Er blies seine Backen auf und rieb die Hände kräftig aneinander. »Scheiße, da friert man sich ja den Arsch ab!«
Joseph schaute sich um, noch immer verwirrt, versuchte, sich zu orientieren. Die Luft schien seltsam milchig. »Ich glaube, es wird bald schneien«, sagte er.
DREI
Hannah
Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ganz sicher nicht mit ihm. Wie kann er am Anfang stehen, wo er doch alles, was meinem Leben einen Sinn gab, zerstört hat?
Sie war unser einziges Kind. Es gab keinen Ersatz für sie, niemanden, der ihre Rolle hätte übernehmen können. Joseph Scott hat dafür gesorgt, dass der Vorhang für immer fiel. Sie war vom ersten Moment an außergewöhnlich – ein zartes Wesen mit den strahlendsten Augen, die die Hebamme je gesehen hatte. Ich war sechsundzwanzig und euphorisch. Mein Baby war ein schrumpeliges Wunder, eine fremdartige Kreatur aus dem All, das Kostbarste im ganzen Universum. Was noch eine Woche zuvor von entscheidender Bedeutung zu sein schien, war plötzlich unwichtig geworden. Der Skiurlaub? Lächerlich – natürlich konnten wir nicht zum Skilaufen fahren, jedenfalls nicht, solange Zoe noch zu klein war. Mein Kampf um die Beförderung zur Fachbereichsleiterin? Wen interessierte das schon? Meine alkoholkranke Schwester Eliza wollte uns für ein paar Tage besuchen? Nein, verdammt noch mal, auf keinen Fall. Kein Besuch, von niemandem. Wir hatten schließlich ein Baby bekommen.
Zoe kam in einem kleinen Krankenhaus unweit unserer damaligen Wohnung zur Welt. Im Bett neben meinem stillte eine junge Frau namens Jennifer ihren Sohn Bradley, einen elf Pfund schweren Wonneproppen. Jennifer hatte rosarote Bäckchen und einen Frotteebademantel, der noch eine Spur rosaroter war. Auf ihrem Nachttisch stapelten sich Glückwunschkarten, und auf jeder stand unübersehbar Es ist ein Junge! Als ob sie das nicht selbst wüsste.
»Wie werden Sie sie nennen?«, fragte sie mit einem prüfenden Blick auf das bisschen Leben in dem Bettchen neben mir.
»Sie soll Zoe heißen«, antwortete ich. »Zoe Eliza.«
»Hübscher Name. Ihr Erstes?«
Ich nickte. Ein dümmliches Lächeln war auf meinem Gesicht festgefroren.
»Bradley ist mein drittes Kind«, fuhr sie fort. »Und mein letztes, das dürfen Sie mir glauben.«
Freddie hielt Zoe so vorsichtig in den Armen, als wäre sie aus Glas. Er lächelte genauso einfältig wie ich. Sein Haar wurde schon schütter, er hatte Geheimratsecken bekommen. Ich fand, das sah vornehm aus und passte zu seinem langen Gesicht und dem feingliedrigen Körperbau.
»Ist das der Opa?«, fragte eine von Jennifers Besucherinnen.
Freddie und ich taten so, als hätten wir es nicht gehört, während Jennifer »Pssst!« machte und die Besucherin kicherte.
Am anderen Morgen kam Jennifers Mann, um sie und das Kind nach Hause zu holen. Ich sah zu, wie sie fröhlich plappernd ihre Sachen zusammenpackte. Dann war sie fort. Die Hebamme kam herein und machte ihr Bett. Es war komisch, aber ich vermisste Jennifer ganz schrecklich. An diesem Tag fing ich an zu weinen, einfach so, völlig grundlos. Als Freddie kam, saß ich schniefend im Stillsessel. Zoe war in meinen Armen eingeschlafen. Ihr herzförmiger Mund stand offen, und sie sabberte Milch auf mein Hemd.
»Es wird sie nicht kriegen«, schluchzte ich, während Freddie beruhigend auf mich einredete und meine Schulter tätschelte.
»Was meinst du?« Er berührte den kupferroten Haarwirbel auf Zoes butterweichem Kopf. Man konnte ihre Venen unter der Fontanelle pulsieren sehen.
»Das Leben«, schniefte ich. »Der Tod.«
Aber er kriegte sie doch.
*
Ich glaube, ich sollte mit dem Brief anfangen.
Er traf am Tag seiner Entlassung ein. Über und über mit den lila Stempeln der Vollzugsanstalt bedeckt, lag er auf dem Küchentisch, den er durch seine bloße Anwesenheit beschmutzte. Vielleicht hatten sie uns versehentlich von der Liste derjenigen, mit denen kein Briefverkehr erlaubt war, gestrichen, oder die Behörden waren nachlässig geworden. Sein Anwalt hatte uns bereits zweimal geschrieben, deshalb konnte ich mir schon denken, was es mit diesem Brief auf sich hatte.
Ich würde ihn nicht aufmachen. Das Ding würde ungeöffnet in den Mülleimer wandern. Da! Ich warf ihn in das dunkle Loch und hörte das befriedigende Klick-Klack des Plastikdeckels. Er würde in einen Klumpen Haferbrei von heute Morgen fallen und hilflos darin versinken. Jetzt weißt du, was ich von dir denke!
Es hatte um die Mittagszeit zu schneien angefangen, und der Garten hatte sich längst in eine weiße Wildnis verwandelt. Obwohl der Schneefall nachgelassen hatte, wirbelten immer noch winzig kleine Räder aus zarter weißer Spitze herum. Frederick und Ben waren draußen und bauten einen Schneemann. Ich konnte sie vom Küchenfenster aus sehen. Ben musste fast rennen, um mit seinem Opa Schritt zu halten. Er schaufelte Schnee in die kleine Holzschubkarre, die Frederick für Zoe gebastelt hatte, als sie noch klein war. Die beiden arbeiteten gemeinsam im Garten, jäteten das Unkraut in den Blumenbeeten. Ich konnte Zoes unaufhörliches Geplapper hören und Fredericks vergnügtes Lachen. Wir hatten uns mehr Kinder gewünscht, mehr erwartet, aber nach drei qualvollen Fehlgeburten hatte ich die Botschaft verstanden, und der arme alte Frederick unterzog sich einer Vasektomie.
Als ich die Backofentür öffnete, schlug mir Rauch entgegen. Meine Kekse qualmten fröhlich vor sich hin. Dieser verdammte Joseph Scott! Jetzt hatte ich seinetwegen auch noch meine Kekse verkohlen lassen. Ich rettete, was noch zu retten war, und klopfte dann ans Fenster. Frederick und Ben standen über das winterkahle Kohlbeet gebeugt – wahrscheinlich hatten sie irgendeinen fremdartigen Organismus entdeckt. Bestimmt erklärte Frederick seinem Enkel in der anschaulichen, leidenschaftlichen Sprache eines David Attenborough etwas dazu, und Ben hing fasziniert und voller Konzentration an den Lippen seines Großvaters. Ein Vierjähriger und ein Sechsundsiebzigjähriger, die eine besondere Liebe zueinander verband.
Ich öffnete die Küchentür und rief zur Melodie von Waltzing Matilda: »Frederick, Ben, Frederick, Ben, wie wär’s mit Tee und Keksen?«
Die Wärme aus der Küche waberte hinaus und hing wie eine schwere Daunendecke über dem gefrorenen, öden Land. Freddie nahm seinen Enkel bei der Hand, und sie machten sich gemeinsam auf den Weg zum Haus – der eine groß und zu dünn, ganz vorsichtig, damit er nicht ausrutschte auf dem vereisten Boden, der andere klein, stämmig, mit schnellen Hüpfern. Flotsam, eine von Zoes Birmakatzen, folgte ihnen mit hocherhobenem Schwanz.
Er kam an diesem Tag raus. Wahrscheinlich war er jetzt schon in Freiheit. Die Behörden hatten uns in einem Brief darüber informiert. Nett von ihnen, oder? Ich hatte nicht die geringste Lust, ihm ohne Vorwarnung plötzlich gegenüberzustehen. Ich legte überhaupt keinen Wert auf eine Begegnung mit diesem Menschen, aber irgendwann würde ich im Supermarkt um die Ecke biegen, und er würde vor mir stehen, unverschämt und frech, und mich anzüglich mustern wie ein Psychopath in einem Schundfilm. Ich konnte den vertrauten Hass in mir spüren. Er loderte und brannte. Was würde ich tun, wenn ich dem Mörder meiner Tochter in die Arme liefe? Vielleicht würde ich das Bremskabel an seinem Auto durchschneiden. Kein Mensch würde mir das verdenken können.
Ben und Frederick kamen johlend wie Tarzan ins Haus gepoltert. Schnee und Schneematsch flogen nach allen Seiten. Sie hängten ihre Mäntel an die Haken und streiften sich die nassen Wollhandschuhe ab. Dann ließ sich Ben auf die Fußmatte fallen und zerrte mit beiden Händen an seinen Gummistiefeln. Sein rechter Fuß berührte fast seine Nasenspitze. Ich kann mich nicht erinnern, als Kind auch so gelenkig gewesen zu sein.
»Legt eure Handschuhe auf die Heizung«, befahl ich. »Und eure grässlichen nassen Socken auch.«
Sie hörten nicht. Sie waren zwei Künstler, die mit dem Entwurf eines Kunstwerks, einer Installation, beschäftigt waren.
»Gut, dann sind wir uns einig: Kronkorken als Knöpfe. Und was machen wir mit den Augen?«, fragte Freddie.
Ben zog sich den zweiten Gummistiefel aus. Seine Nase lief, was kein schöner Anblick war, und er versuchte, den Kopf wegzudrehen, als ich sie ihm putzte.
»Hier. Die kannst du eurem Schneemann aufsetzen«, sagte ich und nahm eine alte Mütze von Freddie vom Haken. Es war eine Schiebermütze aus Tweed, deren Seidenfutter zerrissen war.
»Das ist doch eine Schneefrau«, rief Ben und prustete vor Lachen über meine Blödheit. »Kein Mann! Können wir einen von deinen großen Hochzeitshüten bekommen?«
»Ich muss mich schon wundern, Hannah«, bemerkte Frederick, und seine weißen Brauen zuckten. »Du stellst Vermutungen aufgrund von Geschlechterstereotypen an?«
»Ach, halt doch den Mund!« Ich machte eine unwillige Handbewegung, und Freddie legte mir seinen Arm um die Schultern, so wie er es in den vergangenen vierzig Jahren bestimmt eine Million Mal getan hatte.
Ich war vierundzwanzig, als ich Frederick Wilde kennenlernte und heiratete. Ich hatte nicht die Absicht gehabt, mich zu verlieben, weder zu diesem Zeitpunkt noch zu irgendeinem anderen. Erstens arbeitete ich an meiner Dissertation, und zweitens war ich nicht der Typ, der heiraten wollte. Eines Abends ließ ich mich von einer anderen Doktorandin namens Laura überreden, mit ihr die letzte Aufführung von Der Hausmeister zu besuchen. Die Kritiker waren voll des Lobes über die Inszenierung (unter Frederick Wildes Händen gehen Humor und düstere Widerwärtigkeit eine Verbindung von schockierendem Feingefühl ein). Ich ließ die Vorstellung über mich ergehen, fand das Stück ganz furchtbar, und es war mir völlig schnuppe, ob der Regisseur Frederick Wilde oder Donald Duck hieß.
Laura hatte etwas mit dem Inspizienten, und so ergab es sich, dass wir nach der Aufführung zu einer Party eingeladen waren. Die Theaterleute waren zugegebenermaßen ein amüsantes Völkchen, und ich hatte wider Erwarten viel Spaß. Ein Schlaks in einem Tweedjackett stand im Mittelpunkt des allgemeinen Interesses.
»Wer ist das?«, fragte ich Lauras Freund.
Er folgte meinem Blick. »Das ist Freddie Wilde!«
»Wer?«
»Komm, ich mach euch bekannt. Du wirst ihn mögen.« Und mit diesen unwissentlich prophetischen Worten führte er mich zu meinem Schicksal.
Was mir als Erstes an Frederick auffiel, war seine Bescheidenheit. Die Leute hingen an seinen Lippen, aber er machte den Eindruck, als halte er ihre Geschichten für sehr viel spannender als seine eigene. Er hatte alles, was ich bewunderte, vielleicht alles, was ich nicht hatte: Kreativität und Humor und Nachsicht mit menschlichen Schwächen. Ich habe keine Ahnung, was er an mir fand. Er war zwölf Jahre älter als ich, aber das schien vollkommen unwichtig. Meine Eltern waren beunruhigt, ihnen passte der Altersunterschied überhaupt nicht, aber es dauerte nicht lange, bis sie Fredericks Charme erlagen. Kein Jahr später waren wir verheiratet und sind es vierzig Jahre später noch immer. Laura und ihr Inspizient trennten sich, eine Woche nachdem Der Hausmeister aus dem Programm genommen worden war.
Dieser elende Brief. Es hatte den Anschein, als vibriere der Deckel des Mülleimers, so als hätte ein Tier im Abfall gestöbert. Wer wusste es? Vielleicht wollte Scott uns nur wissen lassen, dass er uns nie wieder behelligen würde. Vielleicht enthielt der Brief die Ankündigung seines Selbstmords; das würde ihm ähnlich sehen – seine Schuld auf uns abzuwälzen.
Flotsam machte es sich im Sessel in der Ecke neben ihrer schlafenden Schwester bequem. Ben kletterte auf den hohen Hocker am Tisch, baumelte mit den Beinen und griff sich einen Keks. Frederick setzte sich ihm gegenüber.
»Kekse! Wie wunderbar«, sagte er und ignorierte taktvoll den Geruch nach Angebranntem.
»In der Zeitung steht eine Kritik über Scarlets Aufführung«, sagte ich und reichte ihm die Yorkshire Post. »Hier, lies selbst.«
Er stellte seine Tasse ab, setzte sich die Brille auf und studierte die Zeitung. Die Aufführung der Bootham-Laienspielgruppe hat viel Erfreuliches zu bieten … die Beleuchtung, die Musik … Ich beobachtete ihn beim Lesen, ich wusste, dass das Beste erst noch kommen würde.
»Oho!«, rief er triumphierend aus. »Scarlet Scott als Puck hat eine starke Präsenz und stiehlt den anderen in jeder Szene, in der sie auftritt, die Schau. Oh, das ist wundervoll! Gut gemacht, Scarletta!«
»Das wundert mich gar nicht.« Ich blickte ihm über die Schulter und las den Artikel ein weiteres Mal. »Sie ist das Glanzlicht jeder Aufführung. Genau wie ihre Mutter es war. Und so wie du es bist, wenn du schauspielerst.«
»Werden wir uns Scarlets Stück ansehen, Hannah?«, fragte Ben.
»Aber natürlich!«
»Hm.« Er dachte über diese Antwort nach, als er nach dem Konfitürenglas griff. »Wird Theo auch mitkommen?«
»Ganz bestimmt. Er wird das Stück mögen.«
»Wird es langweilig sein?«
»Nein, es ist ein sehr schönes Stück. Es handelt von Feen.«
»Und was noch wichtiger ist«, ergänzte Freddie, »wenn ihr ganz still sitzt und ruhig seid, gehen wir anschließend alle miteinander Pizza essen. Und danach Eis.«
»Na gut. Opa, glaubst du, Tür-Anna-Saures hat auch Pizza gegessen?«, fragte Ben, dessen große Leidenschaften Essen und Dinosaurier waren.
Freddie nickte. »Barbecuepizza mochte er am liebsten«, antwortete er ernsthaft.
Während die beiden eine unsinnige Diskussion über prähistorische Pizza führten, ging ich unruhig auf und ab. Der Brief im Mülleimer ließ mir keine Ruhe.
»Alles in Ordnung, mein Schatz?«, fragte Freddie. »Du isst ja gar nichts.«
»Ich achte eben auf mein Gewicht … ich will die Inflationsrate bremsen.«
Er kannte mich so gut.
»Es ist heute, nicht wahr?«, fragte er leise.
Ich nickte nur, und er schien noch einmal zehn Jahre zu altern. Er sah wie das aus, was er war: ein alter Mann, der niemals aufhören würde zu trauern. Er streckte die Hand aus und fuhr mir ein paar Mal über den Arm. Bläuliche Rinnsale verliefen kreuz und quer unter der dünnen Haut seiner Hand.
»Sie müssen ihn entlassen. Er hat seine Strafe verbüßt.«
»Er soll sich bloß nicht hier blicken lassen…«, knurrte ich.
»Das wird er nicht.«
»Wer denn?«, fragte Ben. Er kratzte mit seinem Messer im Konfitürenglas. »Wer soll sich nicht hier blicken lassen?«
»Den kennst du nicht, Schätzchen«, antwortete ich. Und das war die Wahrheit. Als Ben seinen Vater das letzte Mal gesehen hatte, war er ein Jahr alt gewesen.
»Wollen wir wieder rausgehen, Opa? Damit wir fertig werden, bevor Theo und Scarlet kommen.« Er stopfte sich den letzten Keks in den Mund und rutschte von seinem Hocker.
Ich kramte einen Strohhut für die Schneefrau aus dem Kleiderschrank hervor und versprach, ihr einen Besuch abzustatten, sobald sie fertig war.
»Ich werde den Fotoapparat mitbringen«, sagte ich, während Ben und Freddie sich in ihre Stiefel zwängten.
»Und einen Wollschal?«, bettelte Ben. »Schneefrauen tragen nämlich auch Schals.«
»Wie soll sie denn heißen, deine Schneefrau?«
Ben, der an der Tür zog und den eisigen Atem des Winters hereinließ, antwortete, ohne zu zögern: »Schneemami.«
Ich hätte weinen können.
Als sie draußen waren, räumte ich den Tisch ab und schenkte mir noch eine Tasse Tee ein. Er war noch immer da, der Brief, und wühlte sich durch den schmutzigen Untergrund. Ich hielt es nicht mehr aus. Ich langte in den Mülleimer, stocherte zwischen Teebeuteln, Haferbrei und widerlich klebrigen Toastresten herum und klaubte den Brief mit Zeigefinger und Daumen heraus. Etwas Bedrohliches ging von ihm aus.
Ich riss ihn auf und überflog ihn in aller Eile. Ich fühlte mich vergiftet.
Liebe Hannah, lieber Frederick …
Mir drehte sich schon nach dieser Anrede der Magen um. Liebe Hannah, lieber Frederick?
Ich weiß nicht, ob ihr die Briefe meines Anwalts erhalten habt, aber da er keine Antwort bekommen hat, hielt ich es für das Beste, euch selbst zu schreiben. Ich werde sehr bald aus der Haft entlassen. Wie ihr wisst, habe ich meine Kinder seit mehr als drei Jahren nicht gesehen, und ich kann nicht mit Worten beschreiben, wie sehr ich sie vermisse. Ihr habt sie nie hierhergebracht, und ich habe euch auch nie darum gebeten. Der Besucherraum eines Gefängnisses ist kein Platz für ein Familientreffen. Ich wollte nicht, dass die Kinder durchsucht und abgetastet werden, und ich wollte vor allem nicht, dass sie an ihren Vater als an einen Häftling denken.
Aber jetzt bin ich bald wieder draußen, und das ist etwas ganz anderes. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Und deshalb würde ich gern wissen, wo und wann ich sie sehen kann.
»Nur über meine Leiche«, sagte ich laut.
Es ist wichtig, dass sie mich kennenlernen. Sie müssen wissen, dass ihr Vater ein Mensch und kein Monster ist und dass ich meine Tat zutiefst bereue. Ich würde alles dafür geben, wenn Zoe noch am Leben und ich an ihrer Stelle gestorben wäre.
In diesem Punkt waren wir uns einig. In einer perfekten Welt wäre er jetzt tot – oder, besser noch, ausgelöscht aus der Geschichte, so als hätte er nie existiert.
Bitte schreibt mir an diese Anschrift, aber vergesst nicht, die Haftnummer auf dem Umschlag zu notieren, sonst kommt der Brief nicht an. Oder wendet euch an meinen Anwalt, Richard O’Brien in York. Falls ich nichts von euch höre, muss ich gerichtliche Schritte einleiten. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt.
Mit herzlichen Grüßen
Joseph Scott
Laut Datum war der Brief zwei Wochen alt. Anscheinend hatte es eine ganze Weile gedauert, bis er die nutzlose Briefkontrolle im Gefängnis durchlaufen und uns dann auf dem Postweg erreicht hatte. Egal. Ich würde weder ihm noch seinem verdammten Anwalt schreiben. Mir zitterten schon die Knie beim bloßen Anblick seiner Handschrift, weil ich unwillkürlich seine Hand, die Hand eines Mörders, sah, wie sie den Stift führte. Ich schnappte Brief und Umschlag und warf beides zurück in den Mülleimer.
Dann saß ich da und presste beide Hände auf den Mund. Ich würde auf keinen Fall weinen. Ich hatte schon so viele Tränen vergossen. Ich hatte geweint, bis meine Augen wund waren. Ich hatte in Dunkelheit gelebt, sogar mit dem Gedanken gespielt, mir das Leben zu nehmen. Alles nur seinetwegen.
Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als dass Joseph Scott für immer verschwinden würde.
VIER
Scarlet
Wenn ich erwachsen bin, möchte ich Schauspielerin werden. Das ist mein größter Wunsch. Viele Mädchen sagen, sie wollen Schauspielerin werden, aber die wenigsten schaffen das auch. Bei mir ist das anders. Mir liegt es im Blut.
Wir haben Videos von Mum von einem Bühnen- und sogar von einem Fernsehauftritt. Ihre bekannteste Rolle war die Melinda, die Antiheldin in der Miniserie Der letzte Postbote von Bosnien. Die Mädchen in der Schule haben noch nie von dieser Serie gehört, weil sie schon vor Jahren gelaufen ist. Aber Mrs. May, meine Englischlehrerin, hat sie bei der ersten Ausstrahlung gesehen, und sie sagt, meine Mutter habe die Melinda ganz hervorragend verkörpert. Sie sagte sogar, meine Mum sei »das Beste an dieser Produktion« gewesen. Ich denke, sie wollte mir damit zu verstehen geben, dass sie die Serie grottenschlecht fand, aber Mums Schauspielerei liebte.
Alle sagen, ich würde ihr sehr ähnlich sehen. An meinem dreizehnten Geburtstag habe ich mir die Haare abschneiden lassen. Opa war entsetzt, weil er mir immer so gern die Haare gebürstet hatte. Ich hätte so eine wunderschöne Haarfarbe, jammerten er und Hannah und der Frisör, und es sei ein Verbrechen, so lange Haare – sie gingen mir bis zur Taille – abzuschneiden. Sie machten ein ganz schönes Theater, aber Hannah hatte mir versprochen, ich könne mir die Haare schneiden lassen, wenn ich dreizehn wäre, und versprochen ist versprochen. Ich wollte eine Kurzhaarfrisur, einen Pixie-Cut so wie Mum, nur mit längeren Stirnfransen und kleinen Dreiecken vor den Ohren. Kurze Haare waren viel leichter zu pflegen.
Außerdem habe ich grüne Augen, und Mums kantiges Kinn habe ich auch geerbt, sagen die Leute, sodass ich in mancherlei Hinsicht wirklich aussehe wie sie. Da ist nur ein großes Problem: Sie war dünn, unheimlich dünn. Sie hatte nirgendwo auch nur ein Gramm Fett zu viel. Man konnte ihre Rippen sehen und auch ihre Beckenknochen, wenn sie tief sitzende Hipsterjeans trug. Sie sah nicht aus wie andere Mütter. Andere Mütter haben einen dicken Hintern oder einen Bauch, den sie rausstrecken, auch wenn sie noch so sehr versuchen, ihn einzuziehen oder unter figurformender Wäsche zu verstecken. Meine Mum war so jung und gertenschlank, dass sie die Tochter dieser Mütter hätte sein können. Sie müsse mehr essen, sagten die Leute immer zu ihr, und dann wurde sie jedes Mal richtig sauer. »Was fällt denen ein?«, murrte sie. »Das ist so was von unhöflich. Ich mache doch auch keine Bemerkungen über ihre schwabbeligen Oberarme.«
Jedenfalls habe ich anscheinend eine andere Art von Körper, denn ganz egal, wie wenig ich esse, wie viel Sport ich treibe, ich wachse und werde größer und größer, wie Alice im Wunderland, nachdem sie ein Stück von dem Pilz gegessen hat. Ich bin nicht dick, aber meine Figur ist ganz anders als die von meiner Mum. Ich habe sogar Brüste, was ich überhaupt nicht leiden kann. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich.
In der Woche, als es schneite, bauten Ben und Opa eine Schneefrau im Garten, und ich spielte den Puck im Little Theatre. Die letzte Aufführung fand an einem Sonntagnachmittag statt, und die ganze Familie kam und schaute zu. Opa und Hannah schickten mir einen Riesenstrauß zum Bühneneingang. Der gruselige alte Knabe, der sich Inspizient nannte, brachte ihn mir. Er warf mir einen anzüglichen Blick zu und meinte: »Du hast wohl einen Verehrer.« Er verdrehte die Augen, als ob ich mit demjenigen, der die Blumen geschickt hatte, schlafen würde. Ich hätte ihm am liebsten in die Eier getreten.
Die Aufführung lief fantastisch. Ich hatte den ganzen Tag damit verbracht, mich in meine Rolle hineinzudenken, und der Erfolg war, dass ich mich wirklich wie ein boshafter, fast ein wenig grausamer Kobold fühlte, der die Menschen für Narren hält. Ich will nicht eingebildet klingen, aber ich bekam eindeutig den meisten Applaus, als der Vorhang fiel. Ich war noch ganz aufgedreht, als ich das Theater verließ. Opa wartete am Bühneneingang auf mich, während Hannah mit den Jungs das Auto holen ging. Opa fiel allein schon durch seine Größe auf, und mit Tweedmantel und Schiebermütze sah er aus, als wäre er einem Agentenstreifen entsprungen. Da er ein bekannter Regisseur ist, ist er eine Berühmtheit am Little Theatre. Ich war stolz, dass er mich abholte. Er streckte mir beide Hände entgegen, die Handflächen nach außen, und ich klatschte ihn ab.
»Du hast die Leute zu Begeisterungsstürmen hingerissen«, sagte er. Ich sah Tränen in seinen Augen. Er wischte sie schnell weg und lächelte. »Und ich bin ein dummer alter Trottel.«
Ich glaube, er dachte an Mum. Ich legte meine Arme um ihn und drückte ihn fest. Ein Auto hupte. Es war Hannah. Theo beugte sich weit aus dem Fenster und brüllte: »Beeilt euch, ihr Trantüten!«, weil sie im absoluten Halteverbot standen.
Hannah und Opa gingen mit uns zu Antonio’s. Hannah sah ganz reizend aus. Sie ist immer noch hübsch für ihr Alter. Sie hat blaue Augen und eine duftige Bob-Frisur, die sie viel jünger als vierundsechzig aussehen lässt. Und sie ist verrückt nach Opa, richtiggehend verrückt nach ihm. Er braucht bloß neben ihr zu stehen, und schon strahlt sie vor Glück. Ihre Ohrringe funkelten im Kerzenlicht. Die Smaragde passten zu ihrem Verlobungsring. Sie waren ein Geschenk von Opa zu ihrem sechzigsten Geburtstag, und sie trug sie nur zu ganz besonderen Anlässen.
Wir waren alle gut gelaunt und fröhlich, und dann kam Ben und sagte etwas Dummes. Ich weiß nicht, was diesen Vierjährigen manchmal einfällt. Ich persönlich glaube ja, dass es ihm gegen den Strich ging, ausnahmsweise einmal nicht im Mittelpunkt zu stehen. Ben war zu früh auf die Welt gekommen, und Mum war nach seiner Geburt krank geworden. Aber jetzt ist er richtig süß mit seinen Sommersprossen und den flauschigen blonden Haaren. Er sieht eher wie ein Zwei- oder Dreijähriger aus und nicht wie ein Vierjähriger. Die Leute geraten bei seinem Anblick immer in Verzückung. Opa und ich unterhielten uns über die Kostüme, und ich merkte, dass Ben immer zappeliger wurde. Er überlegte, wie er die Aufmerksamkeit wieder auf sich lenken könnte.
»Hannah?«, winselte er in einem absolut nervtötenden Ton.
Hannah bat die Bedienung gerade, uns noch eine Flasche Wasser zu bringen, und hörte ihn daher nicht.
»Hannah, Hannah, Hannah!«, kreischte er.
»Ja, Schätzchen?« Sie wirkte ein bisschen genervt. »Du brauchst nicht gleich so zu schreien.«
Ben, der sich gerade ein großes Stück Pizza in den Mund geschoben hatte, spuckte beim Reden kleine Käsebröckchen aus. »Mm, Hannah«, nuschelte er mit vollem Mund, »mm, dürfen wir mit Fremden reden?«
»Halt die Klappe, Ben«, zischte Theo. Er war feuerrot angelaufen.
Hannah war ganz vernarrt in Ben, was nicht verwunderlich war, da sie und Opa sich um ihn kümmerten, seit er ein Jahr alt war. Die beiden sind praktisch seine Eltern. Ben ist ihr Baby. Und so säuselte sie mit liebevoller Stimme:
»Nein, mein Schatz, lieber nicht, es sei denn, es ist jemand in der Nähe, der euch im Notfall zu Hilfe kommen kann. Weißt du, es gibt sehr nette Leute, deshalb sollt ihr auch nicht unhöflich zu Fremden sein, aber leider gibt es auch schlechte Menschen. Und deshalb solltet ihr euch nie von einem Fremden ansprechen lassen, und auf keinen Fall solltet ihr Süßigkeiten annehmen oder in ein fremdes Auto steigen.«
Das war eine lange Antwort auf eine kurze Frage, und Ben hatte nicht eine Sekunde lang zugehört. Er warf ungeduldig den Kopf vor und zurück, und ich wusste, dass er auf Ärger aus war. Ich wusste es einfach.
»Dann dürfen wir also nicht mit Fremden reden?«, beharrte er.
»Warum fragst du?«
Theo ließ seine Gabel fallen und bückte sich unter den Tisch. Ben zog die Stirn kraus und setzte eine sorgenvolle Miene auf.
»Weil Theo heute mit einem Fremden geredet hat.«
»Wirklich?«, erwiderte Hannah unbekümmert. Noch machte sie sich keine Gedanken.
»Theo hat im Park mit einem Mann geredet. Ich hab ihm gesagt, dass wir das nicht dürfen. ›Wir dürfen nicht mit Fremden reden, Theo‹, hab ich zu ihm gesagt.«
Der Park liegt am Ende unserer Straße, der Faith Lane, unweit der Stadtmauer. Es gibt Schaukeln dort, ein kleines Karussell und ein Mini-Fußballtor. Weil er nur ein paar Schritte von unserem Haus entfernt ist, dürfen die Jungs allein dorthin gehen.
Opa und Hannah sahen erst sich an, dann guckten sie auf Theos leeren Stuhl und schließlich zurück zu Ben.
»Erzähl weiter«, brummte Opa mit gespielt grimmigem Gesicht.
Ben setzte seine Unschuldsmiene auf. »Na ja, ich saß auf der Schaukel, aber die war ganz nass vom Schnee, und deshalb hab ich Theo gefragt, ob er den Schnee nicht mit seinem Schal wegwischen könnte, aber er wollte nicht, weil er Fußball gespielt hat und den Ball ins Tor kicken wollte, und da ist dieser Mann aus einem großen …« Er machte eine Pause, um Luft zu holen, und wir schauten ihn gespannt an. Ben braucht eine Ewigkeit, um eine Geschichte zu erzählen. »Ähm, er ist aus einem großen, ähm, aus einem großen schwarzen Auto ausgestiegen und hat sich auf die Mauer gesetzt.« Eine weitere Pause zum Luftholen. Gekaute Pizzabröckchen flogen in alle Richtungen. »Und dann hat er uns stundenlang beobachtet.«
»Stimmt ja gar nicht!«, protestierte eine gedämpfte Stimme unter dem Tisch hervor. »Wir waren ja gar nicht stundenlang da!«
»Vielleicht hat sich der arme Kerl gar nicht für euch interessiert«, meinte Opa. »Vielleicht hat er nur auf jemanden gewartet.«
Ben warf ihm einen finsteren Blick zu. »Vielleicht hat er auf jemanden gewartet, aber er hat uns beobachtet. Als Theo den Ball zu der Mauer dribbelte, hat er Hallo zu Theo gesagt, und dann, und dann …«
»Halt die Klappe, Ben!«, schrie Theo.
»Und dann hat Theo auch Hallo zu ihm gesagt.«
»Hab ich nicht!«
Opa hob das Tischtuch ein Stück an und warf einen Blick unter den Tisch. »Schon gut, Theo. Es ist kein Verbrechen, Hallo zu jemandem zu sagen.«
»Aber es ist ein Verbrechen, Hallo zu einem Fremden zu sagen.« Ben machte ein selbstzufriedenes Gesicht. »Und das war noch nicht alles. Der Mann hat gesagt: ›Du kannst aber gut mit dem Ball umgehen.‹ Und dann hat Theo gesagt …«
»Ich bring dich um, Ben Scott!«
»Dann hat Theo gesagt: ›Danke, ich hab viel geübt.‹ Und dann hat er ihm ein paar von seinen Kunststücken vorgeführt, und dann haben sie ganz viel über Fußball geredet. Und das ist mit einem Fremden reden! Und da bin ich zu ihnen gegangen und hab gesagt…« Ben warf sich in die Brust. »Da hab ich gesagt, wir dürfen nicht mit Fremden reden, auf gar keinen Fall, und Sie sind ein Fremder, und wenn Sie nicht sofort aufhören, mit uns zu reden, und weggehen, lauf ich nach Hause und hole meine Oma, die wohnt da drüben, und dann kommt sie und steigt Ihnen aufs Dach, und sie ruft die Polizei. Da hat der Mann ein erschrockenes Gesicht gemacht und gesagt: ›Das wollen wir doch nicht, oder?‹ Und dann ist er in dem schwarzen Auto weggefahren.«
»Gut gemacht, Ben.« Hannah fuhr ihm durch seine Locken. »Das hast du genau richtig gemacht.«
Aber Bens Geschichte war noch nicht zu Ende. »Aber vielleicht war der Mann doch kein Fremder. Vielleicht war er ein Kein-Fremder.«
»Warum?«, fragte Hannah. »Hast du ihn schon mal gesehen?«
»Nein, aber ich glaub, er hat uns schon mal gesehen.«
»Wie kommst du darauf?«
»Weil er gesagt hat: ›Wiedersehen, Ben, Wiedersehen, Theo!‹ Und dann ist er ins Auto gestiegen. Dann hat er den Motor angelassen. Aber er ist immer noch nicht losgefahren. Er hat das Fenster aufgemacht und sich hinausgelehnt, und dann hat er gesagt …« Ben musste ein weiteres Mal Luft holen. Er hatte sein Publikum ganz in seinen Bann geschlagen. »Dann hat er gesagt: ›Wie geht’s Scarlet?‹«
»Wirklich?« Ich war hocherfreut. »Dann war’s bestimmt jemand vom Theater.«
»Theo hat ihn gefragt, woher er Scarlet kennt, aber er hat nur gelächelt und ist weggefahren.«
»O mein Gott«, flüsterte Hannah. Sie sah wütend aus, aber irgendwie hatte ich nicht das Gefühl, dass sie wütend war. Ich kannte diesen Gesichtsausdruck, ich hatte ihn schon einmal bei ihr gesehen, als Theo nicht von der Schule nach Hause gekommen war. Sie hätte fast die Polizei angerufen, aber dann stellte sich heraus, dass Theo zu einem Freund gegangen war und nur vergessen hatte, es ihr zu erzählen.
»Mach dir keine Gedanken, Hannah«, sagte ich, um sie zu beruhigen. »Das war sicher jemand vom Theater oder von der Schule oder … ich weiß auch nicht. Das kann irgendwer gewesen sein.«
»Wie sah dieser Mann aus, Ben?«, fragte sie.
Ben konnte nicht antworten, weil er sich so viel Pizza in den Mund gestopft hatte, dass seine Backen ganz dick waren.
»Du bist ein verfressenes kleines Schweinchen, Ben«, sagte ich.
Er machte ein weinerliches Gesicht, und ich hatte ein schlechtes Gewissen. Auch wenn er ein verwöhnter Balg ist – ich möchte seine Gefühle nicht verletzen. Wir drei müssen doch zusammenhalten.
Opa beugte sich ein zweites Mal unter den Tisch.
»Komm wieder raus, junger Mann. Alles in Ordnung. Niemand wird dir den Kopf abreißen.« Als Theo wieder an seinem Platz saß, fragte Opa ihn: »Und jetzt erzähl mal. Hast du diesen Mann gekannt?«
»Nein«, murmelte Theo. »Weiß nicht. Und du halt endlich die Klappe, Ben. Ich hab nichts gemacht. Ich bin nicht in sein Auto eingestiegen, und ich habe keine Süßigkeiten von ihm genommen. Er hat gesagt, meine Beinarbeit sei klasse, und es wäre doch unhöflich gewesen, wenn ich nichts darauf geantwortet hätte. Ihr sagt doch immer, gutes Benehmen ist das A und O.«
Opa blinzelte. »Äh, ja, das ist richtig. Gutes Benehmen ist sehr wichtig.«
»Und wenn er nun ein Talentsucher war? Dann hätte Ben, dieses Großmaul, mir nämlich eine Riesenchance verdorben.«
»Du bist unser Champion«, sagte Opa und legte seinen Arm um Theos Schultern. »Meinst du, du kannst mir diesen Talentsucher beschreiben?«
Theos Gesichtsausdruck wurde noch eine Spur durchtriebener. »Oh, äh, weiß nicht. Ich glaub, ich hab ihn irgendwo schon mal gesehen. Er sah ein bisschen aus wie, äh, wie der Typ dort drüben, der Pizzabäcker.«
Wir guckten alle hin. Antonios Koch stand an dem großen Backofen und backte unermüdlich eine Pizza nach der anderen. Er war ungefähr in Hannahs Alter, irgendwo zwischen sechzig und siebzig, und hatte eine Glatze unter der Kochmütze. Er lächelte unentwegt, so als täte er nichts lieber, als mit Pizzateig zu hantieren. Eigentlich sah er selbst wie Pizzateig aus.
»Nein, gar nicht wahr! Er hat überhaupt nicht so ausgesehen!«, schrie Ben. »Er war viel, viel, viel dünner und viel jünger. Der da drüben ist ein fetter alter Mann!«
»Pssst!«, machte ich. Ich spürte, wie ich rot wurde.
»Er war dünner«, krakeelte Ben. »Und er hatte ganz viele schwarze Haare. Und er hatte eine runde Brille wie Harry Potter.«
Hannah starrte Opa an. Opa starrte Hannah an. Dann tat Opa etwas wirklich Sonderbares. Er stand wortlos auf, ging in seinem Altmännergang um den Tisch herum und kniete sich neben Hannah auf den Fußboden. Er nahm ihre Hände in seine beiden und drückte sie an seine Wange.
»Ich glaube, wir sollten die Polizei rufen«, flüsterte Hannah.
Ich sollte das nicht hören, deshalb tat ich so, als hätte ich nichts gehört.
»Wenden wir uns lieber an seinen Anwalt«, sagte Opa. »Soll er sich mit ihm in Verbindung setzen. Das ist nicht so aggressiv.«
»Ich glaube kaum, dass er in der Position ist, uns aggressives Verhalten vorzuwerfen.«
Dann sagte sie noch etwas über jemanden, der seine Strafe voll und ganz verbüßen müsse, und ich fragte mich, wen sie damit meinte.
Opa beugte sich unvermittelt vor und nahm Hannah fest in seine Arme. Das war entsetzlich peinlich, weil in diesem Moment die Bedienung kam, um unseren Tisch abzuräumen. Ich hatte sie vorher noch nie gesehen, aber wie alle Kellnerinnen im Antonio’s war sie erstens bildhübsch und zweitens ganz in Schwarz gekleidet.
»Opa!«, zischte ich.
Ich hätte im Boden versinken mögen, aber die Kellnerin schien sich nicht an der merkwürdigen Szene zu stören.
»Oma und Opa haben euch wohl zum Essen eingeladen, hm?«, meinte sie. »Hat wer Geburtstag?«
»Äh, nein«, antwortete ich. »Ich habe in einem Stück mitgespielt und …«
Ben ließ seinen Charme spielen und klimperte mit seinen langen Wimpern. »Ich bin viereinhalb«, quietschte er. »Vier Jahre und … und ein halbes Jahr!«
»Viereinhalb!« Sie tat, als wäre sie völlig baff, so wie es Erwachsene eben machen. Aber was soll das? Ich meine, wir sind schließlich alle viereinhalb gewesen. Wäre Ben einhundertviereinhalb, dann hätte er damit angeben können.
»Wow, so ein großer Junge! Dann gehst du ja bald zur Schule, oder?«
»Im Januar«, sagte ich. »Hoffentlich bringen sie ihm dort Manieren bei.«
Sie nahm meinen Teller. »Ich finde es toll von euren Großeltern, dass sie mit euch essen gehen. Dann haben Mum und Dad mal einen Abend für sich, nicht wahr?«
»Mhm«, pflichtete ich ihr bei.
»Genau.« Theo nickte wie wild. »Einen Abend für sich.«
»Wir haben keine Mum«, krähte Ben. »Sie ist im Himmel. Und mein Dad ist ein ganz, ganz böser Mann. Er ist für viele, viele Jahre im Gefängnis, weil er sie totgemacht hat.«
Theo und ich zuckten zusammen. Wir sagen nie die Wahrheit über unsere Eltern. Niemals. Die Leute wollen das nicht wissen. Sie können nicht damit umgehen. Ben wird das auch noch lernen.
Die Bedienung machte erwartungsgemäß ein Gesicht, als sei sie vom Blitz getroffen worden. Wahrscheinlich wünschte sie, sie könnte sich in irgendeinem Loch verkriechen.
»Oje«, stammelte sie. »Das ist aber schlimm. Ach herrje. Gut, dann … äh, möchte jemand Nachtisch?«
In dieser Nacht machte Theo wieder ins Bett. Nach Mums Tod hatte er damit angefangen, aber es war seit über einem Jahr nicht mehr passiert. Wir dachten wirklich, er hätte es überwunden. Aber anscheinend hatten wir uns geirrt.
FÜNF
Joseph
»Ich hab dir doch gleich gesagt, dass das eine beschissene Idee ist, Alter.« Akash knallte eine Schachtel Cornflakes vor seinen Freund auf den Tisch. »Das war das letzte Mal, dass ich dir meine Karre geliehen hab. Du bist erst drei Tage draußen und kannst von Glück reden, dass sie dich nicht schon wieder eingelocht haben.«
»Tut mir leid«, brummte Joseph und schenkte sich einen Becher Kaffee ein. Er trank ihn schwarz. Es war Montagmorgen. Er fühlte sich elend und schmuddelig. Nach seinem Besuch in der Faith Lane hatte er mit Akash ein paar Bierchen getrunken. Aber nicht einmal in dem vom Alkohol benebelten Zustand hatte er Frieden gefunden. Er hatte es nicht verdient, Frieden zu finden. Zoe verfolgte ihn, er sah sie vor sich, wie sie immer und immer wieder starb, die Augen wie loderndes grünes Feuer in dem abgehärmten Gesicht.
Akash wechselte das Thema. »Ich hab ein Auto für dich aufgetrieben. Einen Fiesta, hat eine Million Meilen auf dem Tacho. Fünfhundert wollen sie dafür.«
»Ist er sauber?«
»Ist er sauber?«, echote Akash mit einem Ausdruck gekränkter Würde. »Das trifft mich jetzt aber, Alter, das trifft mich wirklich.«
»Bei deinem Vorstrafenregister hat man die Karre vermutlich aus zehn verschiedenen Autos zusammengeschweißt, mit neuen Nummernschildern versehen und neu lackiert.«
»Nein, sie ist wirklich sauber.« Akash machte ein Gesicht, als überraschte ihn das selbst. »Die haben sämtliche Papiere. Eins der Mädels von meinem Reinigungstrupp hat mir erzählt, dass ihre Schwester die Kiste verkaufen will, weil sie Zwillinge bekommt und ein größeres Auto braucht. Wir können es uns heute Abend ja mal ansehen, wenn du Interesse hast.«
»Das wär fantastisch«, erwiderte Joseph. »Danke, Mann.«
Akash schaufelte sich mit der einen Hand Cornflakes in den Mund und öffnete mit der anderen seine Post. Joseph hatte ihn um drei Uhr morgens aus dem Bett springen hören. Dann hatte er die Wohnung verlassen und war zur Arbeit gefahren, wo er sechs Stunden lang ein Heer von Angestellten beaufsichtigte und gleichzeitig selbst mit dem Staubsauger hantierte. Jede seiner Bewegungen war effizient, seine Kleidung gebügelt, die schwarzen Haare tadellos frisiert. Er war eher klein – ungefähr einen Meter fünfundsechzig, hatte er Joseph einmal erzählt –, aber energiegeladen.
»Diese Halsabschneider!«, schimpfte er. »Guck dir das an – die Elektrizitätswerke wollen uns wohl verarschen! Das Beste am Knast ist, dass du nie Rechnungen bekommst. Und, was hat dein Bewährungsfuzzi gesagt, als du ihn angerufen hast?«