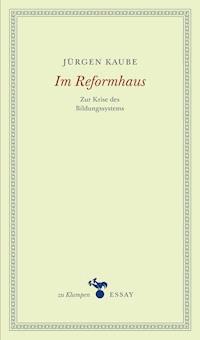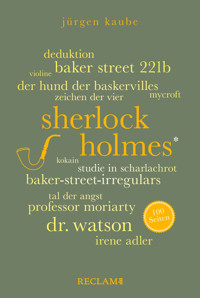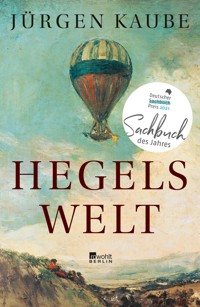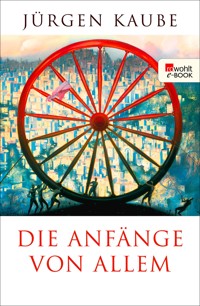
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Seit wann gibt es den aufrechten Gang, und wie entstand das Wunder der Sprache? Wie kamen Religion, Recht, Kunst, Geld, Musik oder Städtebau in die Welt? Wann begannen die Menschen, ihre Toten zu bestatten, und warum schätzen die meisten Kulturen die Monogamie? Jürgen Kaube gibt Antworten auf diese Fragen, die uns in politischen und kulturellen Konflikten oft bis heute beschäftigen, und erzählt in aufregender Weise von den Anfängen der Menschheit. Da ist etwa das Rätsel Sprache: Sie ist evolutionär nicht erklärbar, nicht einmal Menschenaffen haben einen zum Sprechen ausreichenden Rachenraum; ging Sprache womöglich aus dem Schmatzen hervor, als Nebeneffekt der Nahrungsaufnahme? Oder später die Schrift: Sie wurde keineswegs erfunden, um Gesprochenes festzuhalten, sondern kam um 3500 v. Chr. in Mesopotamien in die Welt – als bürokratische Merkhilfe beim Rinderzählen. Und das erste Geld um 700 v. Chr. diente nicht dem Handel, sondern als religiöse Opfergabe – rührt daher seine kultische Verehrung? Jürgen Kaube, Herausgeber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» und renommierter Wissenschaftsautor, schildert spannend, aufschlussreich und immer wieder überraschend, wie die menschliche Kultur entstand – ein Buch über die Anfänge all dessen, was Menschsein für uns heute ausmacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 585
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Jürgen Kaube
Die Anfänge von allem
Über dieses Buch
Was uns ausmacht – und wie alles begann: eine spannende Entdeckungsreise zu den Ursprüngen der Zivilisation
Seit wann gibt es den aufrechten Gang, und wie entstand das Wunder der Sprache? Wie kamen Religion, Recht, Handel, Geld, Musik oder Städtebau in die Welt? Wann begannen die Menschen, ihre Toten zu bestatten, und warum schätzen die meisten Kulturen die Monogamie? Jürgen Kaube gibt Antworten auf diese Fragen, die uns in politischen und kulturellen Konflikten oft bis heute beschäftigen, und erzählt in aufregender Weise von den Anfängen der Menschheit.
Da ist etwa das Rätsel Sprache: Sie ist evolutionär nicht erklärbar, nicht einmal Menschenaffen haben einen zum Sprechen ausreichenden Rachenraum; ging Sprache womöglich aus dem Schmatzen hervor, als Nebeneffekt der Nahrungsaufnahme? Oder später die Schrift: Sie wurde keineswegs erfunden, um Gesprochenes festzuhalten, sondern kam um 3500 v. Chr. in Mesopotamien in die Welt – als bürokratische Merkhilfe beim Rinderzählen. Und das erste Geld um 700 v. Chr. diente nicht dem Handel, sondern als religiöse Opfergabe – rührt daher seine kultische Verehrung? Jürgen Kaube, Herausgeber der FAZ und renommierter Wissenschaftsautor, schildert spannend, aufschlussreich und immer wieder überraschend, wie die menschliche Kultur entstand – ein Buch über die Anfänge all dessen, was Menschsein für uns heute ausmacht.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, September 2017
Copyright © 2017 by Rowohlt·Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Frank Ortmann, Berlin
Umschlagabbildung Invention of the Wheel: © by Vladimir Kush. All Rights Reserved.
Karte Peter Palm, Berlin
ISBN 978-3-644-11971-0
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Einleitung: Das Rad
Erstes Kapitel Bodenständig, tragfähig, treu: Der Anfang des aufrechten Gangs
Zweites Kapitel Die Zeit der Zähne und die Zeit der Feste: Der Anfang des Kochens
Drittes Kapitel Röhrende Hirsche, die am Stammtisch leiser werden: Der Anfang des Sprechens
Viertes Kapitel Dieses Spiel geht nur zu dritt: Der Anfang der Sprache
Fünftes Kapitel Die Schönheit des Schmucks, des Sexes und der wilden Biester: Der Anfang der Kunst
Sechstes Kapitel Von Toten und Tieren: Der Anfang der Religion
Siebtes Kapitel Baby, don’t cry, you’ll never walk alone: Der Anfang der Musik und des Tanzes
Achtes Kapitel Weizen, Hunde und die Nichtreise nach Jerusalem: Der Anfang der Landwirtschaft
Neuntes Kapitel Jemand hatte vor, eine Mauer zu bauen: Der Anfang der Stadt
Zehntes Kapitel Die Königsmafia: Der Anfang des Staates
Elftes Kapitel Buchhaltung mit gravierenden Folgen: Der Anfang der Schrift
Zwölftes Kapitel Störungen der Impulskontrolle: Der Anfang des geschriebenen Rechts
Dreizehntes Kapitel Von der Hand in den Kopf und zurück: Der Anfang der Zahlen
Vierzehntes Kapitel Die Göttin hat unten am Meer das letzte Bordell vor dem Jenseits: Der Anfang des Erzählens
Fünfzehntes Kapitel Zigaretten oder unendliche Lösung? Der Anfang des Geldes
Sechzehntes Kapitel In guten wie in schlechten Zeiten: Der Anfang der Monogamie
Epilog Am Ende der Anfänge
Anhang
Literatur
Zeittafel
Dank
Bildnachweis
Tafelteil I
Tafelteil II
Tafelteil III
Für Ida, Emma und Henri
Ein Ganzes ist, was Anfang, Mitte und Ende hat. Ein Anfang ist, was selbst nicht mit Notwendigkeit auf etwas anderes folgt, nach dem jedoch natürlicherweise etwas anderes eintritt oder entsteht.
Aristoteles
Wenn der Spürhund zwischen zwei Wegen zögert, so kehrt er zum Menschen zurück. DENKE … scheint er ihm zu sagen, DAS IST DEINE ANGELEGENHEIT.
Paul Valéry
Einleitung:Das Rad
Wer die Laterne trägt, stolpert leichter, als wer ihr folgt.
Jean Paul
Die wichtigsten Erfindungen haben keine Erfinder. Wir kennen den Menschen nicht, der als erster aufrecht ging oder der als erster ein Wort sagte, wir kennen die Gemeinschaft nicht, die als erste einem unsichtbaren Wesen huldigte oder die als erste tanzte. Wie hieß die erste Stadt? Wer nahm als Erster ein Geldstück an und machte es dadurch überhaupt erst zu Geld? Wo lebte das erste monogame Paar?
Dass alle diese Fragen unbeantwortet bleiben müssen, liegt nicht nur an unserer Unkenntnis. Es liegt also nicht nur an der Ferne der Zeiten, in die wir aus Mangel an Überbleibseln nicht mehr ausreichend genau blicken können, um zu sehen, wer mit diesen Dingen wann und wo genau angefangen hat. Vielmehr können wir uns nicht einmal vorstellen, dass sie überhaupt von einzelnen Menschen erfunden worden sind.
Lange allerdings hat es sich die Menschheit so vorstellen wollen. Prometheus soll das Feuer gebracht, Kain oder Marduk sollen die erste Stadt gegründet haben, Dädalus und Ariadne wird der erste Tanz zugeschrieben, dem ägyptischen Gott Thot, der bei den Griechen zu Hermes wurde, die Erfindung der Schrift, und der Anfang der Religion lag selbstverständlich bei Gott, als er sagte: «Lasset uns einen Menschen machen», ohne dass wir genau wüssten, zu welchem «uns» er da sprach.
Solche Erzählungen stammen aus einer Zeit, die annahm, dass in der Vergangenheit ohnehin mehr gewusst wurde als in der Gegenwart – im Grunde alles. Insofern waren die Anfänge für sie voller Erkenntnis und geheimnisvoll zugleich. Gesellschaften, die von Adelsfamilien beherrscht sind, haben naheliegenderweise eine Präferenz für alte Herkünfte: je älter, desto besser. Berühmt ist die witzige Umkehr dieser Logik durch den englischen Priester John Ball: «Als Adam grub und Eva spann, wo war denn da der Edelmann?» Doch auch diese Polemik hält den Primat des Anfangs fest: Wenn in ihm kein Edelmann war, dann herrschte eben ursprünglich Gleichheit, woraus sich Ansprüche auf Gleichheit auch später ergeben sollten.
Weil am Anfang die Erkenntnis noch klar und umfassend war, so der schöpfungstheologische Gedanke, war der Anfang überhaupt fähig, für alles Weitere prägend zu sein. Adam beispielsweise war für die Theologen anderthalbtausend Jahre lang nicht nur der erste, sondern auch der wissendste Mensch. Man stellte sich ihn nicht bloß als Erfinder der Schrift, sondern sogar als Verfasser gelehrter Werke vor, die nur leider mitsamt den Bibliotheken, die es damals gegeben habe, in der Sintflut untergegangen seien. Überboten wurde dieses Denken noch von Theologen, die sich Unzulänglichkeiten Adams allein damit zu erklären vermochten, dass es präadamitische Menschen gegeben haben müsse, die noch mehr wussten.[1]
Eine spätere, eine philosophische Tradition sah von mythischen Namen ab, ja von Namen überhaupt, erzählte aber nach wie vor von den Ursprüngen. Auch ihre Erzählungen verlegten das vermutete Wesen der sozialen Erfindungen in deren Anfang. «Der Mensch begann als Mensch, und das war der Anfang und das Ende davon.»[2] Allerdings fehlten für diese Anfänge bis weit ins neunzehnte Jahrhundert hinein jegliche Zeugnisse, und die Aussagekraft der Bibel, die lange als ein solches Zeugnis betrachtet worden war, litt zunehmend unter der wissenschaftlichen Beschäftigung mit ihrem Text. Da die ersten Menschen so wenig wie die Indianer über Schrift verfügten, hieß es beispielsweise, könnten die Ursprungsberichte keinesfalls von ihnen selbst stammen.[3] Außerdem berichte die Genesis ja fast nichts über die damaligen gesellschaftlichen Umstände.
Also konstruierte man seit Beginn der Neuzeit philosophische Modelle des Anfangs und nannte die Gesamtheit seiner Bedingungen den «Naturzustand». Dieser status naturalis sollte dem Menschen zeigen, wie er unter Abzug aller zivilisatorischen Leistungen dasteht. Er stand dann ziemlich bedürftig da, um es vorsichtig zu sagen. Die philosophische Aufgabe war, aus diesem wenig befriedigenden Zustand hervorgehen zu lassen, was ihn überwand: Herrschaft, Arbeitsteilung, Eigentum, Verträge, Moral und so weiter. Allerdings steckten die Geschichten, die davon erzählt wurden, voller Widersprüche und Zumutungen.
Nehmen wir nur – und in aller Kürze – die berühmteste von ihnen, den Naturzustand bei Thomas Hobbes, dem englischen Theoretiker des modernen Staates. Ihm zufolge entsteht der Staat, weil der Naturzustand, in dem es nur Einzelne und ihre Fähigkeit zur Gewalt gibt, ein «Krieg aller gegen alle» ist, aus dem für die Einzelnen nichts als Unsicherheit, Elend und Tod hervorgehen. Also schließen am Anfang alle einen Vertrag miteinander, in dem sie ihren Anspruch, die eigenen Interessen durchzusetzen, an einen Herrscher abtreten, der um des Friedens willen alle Gewalt monopolisiert. Doch setzt ein anfänglicher Vertragsschluss nicht schon dasjenige Vertrauen in die Vertragstreue der anderen voraus, von dem behauptet wird, im Naturzustande existiere es nicht? Später wurde das so formuliert: Vertragliche Grundlagen von Verträgen gibt es nicht, ein Vertrag kann also nicht am Anfang des gesellschaftlichen Lebens gestanden haben. Was andererseits soll man sich unter einem Krieg aller gegen alle vorstellen? Wäre der Urmensch nicht damit überfordert gewesen, buchstäblich jeden zum Feind zu haben?
Die Modelle vom Naturzustand waren nur eine Zwischenlösung, was die Überlegungen zu den zivilisatorischen Anfängen angeht. Ihre wichtigste Leistung war nicht, eine zufriedenstellende Antwort auf die Frage gegeben zu haben, wie soziale Ordnung entstand.[4] Folgenreich war vielmehr die Wertungsumkehr, die sie vornahmen: Adam war in diesen Gedankenspielen kein Weiser mehr, sondern ein Wilder. Das minderte nicht das Interesse an ihm und den Ursprüngen, aber es setzte einen anderen Akzent. Am Anfang sollte nicht die Fülle gewesen sein, sondern die Armut und ein Haufen Probleme für Wesen, die sich in der Natur auf sich selbst gestellt behaupten mussten. Im achtzehnten Jahrhundert kam die Vorstellung auf, dass die wilden Völker, deren Existenz die europäische Expansion nach und nach zur Kenntnis brachte, den Schlüssel zu den Anfängen der Menschheitsgeschichte bieten, die sich von diesen Ursprüngen durch technologischen und sozialen Fortschritt immer mehr entfernt habe. Das war ein Gedanke, der in wissenschaftlicher Form noch im zwanzigsten Jahrhundert ganz lebendig war, «primitive Völker» wurden als «unsere zeitgenössischen Vorfahren» tituliert.[5]
Dazwischen aber lag das neunzehnte Jahrhundert, das in Bezug auf die Frage nach den Anfängen das Jahrhundert Darwins genannt werden muss. Die Evolutionstheorie, die durch Charles Darwin angestoßen wurde, hat uns eine Sprache für alle Zweifel an einfachen, erzählerisch ergiebigen Anfangsspekulationen bereitgestellt. Denn seit Darwin haben wir Begriffe dafür, dass die zivilisatorisch bedeutsamen Dinge nicht fertig aus der Hand eines Erfinders entspringen und sich auch nicht einer problematischen Situation als deren Lösung verdanken – sondern in geduldiger Vorleistung zufallsbehafteter Schritte davon abhängen, dass kleine Veränderungen hier und da und unter Nutzung unfassbar langer Zeiträume irgendwann zu einem sichtbaren Unterschied führen, der nachträglich als Ursprung gedeutet werden kann. Seit Darwin wissen wir, dass ein Anfang Millionen Jahre dauern kann und dass ihm schon deshalb meistens keine Absicht und kein Plan zugrunde lagen.
Seit Darwin und den Geologen des neunzehnten Jahrhunderts, die mittels stratigraphischer Forschungen über Gesteinsschichten das Alter der Erde abschätzten, wissen wir auch, wie groß die Zeiträume sind, in denen alles angefangen hat, wie wenig wir über Anfänge wissen, die keine Fossilien hinterlassen haben, und wie mühselig darum die Rekonstruktion unserer Vorgeschichte ist. Auf einigen Gebieten schossen damals die philosophischen Theorien darüber, was am Anfang war, so sehr ins Kraut, dass es manchen Wissenschaftlern zu viel wurde. Es gab schließlich noch anderes zu erforschen als Anfänge: Tatsachen, Strukturen, Funktionen, Fortschritte. Schon 1866 untersagte es sich die «Société de linguistique de Paris» per Beschluss, jemals wieder eine Preisfrage nach dem Ursprung der Sprache zu stellen. Im Zuge des späten achtzehnten und des neunzehnten Jahrhunderts also bekam die Forschung ein Gefühl dafür, was man alles wissen müsste, um von den Anfängen der Geschichte und der Zivilisation sinnvoll zu reden. Erst allmählich entstanden Disziplinen wie die Paläontologie, die Archäologie, die Ur- und Frühgeschichte, die versuchten, das Reden über weit entlegene Zeiten empirisch zu fundieren.
Immer mehr Zeugnisse frühester Kulturen wurden in der Zeit zwischen 1800 und 1950 erschlossen. Die ersten Ausgrabungen in Pompeji beginnen 1748, im Bergwerk von Hallstatt finden seit 1824 Forschungen statt, der Neandertaler wird 1856 gefunden, drei Jahre zuvor die Pfahlbauten am Zürichsee, zwischen 1849 und 1859 erscheinen die «Denkmaeler aus Aegypten und Aethiopien» von Karl Richard Lepsius. Die Anschauungen von der Antike wie der «Urzeit» wurden also auf allen Gebieten kontrastreicher, die «wilden», unwahrscheinlichen Herkünfte des Europäers plausibler. 1836 prägt der dänische Archäologe Christian Jürgensen Thomsen die Begriffe «Stein-», «Eisen-» und «Bronzezeit». Über den Ursprung der Familie und die Frage, ob die Monogamie oder die Polygamie, das Mutterrecht oder das Vaterrecht, Kommunismus oder Privatbesitz am Beginn der menschlichen Geschichte standen, wurden endlose Kontroversen geführt. 1884 publizierte Friedrich Engels seine Schrift «Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats», in der er sich mit den ethnologischen und rechtshistorischen Forschungen seiner Epoche auseinandersetzte. Die Stadt Uruk, von der wir heute wissen, dass sie der Fundort der ersten Schrift ist, wurde 1849/50 zum ersten Mal erforscht. 1868 entdeckte ein spanischer Jäger die Höhlen von Altamira, doch es dauerte noch fast ein Vierteljahrhundert, bis anerkannt wurde, dass es sich hier um früheste Malerei der Steinzeit handelte. Die Überreste der ältesten Sammlung von Rechtssätzen, des Codex Ur-Nammu, wurden 1952 und 1965 gefunden. Dass die Lyder die Ersten waren, die Münzgeld verwendeten, ist ebenfalls seit dem neunzehnten Jahrhundert bekannt, aber die Debatte darüber, ob es nicht auch schon vorher Geld gab, reicht bis zu Bernhard Laums Schrift «Heiliges Geld» von 1924. Über den Ursprung der Religion wurde Ende des neunzehnten Jahrhunderts diskutiert: Lag er im Animismus, wie der britische Archäologe Edward Burnett Tylor 1871 formulierte, also in der Vorstellung, nicht nur Menschen hätten eine Seele, sondern jedes Ding? Oder war der Präanimismus ursprünglicher, wie der schottische Ethnologe James Frazer 1890 annahm, indem er behauptete, dass für die ersten Religionen eine unpersönliche Kraft alle Dinge beherrsche?
Kurzum: Das Jahrhundert Darwins und der historischen Religionswissenschaft, der Sprach- und Rechtsgeschichte sowie der Archäologie leuchtete die älteste Vergangenheit mehr und mehr aus. Wie aber steht es nun heute? Die Forschung über die Frühzeit menschlicher Zivilisation hat philosophische Spekulation durch Kohlenstoffchemie, Genetik, Philologie, Soziologie und Materialkunde ersetzt. Die Methoden des neunzehnten Jahrhunderts sind unendlich viel raffinierter geworden, der Zuwachs an technologischen Möglichkeiten der Analyse von sehr alten Befunden ist enorm. Es gibt inzwischen Spezialisten für Anfänge.
Im Folgenden soll es um das gehen, was wir heute von den Anfängen zivilisatorischer Errungenschaften wissen. Was wissen wir über den Anfang des aufrechten Gangs, der Sprache, des Tanzes, der Stadt, des Geldes, der Religion, der politischen Herrschaft oder des Epos? Auf der Suche nach wissenschaftlich plausiblen Antworten, das werden wir sehen, verschwinden weder die philosophischen Fragen nach den Anfängen, noch werden alle Lücken geschlossen, die sich aus der Ferne der Anfangszeiten ergeben. Beides, das philosophische Interesse wie das Unwissen, nimmt durch Forschung nur eine andere, besser diskutierbare Form an. Es ist die Forschung, die uns das Denken lehrt, weil sie ständig auf neue Möglichkeiten stößt und am prähistorischen Tatort wie ein Detektiv die Bedeutung der Relikte untersucht, um zu fragen: «Könnte es nicht auch so gewesen sein?» Den Sinn für diese Art des Fragens zu wecken, ist das Ziel der folgenden Kapitel.
Auf dem Umschlag dieses Buches ist eine Erfindung zu sehen, die im Buch selbst gar nicht vorkommt: das Rad. Es kommt nicht vor, weil es in diesem Buch nicht um die Anfänge technischer Erfindungen gehen soll. Schrift, Kunst, Recht oder Sprache sind nicht im selben Sinne Techniken wie das Rad. Denn man kann zwar ein Rad verwenden, ohne in Kommunikation und soziale Beziehungen einzutreten, aber mit den hier thematisierten Erfindungen kann man das nicht. Selbst der aufrechte Gang, das wird sich zeigen, ist eine gesellschaftliche Errungenschaft.
Gleichwohl ist das Rad für einen Aspekt der Anfänge, um die es hier geht, geradezu exemplarisch. Denn es kommt in der Natur nicht vor. Den Hammer hat man als «Organprojektion» nach dem Vorbild der geballten Faust erklärt, die Mühlsteine aus dem Gebiss und die mechanischen Hebel aus den Armen. Selbst der Löffel, den noch Nikolaus von Kues als originäre Erfindung menschlicher Konstruktion bezeichnet hat, mag auf die hohle Hand zurückgeführt werden.[6] Doch für das Rad – ein Gebilde, das sich um 360 Grad dreht und so gelagert ist, dass es zwei Freiheitsgrade hat, die Drehung in sich und die Rollrichtung, wenn es den Boden berührt[7] – geben weder der menschliche Körper noch die Umwelt Anregungen. Die Gliedmaßen können nicht rotieren, und selbst die Sonne ist für die Anschauung nur rund, aber sie dreht sich nicht. Das Rad kann darum nicht durch Nachahmung der Natur erfunden worden sein. Als den Brüdern Wright 1903 der entscheidende Durchbruch beim Bau des ersten Flugzeugs gelang, war eine Voraussetzung dafür, dass sie, die sich zuvor mit dem Reparieren von Fahrrädern beschäftigt hatten, nicht länger an der Vorstellung festhielten, für die Konstruktion eines Flugapparats müsse man sich die Fähigkeiten der Vögel zum Vorbild nehmen. Vögel haben keine Propeller.
Das Rad war eine vergleichsweise späte Erfindung, und sie wurde lange Zeit nur wenig genutzt. Obwohl die Töpferscheibe schon in der Bronzezeit bekannt war – ein ganzes Zeitalter wird als «keramisches» bezeichnet –, zogen beispielsweise die Ägypter alle Steine, die sie für den Pyramidenbau heranschleppen mussten, auf Schlitten. Andere Gesellschaften transportierten schwere Gegenstände auf dem Wasser und luden an Land solche Lasten vor allem Menschen und Tieren auf. Noch 1833 notiert ein englischer Reisender, in ganz Persien keinen Wagen mit Rädern gesehen zu haben. Das war insofern überraschend, als die ersten Räder vermutlich in Mesopotamien aufgekommen waren.[8] Es war aber insofern naheliegend, als Räder ihre Effektivität erst beweisen, wenn es Straßen oder andere Strukturen gibt, auf denen sie rollen können. Eines ist es, etwas zu erfinden, ein anderes, wie die Erfindung genutzt wird und ob sie sich verbreitet. Womöglich führte erst der Abbau von Kupfererz in ukrainischen Minen um 4000 v. Chr. zur Erfindung des Rades als Transportmittel. Die frühesten Modelle von Wagen mit Rädern haben alle unbewegliche Achsen. In den Minen mussten die vierrädrigen Wagen nicht gesteuert werden, weil sie auf gespurten Bahnen liefen.
Für die Anfänge, von deren Erforschung hier berichtet werden soll, ist entscheidend, dass sie wie das Rad nicht aus Nachahmung hervorgingen. Die Musik, das wird sich zeigen, kam nicht durch Imitation des Vogelgesangs in die Menschenwelt. Für das Sprechen und den aufrechten Gang gibt es in der Natur kein Vorbild, und für die Monogamie, sofern sie denn existiert, auch nicht. Die ersten Städte folgen nicht dem, was im Tierreich an Kolonien zu beobachten ist. Die Schrift ist nicht der Versuch, etwas Vorgegebenes, die Lautsprache, mimetisch in ein anderes, visuelles System zu übertragen. Alle Anfänge der menschlichen Gesellschaft sind Dokumente hochkonstruktiver Leistungen, denen man nicht auf den ersten Blick ansieht, weshalb es zu ihnen kam. Wir täuschen uns hierüber oft. Für uns scheint der Nutzen beispielsweise des aufrechten Gangs, des Sprechens, des Geldes oder der Stadt auf der Hand zu liegen. Doch die Forschung zeigt, dass die jeweilige Nützlichkeit, so wie wir sie uns vorstellen, zumeist nicht der Grund für ihre Entstehung war. Der Affe hat sich nicht aufgerichtet, um weiter sehen zu können, das Sprechen hat sich nicht entwickelt, um Botschaften zu übermitteln, das Geld stammt nicht aus dem Tausch, und die ersten Städte wurden nicht gegründet, weil man in ihnen nicht so stark von seinen Nachbarn behelligt wird und – Stadtluft macht frei – die Lebensführung dort unabhängiger ist.
Dies ist, neben dem Sinn für die detektivische Arbeit im Umgang mit sozialen Rätseln, das Zweite, was die folgenden Kapitel anstreben: Perspektiven auf die Zivilisation zu eröffnen, die nicht von unseren eigenen Gewohnheiten schon festgelegt sind. Wir sind keine selbstverständlichen Wesen, und unsere Gesellschaft ist das Resultat der unwahrscheinlichsten Vorgänge, des unabsehbaren Zusammentreffens von Geschehnissen, die nichts miteinander zu tun hatten, sowie der Lösung von Problemen, die wir vergessen haben. Wir sind nicht die Krone der Schöpfung, wir sind merkwürdig. Und weil es inzwischen nur noch eine Zivilisation gibt, haben wir gute Gründe darüber nachzudenken, vor allem aber: zu erforschen, wie merkwürdig genau wir sind.
Erstes KapitelBodenständig, tragfähig, treu: Der Anfang des aufrechten Gangs
Unter allen vierfüßigen Thieren ist nicht ein einziges, welches nicht schwimmen könnte, wenn es durch Zufälle ins Wasser geräth. Der Mensch allein ersäuft, wo er das Schwimmen nicht besonders gelernt hat. Die Ursache ist, weil er die Gewohnheit abgelegt hat, auf allen Vieren zu gehen.
Imanuel Kant
Eine Horde Primaten treibt sich auf einem wüsten Hochplateau um ein Wasserloch herum. Tags zuvor hatte sie dort noch eine andere Gruppe mit Geschrei und Drohgebärden verscheucht. Die Tiere bewegen sich im sogenannten Knöchelgang fort, bei dem die vorderen Extremitäten abstützend mit dem Rücken der Finger aufgesetzt werden und die hinteren sich abstoßen. Einer der Affen stöbert in den Überresten eines Tapirskeletts. Er hält inne, betrachtet die Knochen, sinniert und greift sich einen davon, mit dem er zunächst versuchsweise, dann – unter Begleitung der triumphalen Paukenschläge und Fanfaren aus «Also sprach Zarathustra» von Richard Strauss – immer entschiedener andere Knochen spaltet, um schließlich in einem Taumel zähnefletschender Aggression den Schädel des toten Tiers zu zertrümmern. Tags darauf wird der Knochen gegen rivalisierende Artgenossen eingesetzt, um einen von ihnen zu Tode zu prügeln. Hier stehen die nunmehr bewaffneten Affen bereits.
Wer aufrecht geht, hat die Hände frei. Und wozu? Zum Töten, sagt diese Ursprungserzählung. Der aufrechte Gang habe es dem Vormenschen erlaubt, sich im Kampf um knappe Ressourcen besser gegen seinesgleichen durchzusetzen.[1] Könnte sich die Menschwerdung so wie in Stanley Kubricks 1968 gedrehtem Film «2001: Odyssee im Weltraum» abgespielt haben? Zumindest wenn man davon absieht, dass Tapire in Afrika, der Wiege der Menschheit wie der Menschenaffen, gar nicht vorkommen?
Zunächst: So schnell kann es sich natürlich nicht abgespielt haben. Anfänge sind keine Einfälle. Sie ziehen sich lange hin, sie erfolgen nicht über Nacht, sondern zumeist in unendlich kleinen Schritten, die Menschheit brauchte unvorstellbar viel Zeit. Deswegen gibt es keine Zeugen von Anfängen, allenfalls Zeugnisse von Übergängen. Der Übergang vom sich vierfüßig fortbewegenden Menschenaffen zum aufrecht gehenden Vormenschen beispielsweise hat Millionen Jahre in Anspruch genommen. Wenn die ersten aufrecht gehenden Hominiden, die zwischen Menschenaffen und Mensch standen, vor sieben bis sechs Millionen Jahren lebten – wie nahe die entsprechenden frühesten Knochenfunde, des Sahelanthropus tchadensis wie des Orrorin tugenensis und des Ardipithecus kadabba, dem Menschen und dem Affen stehen, ist nach wie vor kontrovers –, dann dauerte es bis zum ersten nachweisbaren Werkzeuggebrauch noch etwa 4,5 Millionen Jahre. Aber selbst wenn man sehr viel vorsichtiger an die vorliegenden Fossilien herangeht, liegen Millionen von Jahren zwischen den ersten Fußabdrücken eines zweibeinigen Vormenschen, den 3,6 Millionen Jahre alten Spuren von Laetoli, und einem Fossil, das in allen entscheidenden Aspekten seines Bewegungsapparats menschenähnlich ist. Eine unserer Anatomie vollständig ähnliche wird von manchen Forschern erst dem Homo ergaster zugeschrieben, der vor etwa 1,8 Millionen Jahren lebte.[2]
Weshalb hat es so lange gedauert, bis der Affe aufrecht ging und danach Vormensch genannt werden konnte? Die These, dass es gar keinen Übergang von Vierbeinern zu Zweibeinern gab, weil nicht vierbeinige Primaten, sondern Koboldmakis mit bereits stark differenzierten, an das Leben in Bäumen angepassten Vordergliedern unsere nächsten Verwandten seien, deren bewegliche Hände wir nicht wiedergewonnen, sondern behalten hätten, war leider – wer möchte nicht lieber von Koboldmakis als von Schimpansen abstammen? – unhaltbar.[3] Für den Übergang von der Vier- zur Zweibeinigkeit musste sich über genetische Mutation und Selektion die gesamte Anatomie des Affen verändern. Bei zweibeinigem Gang muss beispielsweise immer ein Bein schwingen, weil das bloße Strecken des Beins zu keiner Fortbewegung führt und der nach vorn verlagerte Körper aufgefangen werden muss. Aber das nach vorn schwingende Bein fängt die Bewegung nur auf, wenn sein Fuß seinerseits nicht sofort wieder vom Boden abhebt. Der schnell laufende Mensch droht also vornüberzufallen. Sein großer Gesäßmuskel, der nur bei ihm, nicht beim Affen seinen Namen, gluteus maximus, verdient, verhindert das. Weitere Stabilität brachte die Verkürzung des Torsos beim Vormenschen mit sich: durch ein stark verkürztes Darmbein als Teil der Hüfte und generell durch deren Absenkung; Zweibeiner bewegen sich, anders als Vierbeiner, nicht mittels großem Hüfteinsatz, ihre Muskeln in diesem Bereich haben eine andere, stützende und die momentane Instabilität bei angehobenem Bein ausgleichende Funktion. Hinzu kamen Veränderungen an den Knien, dem empfindlichsten Teil der aufrechten Konstruktion, und den Füßen, die nun als Hebel eingesetzt werden und nicht mehr als Greifglieder.[4]
Die Konstruktion des Beckens ist nicht nur entscheidend für die Bewegung, sondern bei weiblichen Zweibeinern auch entscheidend für den Geburtsvorgang. Zwar ist das Kinderbekommen auch bei Menschenaffen schmerzhaft, aber die Geburt erfolgt zumindest bei Schimpansen, Gorillas und Orang-Utans aufgrund ihrer Köpergröße und der Anatomie ihres Beckens vergleichsweise schnell; die durchgängig ovale Form des Geburtskanals bereitet keine Komplikationen. Das ist bei Frauen anders, die nur unter großen, von Presswehen begleiteten Schmerzen gebären. Das menschliche Neugeborene dreht sich schwer ins Leben und wendet beim Austritt aus dem mütterlichen Körper das Gesicht von ihr ab. Das hat die Geburt von Zweibeinern seit jeher zu einem sozialen Vorgang der Geburtshilfe gemacht, während Menschenäffinnen allein gebären.[5]
Die unfassbar lange Zeit, die es brauchte, um einige Affen aufzurichten, ist ein Ausdruck dafür, wie unwahrscheinlich diese Entwicklung war. Nicht zuletzt zeigt die Tatsache, dass Menschenaffen, Meerkatzen und Gibbons nach wie vor existieren, wie gut ihr Bewegungsapparat seit jeher an ihre Lebensumstände angepasst ist. Warum also überhaupt der langwierige Übergang zu einer Anatomie, die Gleichgewichtsprobleme, eine reduzierte Geschwindigkeit am Boden, geringere Beweglichkeit beim Klettern und einen schwierigeren Geburtsvorgang mit sich brachte? Anfänge sind Abschiede, sie gehen mit Verzicht einher. Stabilität kostet Kraft und Geschwindigkeit. Was einen gut – energieeffizient – ausschreiten lässt, wird einen gleichzeitig weniger gut klettern lassen. Dass die Sonne bei einem Zweibeiner nicht mehr direkt auf den ganzen Rücken strahlt, ist ein Vorteil. Dass ausgerechnet der Kopf nun besonders durch Überhitzung gefährdet ist und die Versorgung des Steuerungszentrums mit Blut gegen die Schwerkraft arbeiten muss, ist ein Nachteil. Und schließlich: Wer die anderen besser sieht, wird auch von ihnen besser gesehen. Welche Vorteile des aufrechten Gangs also konnten die offenkundigen Nachteile mehr als ausgleichen? Genauer: Welche frühen Vorteile waren das? Denn wenn die Nachteile sofort anfallen, müssen sie in der Evolution auch sofort ausgeglichen werden. Im Überlebenskampf ist Zukunft kein Argument.[6]
Bevor wir zu den Antworten kommen, die auf diese Fragen gegeben worden sind, worunter «Waffen- und Werkzeuggebrauch» aus Kubricks mythischer Szene nur eine von vielen ist, muss zuerst begründet werden, weshalb der aufrechte Gang hier überhaupt am Anfang aller weiteren Anfänge steht. Schließlich zeichnen den Menschen auch noch andere Merkmale gegenüber seinen Vorfahren aus. Er ist kein Baumbewohner, er ist ein Allesfresser, das Volumen seines Gehirns ist relativ zur Körpergröße etwa dreimal so groß wie das der Menschenaffen, er hat ein im Vergleich zur Größe des Kopfes eher kleines und mehr parabolisches als u-förmiges Gebiss, in dem die Backenzähne dominieren, äußerst bewegliche Hände sowie irgendwann auch einen Sprechapparat. Außerdem weicht das sexuelle und reproduktive Verhalten des Menschen von dem der Menschenaffen deutlich ab.
Diese kleine Liste von Besonderheiten wird bei weitem übertroffen von der Liste der philosophischen Antworten auf die Frage «Was ist der Mensch?». Sie reichen vom «sprechenden», dem «arbeitenden» und dem «lachenden Tier» über das «lügende Tier» und das «Tier, das versprechen darf», bis zum «Wesen, das sich langweilt». Es gibt den «homo faber», der sich durch Werkzeuge auszeichnet, den «homo inermis», der schutz- und instinktlos ist, und bei Aldous Huxley gibt es sogar den «homo loquax», den geschwätzigen Menschen, der uns als Vorform des sprechenden auch noch begegnen wird. Doch alle diese Definitionen setzen den Menschen bereits voraus, der schon vieles sein muss, um dann auch noch lachen oder lügen zu können. Der aufrechte Gang ist früh als Merkmal aufgefallen, das von diesem Einwand nicht getroffen wird. Der Mensch musste, bevor er aufrecht ging, nur ein sich in winzigsten Schritten weiter an seine Umwelt anpassender Affe sein. Die Voraussetzungen für den aufrechten Gang sind hochkompliziert, aber es sind keine Komplikationen sozialer, kultureller, technologischer Art, die verarbeitet werden mussten, um ihn zu ermöglichen. Darum galt er vielen Philosophen als der Inbegriff des Anfangs einer «künstlichen» Existenz, die sich gegen alle naheliegende Bequemlichkeit über die Naturkräfte erhebt, um über sich hinaus und weit um sich zu schauen, wie es bei Herder 1784 heißt. Schon Herder denkt dabei in eine Richtung, der später Darwin folgen wird: «Also auch der verwilderte Mensch ist, seiner Organisation nach, nicht ohne Vertheidigung; und aufgerichtet, cultiviert – welch Thier hat das vielarmige Werkzeug der Kunst, was er in seinem Arm, in seiner Hand, in seiner Geschlankigkeit seines Leibes, in allen seinen Kräften besitzet? Kunst ist das stärkste Gewehr und er ist ganz Kunst, ganz und gar organisierte Waffe. Nur zum Angriff fehlen ihm Klauen und Zähne; denn er sollte ein friedliches, sanftmüthiges Geschöpf sein.»[7]
Herder meinte, dass es deshalb keine Entwicklung hin zum aufrechten Gang gegeben haben kann, weil das Konzept der «Entwicklung» doch wieder natürliche Gründe für den Übergang beanspruchen müsste, das Aufrechtgehen aber als Geniestreich der Frühgeschichte das Beispiel für die letzthinnige Unbegreiflichkeit und Unableitbarkeit aller zivilisatorischen Zäsuren abgibt. Das folgt daraus aber nicht. Denn man kann fragen, weshalb die angestrengte Einzigartigkeit des Menschen sich gerade im Unterschied zum vierfüßigen Gang zeigen soll. Die Vierfüßigkeit wird nämlich erst dadurch zu einer «natürlichen» Bewegungsform, dass man darauf verzichtet, den Auszug aus der Bequemlichkeit anatomisch am Übergang aus der schwimmenden Existenz festzuhalten. Auch Schwimmen war bequemer, als auf allen vieren zu gehen. Schon die Differenzierung von Vorder- und Hintergliedern an Vierfüßern, bei denen die vorderen Gliedmaßen das visuelle Nahfeld richtunggebend miterschließen und die hinteren Gliedmaßen für den Antrieb sorgen, arbeitete gegen die Schwerkraft an. Der aufrechte Gang gibt den Beinen und Füßen insofern sogar etwas zurück und nimmt dem, was dann zu den Händen wird, was diese Glieder schon einmal hatten: eine Steuerungsfunktion. Dass die Menschheit mit einem Schlage entstanden ist, als ein Affe sich aufrichtete, etwa um mit einem Steinwurf Angreifer auf Distanz zu bringen – dies eine friedlichere Variante von Kubricks Menschwerdungsszene –, bleibt also ein Mythos, der ein Verständnis des unglaublich lange Zeit beanspruchenden Vorgangs verhindert.[8]
Was signifikante Merkmale des Menschen im Einzelnen angeht, etwa die Hände und andere «postcraniale», also unterhalb des Schädels befindliche, so ist sich die Forschung ziemlich sicher, dass sie Folgen des aufrechten Gangs sind. Die vormenschlichen Zähne weichen von denen der Affen vor allem darin ab, dass männliche und weibliche Gebisse sich beim Menschen und seinen Frühformen weniger stark unterscheiden. Das Gebiss der Vormenschen ist keine Waffe mehr. Es dokumentiert ein Wesen, das sich auf sehr verschiedene Weise ernährte und in sehr verschiedenen Habitaten Nahrung fand, was auf frühe Mobilität aufgrund von klimatischem Wandel hindeutet. Allerdings zeigen auch schon viel ältere Menschenaffen wie Oreopithecus und Ramapithecus (nachgewiesen für die Zeit vor vierzehn bis acht Millionen Jahren) kleinere Vorderzähne als beispielsweise Schimpansen, was einen Zusammenhang der Gebissstruktur mit dem Gebrauch von Werkzeug unwahrscheinlich macht. Womöglich war der Werkzeuggebrauch nicht die Ursache für die Verkleinerung der Eckzähne, sondern eine Kompensation seiner Folgen. Bei verschiedenen Vormenschen, vom Ardipithecus ramidus (4,4 Millionen Jahre vor uns) bis zum Australopithecus africanus (2,5 Millionen Jahre), lässt sich anhand ihrer Zahngröße, Zahnformen, Zahnschmelz- und Kieferstruktur vielmehr ein erheblicher Wandel der Ernährungsgewohnheiten belegen, bis hin zum menschlichen Esser, der mit harten wie weichen Nahrungsmitteln gleichermaßen zu Rande kommt.[9]
Doch selbst dies ist mit der Frage des aufrechten Gangs verknüpft. Denn die Weisen, sich zu ernähren, hängen selbstverständlich davon ab, ob es mittels Früchten geschieht, die in den Bäumen weit oben hängen, oder mittels Beeren, harten Samen und Käfern, die sich in Bodennähe befinden, ob gepflückt, gesammelt oder gejagt wird. Die Vorderbeine haben sich mehr und mehr zu Armen entwickelt, die durch Werkzeugeinsatz das Gebiss entlasteten, was wiederum die Entwicklung des Sprechapparats und kognitiver Fähigkeiten begünstigte; auch das Gehirn profitierte vom Raffinement der Handbewegungen und diese wiederum vom Wachstum des Gehirns – all das gehört zu den wechselseitigen Bedingtheiten evolutionär sich herausbildender Merkmale. Sie stärken einander, ohne deswegen aus denselben Gründen entstanden und zeitlich eng aufeinander gefolgt zu sein. Auch Affen benutzten Werkzeuge, auch Zweibeiner hatten nicht sofort ein größeres Gehirn, auch Vormenschen mit relativ großem Gehirn entwickelten nicht unmittelbar Werkzeugtechniken. Das alles beantwortet aber nicht die Frage, weshalb eine Spezies in diesen Zusammenhang einander begünstigender Entwicklungen eingetreten ist. Man kann es also drehen und wenden, wie man will, die Zweibeinigkeit bleibt der informativste Unterschied zwischen den Vorformen des Menschen und seinen nächsten Verwandten unter den Affen.[10]
Sieht man von der Länge der Zeit und den Komplikationen ab, die mit dem Übergang zu dieser Bewegungsform einhergingen, so knüpft Kubricks Szene durchaus an eine der wissenschaftlichen Hypothesen an, weshalb manche Affen sich aufrichteten. Anschließend an Charles Darwins Vermutung, die Hände seien für den Gebrauch derjenigen Werkzeuge und Waffen frei geworden, die das leistungsfähige Gehirn des Menschen erfunden hatte, hat Raymond A. Dart im Jahr 1953 die Deutung vorgetragen, das Aufrechtgehen habe, weil es dem Frühmenschen über den Waffengebrauch hinaus auch erlaubte, in die Ferne zu blicken, ein aggressives und erfolgreiches Jagdverhalten begünstigt. Ein gutes Vierteljahrhundert zuvor hatte der australische Paläoanthropologe mit der Vorstellung aufgeräumt, dass die Menschwerdung des Affen vom Gehirn ausgegangen sei, dass also ein überlegener Intellekt, oder sagen wir vorsichtiger: eine höhere kognitive Verarbeitungsfähigkeit, am Beginn der Entwicklung hin zum Menschen gestanden habe. Denn als 1924 in einem südafrikanischen Kalksteinbruch das damals älteste Relikt eines Vormenschen gefunden wurde, das «Kind von Taung», wie das zwei bis drei Millionen Jahre alte Fossil aufgrund seiner noch nicht vollständig durchgebrochenen Zähne bezeichnet wird, erkannte Dart, der den Schädel als Erster analysierte, «zarte menschenähnliche Merkmale» und das «Mitglied einer ausgestorbenen Affenart»; kein «wahrer Mensch», aber zwischen Menschenaffen und Menschen anzusiedeln.
Dart nannte dieses Wesen Australopithecus africanus, «südlicher Affe aus Afrika», obwohl interessant an ihm eben gerade die Merkmale waren, die ihn von allen bekannten Affen unterschieden. Das foramen magnum, also das Eintrittsloch für das Nervensystem ins Gehirn, befand sich unterhalb des Schädels und nicht am Hinterkopf, was für die Forschung lange auf eine vertikale Wirbelsäule und mithin eine, dem aufrechten Gang gemäß, ausbalancierte Schädelposition hindeutete. Heute wären die Biologen vorsichtiger und würden sich lieber auf Hüft- oder Beinknochen verlassen, um Zweibeinigkeit zu diagnostizieren, von denen aber leider nicht so viele überliefert sind. So oder so: Das Gehirn des Australopithecus war nur etwas größer als bei den meisten Affen. Die relativ kleinen und scharfen Eckzähne ähnelten deutlich denen von Menschen. Dart schloss sich später jenem Teil von Darwins These an, der besagt, dass der wichtigste Schritt hin zum Menschen von Affen gemacht worden sei, die sich aus den Wäldern in Savannen hinausbewegt hätten, deren Graswelt Weitsicht und Waffengebrauch begünstigte.[11]
Die Fachwelt glaubte freilich lange nicht, dass der Australopithecus etwas anderes als ein Affe sei. Sein Gehirn war doch viel zu klein, und was, wenn nicht die kognitive Kapazität, also die Gehirngröße, unterscheide den Menschen vom Affen! Außerdem beharrte man auf Darwins Vermutung, den Menschen kennzeichne Werkzeuggebrauch, weshalb Fossile, in deren Nähe sich keine Steinwerkzeuge fanden, nicht als Zwischenglieder zwischen Menschenaffe und Mensch in Erwägung gezogen wurden. 1912 war in London überdies der Schädel des «ersten Engländers» vorgestellt worden, den man im südostenglischen Dorf Piltdown gefunden hatte und der zwischen 200000 und 500000 Jahre alt schien. Er belegte zumindest für die Engländer, dass am Beginn der Entwicklung des Menschen ein britisches Gehirn gestanden habe, deutlich größer als das von Affen. Der Fund von Piltdown erwies sich dann als eine aus einem mittelalterlichen Menschenschädel und einem zurechtgefeilten Orang-Utan-Kiefer zusammengesetzte Fälschung, doch das kam trotz früher Zweifel erst vierzig Jahre später heraus, als die Technik so weit war, Knochen physikalisch datieren zu können. Bis dahin konnten Schädelfunde noch so menschliche Zähne haben und auf Zweibeiner hinweisen – so lange ihr Gehirn nicht groß genug war, kamen sie für die meisten Forscher nicht als Vormenschen in Betracht. Dass die Gehirngröße nicht absolut, sondern in Relation zur jeweiligen Körpergröße von Menschenaffen eingeschätzt werden sollte, wurde nicht gesehen. Ein männlicher Gorilla wiegt etwa hundertsechzig Kilogramm, der Australopithecus wog bei etwas größerem Gehirnvolumen rund vierzig Kilogramm. Einzelne Varianten des Australopithecus hatten, relativ betrachtet, tatsächlich das größte Gehirn aller bekannten Tiere ihres Körpergewichts.[12]
Entscheidend bleibt jedoch die Erkenntnis, dass der aufrechte Gang die Entwicklung des menschlichen Gehirns ermöglichte. 1947 wurde in Sterkfontein zusammen mit einem Teil der Wirbelsäule und einem Oberschenkel das Becken eines Australopithecus africanus gefunden. Anhand der Form der Hüftknochen und der Krümmung der Wirbelsäule ließ sich die Zweibeinigkeit seines Besitzers nachweisen. Zusammen mit dem Schädel des Taung-Kindes und seinen affenuntypisch kleinen Eckzähnen ergab sich für die Forscher nun zwingend, dass die Unterschiede zwischen dem Affen- und dem Zweibeinergehirn sich erst entwickelt hatten, nachdem der Affe aufrecht ging. Unsere kopflastige Existenz verdankt sich dem besonderen Bewegungsapparat und nicht umgekehrt. Endgültig bewiesen war das, als 1978 die Fußspuren in der versteinerten feuchten Vulkanasche von Laetoli (Tansania) entdeckt wurden. Von ihnen steht heute fest, dass sie sich einem Wesen (Australopithecus afarensis) verdanken, das – auch was den Energieverbrauch betraf – so ging wie wir. Das gilt ebenfalls für die Australopithecus-anamensis-Funde aus Kenia, die zwischen 4,2 und 3,9 Millionen Jahre alt sind. Die frühesten Steinwaffen wiederum, die je entdeckt wurden, sind etwa eine Million Jahre jünger, und seine jetzige Größe hat das menschliche Gehirn erst etwa vier Millionen Jahre nach dem Übergang zur zweibeinigen Bewegung entwickelt.[13]
Wie Paläontologen und Evolutionstheoretiker diskutieren, kann an den Interpretationen dieser Befunde nachvollzogen werden. Nehmen wir als Beispiel nur die historische Kontroverse zwischen den berühmten Anthropologen Sherwood Washburn, Ralph Holloway, Clifford Jolly und Owen Lovejoy. Die gegenüber den Menschenaffen kleineren Eckzähne des Vormenschen gehen auf einen abnehmenden Selektionsdruck wegen Werkzeuggebrauchs zurück. Soll heißen: Die großen Hauer hatten für ihre Träger keine Vorteile mehr, weil ihre Funktion auch von Waffen beziehungsweise Werkzeugen erfüllt werden konnte. Nicht Schwerter wurden zu Pflugscharen, sondern Eckzähne zu Schwertern. So Sherwood Washburn ganz im Sinne der Jägerthese Raymond Darts. Das Jagen kommt als Ursache solchen Werkzeuggebrauchs dabei allerdings nicht in Betracht, denn die ersten Zweibeiner waren keine Jäger, sondern Gejagte, und sie aßen vorzugsweise Früchte, Körner und Blätter. Also bleibt als Gelegenheit, scharfe Eckzähne und entsprechende Ersatzmittel einzusetzen, der Nahkampf, nicht zuletzt der unter Artgenossen und sogar unter Mitgliedern desselben «Clans», etwa beim Streit um Frauen. Doch Waffen, die in ihm später ersatzweise zum Einsatz hätten kommen können, sind eben nicht überliefert.
Das focht Washburn nicht an. Weil die Zähne kleiner wurden, argumentierte er, muss es die Ersatztechnologie für die großen Hauer schon zuvor gegeben haben, sie ist nur noch nicht gefunden worden, oder sie wird nie gefunden, wenn jene Werkzeuge nicht aus dauerhaftem Material waren. Aber sollten wirklich Waffen aus Holz große Zähne ersetzt haben? Dass es etwas misslich ist, die Beweislast für eine Hypothese in eine Zukunft zu verschieben, in der man womöglich finden wird, was sie bestätigt, kommt hinzu. Und was soll überhaupt der selektive Vorteil für Affen gewesen sein, die sich mit ihren Zähnen in der Gruppe durchgesetzt haben, diese Waffen «abzulegen», nur weil sie unterdessen auch über Schneidewerkzeug verfügten? So fragte Ralph Holloway und erhielt von Washburn zur Antwort: Sie haben dann bei Rangkämpfen innerhalb der Gruppe einander nicht mehr so stark verletzt. Ein solcher auf den Clan bezogener Altruismus lässt sich allerdings evolutionsbiologisch nicht erklären: Wieso sollten die Träger kleinerer Gebisse sich besser reproduziert haben, nur weil es für die Gruppe insgesamt gut war?
Holloways eigene Erklärung für den Größenrückgang der Zähne brachte ebenfalls die Organisation vormenschlicher Gemeinschaften ins Spiel. Auf der Durchsetzungsfähigkeit innerhalb der Gruppe habe keine so hohe sexuelle Prämie mehr gelegen wie unter Affen. Anders gesagt: Wenn die Aggression ab- und die Kooperation im Zuge des gemeinsamen Jagens und Sammelns zunahm, war der Inhaber eines prächtigen Gebisses nicht mehr erfolgreicher als weniger eindrucksvoll ausgestattete Männchen. Nicht technologische, sondern mit dem aufrechten Gang zusammenhängende soziale Veränderungen hätten dann die körperliche Evolution beeinflusst.[14]
Das wiederum setzt sich dem Einwand aus, dass die kooperative Nahrungssuche bei allesfressenden Schimpansen nicht auf den Übergang zum aufrechten Gang und zu kleineren Zähnen schließen lässt. Denn Letztere sind beim Essen von Fleisch wenig vorteilhaft, und Ersterer brachte erhebliche Instabilitäten mit sich, die gerade für die Jagd ungünstig gewesen sein müssen. Clifford Jolly schlug darum vor, sich ganz von der Jagd- und Fleischobsession zu verabschieden und friedlichere Auslöser zu suchen. Seine eigene Hypothese, deren «Modellaffen» nicht Schimpansen, sondern Paviane waren, die Vormenschen anatomisch mehr ähnelten, zielte auf Veränderungen der Ernährungsweise, die starke Backenzähne gegenüber starken Eckzähnen begünstigten: das Kauen von Samen, der Verzehr von kleinen Insekten, Reptilien, Mäusen. Grasböden seien das Habitat gewesen, in dem Affen im Übergang zum Vormenschen lebten und sich dort hockend, also schon mit aufrechter Wirbelsäule ernährten. Doch die Skelette und Schädel der ersten Vormenschen wurden nicht in offenen Savannen gefunden – was auch die Theorie vom aufrechten Gang als Kühlungstechnik obsolet macht –, sondern in bewaldeten Gegenden. Die klimatischen Bedingungen des mittleren und späten Miozäns waren zwar von Abkühlung, Trockenheit und stärkeren jahreszeitlichen Schwankungen bestimmt. Sie hatten vor zehn Millionen Jahren aber nicht einfach nur zu einem Schrumpfen der Wälder geführt, das manche Affen ins Offene getrieben hätte, sondern zu einer mosaikhaften Geographie, in der sich eine Vielzahl von unterschiedlichen Biotopen dicht nebeneinander befand.
Insbesondere diese jahreszeitlichen Schwankungen und die heterogenen Biotope liegen dem viel diskutierten Modell von Owen Lovejoy zugrunde. Sein Reiz liegt vor allem darin, dass es die beiden großen Selektionsmotive der Evolution, Ernährung und sexuelle Reproduktion, verbindet. Lovejoy zufolge mussten nämlich monogame männliche Affen, die in Wäldern lebten, zur Aufzucht ihres Nachwuchses Nahrung – ob gesammelte, gejagte oder als Aas gefundene – aus Gegenden heranschaffen, die je nach Jahreszeit weitab von den Orten liegen konnten, an denen die Mutter mit den Kindern zurückgelassen wurde. Bei der Nahrungssuche hatten sie unter den klimatischen Umständen mit größeren Distanzen, mit «Lücken» und mit geringerer Nährstoffdichte zu rechnen. Hier wurde der aufrechte Gang zum Vorteil. Ein fünfzig Kilogramm schwerer Zweibeiner – so viel wogen die Vormenschen bei einer Körpergröße von 1,20 Meter etwa – kann mit demselben Energieaufwand sechzehn Kilometer Wegstrecke zurücklegen, den ein männlicher Schimpanse von fünfundvierzig Kilogramm benötigen würde, um zehn Kilometer «abzugrasen». Tatsächlich legen Affen auch heute am Tag nicht mehr als zwei Kilometer zurück, während menschliche Sammlergemeinschaften es auf etwa dreizehn Kilometer bringen. Je weitere Strecken zurückgelegt werden müssen, desto größer ist die Energieersparnis durch aufrechten Gang; sie liegt zwischen zwölf und sechzehn Prozent.[15]
Weil es für Weibchen riskant war, den Nachwuchs bei der Nahrungssuche in weniger geschützten Umgebungen und über große Distanzen mit sich zu führen, kam es zur geschlechtlichen Arbeitsteilung: Monogamie beziehungsweise Sex gegen Ernährung. Das ließ die Weibchen mehr Geburten überleben – schon weil der Nachwuchs nicht transportiert werden musste und besser vor Raubtieren geschützt war –, und es erlaubte ihnen überhaupt mehr Geburten. Der aufrechte Gang wäre, so gesehen, ein Beitrag zur Entstehung der Kleinfamilie gewesen. Oder besser gesagt: Die Vorteile des aufrechten Gangs beim Absuchen größerer Gebiete und die Vorteile der Monogamie, die Konflikte unter Männchen mindert, hätten sich wechselseitig verstärkt. Dass beim Vormenschen die Eckzähne keine Hauer sind, würde in dieses Bild passen, weil in monogamen Verhältnissen weniger Bissigkeit nötig ist und bei zunehmendem Umfang des Territoriums, in dem Nahrung gesucht wird, dessen Verteidigung ohnehin nicht möglich ist.
Experimente mit Schimpansen, bei denen diese besonders bevorzugte Nahrung zweibeinig davonschleppten, während sie weniger begehrte Pflanzen auf allen vieren transportierten, deuten ebenfalls darauf hin, dass der zweibeinige Transport vorteilhaft ist, wenn Konkurrenz befürchtet wird. Ein Haken an Lovejoys These, die auf Analogien in der Affenwelt verzichten muss, weil es sie nicht gibt, ist womöglich, dass keine zwingenden Hinweise auf eine monogame Lebensform des Australopithecus vorliegen. Im Gegenteil spricht das deutlich größere Gewicht der männlichen Vormenschen im Vergleich zu den weiblichen aus Sicht mancher Forscher für Polygamie. Eine Erklärung für diesen «sexuellen Dimorphismus», also die beträchtlichen Unterschiede zwischen Männern und Frauen, könnte freilich auch sein, dass die größeren und in ihrem Bewegungsapparat menschenähnlicheren Hominidenmännchen auf Nahrungssuche in offenen Zonen an den Waldrändern die Weibchen zurückließen, die dort ohne die bleibende Fähigkeit, auf Bäume zu fliehen, schutzlos gewesen wären. Die einen hätten sich dann mit dem aufrechten Gang schneller an die ökologischen Gegebenheiten ihrer Sammelgründe und mit dem stärkeren Körperbau an deren Risiken angepasst; die anderen wären, mit einer Formulierung des Anatomen Randall Susman, noch länger «Teilzeitbaumbewohner» geringeren Körpergewichts geblieben.[16]
Als Ertrag dieser Diskussionen kann festgehalten werden, dass es keine lineare Geschichte von der Entstehung des aufrechten Gangs zu erzählen gibt und keine, die nicht spekulativer Natur wäre. Der Australopithecus ernährte sich, wie wir inzwischen wissen, vorzugsweise, aber nicht ausschließlich von Pflanzen. Jagdvorteile haben den aufrechten Gang also nicht bewirkt. Deutlich plausibler sind Modelle, die den Affen vom Boden oder von Ästen aus sich aufrichten lassen, um an Früchte heranzukommen. 85 Prozent aller Fälle, in denen Schimpansen kurz zweibeinig gehen, dienen der Ernährung, die wenigsten hingegen dem Tragen, Werfen, Beobachten, der Werkzeugverwendung oder dem Imponiergehabe. Wurden andere Tiere schneller, wenn sie zur Zweibeinigkeit übergingen, gilt das für den späten Affen beziehungsweise frühen Menschen nicht. Theorien, die ganz auf weite Läufe in offenen Gebieten setzen, finden hierin ihre Grenze. Schon der gelegentlich aufrecht gehende, 4,4 Millionen Jahre alte und 1994 in Äthiopien gefundene Ardipithecus ramidus, der noch viel weniger auf eine Nahrungsquelle festgelegt war, lebte nicht in der Savanne. An «Lucy», dem berühmtesten Teilskelett eines Australopithecus afarensis, wurden Merkmale für ein Wesen gefunden, das nach wie vor kletterte und sich zumindest nachts auf Bäumen vor Raubtieren in Sicherheit brachte. Die ältesten Vormenschen bewohnten ganz offenkundig bewaldete Gegenden, entwickelten aber dort Fähigkeiten, die sie auch in anderer Umgebung überleben ließen. Die stärkeren jahreszeitlichen Schwankungen des Klimas und die sich daraus ergebende mosaikhafte Biogeographie Ostafrikas führten dazu, dass Verhaltensflexibilität belohnt wurde, wie sie beispielsweise ein Wesen hatte, das auch in seinem Bewegungsrepertoire über mehr als eine Möglichkeit verfügte. Die Evolution scheint hier also nicht auf eine spezialisierte Existenz hingewirkt zu haben, deren Anatomie auf das Leben in einer ganz bestimmten Umgebung, einer Nische ausgelegt ist, sondern auf einen migrationsfähigen, sich vielfältig ernährenden, die Risiken des Bodens wie der Bäume ausgleichenden Artgenossen, der erst vor 2,5 bis 1,8 Millionen Jahren zur «obligaten Zweibeinigkeit» überging.[17]
Oft wird in der Evolutionstheorie vermutet, dass besonders unwirtliche Umweltbedingungen Veränderungen ausgelöst haben. Die Härte des Überlebenskampfes und die Knappheit an Ressourcen, so die gängige Deutung, üben den entscheidenden Druck aus, unter dem bestimmte Merkmale besser reproduziert werden als andere. Die meisten Erklärungen des aufrechten Gangs folgen diesem Schema. Anders sieht das der britische, in Afrika lebende Zoologe Jonathan Kingdon, weil für eine prekäre Entwicklung, deren endgültige Vorteile sich erst langsam bemerkbar machten, eine begünstigende ökologische Situation erforderlich gewesen sei. Der Affe müsse schon zweibeinig gewesen sein, um in der Savanne zu bestehen, zwischen dem vierbeinigen Baumbewohner und dem Zweibeiner habe es eine vermittelnde Form der Fortbewegung gegeben.[18]
Eine Trockenperiode, die vor 10,5 Millionen Jahren begann, schuf zwei große Zonen entlang des Großen Afrikanischen Grabenbruchs, der von Mosambik bis Syrien reicht. So gut wie alle Fundstätten von vormenschlichen Fossilien liegen östlich dieser Linie. Darauf gründet die «East Side Story». Ihr zufolge haben die tektonischen Spannungen am Großen Graben gegen Ende des Miozäns – vor etwa sechs Millionen Jahren – natürliche Hindernisse (Berge, Hochebenen) zwischen zwei Ökosystemen geschaffen, in denen sich dann einerseits die Entwicklung zum Menschenaffen, andererseits die zum Menschen zutrug. Dabei war die Schimpansen- und Gorillawelt von feuchten Wäldern bestimmt, die Hominidenwelt von einem Fleckenteppich aus trockenen Savannen, Flussregionen und kleinen Küstenwäldern. Diese Hypothese wird wohl noch nicht erschüttert durch den Umstand, dass 1995 der Kieferbogen und ein Backenzahn eines Australopithecus (A. bahrelghazali) im Tschad, also weit westlich der besagten Trennlinie, gefunden wurden.
Dadurch, dass manche Affen in jenen Küstenwäldern durch die Versteppung der umliegenden Gebiete isoliert wurden, war ihre genetisch nunmehr separierte Evolution vom Auf und Ab der Feuchtigkeitsgrade und Temperaturen wie überhaupt vom ökologischen Wandel dieses Biotops geprägt. Zu dessen Merkmalen gehörten beispielsweise das Kleinerwerden der Bäume infolge von Trockenheit, das jahreszeitlich bedingte Entfallen bestimmter Früchte, das Entstehen einer reicheren Bodenfauna und -flora durch verwesende Blätter und das deshalb systematischere Absuchen des Bodens durch die Affen. Diese Affen richteten sich – hierin folgt Kingdon der Richtung, die von Clifford Jolly eingeschlagen worden war – zunächst im Sitzen auf, um kleine Nahrungsobjekte – Samen, Insekten, Reptilien, Beeren – aufzusammeln und zu verzehren. Vor dem Stehen kam das Hocken, vor dem aufrecht gehenden Vormenschen kam das, was Jonathan Kingdon den «Bodenaffen» nennt, eine wörtliche Übersetzung von Ardipithecus ramidus: «Bodenaffe an der Wurzel». Nicht der aufrechte Gang selbst führte demzufolge zu den Veränderungen des vormenschlichen Oberkörpers, seiner Wirbelsäule und des Beckens, sondern die hockende Ernährungsweise. Das abgestützte Hocken befreite eine Hand, der aufrechte Gang befreite beide Hände: Er konnte sich aus dem Hocken entwickeln, wenn genug Nahrung am heimischen Boden vorhanden war und sichere Orte leicht erreichbar, also in der Nähe von Wäldern. Auch das hockende Sammeln in flachen Gewässern kommt als mögliche Rahmenbedingung für allmähliche Zweibeinigkeit in Betracht. Da beides die Affen mit anderen Tierarten in Konkurrenz brachte als das Leben in Baumkronen, mag sich mit der Bodennähe auch das Gruppenleben neu geordnet und die Kommunikation unter ihnen stärker entwickelt haben. Mit anderen Worten macht Kingdon gerade nicht den Kampf um Ressourcen, sondern die Entlastung von ihm zur Bedingung für den unwahrscheinlichen, mit hohen Risiken behafteten Übergang zur Zweibeinigkeit.[19]
Auch dies nur ein Modell, eine Zusammenstellung von Informationen, eine Vermutung. Zur Eigenschaft des aufrechten Ganges gehört es, zahllose Möglichkeiten eröffnet zu haben, von denen dann im Umkehrschluss überlegt werden kann, ob sie nicht den entscheidenden Vorteil seiner Herausbildung ausgemacht haben. Und weil der aufrechte Gang ein Sondermerkmal in der Abstammungslinie ist, entfallen Vergleiche, die klären könnten, welches kausale Gewicht genau welchem Nützlichkeitsaspekt dieser Bewegungsform zugekommen ist. Die «Bildung der Hand als des absoluten Werkzeugs» (Hegel) wurde von ihr nicht ausgelöst, sondern nur weiter begünstigt. Da die Hand aber tatsächlich ein absolutes Werkzeug ist, das zu Gesten oder zum Tragen ebenso eingesetzt werden kann wie im Kampf, beim Feuermachen oder bei der Geburtshilfe, führt auch sie nicht zu einem bestimmten Nutzen, einem bestimmten selektiven Vorteil. Insofern kann man sagen, dass der Affe mit dem aufrechten Gang unspezifisch wurde. Von Vierbeinern weiß man besser, warum sie wohin gehen und was sie dort tun werden. Bei den Zweibeinern behalten die entsprechenden Vermutungen, bei allem fortschreitenden biologischen, geographischen und paläontologischen Wissen, sechs Millionen Jahre, nachdem sie sich so in Bewegung gesetzt haben, immer etwas von einer Erzählung.
Zweites KapitelDie Zeit der Zähne und die Zeit der Feste: Der Anfang des Kochens
Boy meets grill
Robert William Flay
«Der Mensch ist, was er isst.»[1] Ludwig Feuerbachs Satz klingt wie eine Aufforderung nachzufragen, was der Philosoph gerade gegessen hatte, als er ihn niederschrieb. Möchten doch selbst die entschiedensten Vegetarier nicht auf ihre Diät reduziert werden. Wenn man mit ihnen über den Sinn der fleischlosen Ernährung diskutiert, legen sie Argumente auf den Tisch und nicht Gemüse. Der Mensch ist insofern noch anderes als das, was er isst. Er ist beispielsweise eine Reihe von Stellungnahmen zum Essen. Denn was isst der Mensch? Als Gattungswesen: so gut wie alles. Als regionale Existenz: bei weitem nicht alles und vieles auf keinen Fall. Zwischen den Inuit vergangener Zeiten, die sich im Winter fast ausschließlich von zumeist rohem Fisch, Fleisch und Seehundblut ernährten und dafür magisch-medizinische Begründungen der Verbindung von Tier und Mensch hatten, zwischen ihnen also und den Jains, die nicht nur kein Fleisch, sondern auch kein Wurzelgemüse, keine Pilze und keinen Honig sowie nichts, das über Nacht gelagert wurde, zu sich nehmen, weil sie das Essen ohnehin gewalttätig finden und allen Pflanzen eine, mehrkernigen Pflanzen wie Tomaten, Gurken und Melonen sogar viele Seelen zuschreiben, liegen viele Möglichkeiten. Der Mensch ist kein festgelegter Esser. Darum produziert er seit langem Begründungen dafür, was er isst.[2]
Und wie isst der Mensch alles? Auf alle möglichen Weisen: roh, gekocht, gemahlen, gebraten, geröstet, frittiert, gebacken, überbacken, blanchiert, mariniert, gezuckert, gewürzt und so weiter. Der Mensch nimmt seit langem Nahrung nicht einfach zu sich, er macht zuvor etwas mit ihr. Das führt nicht nur sachlich, sondern auch zeitlich und sozial zu einer anderen Art des Essens. Während große Affen etwa die Hälfte des Tages mit Kauen beschäftigt sind, macht das beim Menschen nur noch etwa fünf Prozent seiner Zeit aus, die überwiegend auf gemeinsames Essen verwendet werden.[3] Aufaddiert können natürlich in einem Leben trotzdem rund hunderttausend Mahlzeiten und deutlich mehr als ein Dutzend Jahre zusammenkommen, die mit Essen verbracht werden. Ob die Einführung von Schnellrestaurants diese Zahlen verändert hat, steht dahin, Psychologen wollen unter dem Titel «You Are How You Eat» jedenfalls einen Zusammenhang zwischen Fastfood und Ungeduld festgestellt haben.[4]
Tiere sind also viel mehr, was sie essen, als der Mensch. Denn ihre Anatomie folgt in wesentlicher Hinsicht der speziellen Nahrung, durch die sie sich Energie zuführen. Wer wissen will, weshalb ein Ameisenbär, eine Biene oder ein Frosch so sind, wie sie sind, wird bei Ameisen, Blütenstaub und Fliegen anfangen müssen. Die Anatomie des heutigen Menschen ist demgegenüber nicht sehr auskunftsfreudig, weil es so etwas wie «die» Nahrung des Menschen nicht gibt. Darum bringen ihn ja auch die zahllosen Diäten nicht um, die er sich zumutet. Im Tierreich gibt es keine Diäten. Dort stellt die Ernährung tatsächlich eine unmittelbare Verbindung zwischen dem Tier und seiner Umwelt dar. Das ändert sich, wenn die Nahrung vom Tier nicht hingenommen, sondern verändert wird. Rohkost im strikten Sinne beschränkt sich beim Menschen zumeist auf Früchte, Gemüse und Nüsse. Alle anderen Nahrungsmittel führt er sich in der Regel verändert zu. Was den Menschen angeht, so hat es darum nicht Feuerbach, sondern James Boswell getroffen: «No beast is a cook» – «kein Tier ist ein Koch». Der Mensch ist ein kochendes Tier.[5]
Das Kochen ist ein Grund dafür, dass der Mensch anders als seine biologischen Ahnen so viele verschiedene Nahrungsmittel zu sich nimmt. Denn vieles von dem, was er nicht verdauen kann, macht er sich verdaubar. Der Australopithecus africanus, einer unserer frühesten Ahnen, hatte mit seinem Gebiss vier- bis fünfmal so viel Kraft aufzuwenden, um beim Kauen denselben Druck auf die Nahrung auszuüben wie ein Mensch. Er musste, mit anderen Worten, viel mehr essen, um denselben Energiegewinn daraus zu ziehen, weil er sehr viel schwer- oder gar unverdauliche Nahrung zu sich nahm.[6] Das Kochen schiebt die Grenze der Unverdaulichkeit weit hinaus, weil weiche Nahrung nicht nur weniger Anstrengung des Kauapparats bedarf, sondern auch weniger Energieaufwand der Verdauung. Tierexperimente haben gezeigt, dass es sogar schon genügt, bestimmte Nahrung mittels Luftbeimischung weicher zu machen, um ihre Esser weniger Kalorien verbrauchen zu lassen. Kochen ist solchen Techniken noch überlegen.[7] Das schränkt ein, was der große Anthropologe Claude Lévi-Strauss über das Kochen sagte. Nahrung zu erhitzen, dient nicht nur einer symbolischen Abgrenzung vom Tierreich. Nicht nur die Kommunikation unterscheidet das Rohe vom Gekochten, der Körper tut es auch.
Doch was wird überhaupt gegessen? Im selben Jahr 1773, in dem der schottische Reiseschriftsteller Boswell das Wort vom «kochenden Tier» in seinem Tagebuch festhielt, notierte sein Landsmann James Burnett in seinem Werk über den Ursprung der Sprache, dass der Übergang von der «frugivoren» zur «karnivoren» Ernährung den Charakter des Menschen sehr verändert haben muss. Über ein harmloses Wesen, das mehr zur Flucht als zum Angriff disponiert gewesen sei, habe durch den Übergang zur Jagd die wilde Bestie, die stets ein Teil von ihm gewesen sei – «a part of his composition» –, die Vorherrschaft erlangt, und von da sei es nicht mehr weit bis zu Krieg und Kannibalismus gewesen.[8]
Bis heute sind diese beiden Unterscheidungen, «roh/gekocht» und «sammeln/jagen», zentral für die Beschreibung des frühgeschichtlichen Menschen und seiner Nahrung. Das liegt unter anderem daran, dass die informativsten Überreste der Hominiden Schädel, Kiefer und Zähne sind; Messungen der Zähne sowie mikroskopische Untersuchungen an den Abreibungen und der Knochenstruktur erlauben es, auf Muskelstärken, Kauverhalten und die Art der Ernährung zu schließen.[9] So hat sich gezeigt, dass die Größe der Kauoberfläche evolutionär von der Größe des Lebewesens einerseits, seiner Ernährung andererseits abhängt. Wenn also ein durchschnittliches weibliches Exemplar von Australopithecus afarensis etwas kleiner ist als eine durchschnittliche Schimpansin, aber deutlich größere Backenzähne hat, lässt das den Schluss auf einen höheren Anteil an härterer Rohkost – zum Beispiel Grassamen und Blätter – im Speiseplan zu.
Die Frage nach dem Anfang des Kochens ist darum eng mit der Frage nach dem Übergang von Hominiden zum Menschen verbunden. Denn in der Abfolge des Homo habilis vor 2,4 Millionen Jahren zum Homo erectus, der vor 1,9 Millionen Jahren lebte, und zum Homo sapiens vor 200000 Jahren, sind die größten anatomischen Unterschiede am Anfang zu beobachten. Der Homo erectus hat viel kleinere Zähne als seine Vorgänger, sein Körper ist nicht mehr auf Klettern eingestellt, sein Gehirnvolumen ist deutlich größer, die männlichen und weiblichen Exemplare sind einander körperlich viel ähnlicher als das zuvor der Fall war, und er ist der erste Frühmensch, der außerhalb Afrikas angetroffen wird: vor 1,7 Millionen Jahren in Asien, vor 1,6 Millionen Jahren in Indonesien, vor 1,4 Millionen Jahren in Spanien.[10]
Hier interessieren zunächst die Zähne und das Gehirn. Das Gehirn, weil sein Wachstum als das eines großen, nein, des größten Energieverbrauchers im Menschen von Umbauten in seiner gesamten Lebensweise abhängig ist. Ein Australopithecus wandte bei einem Gehirnvolumen von vierhundertfünfzig Kubikzentimetern gut zehn Prozent seiner Energie für die Versorgung des Gehirns auf, ein Homo erectus bei neunhundert Kubikzentimetern etwa siebzehn Prozent.[11] Es muss sich etwas Grundsätzliches in der Energiebilanz der Hominiden verändert haben, wenn es zu einer derart auffälligen Entwicklung des menschlichen Steuerungszentrums gekommen ist.
Schon Ende des neunzehnten Jahrhunderts war das Verhältnis von Gehirnvolumen und Länge des Verdauungstraktes bei Primaten bekannt: Je größer der Denk- und Steuerungsapparat, desto kürzer sind bei ihnen die Verdauungswege. Deren Länge wiederum ist bei Fleischfressern geringer als bei Vegetariern, weil Fette und tierische Proteine leichter verdaut werden können. Im Übergang zum Menschen scheint darum der Energieverbrauch des Verdauungstraktes auch durch Umstellung der Nahrung zugunsten des Gehirns reduziert worden zu sein.[12]
Diese Nahrungsumstellung erfolgte nicht zuletzt durch das Jagen. Da Jagen höhere kognitive Leistungen verlangt als Sammeln, haben wir es mit einer wechselseitigen Abhängigkeit der Entwicklungsschritte zu tun. Die Aufnahme höherer Fleischanteile in den Speiseplan versorgte den Menschen mit Brenn- und Aufbaustoffen für seine Intelligenz, mehr Intelligenz war aber gleichzeitig vorausgesetzt, um an das entsprechende Fleisch zu kommen. Denn Tiere laufen, anders als Pflanzen, weg, wenn man sie essen möchte; die Jagd ist insbesondere dann ein Intelligenztest samt Energiebeschaffungsfrage, wenn die Beute schneller läuft als der Jäger. Vielleicht half das anspruchslosere Essen von Aas – von Tieren also, die nicht mehr weglaufen können – beim Eintritt in diese Schleife. Knochenfunde, bei denen die Gebissspuren fleischfressender Tiere nachträglich durch frühmenschliche Schnittspuren überlagert sind, unterstützen diese Vermutung.[13]
Vielleicht half aber auch das Kochen. Die Backenzähne nämlich sind im Verlauf der Evolution nicht zuletzt deshalb kleiner geworden, weil nicht mehr so viel Kraft in das Zermahlen der Nahrung investiert werden muss, wenn mit ihr vorher etwas geschieht oder wenn sie von vornherein weich ist. Das Gebiss des Australopithecus war dem Bedürfnis angepasst, sich von Zeit zu Zeit auch von harten Körnern und Samen zu ernähren, wohingegen es von seiner Struktur her sich nicht besonders für den Verzehr von rohem Fleisch eignete. Da wir aber aus Isotopenanalysen seiner Zähne wissen, dass der Australopithecus tatsächlich Fleisch aß, spricht viel dafür, dass es schon vor dem Verzehr bearbeitet worden war oder sich als Aas bereits in einem Zustand des Zerfalls befand.[14]
Das demgegenüber deutlich kleinere Gebiss des Homo erectus weist auf abermals veränderte Ernährungsumstände hin. Nicht so sehr, weil es einen Selektionsvorteil bedeutet, wenn Energie anstatt in den Aufbau eines kräftigen Gebisses in etwas anderes gesteckt wird, sobald Techniken zur Hand sind, die Kieferkraft zu ersetzen. Messungen ergaben, dass seit dem Ende des Pleistozäns über fünfhundert Generationen hinweg pro Generation ein Größenrückgang der Zähne um 0,21 Quadratmillimeter zu verzeichnen ist. Das sollte keinen Wettbewerbsvorteil im Kampf ums Überleben bedeutet haben.[15] Der Grund für die allmähliche Verkleinerung des Kauapparats ist vielmehr, dass Individuen mit kleineren Zähnen – und übrigens auch sehr viel kleineren Mündern als jeder Menschenaffe – nicht mehr unter Selektionsdruck stehen, wenn es für die Leistungen des starken Gebisses angemessene Ersatzmittel gab. Evolution kann auch heißen: sich unabhängig machen von allzu engen Gesichtspunkten der Überlegenheit.