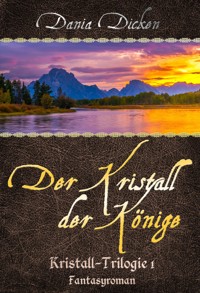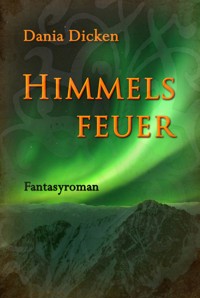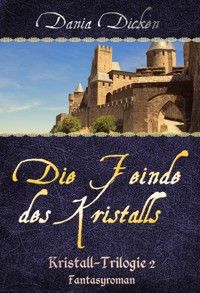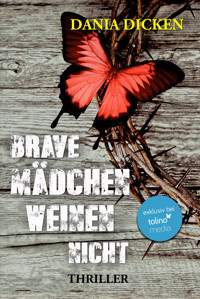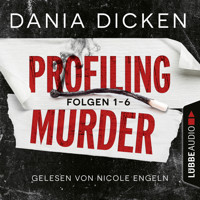4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wenige Wochen nach ihrer Entführung durch den Serienmörder Vincent Howard Bailey kämpft FBI-Profilerin Libby Whitman darum, mit ihren traumatischen Erinnerungen fertig zu werden und wieder in den aktiven Dienst zurückkehren zu dürfen. Auch für ihren Mann Owen ist die Situation nicht einfach, denn parallel ist er beruflich aufgrund seiner Ermittlungen in einem Mordfall stark gefordert. Als Owen unverhofft erst vom Dienst suspendiert und kurz darauf sogar wegen Korruptionsverdachts verhaftet wird, ist Libby fest entschlossen, die Unschuld ihres Mannes zu beweisen. Dabei läuft sie fast zu alter Form auf – und versucht verbissen das Geheimnis zu verbergen, von dem noch nicht einmal Owen etwas weiß ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dania Dicken
Die Angst kommt in der Dunkelheit
Libby Whitman 8
Thriller
Wenn die Wunde nicht mehr wehtut,
schmerzt die Narbe.
Bertolt Brecht
Prolog
Jerome war nervös. Dass der Boss ihn zu sich zitierte, war ganz bestimmt kein gutes Zeichen. Jeder Schritt erschien ihm unüberwindlich, als er die große Lagerhalle durchquerte, an deren Ende Santos mit mehreren seiner Leute vor einigen Paletten stand und augenscheinlich in eine Diskussion vertieft war.
„Boss“, sagte Pete hinter ihm. Santos hob den Kopf und lächelte wohlwollend.
„Das ist gut. Mit euch wollte ich sprechen.“ Er nickte den anderen zu und kam dann zu ihnen.
„Schon merkwürdig, oder? Jemand hat mir gesteckt, dass unsere Lieferung am Donnerstag nicht mehr sauber ist. Die DEA weiß Bescheid und erwartet sie im Hafen von Baltimore.“
Jerome schluckte. „Ehrlich?“
„Ja, tatsächlich. Du hast nicht zufällig eine Idee, wie das sein kann?“
„Ich? Wieso?“
„Nun, möglicherweise deshalb, weil einer meiner Männer dich gesehen hat, wie du mit einem DEA-Agenten gesprochen hast.“
Jetzt wurde Jerome heiß. Kopfschüttelnd sagte er: „Nein, das muss ein Missverständnis sein. Das war ich ganz bestimmt nicht.“
„Und wie erklärst du dir dann das hier?“ Santos griff nach seinem Handy und zeigte ihm ein unscharfes Handyfoto. Verdammt, er hatte ihn tatsächlich erwischt. Auf dem Foto waren ganz klar er und Agent Billings zu sehen.
„Jerome, bist du ein DEA-Spitzel?“, fragte Santos nun ganz direkt.
Hastig schüttelte Jerome den Kopf. „Nein, da muss ein Irrtum vorliegen. Ich würde doch nie …“
Ohne jede Vorwarnung brüllte Santos ihm ins Gesicht. „Willst du mich für dumm verkaufen? Ich weiß doch, was meine Augen hier sehen! Hast du die Lieferung am Donnerstag an die DEA verraten?“
Jerome wollte schon etwas erwidern, als er plötzlich die Mündung einer Waffe am Hinterkopf spürte. Nervös hob er die Hände und blieb ansonsten stocksteif stehen.
„Lass es mich erklären“, begann er.
„Da gibt es nichts zu erklären. Du bist ein Spitzel. Ich hasse es, wenn ich hintergangen werde.“
„Auf die Knie“, sagte Pete und Jerome tat es. Er war furchtbar angespannt und überlegte konzentriert, wie er die Situation retten konnte. Während er fieberhaft nachdachte, nickte Santos Pete zu. Jerome wollte noch etwas sagen und um sein Leben verhandeln, doch bevor er dazu kam, knallte es.
Freitag, 3. September
Über ihren Köpfen segelten die Möwen in der steifen Brise, die vom Pazifik her landeinwärts blies. An der Küste der Marin Headlands auf der anderen Seite des Golden Gate bildeten sich kleinere Nebelfelder, die aber von der Sonne gleich wieder aufgelöst wurden.
Libby blinzelte geblendet, als sie ihre Blicke über die Wellen draußen auf dem Pazifik gleiten ließ. Schließlich wandte sie sich wieder nach Norden und beschloss, diesen Moment für immer in ihrer Erinnerung zu konservieren, als sie zur Golden Gate Bridge schaute.
Hätte man sie gefragt, welches ihr liebster Platz auf der Welt war, hätte sie Marshall’s Beach genannt. Der Strand am nordöstlichen Zipfel von San Francisco unweit der Golden Gate Bridge war immer gut besucht, weil man dort tolle Fotos von der berühmten Brücke schießen konnte, aber man fand eigentlich immer ein ruhiges Plätzchen an dem felsigen Küstenstreifen, wo man sich einfach hinsetzen und träumen konnte.
An diesem Tag hatte sie es wahr gemacht und Sadie gebeten, sie auf dem Weg zur University of California in San Francisco einfach mitzunehmen und am Strand abzusetzen. Owen hatte keine Sekunde gezögert und sie begleitet. Er saß neben ihr auf einem großen Felsbrocken, hatte die Ellenbogen auf die Knie gestützt und sog ebenfalls die wundervolle Atmosphäre im goldenen Licht der sinkenden Sonne in sich auf.
„Ich will hier nicht wieder weg“, sagte Libby leise.
„Kann ich verstehen. Ich würde noch ein paar Urlaubstage opfern, aber vielleicht sollte einer von uns mal wieder Geld verdienen gehen.“ Owen grinste schief, als er das sagte.
„Du kannst ja wenigstens“, murmelte Libby.
„Sie werden dich bald auch wieder zurückholen.“
Das hoffte Libby sehr. Sie war im Augenblick nicht nur aus gesundheitlichen Gründen nicht arbeitsfähig, sondern überdies noch vom Dienst suspendiert, solange die interne Untersuchung zu Vincent Howard Baileys Tod noch nicht abgeschlossen war. Vor der Anhörung, die ihr diesbezüglich bevorstand, hatte sie Angst. Sie konnte sich jetzt schon denken, welche Fragen man ihr stellen würde und sie betete, dass sie dem gewachsen war. Daran hing nicht bloß ihr Job – schlimmstenfalls drohten ihr strafrechtliche Konsequenzen. Letzteres war nicht sehr wahrscheinlich, aber hätte man ihr wegen seines Todes den Job genommen … Sie wagte gar nicht, sich die Konsequenzen auszumalen.
Als sie nichts sagte, legte Owen seinen Arm um sie. „Das wird schon.“
„Ja, klar …“ Sie seufzte unwillig. „Ich habe Angst davor, nächste Woche wieder allein in unserer Wohnung zu sitzen. Da, wo es passiert ist.“
„Das kann ich verstehen. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber vielleicht finden wir ja bald ein neues Zuhause.“
Ein Lächeln huschte über Libbys Lippen. Das hätte sie sich auch gewünscht. Sie hatten bereits Besichtigungstermine mit Maklern in Arlington, Springfield und Newington vereinbart, um sich Häuser anzusehen. Owen verstand ihren Wunsch nach einem neuen Zuhause nur zu gut – er hatte zugegeben, dass es ihm kaum anders ging. Schließlich war es sein Blut, das den Teppich im Schlafzimmer durchtränkt hatte und nicht mehr rückstandslos entfernt werden konnte. Den Teppich mussten sie rausreißen – aber erst, wenn sie auszogen. In einer Baustelle wollte Libby jetzt auch nicht leben.
In zwei Tagen würden sie zurück nach Hause fliegen. Libby wäre gern noch länger in Kalifornien bei ihrer Familie geblieben, aber Owen hatte Recht. Einer von ihnen musste zusehen, dass wieder Geld ins Haus kam. Sie hatten ihre Krankheitstage längst verbraucht und noch war nicht absehbar, wann Libby wieder arbeiten konnte. Deshalb hatte Owen zugestimmt, als sein Captain vorgeschlagen hatte, ihn am kommenden Montag vom Amtsarzt der Polizei untersuchen und seine Dienstfähigkeit beurteilen zu lassen. Zudem hatte Owen das Gefühl, wieder auf dem Damm zu sein. Die Kugel in seiner Schulter war ein glatter Durchschuss gewesen und völlig komplikationslos verheilt, aber auch der Schuss ins Bein hatte keine größeren Schwierigkeiten bereitet. Das größte Problem war sein eklatanter Blutverlust gewesen, aber inzwischen ging es ihm besser.
Auch bei Libby waren die schlimmsten Wunden inzwischen einigermaßen verheilt. Sie würde sichtbare Narben zurückbehalten – einige sogar. Am Pazifik war es an diesem Tag windig und frisch, weshalb es nicht weiter auffiel, dass sie mit langen Ärmeln dasaß, aber noch ein paar Tage zuvor hatten sie in Pleasanton bei 35 Grad gebrütet und Libby hatte es nicht fertiggebracht, ein ärmelloses Trägershirt anzuziehen. Ein kurzärmeliges T-Shirt war für sie das Höchste der Gefühle gewesen, denn so waren bloß die verheilenden Schürfwunden an ihren Handgelenken und die Schnitte an ihren Armen sichtbar gewesen, aber nicht die Striemen an ihrem Rücken und das Brandzeichen an ihrer Schulter, dessen Anblick sie kaum ertrug.
Sie wusste noch nicht, wie sie damit umgehen sollte. Im Augenblick fühlte sie sich unsäglich entstellt. Sadie hatte versucht, ihr Mut zu machen, aber auch zugegeben, dass sie ihre Scham nur zu gut nachvollziehen konnte.
Im Kreis ihrer Familie kam Libby damit zurecht, aber sie wollte nicht von Fremden angestarrt werden. Sie wollte nicht für eine Ritzerin gehalten werden – aber noch weniger wollte sie den Leuten die Wahrheit darüber sagen, wie ihre Wunden entstanden waren. So weit war sie noch nicht. Sie war schon durch die Hölle gegangen, als sie in San José zu ihrer Frauenärztin von früher gegangen war, um die Fäden ziehen zu lassen, mit denen die Ärztin im Krankenhaus in State College ihre Schnittwunden genäht hatte. Wenigstens das bereitete ihr keinerlei Beschwerden mehr und war ohnehin für niemanden sichtbar.
An Owen gelehnt, saß sie da und beobachtete die Nebelfelder, die wieder ihr Glück versuchten. Dort hätte sie wirklich ewig bleiben wollen. Sie konnte sich auf der ganzen Welt keinen schöneren Ort vorstellen.
„Ich liebe dich“, sagte sie leise, während sie ihre Finger mit Owens verschränkte.
„Ich liebe dich auch. Ich werde auch nie aufhören, deine Stärke zu bewundern und stolz darauf zu sein, wie gut du das alles meisterst“, sagte er.
Libby zuckte mit den Schultern. „Was soll ich denn tun? Es muss ja weitergehen. Ich kann und will mich nicht hängen lassen. Dann hätte Vincent gewonnen – und das wäre so ungerecht dir gegenüber. Du hast mich bestimmt nicht geheiratet, um jetzt ein Häufchen Elend hochpäppeln zu müssen.“
Überrascht sah sie ihn an, als er die Schultern straffte und einen entrüsteten Gesichtsausdruck annahm.
„Das meinst du nicht ernst, oder?“, fragte er.
Nach kurzem Zögern erwiderte sie: „Doch, das tue ich. Wir sind füreinander verantwortlich und du tust so viel, damit es mir besser geht. Das klappt auch und das sollst du auch spüren. Nichts davon war je deine Schuld und ich will die Frau für dich sein, die du geheiratet hast.“
Sie verstand gar nicht, warum er sie so ungläubig ansah und den Kopf schüttelte.
„Ich bitte dich, ich habe dich nicht nur geheiratet, weil du hübsch und intelligent bist und überhaupt die Frau meiner Träume. Ich habe dich auch geheiratet, weil ich für dich da sein will – egal weshalb. Ich komme schon nicht damit zurecht, dass ich das alles nicht verhindern konnte, aber jetzt gib du dir bitte nicht die Schuld. Ich möchte, dass du wieder ganz die Alte wirst, aber du darfst durchaus auch mal Schwäche zulassen.“
„Tue ich doch …“
Nun lächelte er wieder. „Ja, schon – aber bitte versuch nie, mir etwas anderes vorzuspielen, wenn es dir mal schlecht geht. Du darfst auch mit mir über deine Alpträume sprechen oder generell über die Dinge, die passiert sind. Ich packe das, ehrlich.“
„Ich weiß. Es liegt nicht daran, dass ich nicht mit dir reden will. Ich kann es nur noch nicht. Sadie hat dir doch erklärt, warum. Ich übe das gerade mit ihr.“
„Schon klar. Alles gut.“ Owen strich ihr übers Haar und küsste sie auf die Stirn. „Ich bin doch bloß froh, dass du wieder bei mir bist. Ich will nie wieder so auf dem Zahnfleisch gehen wie in den fünf Tagen, in denen ich dich nicht finden konnte und genau wusste, dass du durch die Hölle gehst. Das war auch für mich die Hölle, nur anders.“
Libby nickte, denn das konnte sie sich allzu gut vorstellen. Allerdings war sie der Meinung, dass sie das bislang gar nicht so schlecht meisterten. Zwar hatte sie ihm immer noch kein einziges Wort über das gesagt, was Vincent ihr angetan hatte, aber sie wusste, dass das Zeit brauchte. Sadie vermittelte zwischen ihnen und Libby beschränkte sich gerade darauf, ohne Worte mit Owen zu kommunizieren – es zu genießen, wenn er sie umarmte und seinen Trost zu suchen, wenn sie aus einem furchtbaren Traum hochschrak.
Sie hatte nicht das Gefühl, dass etwas zwischen ihnen stand. Eigentlich fühlte es sich sogar für sie an, als wären sie einander näher denn je – was vor allem daran lag, dass Owen ihr frei von jeglichen Erwartungen gegenüber trat. Das machte er wirklich gut. Sie war ihm unendlich dankbar.
Sie hatten noch eine ganze Weile so dagesessen, als sie hinter sich im Sand Schritte hörten, die sich langsam näherten. Als Libby sich neugierig umdrehte, entdeckte sie Sadie.
„Hey, da bist du ja“, begrüßte sie ihre Mutter.
„Ich dachte, ich schaue mal, ob ich euch hier nicht irgendwo finde. Ist das toll hier.“
„Ich könnte bis ans Ende meiner Tage hierbleiben“, sagte Libby.
„Ich habe Hunger …“ merkte Owen vorsichtig an und lachte.
„Ich auch. Wollen wir mal sehen, wie weit Matt und Hayley mit der Pizza sind?“, schlug Sadie vor.
„Na gut“, sagte Libby und lächelte. Nachdem sie aufgestanden war, klopfte sie den Sand von ihrer Jeans und machte sich mit Owen und Sadie auf den Weg zum Parkplatz etwas oberhalb der Klippen. Sadie hatte ihren Chevrolet Cruze ganz in der Nähe geparkt und fuhr ein Stück weiter auf den Highway 101 auf, um zur Bay Bridge zu kommen. Libby blickte noch einmal zurück zur Golden Gate Bridge, bevor sie die Aussicht auf die Bucht von San Francisco hinüber nach Alcatraz genoss.
Sie wollte wirklich nicht zurück nach Virginia, aber dort war ihr Leben. Das hatte sie sich so ausgesucht und nun musste sie damit leben, dass ihr Team am anderen Ende der USA stationiert war. Das war auch eigentlich immer okay gewesen, aber sie scheute die Ungewissheit, die sie dort in einigen Tagen erwartete.
Sie brauchten über eine Stunde bis nach Pleasanton, aber Libby genoss die ganze Fahrt und sog alle Eindrücke in sich auf. Zwischendurch telefonierte Sadie mit Matt, um ihn über ihren vermutlichen Ankunftszeitpunkt in Kenntnis zu setzen, und als sie schließlich in Pleasanton das Haus betraten, duftete es dort bereits köstlich nach Pizza.
„Da seid ihr ja“, begrüßte Matt sie erfreut im Flur. „In fünf Minuten ist die Pizza fertig.“
„Fantastisch, ich muss also nicht verhungern“, sagte Owen grinsend.
„Wie war es?“
„Schön wie immer. Ich bin so gern am Pazifik“, sagte Libby. Während die anderen in Richtung Küche gingen, zog sie langsam ihre Schuhe aus und schluckte schwer, als ganz unerwartet die Erinnerung daran in ihr hochkroch, wann sie zuletzt an Marshall’s Beach gedacht hatte. Dorthin hatte sie sich in Gedanken geflüchtet, als Vincent Bailey sie ans Bett gefesselt und zum ersten Mal vergewaltigt hatte.
Unwillkürlich hielt sie sich am nahen Treppengeländer fest und schnappte nach Luft. Das hatte sie verdrängt. Sie wusste nicht, warum die Erinnerung so plötzlich über ihr hereinbrach – oder doch, denn zumindest kannte sie den Fachbegriff dafür. Das war ein Flashback. Nicht der erste – und es würde auch nicht der letzte sein, das war ihr vollkommen klar.
„Alles in Ordnung?“, fragte Sadie, die in den Flur spähte, um nach Libby zu sehen.
Libby nickte stumm und versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, doch vergeblich. Sadie musste sie nur ansehen, um alle Dämme in ihr brechen zu lassen. Zwar wandte Libby sich noch ab und versuchte, die Tränen zurückzuhalten, aber sie schaffte es nicht. Wortlos kam Sadie zu ihr und schloss sie vorsichtig in die Arme. Als Libby zu schluchzen begann, wiegte Sadie sie liebevoll hin und her, wie sie es früher immer mit Hayley gemacht hatte, und strich ihr sanft übers Haar.
„Es ist okay, du bist hier sicher“, sagte sie, doch Libby fühlte sich in diesem Moment einfach nur erbärmlich und innerlich ganz kalt.
„Hast du dich an etwas erinnert?“, fragte Sadie leise. Libby nickte stumm und erwiderte ihre Umarmung. Sie hörte Schritte im Flur und spürte, wie Sadie gestikulierte, aber daran störte sie sich nicht.
Schließlich hob sie den Kopf und sagte: „Es war mein Zufluchtsort, verstehst du? Daran habe ich gedacht, als … als ich einfach versucht habe, auszublenden, was er mit mir macht. Daran habe ich mich gerade erinnert …“
Sadie nickte verstehend. „Das war dir gar nicht mehr bewusst, oder?“
„Nein, ich … ich wollte heute einfach an den Strand, weil ich es liebe. Ich habe die ganze Zeit nicht daran gedacht, dass mir in diesem einen Moment nur die Erinnerung an diesen Ort geblieben ist, um …“ Libby schluckte und atmete tief durch. „Um irgendwie zu überleben, was er da getan hat.“
„Okay, ich weiß, was du meinst. Schon gut. Geht es wieder?“
Libby nickte und machte nun den ersten Schritt in Richtung Küche. Owen und Matt versuchten, sie nicht allzu besorgt anzusehen, aber es gelang ihnen nicht. Hayley kam aus dem Esszimmer und lächelte scheu, sagte jedoch nichts. Ihr fiel es immer noch schwer, damit umzugehen, weil sie noch nicht einschätzen konnte, was Libby überhaupt zugestoßen war. Das nahm Libby ihr aber nicht übel, sie wollte es gar nicht anders. Nachdem Hayley mit fünf Tellern ins Esszimmer verschwunden war, fragte Owen: „Eine Erinnerung?“
„Ja … keine gute. Ich meine …“ Libby suchte nach Worten. Sie wollte es unbedingt versuchen. „In Gedanken war der Strand mein Zufluchtsort. Daran habe ich gedacht, wenn ich ausblenden wollte …“ Sie musste kurz innehalten. „Was er getan hat. Wenn … wenn es zu schlimm war.“
Für einen Moment war es still in der Küche. Es war ihr unangenehm, als die Blicke der anderen auf sie gerichtet waren, aber sie verstand den Grund. Sie hatte zum ersten Mal ein solches Detail vor Matt und Owen angesprochen, bislang war ihr das nur bei Sadie gelungen.
„War es denn vorhin nicht seltsam, dort zu sein?“, fragte Owen in die Stille hinein.
„Nein, überhaupt nicht. Das war erst jetzt seltsam, als es mir wieder eingefallen ist.“
Nun lächelte er. „Aber gerade hast du es ausgesprochen.“
Libby nickte zögerlich. „Ja … und das ist verdammt seltsam. Ich kann das ja gar nicht präzise formulieren – wenn ich es versuche, dann geht in meinem Kopf eine Schranke zu und es kommt nichts mehr.“
„Du machst das toll“, sagte Matt und lächelte. Erneut schossen Libby Tränen in die Augen, aber diesmal vor Rührung. Owen legte eine Hand auf ihre Schulter und nickte ihr zu. Sie lächelte kurz, bevor sie mit Sadie und Owen ins Esszimmer ging und sich zu Hayley setzte. Matt folgte kurz darauf mit dem Pizzablech und stellte es auf den Untersetzern auf dem Tisch ab.
„Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit dem, was wir hier verbrochen haben“, sagte er, bevor er begann, die Pizza in Stücke zu schneiden und den anderen ihre Wunschstücke zu überreichen.
„Großartig“, sagte Owen kurz darauf. „Gute Salami – mehr braucht eine Pizza eigentlich gar nicht.“
Matt grinste und blickte zu Hayley. „Das Pizzabacken hat auf jeden Fall Spaß gemacht, oder?“
„Klar“, erwiderte sie mit vollem Mund und kicherte verlegen. „Ups.“
Libby genoss die Normalität beim Abendessen. Sie war den anderen dankbar dafür, dass sie klug genug waren, jetzt nicht weiter mit ihr darüber zu sprechen, was in ihr vorging. Das wäre ihr auf den Magen geschlagen.
Den restlichen Abend verbrachten sie mit Gesellschaftsspielen. Am nächsten Tag musste Hayley nicht zur Schule und durfte entsprechend länger aufbleiben. Libby konzentrierte sich ganz auf die Spiele und konnte alles andere vergessen, worüber sie sehr froh war. Inzwischen klappte das immer besser.
Als Hayley schließlich schlafen ging und Matt und Sadie kurz in der Küche verschwanden, um noch etwas aufzuräumen, stahl Libby sich davon und ging leise ins Gästezimmer. Aus dem Bad hörte sie Wasserrauschen, während sie im Koffer auf der Suche nach ihren Tabletten ging. Nach diesem Flashback würde sie sonst kein Auge zumachen, das ahnte sie jetzt schon. Das hatte sich eingebrannt, sie fühlte sich noch immer, als stünde sie unter Strom.
Sie zog das Röhrchen aus einer Seitentasche des Koffers und fischte eine Ativan heraus. Danach blieben noch fünf Tabletten. Wenn sie wieder in Virginia war, würde sie sich Nachschub besorgen müssen, ob ihr das nun gefiel oder nicht. Hier in Kalifornien hatte sie nicht ständig welche gebraucht, aber sie ahnte, dass sie zu Hause Schwierigkeiten haben würde. Noch kam sie anders nicht damit zurecht. Nicht, dass sie es nicht versucht hätte, aber es klappte einfach nicht.
„Was machst du da?“
Libby zuckte zusammen und prallte rücklings gegen den Schrank. „Hayley … hast du mich erschreckt.“
„Tut mir leid, das wollte ich nicht. Alles okay? Was hast du da?“
Mühsam rang Libby sich ein Lächeln ab. „Ach, ich hab bloß Kopfschmerzen.“
„Ach so.“ Hayley stand verlegen in der Tür und druckste ein wenig herum, bevor sie einen Schritt ins Zimmer machte. „Libby?“
„Ja?“
„Ich … ich muss immer daran denken, was passiert ist. Ich war im Internet, weil ich dachte, dass ihr mir nicht alles erzählt und … ich habe da so furchtbare Dinge über ihn gelesen.“ Betreten sah Hayley ihre große Schwester an.
„Das kann ich mir vorstellen“, sagte Libby. „Und jetzt macht dir das Angst?“
„Nein, ich meine … doch, schon irgendwie. Ich hab ja keine Ahnung, wie das ist, wenn ein Mann und eine Frau …“ Sie lief knallrot an und senkte beschämt den Blick, aber Libby hatte eine Ahnung, worauf Hayley hinaus wollte.
„Du kannst dir nicht so richtig vorstellen, was er getan hat, oder?“
Hayley schüttelte den Kopf. „Nein, aber was ich mir vorstelle, ist so schlimm … ich muss dann immer daran denken, wie weh dir das getan haben muss …“
Libby schluckte schwer und stand auf, um ihre kleine Schwester zu umarmen. Dabei war Hayley am ganzen Leib wie erstarrt und Libby brachte sie dazu, sich zu ihr aufs Bett zu setzen.
„Pass auf – wenn Männer und Frauen sich lieben, ist das etwas Großartiges. Es ist schön, wenn man einem anderen Menschen so sehr vertraut, dass man ihm Dinge über sich verrät, die sonst niemand weiß – wie man gern berührt werden möchte zum Beispiel. Klar ist das erst mal komisch, Jungs oder Männer sind ja anders als wir. Wenn man sich gern hat, findet sich das alles irgendwie. Aber es gibt eben auch Männer wie Bailey, die …“ Libby suchte kurz nach den richtigen Worten. „Die gar nicht wissen, wie es ist, wenn man möchte, dass es einem anderen Menschen gut geht. Bailey wollte das Gegenteil, da war etwas ziemlich kaputt in seinem Kopf. Und ja – es ist mit das Schlimmste überhaupt, wenn dich ein anderer Mensch zu etwas zwingt, was du nicht willst und er dir weh tut, weil ihm das Spaß macht. Er hat versucht, sich etwas zu nehmen, was ihm nicht gehört, verstehst du? Aber er hat es nicht bekommen. Ich habe ihn nicht gelassen. Das hat ihn geärgert und dann hat er versucht, mir noch mehr weh zu tun. Und das ist etwas, worüber ich noch nicht richtig sprechen kann.“
„Weil es dich traurig macht.“
Libby nickte. „Ziemlich, ja.“
„Aber was ist mit Owen? Kannst du ihn jetzt nicht mehr lieb haben?“
Es kostete Libby einiges, nicht die Beherrschung zu verlieren. „Doch, natürlich. Er tut mir ja nicht weh, verstehst du? Das würde er nie tun. Wir müssen es nur langsam angehen lassen.“
„Okay … ich … ich hatte nur Angst, dass ihr euch jetzt nicht mehr gern habt …“
Gerührt legte Libby einen Arm um Hayleys Schultern. „Natürlich haben wir uns gern. Oder sieht es für dich danach aus, als hätten wir uns nicht mehr lieb?“
Als Hayley den Kopf schüttelte, lächelte Libby. „Siehst du. Mach dir keine Sorgen. Und jetzt gehst du am besten schlafen.“
„Okay. Ich hab dich lieb.“ Hayley umarmte Libby, bevor sie sich aus dem Zimmer stahl und in ihrem verschwand. Nachdenklich blickte Libby ihr hinterher und ging ins Bad, um mit einem Schluck Wasser die Tablette zu nehmen. Anschließend kehrte sie nach unten zurück und setzte sich noch kurz mit den anderen zusammen. Sie sprachen über die anstehenden Wohnungsbesichtigungen und Sadie begrüßte es, dass Owen und Libby einen Tapetenwechsel anstrebten. In ihren Augen war das die einzig richtige Idee.
Schließlich wollten auch Owen und Libby ins Bett gehen. Libby fühlte sich inzwischen ruhiger und einigermaßen müde, worüber sie froh war.
„Warst du vorhin noch oben?“, fragte Owen, als sie nach dem Zähneputzen im Gästebett lagen.
Ertappt sah Libby ihn an. „Warum fragst du?“
„Ich habe dich und Hayley gehört.“
„Ja … ich hab mir was gegen Kopfschmerzen geholt und wollte ihr noch mal gute Nacht sagen, aber da hat sie mich etwas gefragt … Ich hatte das Gefühl, ihr macht die Vorstellung dessen Angst, was Bailey getan hat. Weil sie sich nicht vorstellen kann, was ein Vergewaltiger tut. Sie hat gelesen, dass er einer ist, und das hat ihr wohl ziemliche Angst gemacht.“
„Klar … wenn ich mal überlege, wie absurd ich in ihrem Alter die Vorstellung von Sex fand. Da versteht man erst recht nicht, wie es ist, wenn so etwas mit Gewalt einhergeht.“
„Ja, eben. Aber sie war da sehr reflektiert – ihr war klar, dass sich das auf unsere Beziehung auswirkt. Sie hatte Angst, dass wir jetzt Probleme haben und es unsere Liebe kaputt macht.“
Das zu hören, überraschte Owen. „So weit hat sie da gedacht?“
„Das hat mich auch erstaunt. Anscheinend ist ihre Vorstellung von allem klarer, als wir dachten. Vielleicht rede ich morgen noch mal mit ihr und versuche, ihr ein paar Dinge so zu erklären, dass sie sie versteht. Das Ganze macht ihr wirklich Sorgen.“
„Süß von ihr. Sie ist ein tolles Mädchen.“
Libby nickte langsam. „Ja, das ist sie. Ich hoffe nur, dass sie so etwas nie erleben muss.“
Sonntag, 5. September
Eigentlich wollte Libby nichts weniger, als nach Virginia zu fliegen. Sie wollte in Kalifornien bleiben, am liebsten für immer. Bei ihrer Familie und den Katzen in dem schönen Haus mit Garten in Pleasanton. Insgeheim war sie fast schon froh, weiterhin vom Dienst suspendiert zu sein, denn sie war noch nicht so weit, es wieder mit den Verbrechern der Welt aufzunehmen. Sie fühlte sich noch zu verletzlich. Verwundet.
Nur Matt und Sadie begleiteten sie zum Flughafen in San Francisco. Der Flug nach Washington ging um halb neun Uhr morgens und Hayley war sichtlich unglücklich bei der Vorstellung gewesen, an einem Sonntag um fünf aufstehen zu müssen, um Libby am Flughafen zu verabschieden – etwas, was Libby nur zu gut verstehen konnte. Für Hayley hatte das Schuljahr am Tag von Libbys Entführung begonnen und als Schüler kurz vor der Pubertät feilschte man um jede Minute wertvollen Schlafes.
Libby hatte sich am Vorabend von ihrer Schwester verabschiedet, nachdem sie noch eine ganze Weile mit ihr gesprochen und versucht hatte, ihr einiges über Vincent zu erklären und über das, was er getan hatte. Weil sie es für Hayley ohnehin anders ausdrücken musste, fiel es ihr gar nicht so schwer, wie sie befürchtet hatte. Es hatte Hayley auch gutgetan, mit ihrer Schwester im Vertrauen zu sprechen.
Hinter ihnen wurde es allmählich hell, während sie über die San Mateo Bridge zum Flughafen fuhren. Libby hatte sich an Owen gelehnt und schaute aus dem Fenster auf die erleuchtete Skyline von San Francisco. Sie wäre wirklich gern geblieben, aber das ging einfach nicht.
Um sechs hatten sie den Flughafen erreicht und Sadie hielt vor dem Terminalgebäude, um Owen und Libby dort aussteigen zu lassen. Matt holte ihr Gepäck aus dem Kofferraum und stellte die Taschen neben dem Auto ab.
Libby hatte einen dicken Kloß im Hals, als sie ihre Eltern ansah, und wollte sich gar nicht von ihnen verabschieden. Matt machte schließlich den Anfang, er umarmte sie nacheinander und drückte Libby so fest an sich, dass ihr kurz die Luft wegblieb. Das half ihr nicht gerade dabei, die Beherrschung nicht zu verlieren, und als Sadie sie in die Arme schloss, war es um sie geschehen.
„Ich will nicht weg“, gab sie unter Tränen zu, wischte sie aber hastig weg und atmete tief durch.
„Wir sehen uns im November – und jederzeit vorher, wenn du willst. Meld dich einfach und wir sind da, das weißt du“, sagte Matt. Libby nickte und Sadie fügte hinzu: „Bitte ruf mich an, wenn etwas ist. Egal wann und warum. Versprich mir das.“
Libby nickte und umarmte sie noch einmal. „Ich habe euch lieb.“
Die beiden erwiderten die Worte und Sadie verabschiedete sich auch von Owen, bevor sie wieder ins Auto stiegen und losfuhren. Traurig blickte Libby ihnen hinterher und konnte sich kaum von diesem Anblick lösen, doch schließlich folgte sie Owen ins Terminalgebäude, wo sie die Koffer aufgaben und zum Sicherheitscheck gingen. Als sie den hinter sich gebracht hatten, holten sie sich ein kleines Frühstück, denn inzwischen hatten sie Hunger. Draußen wurde es allmählich hell.
Das Flugzeug startete pünktlich um halb neun. In Arlington würde es schon fast Abend sein, wenn sie landeten. Durch den Flug und die Zeitumstellung ging ihnen fast der ganze Tag verloren.
An Owen gelehnt, saß Libby im Flugzeug. Sie kostete jede Minute seiner Nähe aus und schlief nach etwa zwei Stunden Flugzeit ein. Sie verschlief fast die Hälfte des Fluges, wofür sie sehr dankbar war, aber sie fühlte sich trotzdem müde, als sie am Ronald Reagan Airport landeten und auf die Jagd nach ihren Koffern gingen. Für die Heimfahrt nahmen sie sich ein Taxi und eine Viertelstunde später standen sie vor ihrem Haus.
Alles in Libby protestierte. Sie wollte nicht dort sein. Owen entging nicht, wie zögerlich sie ihm folgte, und als sie vor ihrer Wohnungstür standen, stellte er seinen Koffer ab und umarmte sie.
„Übermorgen haben wir schon den ersten Besichtigungstermin mit einem Makler“, erinnerte er sie.
„Ich weiß … trotzdem habe ich draußen vor meinem inneren Auge den Streifenwagen stehen sehen. Das vergesse ich nicht mehr. Ich vergesse nichts davon.“
„Ich weiß. Wir schaffen das.“
Libby nickte und folgte Owen in die Wohnung, nachdem er die Tür geöffnet hatte.
Ja, das war ihre Wohnung. Sie kam ihr vertraut vor, aber trotzdem fühlte sie sich irgendwie unwohl. Libby vermied es so lange wie möglich, das Schlafzimmer zu betreten, aber irgendwann ging es nicht mehr und sie musste reingehen.
Ein blasser, aber großer brauner Fleck verunzierte den Teppich am Fußende des Bettes. Da musste irgendein Teppich drauf, das stand sofort für sie fest. Dass die Tür des Kleiderschranks eingedrückt war, machte es nicht besser.
„Ist es okay?“, fragte Owen von der Tür aus, weil er sah, dass Libby wie angewurzelt dastand.
„Muss ja“, sagte sie. „Bin mal gespannt, ob ich es schaffe, hier zu schlafen.“
Owen machte ein zustimmendes Geräusch, aber Libby sagte sich, dass es nur eine Erinnerung war. Es war vorbei. Sie war nicht mehr in Gefahr – Vincent war tot. Gestorben durch ihre eigene Hand.
Das machte einen Unterschied für sie. Sadie hatte versucht, sie darauf zu trainieren, dass sie sich das immer wieder bewusst machte. Sie war ihm aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe entkommen – und sie hatte ihm schließlich den tödlichen Schuss beigebracht. Auge in Auge hatte sie ihm gegenüber gestanden und ihm bewiesen, dass er nicht gewonnen hatte.
Owen und Libby beschlossen schnell, nicht erst auszupacken, sondern erst einmal einkaufen zu gehen. Der Kühlschrank war leer, aber sie hatten Hunger. Sie wählten den großen Supermarkt in der Nähe des Kinos, in dem um diese Zeit einigermaßen Betrieb herrschte. Libby bewegte sich etwas unsicher durch die Gänge und versuchte, niemandem aufzufallen, doch als sie an der Kasse standen, blickte die Kassiererin immer wieder verstohlen zu ihr hoch. Während Libby noch überlegte, wie sie darauf reagieren sollte, lächelte die junge Frau unverhofft.
„Es ist gut, dass er tot ist“, sagte sie zu Libbys Überraschung.
Owen, der eigentlich damit beschäftigt war, die bereits erfassten Dinge wieder in den Einkaufswagen zu legen, hielt inne.
„Im Moment kann ich nirgends auftauchen, ohne dass man mich erkennt“, murmelte Libby.
„Ich wusste nicht, ob ich was sagen soll … aber Sie gehen ja oft hier einkaufen und ich hab das immer im Fernsehen verfolgt – das war schlimm. Das hat mich total beschäftigt und ich war so froh, als es hieß, dass Sie ihm entkommen sind und dass er jetzt tot ist.“
Libby nickte langsam. „Ja, das macht es besser.“
„Ich habe mir angesehen, was Sie schon alles fürs FBI gemacht haben. Sie sind ja eine richtige Heldin.“
Ein Lächeln stahl sich auf Libbys Lippen. „Das ist eben mein Job.“
„Ich bewundere das. Sehr mutig. Ich wünsche Ihnen alles Gute.“
„Danke“, sagte Libby. Sie war hin- und hergerissen zwischen einem Gefühl von Scham und andererseits Freude, denn sie fand, dass die Kassiererin sich freundlich geäußert hatte.
Auf dem Weg zum Auto sagte Owen: „Daran müssen wir uns jetzt wohl gewöhnen.“
„Du hast mir ja gesagt, dass ich dauernd im Fernsehen war … aber das ist verdammt seltsam.“
„Ich bin gespannt, wie es wird, wenn ich wieder arbeite. Aber die Hauptperson warst definitiv du. Da verstand das FBI keinen Spaß – sie wollten dich finden. Um jeden Preis.“
Libby lächelte. „Das ist irgendwie gut zu wissen. Ich habe immer noch Angst, dass sie mich demnächst ans Kreuz nageln.“
Owen schüttelte den Kopf. „Nick sagte doch, dass sie das nicht tun werden.“
„Ja, aber hören die Verantwortlichen auch auf Nick Dormer?“
„Als ob ernsthaft einer traurig wäre, weil es jetzt einen Serienmörder weniger auf der Welt gibt.“
Libby wartete, bis sie wieder in Owens Auto saßen und sagte: „Sie müssen nur dahinter kommen, dass ich es drauf angelegt habe.“
„Das wird dir niemand beweisen können.“
Libby hoffte es. Gemeinsam brachten sie die Einkäufe in die Küche, als sie wieder zu Hause waren und stellten gleich die Familienlasagne in den Ofen, die sie mitgebracht hatten. Danach räumten sie erst die Einkäufe aus und schließlich auch ihre Koffer. Sie waren fast fertig, als die Lasagne es auch war, und setzten sich zum Essen hin.
„Ich finde ja, es wird sowieso Zeit, dass wir uns vergrößern und Eigentum anschaffen“, sagte Owen unverhofft.
„Ja, sicher … dann hoffen wir mal, dass ich jetzt nicht meinen Job verliere.“
Er schüttelte den Kopf. „Wirst du nicht. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.“
Libby konnte sich das auch nicht vorstellen, aber sie hatte Angst. Auch an Nick würde das nicht spurlos vorbei gehen, denn er war verantwortlich dafür gewesen, dass sie Vincent in Trenton gegenüber getreten war.
Es war schon halb neun, als sie mit allem fertig waren und sie beschlossen, es sich nur noch vor dem Fernseher gemütlich zu machen. Owen saß auf dem Sofa und Libby hatte sich neben ihn gelegt, den Kopf mit einem kleinen Kissen auf seinen Schoß gebettet. Seine Hand ruhte auf ihrer Seite, was sich ganz wunderbar anfühlte. Zusammen schauten sie sich Bad Boys for Life an und als der Film zu Ende war, war es auch schon an der Zeit, ins Bett zu gehen.
„Ich bin sogar müde“, sagte Owen überrascht, als sie im Bad standen. „Hätte ich nicht gedacht, meine innere Uhr müsste doch wissen, dass es noch nicht so spät ist.“
„Wir mussten aber früh aufstehen und reisen ist sowieso immer anstrengend“, sagte Libby beim Zähneputzen. Im Spiegel streifte ihr Blick ihre ehemals wunden Handgelenke, was langsam verheilte. Sie konnte sich einfach nicht an diesen Anblick gewöhnen, weil es sie daran erinnerte, woher die Verletzungen stammten. Immer wieder hatten die Stricke oder die Handschellen die Wunden aufgerissen, wenn Vincent ihr auf irgendeine Art Schmerzen zugefügt und Libby in ihrer Qual an den Fesseln gezerrt hatte.
Nein, es tat ihr nicht leid, dass sie ihn erschossen hatte. Nicht, nachdem er sie tagelang gefoltert und gedemütigt hatte. Sie war auch nicht sicher, ob es ihr nicht noch schlechter gegangen wäre, hätte sie es nicht getan. So hatte sie irgendwann wieder die Handlungsfähigkeit zurückerlangt, die Vincent ihr genommen hatte.
Owen war schon ins Schlafzimmer gegangen, als Libby nachdenklich vor dem Spiegelschrank stand und schließlich doch das Röhrchen mit den fünf verbliebenen Ativan in die Hand nahm. Sie war ziemlich sicher, dass sie in dieser Nacht eine brauchen würde.
Sie nahm eine, während sie beschloss, sich am nächsten Tag darum zu kümmern, wie sie an Nachschub kam. Zwar war sie sich dessen völlig bewusst, dass das nicht ewig so weiterging, aber im Augenblick schaffte sie es einfach nicht ohne. Der Arzt in State College hatte es gut mit ihr gemeint, weil er ihr eine großzügige Anzahl mitgegeben hatte, aber das hatte er auch mit den Schmerztabletten getan. Davon hatte sie mehr übrig behalten.
Schließlich gesellte sie sich zu Owen ins Bett. In letzter Zeit trug sie auch nachts nur noch etwas, was mindestens kurze Ärmel hatte, aber trotzdem fuhr Owen plötzlich sanft mit den Fingerspitzen über die heilenden Schürfwunden an ihren Handgelenken.
„Das alles ändert übrigens gar nichts daran, dass ich dich immer noch wunderschön finde“, sagte er.
Libby lächelte zaghaft. „Danke.“
„Ich hoffe, dass du es nicht falsch verstehst und dich unter Druck gesetzt fühlst, wenn ich dir jetzt sage, dass es mir fehlt, dir ganz nah zu sein. Ich möchte nur, dass du weißt, dass sich für mich nichts geändert hat – ich liebe dich immer noch mit Haut und Haaren. Lass es mich einfach wissen, wenn du so weit bist, okay? Dann versuchen wir das, was du dir vorstellen kannst. Vorausgesetzt, es ist alles okay und ich tue dir nicht weh.“
Unsicher sah Owen sie an und Libby wusste nicht gleich, was sie erwidern sollte. Es war das erste Mal, dass er es so direkt ansprach, aber sie war froh über seine Offenheit.
„Nein, weh tun würdest du mir nicht … aber ich glaube, ich brauche noch Zeit. Nicht, dass mir das nicht auch fehlt … Du weißt, ich liebe dich. Aber ich muss hier erst mal wieder ankommen und mich an alles gewöhnen. Dieser Flashback am Freitag war ziemlich extrem und im Moment mache ich mir Sorgen, dass so etwas passieren könnte, wenn wir hier irgendwas versuchen. Das packe ich noch nicht.“
„Okay, das verstehe ich. Ehrlich gesagt wüsste ich gar nicht, wie ich das jetzt angehen sollte. Das müsstest du mir zeigen, glaube ich. Ich bin unsicher, weil ich eben nicht weiß, was alles passiert ist. Ich kann es nur vermuten und das macht es nicht gerade einfach.“
Libby nickte verstehend. „Ich muss sehen, dass ich mehr mit dir darüber spreche. Ich war froh, als ich das am Freitag in Worte fassen konnte, das war schwierig genug.“
„Kann ich mir vorstellen. Das war toll. Ich weiß, dass wir das schaffen“, sagte Owen. Libby war ihm dankbar für seine Zuversicht und die Geduld, die er hatte. Das machte es besser.
Montag, 6. September
Libby hatte ruhig geschlafen und erwachte erst, als Owens Wecker klingelte. Sie standen auf, frühstückten gemeinsam und um kurz nach acht machte Owen sich auf den Weg nach Washington. Den Termin für seine amtsärztliche Untersuchung hatte er um neun.
„Ich melde mich, wenn ich fertig bin“, versprach er Libby, bevor er sich mit einem Kuss von ihr verabschiedete. Liebevoll und ein bisschen sehnsüchtig blickte sie ihm nach, auch als die Tür sich schon hinter ihm geschlossen hatte.
Jetzt war sie allein. Augenblicklich fühlte sie sich unsicher und irgendwie eingesperrt, weshalb sie erst einmal zwei Fenster öffnete und zumindest durch den leichten Luftzug das Gefühl der Beklemmung verschwand.
Sie fragte sich, ob sie je vergessen würde, was passiert war. Vermutlich nicht – dahingehend hatte Sadie ihr auch keine Hoffnungen gemacht. Sie hatte ihr aber versprochen, dass es besser werden würde.
Entschlossen ging Libby ins Schlafzimmer und starrte auf den Blutfleck und die kaputte Schranktür. Den Schrank hatte Owen in einem Möbelhaus ganz in der Nähe erstanden. Kurzerhand beschloss sie, dorthin zu fahren und sich zu erkundigen, ob sich die Tür ersetzen ließ, doch bis das Geschäft öffnen würde, dauerte es noch etwas.
Plötzlich fühlte sie sich wie gelähmt. Was sollte sie jetzt allein tun? Sie hatte keine Ahnung. In Kalifornien schliefen noch alle und Julie war beschäftigt. Sie war auf sich gestellt. Allerdings hatte sie das starke Gefühl, es nicht allein in der Wohnung auszuhalten und entschied sich schließlich dafür, nach Quantico zu fahren und bei den Kollegen mal Hallo zu sagen. Das konnte ihr niemand verbieten.
Sie setzte sich ins Auto und fuhr los. Allein das fühlte sich schon besser an. Unterwegs hörte sie laut Musik und wurde ohne Dienstmarke und Ausweis am Checkpoint durchgelassen, weil der Mann sie erkannte.
Sie hatte auch im Gebäude der Academy keinerlei Probleme. Die Sicherheitsleute erkannten sie ebenfalls und erkundigten sich bei ihr, wie es ihr ging, so wie jeder andere, dem sie auf dem Weg ins Büro begegnete. Dort angekommen, fand sie niemanden vor, aber dann erinnerte sie sich an den Grund. Gerade lief die Teamsitzung, die sie jeden Montagmorgen abhielten.
Libby beschloss, sich an ihren Schreibtisch zu setzen und dort zu warten. Etwa zehn Minuten später kamen ihre Kollegen aus dem Besprechungsraum und waren sichtlich überrascht, als sie sie bemerkten.
„Du bist ja hier“, sagte Belinda erstaunt. „Komm mal her, lass dich ansehen. Du hast ja kalifornische Sonne getankt.“
Nacheinander kamen die Kollegen zu ihr und umarmten sie. Nick hielt sich im Hintergrund, während die anderen sie mit Fragen bestürmten, gab ihr aber mit einem Blick zu verstehen, dass er mit ihr sprechen wollte. Als Libby es geschafft hatte, den anderen zu entkommen, stahl sie sich in sein Büro und schloss die Tür hinter sich. Nick kam zu ihr und umarmte sie herzlich.
„Schön, dich zu sehen. Kalifornien hat dir gutgetan, würde ich sagen. Du siehst besser aus.“
„Ja, es war gut. Sadie hat angefangen, es ein wenig mit mir aufzuarbeiten. Vor allem aber tat der Tapetenwechsel gut.“
„Das kann ich mir vorstellen. Wie geht es Owen?“
„Er hat gleich einen Termin beim Arzt, der beurteilen soll, ob er wieder dienstfähig ist.“
„Schon? Es ist erst drei Wochen her.“
„Gerade verdient keiner von uns Geld.“
Nick machte ein betroffenes Gesicht. „Und du? Wie geht es dir?“
„Besser … wobei ich vorhin aus unserer Wohnung raus musste. Da habe ich es allein nicht ausgehalten.“
Dormer nickte verstehend. „Das ist nicht überraschend. Wollt ihr umziehen?“
„Ja, wir haben morgen einen ersten Besichtigungstermin.“
„Das ist wahrscheinlich eine gute Idee.“
„Ich würde auch gern wieder arbeiten … keine Ahnung, wie ich es jetzt in unserer Wohnung aushalten soll, ohne die Wände hochzugehen.“
„Und damit wären wir auch gleich schon beim Thema – am Freitag hat man mir mitgeteilt, dass nun ein Termin für unsere Anhörung festgesetzt wurde. Deshalb hätte ich dich später noch angerufen.“
„Okay … und?“
„Meine ist nächsten Montag und deine nächsten Dienstag, vormittags um zehn.“
Libby nickte. „Okay, ich werde da sein. Wie ist denn die Stimmung?“
Nick seufzte kurz. „Gemischt. Mir haben sie schon ziemlich auf den Zahn gefühlt. Mit Mary Jane hat auch schon jemand gesprochen – ich weiß, dass sie dich in allen Belangen entlastet hat. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sie misstrauisch sind. Mir haben sie schon mehr als einmal gesagt, wie unverantwortlich es war, eine gleichermaßen befangene und traumatisierte Agentin auf ihren eigenen Entführer loszulassen, wobei mir niemand einen sinnvollen Alternativvorschlag unterbreiten konnte, was ich stattdessen hätte tun sollen. Es war ja nicht genug Zeit. Ich befürchte aber, dass sie trotzdem alles tun werden, um deine Absichten genau zu ergründen.“
„Das kann ich mir denken …“
„Ich habe das Gefühl, sie tun das, gerade weil du so eine talentierte Profilerin bist. Es macht sie stutzig, dass du ihnen aufgrund deines Handelns keinerlei Angriffspunkte lieferst, denn da gibt es nichts zu beanstanden. Ich vermute, sie wollen jetzt darauf hinaus, dass du die Ereignisse entsprechend gesteuert hast, denn sie haben mir deutlich gesagt, dass sie glauben, du wolltest seinen Tod.“
Libby schnaubte wütend. „Die haben gut reden, ehrlich. Weißt du, wie ich mich gefühlt habe? Ich hätte mir am liebsten in die Hose gemacht, denn ich wollte wirklich nichts weniger, als Vincent noch einmal gegenüberzustehen. Ich meine – du siehst, wie ich immer noch aussehe … Ich muss dir nicht sagen, was er mit mir gemacht hat. Es wäre eiskalt gelogen, würde ich behaupten, ich hätte ihn nicht gehasst. Aber ich wollte das einfach nur zu einem Ende bringen, in dem nicht das Baby stirbt und er Mary Jane und mich irgendwo in einem Wald in Stücke reißt. Ich musste ihn erschießen, das weißt du. Das war die einzige Möglichkeit, die ich hatte, um uns zu schützen.“
„Sag das nicht mir. Und du musst mir auch nicht sagen, dass dir das verdammt recht war. Das weiß ich und das ist nur menschlich. Aber ich will, dass du dich gegen sie wappnest. Das wird hässlich. Mir ist zu Ohren gekommen, dass Reed aus New York ausgesagt hat, er wäre davon überzeugt, dass du es darauf angelegt hast. Das hat er vor allem daran festgemacht, dass Owen dir seine Waffe gegeben hat.“
Libby holte tief Luft und versuchte, ihre Wut in Zaum zu halten. „Das MPDC hat deshalb nicht so einen Aufstand gemacht.“
„Nein, die sind allgemein etwas entspannter, ich weiß. Ich mache mir nur Sorgen, dass sie dich nächste Woche auseinandernehmen werden. Da nehmen sie auch wenig Rücksicht darauf, wie es dir wohl gerade geht – natürlich, du hast für dich beansprucht, einsatzfähig gewesen zu sein, als du Bailey erschossen hast. Das wirst du ihnen jetzt beweisen müssen.“
„Okay, ich denke, das kriege ich hin. Hauptsache, meine Suspendierung wird aufgehoben und ich darf wieder zu euch.“
Nick musterte sie skeptisch. „Fühlst du dich denn schon bereit dazu? Wir haben hier am laufenden Band Fälle auf dem Tisch, die dir eine hübsche Sammlung an Triggern und Anlässen zur Retraumatisierung liefern werden. Ich bin ja verantwortlich dafür, dass es dir gut geht.“
„Ich weiß, aber …“ Libby wusste nicht, was sie erwidern sollte. „Ich will meinen Job ja behalten, also muss ich einen Weg finden, um damit umzugehen.“
„Schon klar. Hast du denn ins Auge gefasst, eine Therapie zu machen?“
Libby nickte. „Das sollte ich wohl, ich habe gerade erst angefangen, meiner Familie gegenüber in Worte zu fassen, was passiert ist. Das fällt mir immer noch sehr schwer. Bei Sadie musste ich das ja nicht, aber ich will mit Owen reden können. Er fühlt sich unsicher, solange er nicht mehr weiß, was ich gut verstehen kann.“
„Okay … ich frage deshalb, weil ich das sehr wichtig finde. Ich weiß, deine Mum hat es damals irgendwie allein hinbekommen, aber ich bin nicht sicher, ob sie mit Hilfe von außen nicht noch ein besseres Ergebnis möglich gewesen hätte. Ich habe das nie angemerkt, weil sie damals von hier weggegangen ist und ich nicht mehr zuständig war, aber ich glaube, dich hat es schlimmer erwischt als sie und das schafft niemand allein.“
„Das will ich auch gar nicht.“
„In Ordnung … Es gibt eine Therapeutin bei mir in Annandale, die oft mit FBI-Agenten arbeitet und einen ausgezeichneten Ruf genießt. Sie tauscht sich auch mit unseren Ärzten aus, wenn es um die Dienstfähigkeit geht. Ich würde dir gern ihre Karte geben.“
Libby schluckte. Das traf sie unvorbereitet. „Aber der Schweigepflicht unterliegt sie? Ich meine … du hast damals bewusst aus der Akte meiner Mum alles rausgehalten, was ging, damit es ihre Laufbahn nicht beeinträchtigt. Ich hätte ein ungutes Gefühl, wenn ich zu einem Therapeuten gehen würde, bei dem ich nie sicher sein könnte, was am Ende hier beim FBI und vielleicht in meiner Akte landet.“
Nick erwiderte ihren Blick ernst. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ein Problem gibt, aber ich verstehe deine Vorbehalte.“
Nachdem sie allen Mut zusammengenommen hatte, fragte Libby: „Ich kann dir vertrauen, oder?“
„Natürlich, das weißt du. Ich bin immer auf deiner Seite.“
Sie lächelte dankbar und fuhr zögerlich fort. „Was ich erlebt habe, war auf seine Art schlimmer als das, was Taylor Sadie damals angetan hat. Ich glaube, jeder außer dir würde jetzt grundsätzlich anzweifeln, ob ich diesen Job noch machen kann, aber ich möchte nicht, dass du das tust und ich möchte auch vermeiden, dass das auf irgendeine andere Weise passieren könnte. Ich liebe meinen Job, daran hat Bailey absolut überhaupt nichts geändert. Wie ich das meistern werde, müssen wir sehen, aber ich will es versuchen. Ich brauche aber einen Therapeuten, dem ich alles sagen kann, ohne Angst zu haben, dass das hier in Quantico landet.“
„Das verstehe ich absolut. Davon abgesehen denke ich, dass deine Ausgangssituation eine andere ist als bei Sadie. Durch den Übergriff ihres eigenen Bruders hat sie ihre eigene Identität so weit in Frage gestellt, dass sie sich beinahe umgebracht hätte.