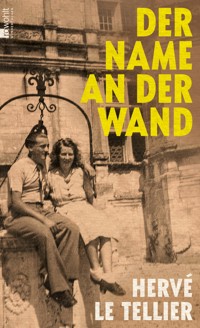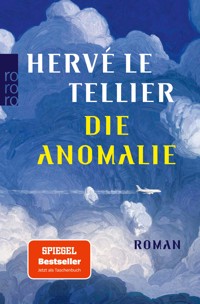
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Überraschungserfolg aus Frankreich: eine brillante Mischung aus Thriller, Komödie und großer Literatur. Im März 2021 fliegt eine Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New York durch einen elektromagnetischen Wirbelsturm. Die Turbulenzen sind heftig, doch die Landung glückt. Allerdings: Im Juni landet dieselbe Boeing mit denselben Passagieren ein zweites Mal in New York. Im Flieger sitzen der Architekt André und seine Geliebte Lucie, der Auftragskiller Blake, der nigerianische Afro-Pop-Sänger Slimboy, der französische Schriftsteller Victor Miesel, eine amerikanische Schauspielerin. Sie alle führen auf unterschiedliche Weise ein Doppelleben. Und nun gibt es sie tatsächlich doppelt − sie sind mit sich selbst konfrontiert, in der Anomalie einer verrückt gewordenen Welt. Hochkomisch und teuflisch intelligent spielt der Roman mit unseren Gewissheiten und fragt nach den Grenzen von Sprache, Literatur und Leben. Facettenreich, weltumfassend, ein literarisches Ereignis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 407
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Hervé Le Tellier
Die Anomalie
Roman
Über dieses Buch
Im März 2021 fliegt eine Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New York durch einen elektromagnetischen Wirbelsturm. Die Turbulenzen sind heftig, doch die Landung glückt. Allerdings: Im Juni landet dieselbe Boeing mit denselben Passagieren ein zweites Mal. Im Flieger sitzen der Architekt André und seine Geliebte Lucie, der Auftragskiller Blake, der nigerianische Afro-Pop-Sänger Slimboy, der französische Schriftsteller Victor Miesel, eine amerikanische Schauspielerin. Sie alle führen auf unterschiedliche Weise ein Doppelleben. Und nun gibt es sie tatsächlich doppelt − sie sind mit sich selbst konfrontiert, in der Anomalie einer verrückt gewordenen Welt.
Eine brillante Mischung aus Thriller, Komödie und großer Literatur. Hochkomisch und teuflisch intelligent spielt der Roman mit unseren Gewissheiten und fragt nach den Grenzen von Sprache, Fiktion und Leben. Facettenreich, weltumfassend, ein literarisches Ereignis.
Vita
Hervé Le Tellier, 1957 in Paris geboren, ist seit 1992 Mitglied der Autorengruppe OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle), die von François Le Lionnais und Raymond Queneau gegründet wurde und der Autoren wie Georges Perec, Italo Calvino und Oskar Pastior angehörten. Er lebt in Paris. Für seinen Roman «L'Anomalie» erhielt er 2020 den Prix Goncourt. Er wird in 34 Sprachen übersetzt und verfilmt.
Jürgen Ritte, geboren 1956 in Köln, Übersetzer, Literaturkritiker, Essayist und Professor für Literaturwissenschaft an der Université Sorbonne Nouvelle in Paris. Ausgezeichnet mit dem Eugen-Helmlé-Übersetzerpreis. Er übersetzte u. a. Patrick Deville, Edmond Jabès, Paul Morand, Georges Perec, Olivier Rolin.
Romy Ritte, geboren 1957 in Hackenbroich, Übersetzerin und Leiterin der deutschen Abteilung des Lycée International Honoré de Balzac. Romy und Jürgen Ritte leben in Paris und übertragen gemeinsam das Werk von Hervé Le Tellier ins Deutsche.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel «L'Anomalie» bei Éditions GALLIMARD, Paris.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, September 2021
Copyright © 2021 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg «L'Anomalie» Copyright © 2020 by Éditions GALLIMARD, Paris
Zitat von William Shakespeare auf S. 181: Teilweise überarbeitete Fassung aus ((KURSIV ANFANG)) Romeo und Julia ((KURSIV ENDE)). In der Übersetzung von A. W. Schlegel und L. Tieck, Zweisprachige Ausgabe, Rowohlt-Klassiker (Englische Literatur Bd. 1), Reinbek 1970, S. 57.
Zitat von William Blake auf S. 12: Übernommen aus William Blake, ((KURSIV ANFANG)) Zwischen Feuer und Feuer ((KURSIV ENDE)), Poetische Werke, Zweisprachige Ausgabe. Aus dem Englischen neu übersetzt und herausgegeben von Thomas Eichhorn, München, DTV, 1996 [Neuauflage 2013], S. 105.
Im literarischen Raum der Figurenrede offenbart sich der Rassismus mancher Romanfiguren. Gerade weil es in der realen Welt Individuen gibt, die sich – leider – auf eine unangemessene Weise äußern und denken, muss dies auch, wie der Autor in Erinnerung ruft, in der Welt der Fiktion abgebildet werden können.
Covergestaltung Cordula Schmidt Design, Hamburg, nach einem Entwurf von Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Artem Chebokha
ISBN 978-3-644-01076-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Und ich, der ich Euch sage, dass ihr träumt,
bin selbst ein Traum.
ZhuÐngzÐ
Der wirkliche Pessimist weiß, dass es schon zu spät ist, um noch Pessimist zu sein.
Die Anomalie
Victør Miesel
ISchwarz wie der Himmel
(März – Juni 2021)
Es gibt etwas Wunderbares, das stets
über das Wissen, die Intelligenz und
selbst das Genie herausragt, und das ist
das Unverständnis.
Die Anomalie
Victør Miesel
Blake
Jemanden umlegen, das ist noch gar nichts. Man muss beobachten, überwachen, nachdenken, sehr viel nachdenken, und im entscheidenden Augenblick eine Leere schaffen. Das ist es. Eine Leere schaffen. Es hinbekommen, dass das Universum sich zusammenzieht, sich so lange zusammenzieht, bis es sich auf den Gewehrlauf oder die Messerspitze verdichtet. Das ist alles. Sich keine Fragen stellen, nicht von der Wut leiten lassen, ein Protokoll erstellen, methodisch vorgehen. Blake kennt sich da aus, und das schon seit so langer Zeit, dass er gar nicht mehr weiß, seit wann er sich auskennt. Der Rest kommt dann ganz von alleine.
Blake bestreitet sein Leben mit dem Tod der anderen. Bitte, keine Moralpredigten. Wenn Sie mit Ethik anfangen, antwortet er mit Statistik. Denn – mit Verlaub, sagt Blake – wenn ein Gesundheitsminister das Budget kürzt, hier einen Scanner streicht, dort einen Arzt und da noch eine Intensivstation, dann dürfte ihm doch klar sein, dass er damit die Existenz von ein paar tausend Unbekannten erheblich verkürzt. Verantwortlich, aber nicht schuldig. Das alte Lied. Blake ist das Gegenteil. Und überhaupt, er hat sich nicht zu rechtfertigen, es ist ihm egal.
Töten, das ist keine Berufung, das ist eine Veranlagung. Ein Geisteszustand, wenn Ihnen das lieber ist. Blake ist elf Jahre alt und nennt sich noch nicht Blake. Er sitzt neben seiner Mutter im Peugeot auf einer kleinen Landstraße bei Bordeaux. Sie fahren nicht wirklich schnell, ein Hund kreuzt die Straße, der Aufprall bringt sie kaum aus der Spur, die Mutter schreit auf, bremst, viel zu heftig, der Wagen schlingert, der Motor säuft ab. Bleib im Auto, Liebling, um Gottes willen, bleib brav im Auto. Blake gehorcht nicht, er folgt seiner Mutter. Es ist ein grauhaariger Collie, der Zusammenstoß hat ihm den Brustkorb eingedrückt, sein Blut fließt über den Straßenrand, aber er ist nicht tot, er winselt, es hört sich an wie ein jammerndes Baby. Die Mutter ist panisch, läuft in alle Richtungen, hält ihre Hände vor Blakes Augen, stammelt zusammenhanglose Wörter, sie will einen Krankenwagen rufen, Aber Mama, das ist ein Köter, nichts als ein Köter. Auf dem rissigen Asphalt hechelt der Collie, sein gebrochener, verdrehter Körper krümmt sich in einem bizarren Winkel, Zuckungen, die langsam schwächer werden, durchrütteln ihn, er agonisiert unter Blakes Augen, und Blake beobachtet interessiert, wie das Leben aus dem Tier entweicht. Es ist zu Ende. Der Junge mimt ein wenig Trauer, das heißt, er mimt das, was er für Trauer hält, damit seine Mutter sich keine Fragen stellt, aber er verspürt nichts. Die Mutter steht noch immer da, wie zu Eis gefroren vor dem kleinen Leichnam, Blake verliert die Geduld, zieht sie am Ärmel, Los, Mama, es bringt nichts hierzubleiben, er ist jetzt tot, gehen wir, ich komm zu spät zum Fußball.
Töten, das meint auch Fertigkeiten. An dem Tag, da sein Onkel ihn mit auf die Jagd nimmt, stellt Blake fest, dass er alles hat, was er braucht. Drei Schüsse, drei Hasen, eine Art Begabung. Er zielt schnell und genau, er weiß sich mit den schlimmsten verrotteten Karabinern abzufinden, mit den am schlechtesten justierten Gewehren. Die Mädchen schleppen ihn mit auf die Kirmes, Hey, bitte, ich will die Giraffe, den Elefanten, den Game Boy, ja, genau, noch mal! Und Blake verteilt Plüschtiere, Spielekonsolen, er wird zum Schrecken der Schießbuden, bevor er sich dafür entscheidet, diskret zu agieren. Blake gefällt auch, was Onkel Charles ihm beibringt, Rehen die Kehle durchtrennen, Hasen aufbrechen. Verstehen wir uns richtig: Er empfindet keinerlei Vergnügen beim Töten oder wenn er einem waidwunden Tier den Rest gibt. Er ist kein perverser Wüstling. Nein, was ihm gefällt, das sind die technischen Handgriffe, die reibungslose Routine, die sich kraft steter Wiederholung einstellt.
Blake ist zwanzig Jahre alt und unter einem sehr französischen Namen, Lipowski, Farsati oder Martin, an einer Hotelfachschule in einer kleinen Stadt in den Alpen eingeschrieben. Doch Vorsicht, das ist keine Verlegenheitswahl, er hätte egal was machen können, er hatte auch Spaß an Elektronik, am Programmieren, er war sprachbegabt, Englisch zum Beispiel, gerade einmal drei Monate bei Lang’s in London, und er sprach fast akzentfrei. Aber was Blake am meisten gefällt, das ist Kochen. Wegen der Momente im Leerlauf, in denen man ein Rezept ersinnt, wegen der Zeit, die ohne Hast verstreicht, selbst inmitten des fieberhaften Treibens in einer Küche, der langen stillen Sekunden, in denen man zuschaut, wie die Butter in der Pfanne zerläuft, die Zwiebeln glasig werden, ein Soufflé aufgeht. Er liebt den Duft der Gewürze, er liebt es, auf den Tellern ein Arrangement von Farben und Geschmacksnoten zu kreieren. Er hätte der brillanteste Eleve der Schule sein können, aber scheiße noch mal, ehrlich, Lipowski (oder Farsati oder Martin), es könnte nicht schaden, wenn Sie nur ein wenig freundlicher zu den Gästen wären. Das ist ein Dienstleistungsgewerbe, Dienstleistung, merken Sie sich das, Lipowski (oder Farsati oder Martin)!
Eines Abends erklärt ihm ein ziemlich betrunkener Typ in einer Bar, dass er jemand anderen umbringen lassen will. Er hat gewiss einen guten Grund dafür, irgendwas mit dem Job, mit einer Frau, aber Blake schert sich nicht drum.
– Würdest du das machen, für Kohle?
– Du bist verrückt, antwortet Blake. Total verrückt.
– Ich zahle, und zwar anständig.
Er schlägt eine Summe mit drei Nullen vor. Blake amüsiert sich.
– Nicht doch, soll das ein Witz sein?
Blake trinkt langsam, lässt sich alle Zeit. Der Typ ist auf dem Tresen zusammengesackt, er schüttelt ihn.
– Hör zu, ich kenne jemanden, der es machen würde. Fürs Doppelte. Ich bin ihm noch nie begegnet. Morgen sage ich dir, wie du ihn erreichen kannst, aber dann zu mir kein Wort mehr darüber, okay?
In dieser Nacht erfindet Blake Blake. Wegen William Blake, den er gelesen hat, nachdem er Roter Drache gesehen hatte, den Film mit Anthony Hopkins, und weil ihm ein Gedicht gefiel: «In die gefährliche Welt ich sprang: / hilflos, nackt, laut wimmernd: / wie ein böser Geist versteckt in einer Wolke». Und außerdem: Blake, black, Lack – und klack!
Schon am nächsten Tag beherbergt ein nordamerikanischer Server die in einem Genfer Internetcafé geschaffene Mail-Adresse eines gewissen blake.mick.22, Blake kauft gegen Barzahlung einem Unbekannten einen gebrauchten Laptop ab, besorgt sich ein altes Nokia und eine Prepaid-SIM-Karte, einen Fotoapparat, ein Teleobjektiv. Nachdem die Ausrüstung komplett ist, liefert der angehende Koch dem Typen den Kontakt dieses «Blake», «ohne Garantie, dass die Adresse noch funktioniert», und er wartet. Drei Tage später schickt der Mann aus der Bar Blake eine windungsreiche Nachricht, aus der hervorgeht, dass er der Sache nicht traut. Er stellt Fragen. Sucht nach dem Fehler im System. Lässt manchmal einen Tag zwischen zwei Mailwechseln verstreichen. Blake spricht von Zielvorgabe, von Logistik, von Lieferzeiten, und diese Vorsichtsmaßnahmen wiegen ihn endlich in Sicherheit. Sie einigen sich, Blake verlangt die Hälfte als Vorschuss: Jetzt sind es schon vier Nullen. Als der Mann ihm seinen Wunsch offenbart, es möge nach einer «natürlichen Ursache» aussehen, verdoppelt Blake die Summe und verlangt einen Monat Zeit. Nunmehr davon überzeugt, dass er es mit einem Profi zu tun hat, akzeptiert der Mann alle Bedingungen.
Es ist sein erstes Mal, und Blake spielt alles durch. Er ist bereits äußerst sorgfältig, vorsichtig, erfinderisch. Er hat schon so viele Filme gesehen. Man macht sich keine Vorstellung davon, was die Auftragskiller den Szenaristen in Hollywood verdanken. Schon zu Anfang seiner Karriere empfängt er die vereinbarte Summe, die Informationen zu seinem Auftrag in einem Plastikbeutel, der an einem von ihm zuvor festgelegten Ort abgelegt wird: ein Bus, ein Fast-Food-Restaurant, eine Baustelle, eine Mülltonne, ein Park. Er vermeidet allzu abgelegene Winkel, in denen man nur ihn sähe, allzu stark bevölkerte, in denen er niemanden ausfindig machen könnte. Er wird stets Stunden im Voraus zur Stelle sein, um die Umgebung zu erkunden. Er wird Handschuhe tragen, eine Kapuze, einen Hut, eine Brille, sich die Haare färben, lernen, wie man sich einen falschen Bart anklebt, die Wangen höhlt, sie bläht, er wird Dutzende von Nummernschildern aus aller Herren Länder zur Verfügung haben. Mit der Zeit übt Blake sich im Messerwerfen, je nach Distanz half-spin oder full-spin, er macht sich mit der Herstellung einer Bombe vertraut, mit der Extraktion eines nicht nachweisbaren Gifts aus einer Qualle, er weiß, wie man in wenigen Sekunden einen 9-mm-Browning, eine Glock 43 auseinandernimmt und zusammenbaut, er lässt sich in Bitcoins bezahlen, dieser Kryptowährung, deren Ströme nicht nachvollziehbar sind, und kauft damit auch seine Waffen. Er richtet seine Seite im Deep Web ein, und das Darknet wird für ihn eines Tages zum Kinderspiel. Denn es gibt Tutorials für absolut alles im Internet. Man braucht nur zu suchen.
Seine Zielvorgabe ist also ein Mann in den Fünfzigern, Blake bekommt sein Foto, seinen Namen, aber er beschließt, ihn Ken zu nennen. Genau, wie Barbies Ehemann. Eine gute Wahl: Ken, das ist so, als existiere er nicht wirklich.
Ken lebt allein, immerhin schon mal das, sagt sich Blake, denn bei einem verheirateten Typen, drei Kinder, hätte er nicht gewusst, wie er sich eine Gelegenheit verschaffen könnte. Bliebe noch, dass es in diesem Alter für einen natürlichen Tod nur wenige Optionen gibt: den Autounfall, das Leck in der Gasleitung, den Herzinfarkt, den unglücklichen Sturz. Punkt. Die Bremse sabotieren, die Lenkung manipulieren, dafür fehlt Blake noch das Wissen, er weiß auch noch nicht, wie er an Kaliumchlorid kommen kann, um einen Herzinfarkt auszulösen; und jemanden mit Gas ersticken, dafür fehlt ihm noch die Nase. Also der Sturz. Zehntausend pro Jahr. Vor allem Alte. Aber es muss auch so gehen. Denn Ken mag zwar kein Athlet sein, aber ein Kampf kommt nicht in Frage.
Ken bewohnt ein 3 ZKDB im Erdgeschoss einer Villa in der Nähe von Annemasse. Drei Wochen lang unternimmt Blake nichts anderes als beobachten und Pläne schmieden. Mit dem Vorschuss hat er sich einen alten Renault-Lieferwagen gekauft, er hat ihn rudimentär eingerichtet, ein Sitz, eine Matratze, Zusatzbatterien für die Beleuchtung, und sich auf einem Parkplatz oberhalb der Siedlung postiert. Der Blick von dort oben geht geradewegs auf die Wohnung. Ken bricht jeden Tag gegen halb neun auf, fährt über die Schweizer Grenze, kommt gegen neunzehn Uhr von der Arbeit zurück. An den Wochenenden gesellt sich manchmal eine Frau zu ihm, eine Französischlehrerin aus dem zehn Kilometer entfernten Bonneville. Der Dienstag ist der am stärksten ritualisierte, vorhersehbarste Tag. Ken kommt früher nach Hause, bricht gleich wieder auf, um zur Gymnastik zu gehen, ist zwei Stunden später zurück, bleibt ungefähr zwanzig Minuten im Badezimmer, isst dann vor dem Fernseher zu Abend, vertändelt noch ein wenig Zeit am Computer und geht zu Bett. Also Dienstagabend. Er schickt seinem Kunden eine Nachricht im vereinbarten Code: «Montag, zwanzig Uhr?» Ein Tag früher, zwei Stunden früher. Der Auftraggeber wird für Dienstag, zweiundzwanzig Uhr, ein Alibi haben.
Eine Woche vor dem besagten Tag lässt Blake eine Pizza an Kens Adresse liefern. Der Bote klingelt, Ken öffnet, ohne zu zögern, die Tür, diskutiert, verwundert, mit dem Angestellten, der mit seiner Schachtel wieder davonzieht. Mehr braucht Blake nicht zu wissen.
Am Dienstag darauf steht auch er mit einer Pizzaschachtel vor der Haustür, er beobachtet einen Moment lang die menschenleere Straße, streift rutschfeste Überzieher über seine Schuhe, kontrolliert die Handschuhe, wartet einen verlassenen Augenblick, um in genau dem Moment zu klingeln, in dem Ken aus der Dusche kommt. Ken öffnet im Bademantel und seufzt, als er die Pizzaschachtel in den Händen des Boten sieht. Aber bevor er auch nur ein Wort sagen kann, fällt die leere Schachtel zu Boden, und Blake rammt ihm die Läufe zweier Elektroschocker auf die Brust. Ken sinkt unter der Gewalt der Entladung in die Knie, Blake begleitet seinen Sturz und drückt ihm zehn Sekunden lang den Taser auf die Brust, bis Ken sich nicht mehr rührt. Der Hersteller sprach von acht Millionen Volt, Blake hat nur ein Gerät an sich selbst ausprobiert und wäre beinahe in Ohnmacht gefallen. Er schleift einen sabbernden, stöhnenden Ken ins Badezimmer, jagt ihm eine neue Ladung durch den Körper, um das Maß vollzumachen, und in einer einzigen schwindelerregend brutalen Bewegung, die er zehnmal an Kokosnüssen geübt hat, packt er Kens Kopf mit beiden Händen, hebt ihn an den Schläfen hoch und stößt ihn mit all seiner Kraft zurück: Der Schädel bricht an der Kante der Duschwanne, unter dem Aufprall splittert eine Raute aus der Kachelung. Sofort fließt Blut, scharlachrot und zähflüssig wie Nagellack und mit dem schönen Geruch von warmem Rost, der Mund steht offen, stumpfsinnig, die weit aufgerissenen Augen starren zur Decke hoch. Blake schlägt den Bademantel auf: Die Elektroschocks haben keinerlei Spuren hinterlassen. Der hypothetischen Falllinie folgend, wie sie ihm die Schwerkraft nach einem tragischen Ausrutscher auferlegt hätte, arrangiert Blake so gut er kann die Position des Körpers.
Und da packt ihn, als er aufsteht, um seine Arbeit zu bewundern, eine unglaubliche Lust zu pinkeln. Das hätte Blake niemals gedacht. Und es ist ja so, dass die Mörder in den Filmen nie pinkeln müssen. Der Druck ist so stark, dass er sogar in Erwägung zieht, sich in die Schüssel zu erleichtern, auch wenn er sie hinterher von Grund auf zu reinigen hätte. Aber wenn die Bullen auch nur halbwegs intelligent oder ganz einfach nur systematisch vorgehen sollten, indem sie methodisch dem Protokoll folgen, werden sie DNA vorfinden. Zwangsläufig. Das jedenfalls sagt sich Blake. Also setzt er trotz seiner ihn anflehenden Blase und grimassierend unter der Qual seinen Plan weiter um. Er greift nach der Seife, presst sie fest auf Kens Ferse, drückt eine Spur auf den Boden und schleudert sie in Richtung des angenommenen Ausrutschers fort: Die Seife prallt ab und verschwindet hinter der Toilette. Perfekt. Der Ermittler wird begeistert sein, sie zu finden, und also nur zu glücklich, das Rätsel gelöst zu haben. Blake stellt die Temperatur der Dusche aufs Maximum, dreht auf und richtet den Strahl des Duschkopfs auf Gesicht und Oberkörper der Leiche, wobei er jeden Kontakt mit dem dampfenden Wasser vermeidet, dann verlässt er das Bad.
Blake eilt zum Fenster, zieht die Vorhänge zu, inspiziert ein letztes Mal das Zimmer. Nichts weist darauf hin, dass hier ein Körper mehrere Meter über den Boden geschleift wurde, und rosiges Wasser beginnt den Boden zu überfluten. Der Computer ist an, auf dem Bildschirm ist von Rabatten gesäumter englischer Rasen zu sehen. Ken hatte einen grünen Daumen. Blake verlässt die Villa, zieht die Handschuhe aus, bewegt sich ohne Hast auf einen in zweihundert Metern Entfernung geparkten Motorroller zu. Er startet, fährt einen Kilometer, hält an, um endlich zu pinkeln. Scheiße, er hat immer noch die Überzieher aus schwarzer Baumwolle an den Füßen.
Zwei Tage später meldet sich ein beunruhigter Kollege bei der Polizei, die den Unfalltod von Samuel Tadler entdecken wird. Am selben Tag erhält Blake den Restbetrag.
All dies hat sich vor sehr langer Zeit zugetragen. Blake hat sich seither zwei Existenzen aufgebaut. In der einen bleibt er unsichtbar unter zwanzig Namen, ebenso vielen Vornamen, mit den entsprechenden Pässen aller möglichen Staaten, darunter echte biometrische, richtig, das ist einfacher, als man denkt. In dem anderen leitet er unter dem Namen Jo aus der Entfernung eine hübsche Pariser Firma, einen Lieferdienst für vegetarische Mahlzeiten, er besitzt Filialen in Bordeaux, Lyon und jetzt auch in Berlin und New York. Seine Mitarbeiterin Flora, die auch seine Ehefrau ist, und ihre beiden Kinder beklagen sich, weil er so oft – und manchmal zu lang – auf Reisen ist. Das stimmt.
21. März 2021
Quogue, New York State
An diesem 21. März ist Blake auf Reisen. Er läuft bei Nieselregen über den feuchten Sand. Langes blondes Haar, Bandana, Sonnenbrille, leichte Kleidung, blau und gelb, die bunt gescheckte Unsichtbarkeit des Joggers. Er ist zehn Tage zuvor mit einem australischen Pass in New York gelandet. Der transatlantische Flug war so fürchterlich, dass er tatsächlich seine letzte Stunde gekommen sah, dass er glaubte, der Himmel verlange nach Rache für all seine Aufträge. In einem endlosen Luftloch drohte ihm sogar die blonde Perücke vom Schädel zu fliegen. Und nun macht er seit neun Tagen an Zehn-Millionen-Dollar-Hütten vorbei, drunter geht nichts, seine drei Kilometer unter dem grauen Himmel von Quogue. Man hat Dünen aufgeworfen, die Straße, der Einfachheit halber, Dune Road getauft, Pinien gepflanzt und Schilfrohr, damit keine Villa von den Nachbarn eingesehen werden kann, damit keinem Besitzer ein Zweifel daran komme, dass ihm der ganze Ozean allein gehört. Blake läuft mit kurzen Schritten, gemütlich, und bremst wie jeden Tag zur gleichen Zeit plötzlich ab vor einem traumhaften, mit breiten Mammutbaumpaneelen verkleideten Bungalow mit großen Fensterfronten, dessen Terrasse über eine Treppe zum Meer führt. Er tut so, als sei er außer Atem, klappt unter imaginären Seitenstichen vornüber, hebt, auch dies wie jeden Tag, den Kopf, um von weitem einen etwas rundlichen Mann Anfang fünfzig zu grüßen, der, mit den Ellbogen auf die Balustrade gelehnt, unter dem Vordach seinen Kaffee trinkt. Ein jüngerer Mann, groß, kurzes braunes Haar, leistet ihm Gesellschaft. Er hält sich im Hintergrund, lehnt mit dem Rücken an den Holzpaneelen, wirkt besorgt, sein Blick wandert wachsam über den Strand. Unter seiner Jacke beult links ein unsichtbares Holster den Stoff. Ein Rechtshänder. Heute tritt Blake zum zweiten Mal in dieser Woche mit einem Lächeln auf sie zu, zwischen Ginster und niedrigem Gesträuch steigt er den sandigen Pfad hoch.
Blake streckt sich, gähnt, nimmt ein Handtuch aus seinem Rucksack, trocknet sich das Gesicht ab, holt dann eine Feldflasche heraus, trinkt einen großen Schluck kalten Tee, das alles in gemessenen Bewegungen. Er wartet darauf, dass der ältere Mann ihn anspricht.
– Tag, Dan. Wie geht’s?
– Hi, Frank, ruft Dan-Blake zurück, der immer noch schwer atmet und dem ein vorgeblicher Krampf das Gesicht verzerrt.
– Mieses Wetter zum Joggen, sagt der Mann, der sich seit ihrer ersten Begegnung vor einer Woche einen Schnäuzer und einen grauen Bart hat wachsen lassen.
– Ich würde sogar sagen ein mieser Tag, antwortet Blake, der fünf Meter vor ihnen stehen bleibt.
– Ich habe heute Morgen an Sie gedacht, als ich den Kurs der Oracle-Aktien sah.
– Ich will nichts davon hören. Wissen Sie, was ich für die nächsten Tage voraussagen kann, Frank?
– Nein?
Blake faltet sein Handtuch sorgfältig zusammen, verstaut es in seinem Rucksack, schiebt dann mit Sorgfalt die Feldflasche nach, bevor er flink eine Pistole herauszieht. Er schießt gleich auf den jüngeren Mann, dreimal, der Schlag wirft diesen zurück, er sackt auf einer Bank zusammen, dann dreimal auf Frank, der, verdutzt und kaum erschüttert, in die Knie sinkt und wie hingegossen an der Balustrade liegen bleibt. Jeweils zwei Einschläge in der Brust, einer mitten auf der Stirn. Sechs Schüsse in einer Sekunde, abgefeuert aus einer P226 mit Schalldämpfer, aber die Wellen haben das Geräusch ohnedies übertönt. Wieder ein Auftrag, alles glatt gelaufen. Hunderttausend leicht verdiente Dollar.
Blake steckt die SIG Sauer zurück in seinen Rucksack, klaubt die sechs Patronen aus dem Sand, betrachtet mit einem Seufzer den dahingerafften Leibwächter. Schon wieder einer von diesen Läden, die Parkwächter einstellen, sie in zwei Monaten umschulen und diese Amateure dann ins wirkliche Leben schicken. Wenn dieser arme Kerl seinen Job gemacht hat, dann hat er seinem Boss den Vornamen Dan genannt, das von weitem aufgenommene Foto vorgelegt, den Namen der Firma Oracle erwähnt, den Blake im Vorbeigehen hatte fallenlassen, und dort wird man sie beruhigt haben, nachdem man einen gewissen Dan Mitchell ausgemacht hat, Unterabteilungsleiter Logistik bei Oracle New Jersey, ein Blonder mit langen Haaren, der Blake sehr ähnlich sieht, welch Letzterer immerhin Dutzende von Organigrammen durchforstet hatte, bis er endlich unter Tausenden von Gesichtern einen plausiblen Doppelgänger fand.
Dann trabt Blake wieder los. Der jetzt stärkere Regen verwischt seine Spuren. Der Leihwagen, ein Toyota, steht in zweihundert Metern Entfernung, seine Nummernschilder sind diejenigen eines identischen Autos, das er in der Woche zuvor in den Straßen von Brooklyn ausfindig gemacht hatte. Fünf Stunden später wird er das Flugzeug nach London nehmen, dann, unter einer neuen Identität, den Eurostar nach Paris. Wenn der Rückflug weniger turbulent ausfällt als der Paris–New York vor zehn Tagen, dann ist alles perfekt.
Blake ist zum Profi geworden, er hat nie mehr Lust, unterdessen zu pinkeln.
Sonntag, 27. Juni 2021, 11 h 43
Quartier Latin, Paris
Fragen Sie Blake, den besten Kaffee von Saint-Germain trinkt man in dieser Eckkneipe an der Rue de Seine. Ein guter Kaffee, Blake meint ein wirklich guter Kaffee, ist ein Wunder, das aus dem engen Zusammenspiel einer exzellenten Bohne, in diesem Fall ein frisch gerösteter, fein gemahlener Nicaragua, einem gefilterten und weichen Wasser und einem Perkolator entsteht, in diesem präzisen Fall einem täglich gereinigten Cimbali.
Seit Blake nahe beim Odéon, in der Rue de Buci, sein erstes vegetarisches Restaurant eröffnet hat, ist er hier Stammgast. Wenn man schon an allem verzweifeln soll, dann wenigstens auf einer Pariser Caféterrasse. Im Viertel heißt er also Jo, für Jonathan oder Joseph oder Joshua. Selbst die Angestellten nennen ihn Jo, und sein Name erscheint nirgendwo außer wahrscheinlich im Kapital der Holding, die der Eigner der im Handelsregister eingetragenen Firma ist. Blake hat immer einen Kult um Geheim- oder sagen wir eher Zurückhaltung getrieben, und jeder Tag beweist ihm, dass er damit recht hatte.
Hier bewegt sich Blake mit offenem Visier. Er geht einkaufen, holt seine Kinder von der Schule ab und geht sogar, seit sie für jedes ihrer vier Restaurants einen Geschäftsführer eingestellt haben, mit Flora ins Theater, ins Kino. Ein banales Leben, in dem man sich auch verletzen kann, aber nur deswegen, weil man sich, als man Mathilde zum Ponyhof begleitete, aus Unachtsamkeit an der Tür zur Box die Augenbraue aufschlug.
Die Trennwand zwischen den beiden Identitäten ist vollkommen dicht. Jo und Flora zahlen den Kredit für eine schöne, nur zwei Schritte vom Luxembourg entfernte Wohnung ab, Blake hat vor nunmehr zwölf Jahren mit Cash eine Zweizimmerwohnung in der Nähe der Gare du Nord bezahlt, ein schönes Haus in der Rue La Fayette, die Fenster und Türen sind gepanzert wie die Wände eines Tresors. Ein offizieller Mieter zahlt die Miete, sein Name wechselt jedes Jahr, was umso leichter ist, als es ihn nicht gibt. Man kann nie vorsichtig genug sein.
Blake trinkt also einen Kaffee, ohne Zucker und ohne Sorgen. Er liest in dem Buch, das Flora ihm empfohlen hat; er hat seiner Frau nicht gestanden, dass er den Autor auf dem Flug Paris–New York im vergangenen März wiedererkannt hat. Es ist Mittag, Flora hat Quentin und Mathilde zu ihren Eltern gebracht. Er überspringt das Mittagessen, denn heute Morgen hat er für fünfzehn Uhr eine Verabredung getroffen: ein Auftrag, der am Vorabend eingegangen ist. Eine einfache Sache, gut bezahlt, der Kunde scheint es sehr eilig zu haben. Er muss nur noch, wie er es immer tut, rasch in die Rue La Fayette, um sich umzuziehen. Dreißig Meter weiter beobachtet ihn ein Mann mit verschlossenem Gesicht und Kapuze.
Victor Miesel
Victor Miesel mangelt es nicht an Charme. Sein kantiges Gesicht hat sich mit den Jahren gerundet, und sein drahtiges Haar, seine römische Nase, sein dunkler Teint mögen an Kafka erinnern, einen kräftigen Kafka, der es über die vierzig hinausgebracht hätte. Sein großer Körper geht in die Länge, ist noch schlank, auch wenn er wegen der seinem Metier eigenen Sesshaftigkeit ein wenig aufgegangen ist.
Denn Victor schreibt. Leider haben es seine Bücher trotz der guten Kritiken für zwei Romane, Die Berge werden zu uns kommen und Missglücktes Scheitern, trotz eines sehr pariserischen Literaturpreises, einer von denen indes, bei denen die rote Bauchbinde keinerlei Kaufgelüste auslöst, nie über ein paar tausend Exemplare gebracht. Er hat sich eingeredet, dass nichts weniger tragisch sei, dass eine verlorene Illusion das Gegenteil eines Scheiterns ist.
Er ist dreiundvierzig Jahre alt, fünfzehn davon hat er mit dem Schreiben verbracht, und die kleine Welt der Literatur erscheint ihm wie ein burlesker Zug, in dem sich Betrüger ohne Fahrschein und mit unfähigen Kontrolleuren als Komplizen lautstark in der ersten Klasse niederlassen, während bescheidene Genies – eine aussterbende Art, der Miesel sich nicht zugehörig fühlt – auf dem Bahnsteig zurückbleiben. Doch er ist nicht verbittert; es macht ihm letztlich nichts mehr aus, er nimmt es hin, auf Buchmessen zu sitzen, um dort gerade einmal vier Bücher in ebenso vielen Stunden zu signieren; wenn ein kollegialer Misserfolg seinem Tischnachbarn die entsprechende Muße lässt, plaudern sie aufs angenehmste miteinander. Miesel, der abwesend und distanziert wirken mag, steht trotz allem im Ruf, ein humorvoller Mann zu sein. Aber ist ein humorvoller Mann, der dieses Namens würdig ist, es nicht immer «trotz allem»?
Miesel bezieht seine Einkünfte aus Übersetzungen. Aus dem Englischen, dem Russischen und dem Polnischen, der Sprache, in der seine Großmutter während seiner Kindheit zu ihm sprach. Er hat Wladimir Odojewski, Nikolai Leskow übersetzt, Autoren des vorletzten Jahrhunderts, die kaum noch jemand liest. Es ist auch vorgekommen, dass er irgendeinen Blödsinn gemacht hat, zum Beispiel – auf Einladung eines Festivals – Warten auf Godot ins Klingonische zu übertragen, die Sprache der grausamen Außerirdischen in Star Trek. Um bei seinem Bankberater eine gute Figur abzugeben, übersetzt Victor auch angelsächsische Bestseller, Unterhaltungsliteratur, die der Literatur den Status einer minderen Kunst für Minderbedarfte verleihen. Sein Beruf hat ihm die Türen zu renommierten, wenn nicht gar mächtigen Verlegern geöffnet, ohne dass seine Manuskripte es deswegen auch über deren Schwelle gebracht hätten.
Miesel hat seinen Aberglauben: In der Tasche seiner Jeans steckt immer ein Legostein, es ist der gängigste, leuchtend rot mit zweimal vier Noppen. Er stammt aus der Festungsmauer einer Burg, an der er mit seinem Vater in seinem Kinderzimmer baute. Dann war da der Unfall auf der Baustelle, und das Modell blieb unvollendet neben seinem Bett stehen. Der Junge betrachtete oft schweigend die Zinnen, die Zugbrücke, die kleinen Figuren, den Bergfried. Den Bau alleine fortzuführen, hätte bedeutet, den Tod zu akzeptieren, ihn zu zerstören auch. Eines Tages brach er dann doch einen Stein aus der Mauer, steckte ihn sich in die Hosentasche, und er baute die Burg ab. Das war vor vierunddreißig Jahren. Zweimal hat Victor den Stein verloren, und zweimal hat er einen neuen, identischen erstanden. Zuerst unter Schmerzen, dann ganz ohne Rührung. Als seine Mutter im letzten Jahr verstarb, legte er ihr den Legostein in den Sarg und ersetzte ihn umgehend. Dieses kleine rote Parallelepiped ist nicht sein Vater, es ist nur die Erinnerung an eine Erinnerung, das Banner der Abstammung und der Treue.
Miesel hat keine Kinder. Im Gefühlsleben segelt er mit einem unverbrüchlichen Enthusiasmus von Schiffbruch zu Schiffbruch. Er bleibt zu oft distanziert, was nicht überzeugt, und er ist niemals der Frau begegnet, mit der er einen längeren Moment seines Lebens hätte verbringen können. Oder er sucht womöglich seine Partnerinnen so aus, dass er sicher sein kann, dass es niemals dazu kommen wird.
Das wäre gelogen: Die Frau hat vor Jahren auf der Übersetzertagung in Arles, den «Assises de la Traduction», seinen Weg gekreuzt: Bei einer Veranstaltung, auf der er erklärte, wie man den «Humor bei Gontscharow» übersetzt, saß sie in der ersten Reihe. Er hatte sich bemüht, nicht nur sie anzuschauen. Weil ein Verleger ihn zurückgehalten hatte – Und wenn Sie für uns die russische Frauenrechtlerin Ljubow Gurewitsch übersetzten? Was meinen Sie? Wäre doch phantastisch, oder? –, hatte Victor sich nicht loseisen können. Aber zwei Stunden später stand sie in der geduldigen Schlange vor den Desserts lächelnd hinter ihm. Die Wahrheit in der Liebe ist, dass das Herz sofort weiß und es laut herausschreit. Natürlich wird man der Person nicht geradeheraus erklären, ganz einfach so, dass man sie liebt. Das würde sie nicht verstehen. Also betreibt man, um sich nicht einzugestehen, dass man bereits ihre Geisel ist, ein wenig Konversation mit ihr.
Bei der letzten Etappe angelangt, den «Petits Gâteaux», drehte Victor sich um und sprach sie an. Er fragte sie stammelnd, wie sie «crème anglaise» ins Englische übersetzen würde, da doch mit French cream die chantilly gemeint sei, die Schlagsahne. Ja, schade, er hatte nichts Besseres gefunden. Sie hatte höflich gelacht und mit einer rauen Stimme, die ihm feengleich vorkam, Ascot cream geantwortet und war an den Tisch zu ihren Freundinnen zurückgekehrt. Er hat einige Zeit gebraucht, bis er begriff, dass Ascot, genau wie Chantilly, eine Pferderennbahn ist, aber eine englische.
Sie hatten Blicke getauscht, aus denen er gerne etwas Komplizenhaftes herausgelesen hätte, er hatte sich ostentativ an die Bar begeben, in der Hoffnung, dass sie sich dort zu ihm geselle, aber sie steckte mitten in einer Diskussion. Da er sich genauso töricht vorkam wie ein Heranwachsender, war er in sein Hotel zurückgegangen. Ihr Foto fand sich nicht unter denen der Teilnehmer, aber er war sicher, ihr wieder über den Weg zu laufen, und den ganzen Vormittag über besuchte er unter verschiedenen Vorwänden die Workshops. Vergeblich. Sie war auch nicht auf dem Fest zum Abschluss der Tagung. Sie hatte sich in Luft aufgelöst. Beim letzten Frühstück im Hotel beschrieb er sie einem der Veranstalter, einem Freund; aber mit «klein», «brünett» und «faszinierend» hat man noch nie jemanden treffend beschrieben.
Zwei Jahre hintereinander ist Victor danach noch zu den «Assises» gefahren, und dies nur, wenn er sich nichts vormachen will, um ihr zu begegnen. Seither bringt er – ein schweres berufliches Vergehen – in seinen Übersetzungen stets kurze Passagen unter, in denen von der Pferderennbahn in Ascot die Rede ist oder von der «crème anglaise». Und den Anfang zu diesen Untaten machte er mit der Aufsatzsammlung der Gurewitsch. In den Eingangstext «Почему нужно дать женшинам все права и свободу», «Warum man den Frauen alle Rechte und die Freiheit gewähren muss», hat er den Satz «Die Freiheit ist keine ‹crème anglaise› auf einem Schokoladenkuchen, sie ist ein Recht» eingefügt. Das war diskret, und wer weiß? Schließlich interessierte sie sich ja für Gontscharow. Aber nichts da. Wenn sie das Buch gelesen hat, dann hat sie den Zusatz nicht bemerkt, der Verleger auch nicht, wie überhaupt kein Leser ihn bemerkt hat. Victor hat das Leben vorbeiziehen lassen, und das ist zum Verzweifeln.
Zu Anfang des Jahres verleiht ihm eine franko-amerikanische Organisation, die von der Kulturabteilung der französischen Botschaft finanziert wird, einen Übersetzerpreis für einen dieser Thriller, die ihn ernähren. Anfang März reist er in die Vereinigten Staaten, und das Flugzeug gerät in monströse Turbulenzen. Einen endlosen Augenblick lang verbiegt der Sturm die Maschine in alle Richtungen. Der Kapitän spricht beruhigende Worte, aber jedem in der Kabine ist klar, und Miesel noch etwas mehr, dass sie ins Meer stürzen, dass sie am Wasser wie an einer Wand zerbersten werden. Über einige lange Minuten hinweg leistet er Widerstand, krallt er sich am Sitz fest, spannt die Muskeln, um sich nicht jedem Stoß zu unterwerfen. Sein Blick meidet das Bullauge, das auf Nacht und Hagel hinausgeht. Da sieht er, ein paar Reihen vor sich, nicht weit von einem eingenickten Blonden mit Kapuze, den scheinbar nichts aus dem Schlaf zu reißen vermag, diese Frau. Hätte er sie beim Einsteigen bemerkt, hätte er den Blick nicht mehr von ihr abwenden können. Auch wenn sie ihr nicht genau ähnelt, so erinnert sie ihn doch auf grausame Weise an seine entschwundene Arlesienne. Ihre Zerbrechlichkeit, die Feinheit ihrer Züge, die Textur ihrer Haut, ihr graziler Körper verleihen ihr etwas Mädchenhaftes, aber die winzigen Fältchen rund um die Augen verraten die gut Dreißigjährige. Die Plättchen ihrer Schildpattbrille drücken ihr zwei ephemere Fliegenflügel auf die Nase. Zuweilen lächelt sie ihren Sitznachbarn an, einen Mann, der älter ist als sie, vielleicht ihr Vater, und das Rütteln des Flugzeugs scheint sie zu amüsieren, es sei denn, die vorgebliche Ungezwungenheit hat eine beruhigende Wirkung auf sie.
Aber die Maschine stürzt abermals in ein Luftloch, und plötzlich zerbricht etwas in Victor, er schließt die Augen und lässt sich in alle Richtungen durchrütteln, macht keinen Versuch, seinen Körper in den Griff zu bekommen. Er ist zu einer dieser Labormäuse geworden, die, einem brutalen Stress ausgesetzt, aufhören zu kämpfen und sich mit ihrem Tod abfinden.
Schließlich, nach einer unendlich langen Zeit, entkommt das Flugzeug dem Gewitter. Aber Miesel ist noch erschlagen, wie benommen von dem schrecklichen Gefühl der Unwirklichkeit. Um ihn herum regt sich wieder Leben, die Leute lachen, weinen, aber er betrachtet all dies wie hinter einer beschlagenen Scheibe. Der Kapitän untersagt ausdrücklich, die Sicherheitsgurte vor der Landung zu lösen, und Miesel, aus dem alle Energie gewichen ist, wäre ohnehin nicht in der Lage, sich von seinem Sitz zu erheben. Sobald die Türen sich öffnen, stürzen die Passagiere, die es eilig haben, diesem Flugzeug zu entfliehen, nach draußen, aber während die Kabine sich leert, verharrt Miesel auf seinem Sitz neben dem Bullauge. Eine Stewardess tippt ihm leicht auf die Schulter, er schickt sich darein, aufzustehen. Da denkt er, noch intensiver, an die junge Frau zurück. Er ahnt, dass nur sie allein ihn aus diesem Abgrund an Nichtexistenz herauszerren kann, er schaut sich nach ihr um, aber sie ist außer Sichtweite, er findet sie auch nicht in der Schlange vor dem Einwanderungsschalter.
Der Leiter des Bureau du Livre holt ihn vom Flughafen ab und zeigt sich diesem stummen und desorientierten Übersetzer gegenüber sehr zuvorkommend.
– Sie sind sicher, dass alles in Ordnung ist, Monsieur Miesel?
– Ja, ich glaube, wir wären beinahe gestorben. Aber es geht mir gut.
Die eintönige Stimme beunruhigt den Mann aus dem Konsulat. Bis zum Hotel wechseln sie kein Wort mehr. Als er tags darauf am Nachmittag wieder vorbeikommt, um Miesel abzuholen, begreift er, dass Miesel das Zimmer die ganze Zeit über nicht verlassen, dass er nicht einmal etwas gegessen hat. Er muss ihn bedrängen, damit er unter die Dusche steigt, sich umzieht. Der Empfang findet in der Buchhandlung Albertine statt, gleich gegenüber dem Central Park an der Fifth Avenue. Zum vorgesehenen Zeitpunkt zieht Miesel auf eine auffordernde Geste des Kulturattachés hin die in Paris geschriebene Dankesrede aus seiner Tasche und bekräftigt dann mit tonloser Stimme, dass es die Aufgabe des Übersetzers sei, «die reine, im Werk gefangene Sprache zu befreien, indem er sie transponiert». Er deklamiert kraftlos all das Gute herunter, das er von der amerikanischen Autorin nicht denkt, einer großen, blonden, schlecht geschminkten Frau, die neben ihm steht und lächelt, dann schweigt er abrupt. Angesichts der sich einstellenden Verlegenheit ergreift die Schriftstellerin das Mikro, um ihm lebhaft zu danken und zu bestätigen, dass ihre phantastische Saga um zwei weitere Bände anwachsen wird. Dann ist es Zeit für den Cocktail; Miesel schaut abwesend drein.
«Scheiße noch mal, bei dem Geld, das uns diese Art von Festivität kostet, hätte er sich ein klein wenig anstrengen können», grummelt der Botschaftsrat für kulturelle Angelegenheiten. Der Verantwortliche des Bureau du Livre verteidigt Miesel halbherzig, der am nächsten Morgen zurückfliegt.
In Paris angekommen, beginnt er wie unter Diktat zu schreiben, und es ist gerade die unkontrollierbare Mechanik dieses Schreibens, die ihn in einen Abgrund von Angst stürzt. Der Titel dieses Buches wird Die Anomalie lauten, und es wird das siebte Buch dieses Autors sein.
«In meinem Leben habe ich nicht eine Geste getan. Ich weiß, dass es seit jeher die Gesten sind, die mich hervorgebracht haben, dass keine Bewegung unter meiner Kontrolle stattgefunden hat. Mein Körper hat sich damit zufriedengegeben, sich zwischen Linien mit Leben zu füllen, die ich nicht gezogen habe. Es ist Anmaßung, so zu tun, als herrschten wir im Raum, wo wir doch nur den Kurven geringsten Kraftaufwands folgen. Grenze der Grenzen. Kein Flug wird uns je den Himmel entfalten.»
In wenigen Wochen füllt ein schreibwütiger Victor Miesel zwischen Lyrismus und Metaphysik oszillierend gut hundert Seiten von diesem Kaliber: «Die Auster, die die Perle spürt, weiß, dass Bewusstsein nur als Schmerz existiert. […] Die Kühle des Kopfkissens verweist mich jedes Mal auf die eitle Temperatur meines Blutes. Wenn ich vor Kälte zittere, dann weil es dem Pelz meiner Einsamkeit nicht gelingt, die Welt zu wärmen.»
Während der letzten Tage geht er nicht mehr vor die Tür. Der allerletzte Absatz an die Adresse seines Verlags verrät, wie sehr jene Erfahrung der Entwirklichung an etwas Unüberwindliches grenzt: «Ich habe nie erfahren, was an der Welt anders wäre, wenn ich nicht existiert hätte, noch zu welchen Ufern ich sie hätte führen können, wenn ich intensiver gelebt hätte, und ich sehe nicht, was mein Verschwinden an ihrem Lauf ändern sollte. Da bin ich, gehe den Weg, dessen abwesende Steine mich nirgendwohin führen. Ich werde zu dem Punkt, an dem Leben und Tod zueinander finden und zuletzt verschmelzen, wo die Maske des Lebenden zur Ruhe kommt im Gesicht des Verstorbenen. Heute Morgen sehe ich bei klarem Wetter bis zu mir, und ich bin wie alle. Ich bereite meinem Dasein kein Ende, ich verleihe der Unsterblichkeit Leben. Vergeblich schreibe ich endlich einen letzten Satz, der den Moment nicht aufzuschieben sucht.»
Nachdem er diese Worte niedergeschrieben und seiner Lektorin die Datei geschickt hat, klettert Victor Miesel, gepackt von einer pochenden Angst, für die er keinen Namen findet, über den Balkon und stürzt. Oder springt. Er hinterlässt keinen Brief, aber der ganze Text führt ihn zu dieser äußersten Geste.
«Ich bereite meinem Dasein kein Ende, ich verleihe der Unsterblichkeit Leben.»
Wir schreiben den 22. April 2021, es ist Mittag.
Lucie
Montag, 28. Juni 2021
Ménilmontant, Paris
Im Halbdunkel des frühen Morgens stößt ein Mann mit kantigem Gesicht leise die Tür zu einem Schlafzimmer auf, sein Blick fixiert das Bett, das man kaum erkennen kann, darin schläft eine Frau. Die Sequenz dauert drei Sekunden, aber Lucie Bogaert gefällt sie nicht. Zu hell, zu diffus, zu statisch. Der Kameramann musste geschlafen haben. Sie notiert, dass sie bei den Spezialeffekten mit dem Gamma und den Kontrasten spielen, ein zu stark aus dem Hintergrund tretendes Gemälde weichzeichnen sollen. Sie korrigiert geringfügig die Rahmung um Vincent Cassels Gesicht, zoomt es leicht heran, verlangsamt die Sequenz um ein paar Bilder, damit sie Rhythmus bekommt. Dafür braucht sie eine Minute. Voilà, so ist es schon viel besser. Diese Aufmerksamkeit fürs Detail, dieser filmische Instinkt hat dafür gesorgt, dass sie zur Lieblingscutterin zahlreicher Regisseure geworden ist.
Es ist noch früh, fünf Uhr morgens, Louis schläft. In zwei Stunden wird sie ihn wecken, to wake, woke, woken, ihm sein Frühstück zubereiten, to eat, ate, eaten, ja, richtig, sie wird mit ihm die unregelmäßigen englischen Verben durchgehen, die auf dem Programm für die siebente Klasse stehen. Aber im Augenblick montiert Lucie unter Hochdruck diese Intérieur-Szene eines Maïwenn-Films neu, die sie sich vor Mittag noch einmal gemeinsam anschauen müssen. Sie steht auf, der Nacken schmerzt, die Augen sind trocken. Der große Spiegel über dem Kamin reflektiert das Bild einer kleinen, schlanken Frau mit den luftleichten Formen eines Mädchens, blasser Haut, feinen Gesichtszügen, kurzem braunen Haar. Auf ihrer schmalen griechischen Nase sitzt eine große Schildpattbrille, was ihr den Anschein einer Studentin verleiht. Sie tritt ans Wohnzimmerfenster. Immer wenn sie sich von der Leere übermannt fühlt, lehnt sie sich mit der Stirn an diese kühle Fensterscheibe. Ménilmontant schläft, aber die Stadt saugt sie an. Am liebsten würde sie aus ihrem Körper fahren und in allem aufgehen, was dort draußen ist.
Ein dumpfes Bling signalisiert den Eingang einer Mail. Sie liest den Vornamen André und seufzt. Sie ist wütend, weniger weil er insistiert, sondern weil er weiß, dass er nicht insistieren soll, und sich dennoch nicht zurückhält. Wie kann er gleichzeitig so intelligent und so schwach sein? Aber Liebe, das bedeutet, dass man das Herz nicht daran hindern kann, auf der Intelligenz herumzutrampeln.
Sie hat André drei Jahre zuvor kennengelernt, auf einer Abendgesellschaft bei Freunden vom Film. Sie war spät eingetroffen, und ein Mann, der gerade gehen wollte, war geblieben. Man hatte sich über ihn lustig gemacht, Aha, natürlich, da kommt die hübsche Lucie, und schon hat André es nicht mehr eilig, nach Hause zu gehen … Das war er also, der André Vannier von Vannier & Edelman, dieser Architekt, von dem sie ihr erzählt hatten. Ein großer, schlanker Mann, der in den Fünfzigern zu sein schien, den man sich aber älter vorstellen konnte. Er hatte lange Finger, einen zugleich traurigen und fröhlichen Blick, der sich etwas von einer unvergänglichen Jugend bewahrt hatte. Sie hatte gleich gespürt, dass sie ihn, sobald sie sprach, gefangen nahm, und es gefiel ihr, dass er ihr Gefangener war.
Sie hatten sich kurz darauf wiedergesehen. Er hatte ihr diskret den Hof gemacht, und sie hatte verstanden, dass er sich weniger davor fürchtete, sich lächerlich zu machen, als sie zu küssen. Sie hatte ihn zunächst, allerdings mit Zartgefühl, abgewiesen. Und doch hatten sie sich weiterhin regelmäßig getroffen, er zeigte sich jedes Mal zuvorkommend, witzig, aufmerksam. Sie ahnte, dass er auf sein Junggesellenleben nicht gerade stolz war, ein Thema, von dem er jedes Mal ablenkte, sie vermutete dahinter ein ganzes Gefolge an Geliebten und nur wenig Zauber.
Eines Abends im Frühling lädt er zu einem Abendessen bei sich zu Hause ein. Der Eklektizismus seiner Freunde erstaunt sie: ein sehr konzeptueller Maler, ein englischer Chirurg auf der Durchreise, ein Journalist von Le Monde, ein dem Alkohol stark zugeneigter Bibliothekar und ein gewisser Armand Mélois, ein ganz köstlicher und raffinierter Mann, der – wie sie im Laufe des Essens erfährt – der französischen Spionageabwehr vorsteht. Lucie entdeckt auch eine große Wohnung im Haussmann-Stil mit nüchternen Möbeln, bei denen Holz und industrielle Fertigung überwiegen, voller Bücher, Romane, eine Wohnung, die weit entfernt ist von dem strengen und kühlen Universum, das man den Architekten unterstellt. Und auf einem Regal dann eine Micky-Maus-Figur aus Gips und in grellen Farben. Sie ergreift die Figur, dreht und wendet sie verblüfft zwischen ihren Fingern. André tritt zu ihr:
– Sie ist scheußlich, nicht wahr?
Lucie lächelt.
– Ich habe sie gekauft, damit irgendetwas in meiner Wohnung der Gewöhnung widersteht. Man gewöhnt sich nicht ans Hässliche. Das ist das Leben. Hässliches Leben, aber Leben.
Den ganzen Abend über schweift Lucies Blick, wie magnetisch angezogen, zu dieser fürchterlichen Micky Maus zurück. Und plötzlich, ohne dass sie wüsste warum, redet Walt Disneys Maus mit ihr, sie sagt ihr, dass mit diesem Mann eine Art Glück möglich ist.
Sie stellt ihm Louis vor. André ist nicht berechnend: Er mag auf Anhieb diesen lebhaften und lustigen Jungen, der kurz vor der Pubertät steht, und er versucht nicht, ihn zu einem Verbündeten zu machen. Aber er macht sich nichts vor: In diesem Kampf um Lucies Herz kann er keinen Feind gebrauchen.
Eines Tages, als sie sich nach dem Mittagessen auf Wiedersehen sagen, will sie die Straße überqueren, sie tut einen Schritt auf die Fahrbahn, und André reißt sie heftig am Arm zurück. Ein Lastwagen donnert an ihnen vorbei. Ihre Schulter schmerzt, aber beinahe wäre sie tatsächlich tot gewesen. Alles Blut ist aus Andrés Gesicht gewichen. Sie bleiben eine Zeitlang Seite an Seite stehen, die Geräusche der Stadt wirken übersteigert. Er atmet schnell, sie auch, und in einem Hauch zerrt er sie an sich und sagt:
– Verzeih, ich habe dir weh getan, ich hatte Angst, ich dachte, dass … Ich liebe dich so sehr.
Und er weicht zurück, erschrocken über diesen Satz, der ihm entglitten ist, stottert nochmals Verzeih und geht fort. Sie schaut ihm hinterher, und zum ersten Mal bemerkt sie, dass er schnell und gerade geht, dass er noch richtig jung ist. Sie ist überwältigt, braucht zwei Wochen, bevor sie wieder Kontakt mit ihm aufnimmt, und als sie sich wiedersehen, spricht er nicht mehr davon.
Aber er hat es gesagt. Ich liebe dich. Lucie misstraut dem Satz. Es ist zu früh für sie, ihn noch einmal zu hören. Sie hat einen anderen Mann geliebt, der dieses lügnerische Verb zu oft und falsch benutzte, der sie gedemütigt, sie misshandelt hat, der verschwand, um wiederzukommen und abermals zu verschwinden. Sie würde André gerne sagen, dass sie all diese Männer leid ist, die sie wegen ihrer sanften Haut, ihrer schlanken Beine, ihrer blassen Lippen begehren, all dem, was sie ihre Schönheit nennen, diesem Glücksversprechen, und die in ihr nichts anderes sehen als das. Sie ist die leid, die sich wie Jäger an sie heranpirschen, die davon träumen, sie wie eine Trophäe an die Wand zu hängen. Sie verdient Besseres als ein impulsives Verlangen, sie will nicht mehr, dass man mit ihr spielt. Sie würde ihm gerne sagen, dass sie deswegen ganz langsam auf ihn zugegangen ist, dass sie deswegen da ist. Wegen der Zeit, die er ihr gewidmet hat, wegen der Zärtlichkeit, die sie in ihm vermutet, auch wegen seines Respekts vor ihr. Sie wäre gerne in der Lage, ihn nicht länger in diesem Stand eines stummen, alten Verliebten zu belassen, sie wäre gerne schroff oder würde lieber loslassen, sich ihm ganz hingeben. Sie begnügt sich mit ihrer Scham darüber, hart zu sein, manchmal grausam, indem sie der wachsenden Zuneigung, die sie zu ihm verspürt, widersteht.
Es vergeht noch ein Winter darüber, und da sagt er es ihr, es ist vier Monate her, nach einem Abendessen im Kim, diesem kleinen koreanischen Restaurant im Marais, das sie immer wieder aufsuchen, noch einmal: «Weißt du, Lucie, mir liegt an dir, und ich weiß um alles, was sich zwischen uns stellt, sich gegen uns stellt. Aber wenn du mich eines Tages, wann es dir beliebt, als deinen Gefährten wünschst, dann wirst du den ersten Schritt machen müssen …» Der Blick, mit dem er sie in diesem Moment anschaut, ist alterslos, sie ist verwirrt, sie lächelt, und selbst wenn sie weiß, dass sie noch Zeit braucht, fürchtet sie, dass er dieses langen vergeblichen Wartens müde wird. Sie beschließt, den rothaarigen kleinen Kairos am Schopf zu packen, jenen griechischen Gott des günstigen Augenblicks. Ihr ganzes Wesen stößt sie neben ihn auf die Sitzbank, und sie küsst ihn zärtlich. Keine romantische englische Komödie hätte eine schönere erste Szene gewagt. Sie bedauert nichts.
Von diesem fast schon unglaublichen Moment an werden André und sie nicht mehr voneinander lassen.