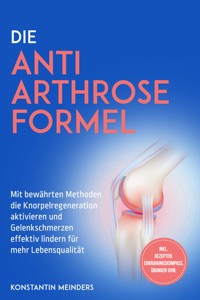
Die Anti Arthrose Formel: Mit bewährten Methoden die Knorpelregeneration aktivieren und Gelenkschmerzen effektiv lindern für mehr Lebensqualität - inkl. Rezepten, Ernährungskompass, Übungen uvm. E-Book
Konstantin Meinders
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: ONIX Media
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Arthrose-Formel: Mit zahlreichen Strategien, Maßnahmen und Anwendungen der Volkskrankheit Arthrose vorbeugen und zu Vitalität & Wohlbefinden zurückfinden Machen Ihnen die ersten Anzeichen einer Arthrose zu schaffen? Vielleicht leiden Sie bereits unter ausgeprägten Beschwerden? Oder Sie wollen es erst gar nicht so weit kommen lassen? In jedem Falle ist dieser Ratgeber Ihr perfekter Verbündeter – und zeigt Ihnen einen kinderleichten Weg zur Vorbeugung, Behandlung und Linderung! Mit der zunehmenden Überalterung unserer Gesellschaft rückt auch das Problem "Arthrose" immer mehr in den Vordergrund: Verschleißen Gelenkteile oder liegen Entzündungen vor, sind irgendwann Schmerzen, Instabilität und Bewegungseinschränkungen die Folge und belasten die Lebensqualität. Doch dagegen haben Sie selbst jede Menge in der Hand! Denn mit dem richtigen Lebensstil beugen Sie ganz einfach vor oder vermindern Ihre Belastung, und in diesem Buch erfahren Sie, wie das alltagstauglich und unkompliziert klappt. Machen Sie sich zunächst mit den wichtigsten Fakten rund um die Erkrankung vertraut, um anschließend selbst aktiv zu werden. Von Ernährung und Bewegung über Lifestyle und Ergonomie bis hin zu alternativen Heilmethoden und ganzheitlich-mentalen Ansätzen entdecken Sie zahlreiche Übungen, Praxisstrategien und Maßnahmen, mit denen Sie jeden Lebensbereich optimal arthrosefreundlich gestalten können. Ganz ohne Medikamente? Keine Sorge! Auch der Aspekt der ärztlichen Intervention wird umfassend erläutert, sodass Sie Ihre Vorgehensweise rundum perfekt auf Ihre individuellen Bedürfnisse ausrichten können. Grundkurs Arthrose: Erfahren Sie kompakt und verständlich das Wichtigste rund um Entstehung, Symptome, Risikofaktoren und Auswirkungen, und werden Sie in kürzester Zeit zum Arthrose-Experten. Wichtige Basics:Finden Sie heraus, wie Sie in den Bereichen Ernährung und Nährstoffversorgung, Sport & Physiotherapie sowie Gewichtsreduktion und Gelenkschonung gezielt und effektiv Beschwerden bekämpfen können. Weiterführende Ansätze: Ob Ergonomie im Alltag, natürliche Heilmittel und Kräuter, Akupunktur, Osteopathie und Hydrotherapie oder unterschiedliche medizinisch-medikamentöse Maßnahmen – lernen Sie verschiedene Ansätze kennen, um langfristig für Verbesserung zu sorgen. Ganzheitlicher Fokus: Entdecken Sie entscheidende Zusammenhänge zwischen chronischen Schmerzen und emotionalen Belastungen, wie Psychotherapien helfen können und wie Sie durch Hobbys, soziale Aktivitäten und mehr Ihre Lebensqualität erheblich steigern. Mit diesem Buch setzen Sie den Gelenkbeschwerden kraftvoll und effektiv etwas entgegen und nehmen Ihre Gesundheit (wieder) selbst in die Hand. Der zusätzliche "Ernährungskompass" im Bonusteil mit 50 arthrosefreundlichen Schlemmer-Rezepten wie Spaghetti mit Paprikasauce, türkischer Bohnensalat oder Caponata hilft Ihnen darüber hinaus, Ihren Körper wieder auf Kurs zu bringen und schenkt Genussmomente bei Tisch. Also worauf warten Sie noch? Klicken Sie nun auf "Jetzt kaufen mit 1-Click" und holen Sie sich Beweglichkeit, unbeschwerte Lebensfreude und Vitalität ganz einfach zurück in Ihren Alltag!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung des Autors beziehungsweise des Verlags für jegliche Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2025 www.edition-lunerion.de
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Fragen und Anregungen:
Auflage 2025
Inhalt
Einführung in Arthrose
Was ist Arthrose?
Ursachen, Einteilung und Risikofaktoren
Symptome und Diagnose
Die Grundlagen: Ernährung und Nährstoffe
Entzündungshemmende Nährstoffe
Empfohlene Lebensmittel
Empfohlene Supplemente
Ernährungsstrategien
Notwendig: Bewegung und Physiotherapie
Gelenkfreundliche Übungen
Dehn- und Mobilitätsübungen
Nicht zu vergessen: Lebensstil und Prävention
Gewichtskontrolle
Gelenkschonung im Alltag
Stressmanagement
Oft übersehen: Ergonomie und Arbeitsplatzgestaltung
Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
Körperhaltung
Gelenkschonende Arbeitsweise
Der Blick über den Tellerrand: Alternative Heilmethoden
Natürliche Heilmittel
Physiotherapeutische Therapien
Komplementäre Therapien
Medikamentöse Behandlung und medizinische Interventionen
Medikamente zur Schmerzlinderung
Injektionen und andere Verfahren
Chirurgische Optionen
Ganzheitlich unerlässlich: mentale Aspekte und Lebensqualität
Umgang mit chronischen Schmerzen
Emotionale Belastungen
Verbesserung der Lebensqualität
Bonus 1: Arthrose-Ernährungskompass
Der Arthrose-Ernährungskompass
Bonus 2: 50 Rezepte für mehr Beweglichkeit, Gesundheit und Wohlbefinden
Fitmacher Frühstücksideen
Blutzuckerfreundliches Mittagessen: Schnell & Einfach
Leicht & nährstoffreich: Abendessen
Superfood-Smoothies
Einführung in Arthrose
Was ist Arthrose?
Definition und Krankheitsbild
Auch heute noch hält sich der Status der Arthrose wacker: Als die grenzübergreifend häufigste diagnostizierte Gelenkerkrankung macht sie sich weltweit bei Millionen von Menschen bemerkbar. Laut einer Studie des Robert Koch-Instituts, namentlich „Gesundheit in Deutschland aktuell 2014/2015-European Health Interview Survey“, gaben bereits 17,9 % der Erwachsenen ab 18 Jahren an, in den letzten zwölf Monaten von einer Arthrose betroffen gewesen zu sein. Die Inzidenz liegt mit 21,8 % bei Frauen dabei deutlich höher als bei Männern, die dagegen einen Prozentsatz von nur 13,9 % ausmachen. Auch steigt das Risiko, an einer Arthrose zu erkranken, mit steigendem Alter signifikant an: Bei der Altersgruppe der über 65-Jährigen waren knapp die Hälfte der Frauen (48,1 %) betroffen. Die Männer folgten mit fast einem Drittel (31,2 %) Betroffenheit. Da die deutsche Bevölkerung in den darauffolgenden Jahren insgesamt gealtert ist, also im Schnitt mehr Menschen höhere Lebensalter erreichen als zuvor, kann davon ausgegangen werden, dass ihre Prävalenz hierzulande einen Aufwärtstrend erfährt. Umso wichtiger scheint es in diesen Zeiten, sich mit dem Krankheitsbild der Arthrose vertraut zu machen und ihr individuell vorzubeugen. Doch lassen wir uns nicht das Feld von hinten aufrollen, sondern zunächst verstehen, wo die Wurzeln dieser Gelenkerkrankung hausen. Mit anderen Worten: Was ist Arthrose eigentlich und wie äußert sich dieses Krankheitsbild am menschlichen Körper?
Unser Bewegungsapparat setzt sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammen. Dazu gehören unter anderem Knochen, Muskeln, Bänder, Faszien, Sehnen ebenso wie Gelenke. Auch wenn Gelenk nicht gleich Gelenk ist und es verschiedene Arten dieser Gruppe gibt, so fügen sie sich im Wesentlichen doch aus den gleichen anatomischen Bestandteilen zusammen. In einem gesunden, das heißt physiologischen Gelenk lassen sich verschiedene Strukturen eindeutig voneinander abgrenzen. Im Wesentlichen sind das die beiden Enden von zwei aufeinandertreffenden Knochen, die jeweils einen Gelenkkopf und eine Gelenkpfanne darstellen. Auf diesen Gelenkflächen liegt wiederum der Gelenkknorpel. Damit wird verhindert, dass die aufeinanderliegenden Knochen durch eine sich sonst zwischen den Gelenkflächen bildende Reibung abgeschliffen und beschädigt werden. Auch wird dadurch Raum für den Gelenkspalt mit der Gelenkflüssigkeit geschaffen, die unter anderem den reibungslosen Bewegungsablauf unterstützt, den Knorpel mit Nährstoffen versorgt und Stöße elastisch abdämpfen kann. Die Gelenkkapsel, die das gesamte Gelenk von außen einschließt, gibt die Gelenkflüssigkeit nach innen ab. Damit auch alle Bestandteile der Konstruktion zuverlässig ihrer Arbeit nachgehen können, werden sie von Bändern und gegebenenfalls umliegenden Muskeln stabilisiert, die zudem für den sicheren Ablauf der Gelenkbewegungen verantwortlich sind. So jedenfalls bildet sich, vereinfacht beschrieben, der Zustand eines gesunden Gelenks ab.
Hinweis: In diesem Buch finden Sie einen QR-Code, der Sie zu einer Audiodatei führt. Falls Sie keine Möglichkeit haben, den QR-Code zu scannen, können Sie die Datei auch über diesen Link finden: https://bit.ly/451MZxB
Berichten Betroffene jedoch von einer Arthrose, befindet sich der Gelenkknorpel im Zustand der Zerstörung durch einen degenerativen Abbau. Das bedeutet, dass sich beim Patienten Abnutzungserscheinungen an Geweben bemerkbar machen, die meist alterungs- oder belastungsbedingt auftreten und bis zu einem gewissen Grad dem natürlichen Prozess des Alterns zugeschrieben werden können. Doch nicht nur der Gelenkknorpel kann dabei bei einer Arthrose abgebaut werden. Auch die subchondrale Region, also der Bereich unter dem Knorpel, und daran angrenzende Strukturen wie die Bänder, Muskeln und Kapseln können und werden dabei häufig beeinträchtigt. Die Osteoarthritis Research Society International (kurz: OARSI) beschreibt Arthrosen offiziell und übersetzt so:
„Arthrose ist eine Erkrankung beweglicher Gelenke, die durch Zellstress und einen durch Mikro- und Makroverletzungen ausgelösten Abbau der extrazellulären Matrix gekennzeichnet ist und maladaptive Reparaturreaktionen einschließlich entzündungsfördernder Wege der angeborenen Immunität aktiviert. Die Krankheit manifestiert sich zunächst als molekulare Störung (abnormaler Stoffwechsel des Gelenkgewebes), gefolgt von anatomischen und/oder physiologischen Störungen (gekennzeichnet durch Knorpelabbau, Knochenumbau, Osteophytenbildung, Gelenkentzündung und Verlust der normalen Gelenkfunktion), die in einer Krankheit gipfeln können.“
Wir können festhalten, dass es sich bei dieser Krankheit in erster Linie um eine molekulare Störung handelt. Durch einen gestörten Stoffwechsel des Gelenksgewebes beobachten Pathologen und Kliniker infolgedessen die oben geschilderten anatomischen und/oder physiologischen Reaktionen des Körpers. Bevor wir uns näher ansehen, wie es zu einer Arthrose kommen kann, welche Faktoren sich begünstigend auf eine solche Krankheitsentwicklung auswirken und wie man feststellen kann, ob man selbst betroffen ist, sollten wir kurz darüber nachdenken, was eine Arthritis mit einer Arthrose zu tun hat. Immerhin klingen die beiden Begriffe doch so ähnlich. Beschreiben sie damit auch Gleichartiges?
Unterschiede zwischen Arthrose und Arthritis
Zugegeben, obwohl die beiden Begriffe denselben Wortstamm haben und sich damit auf dieselbe Körperregion konzentrieren, kann man sie keinesfalls miteinander gleichstellen. Wie der griechische Wortstamm -itis schon verrät, handelt es sich bei der Arthritis um eine Entzündung des betroffenen Gelenks. Im Gegensatz zur Arthrose hat sie demnach nicht den Verschleiß des Gelenks zur Folge. Eine Arthrose und eine Arthritis sind damit zunächst zwei unterschiedliche Erkrankungen.
Das heißt allerdings nicht, dass das eine nicht grundsätzlich auch das andere mit sich bringen kann. Zwar gibt es verschiedene Formen der Arthritis, die sich nach Verlauf, Befallsmuster, Lokalisation und Genese einteilen lassen können. Das hindert eine Arthrose jedoch nicht daran, in manchen Fällen zusätzlich eine Arthritis auszubilden. Ist der Gelenkknorpel durch die mechanische Reizung zu stark strapaziert, kann sich das Gelenk infolgedessen entzünden. Anders als bei einer Arthritis, bei der die Krankheitsauslöser meist eine Autoimmunreaktion oder Infektionen sind, kann danach auch die Überreizung des Gelenks Grund zur Krankheitsentwicklung sein. Damit kann eine Arthritis etwas mit dem Gelenkknorpel zu tun haben - muss sie aber nicht.
Grob gesagt können Arthritiden verschiedene Ursachen haben. Häufig handelt es sich dabei um rheumatische Arthritiden, die einen autoimmunologischen Verlauf mit sich bringen. Das bedeutet, dass der Körper seine eigenen Strukturen nicht mehr erkennt, sie als körperfremd deklariert und nun mithilfe seines Immunsystems versucht, die betroffenen Zellen und Gewebe zu eliminieren. Abseits dessen sind auch die Ablagerung von Harnsäurekristallen in den Gelenken, welche Krankheit sich ferner als Gicht ausbreitet, oder infektiöse Erreger wie Bakterien, Viren und selten auch Pilze als Ursachen denkbar. Die fünf typischen Anzeichen der Entzündung, genannt tumor (Schwellung), calor (Hitze), rubor (Rötung), dolor (Schmerz) und functio laesa (Funktionsverlust) treten wie bei allen anderen Entzündungsarten auch bei Arthritis auf. Dies ist bei der Arthrose nicht der Fall. Eine Gemeinsamkeit ist allerdings, dass bei beiden Krankheiten Frauen deutlich häufiger betroffen sind als Männer.
Achtet man bereits auf vorher genannte Unterschiede, wird es zunehmend einfacher, eine Arthritis von einer Arthrose zu unterscheiden. Noch besser ist es, wenn man sich weitere Informationen zu den einzelnen Störungsbildern einholt. Grund genug, um nun endlich auf die Ursachen und Risikofaktoren der Arthrose zu blicken.
Ursachen, Einteilung und Risikofaktoren
Wie bereits erwähnt, werden bei einer Arthrose die durchaus widerstandsfähigen Knorpelschichten beschädigt. Gebildet von spezialisierten Zellen, den Chondrozyten, sind diese auch in der Lage, moderat lädierten Knorpel durch neues Gewebe zu ersetzen. Dies ist allerdings nur möglich, wenn dieses Gewebe bewegt und mit Nährstoffen versorgt wird, da es nicht separat durchblutet wird. Üben wir also unterschiedliche Drücke beim Laufen oder Rennen aus, stellen wir gleichzeitig die Versorgung des Knorpels sicher. Man kann sich diese Konstruktion wie einen Schwamm vorstellen: Belasten wir das Gewebe und üben Druck auf den Schwamm aus, können Abbauprodukte des Stoffwechsels ins umliegende Gewebe abgegeben werden. Entlasten wir es hingegen und lassen den Schwamm sich entfalten, können in der Gelenkflüssigkeit abgegebene Nährstoffe vom Knorpel aufgenommen werden.
Das Problem bei einer Arthrose ist, dass es durch vielfältige Ursachen wie Fehlstellungen, Übergewicht und Verletzungen zu einer Überlastung des Gelenks kommen kann. Der Druck zwischen den Geweben steigt und bewirkt, dass die Knorpelschicht dünner und rauer, also regelrecht abgeschliffen wird. Bei einer fortgeschrittenen Arthrose kann es sogar zu teilweisen oder kompletten Freistellungen des Knochens kommen, der sich unter dem kaum oder nicht mehr vorhandenen Knorpelgewebe befindet. Zunächst feine, kaum erkennbare Risse können sich bei gleichbleibender Belastung zu größeren Einbuchtungen und Kerben entwickeln.
Es gibt bei diesem Krankheitsbild unterschiedliche Formen der Gelenkerkrankung. Man unterscheidet nach Befallsmuster und nach Ursache. Unter der Kategorie Befallsmuster kommt es darauf an, ob sich eine einzelne oder eine generelle Arthrose ausgebildet hat. Spricht man von ersterem, ist nur ein einzelnes Gelenk betroffen. Dies wird als Monarthrose bezeichnet. Polyarthrosen sind degenerative Gelenkerkrankungen des Knorpels, die sich über mehrere Gelenke erstrecken, wie häufig bei Fingergelenkspolyarthrosen. Bei der Einteilung nach der Ursache der Arthrose gibt es mehrere Aspekte. Es wird in zwei Gruppen unterteilt: primäre und sekundäre Arthrosen. Bei letzterer können eine Vielzahl von Aspekten relevant sein und zum Ausbruch der Krankheit führen. Primäre Arthrosen stehen für sich allein und sind nicht Folge eines anderen pathologischen Zustandes. Sie werden derzeit mit einer genetischen Prädisposition in Verbindung gebracht. Sekundäre Arthrosen entstehen als Folge einer weiteren Erkrankung. Hierzu zählen:
Angeborene Fehlstellungen oder Gelenkdysplasien (Bildungsfehler der knorpelig-knöchernen und bänder-kapselartigen Gelenkanteile)
Disproportionalität zwischen Belastung und Belastbarkeit des Gelenkknorpels durch Übergewicht, Überbelastung etc.
Traumatisch bedingte Gelenkfehlstellungen bzw. Fehlbelastungen
Metabolismus betreffende Ursachen wie Gewebe- und Knochenschäden bei Mangeldurchblutung, Diabetes mellitus, Alkoholismus, Entzündungen etc.
Medikamente betreffende Ursachen
Endokrin bedingte Ursachen
Andere Grunderkrankungen wie CPPD, Gicht, rheumatoide Arthritis, Spondylarthritis, Hämochromatose, Hämophilie, Ochronose, Morbus Wilson
Wir können festhalten, dass die Ausbildung einer Arthrose verschiedene Ursachen haben kann, die eine große Breite an Störungen und Ungleichgewichten im menschlichen Körper abdecken. Nichtsdestotrotz erkranken nicht alle Personengruppen mit derselben Häufigkeit. Das liegt daran, dass es verschiedene Risikofaktoren gibt, die die Erkrankung bei Menschen mit bestimmten Eigenschaften begünstigen.
Konkret bedeutet dies, dass wir nach jetzigem Stand der Forschung von personenbezogenen und von gelenkbezogenen Risikofaktoren sprechen. Wie zu Beginn des Kapitels erwähnt, erkranken häufiger ältere als junge und weibliche als männliche Personen an einer Arthrose. Die genetische Disposition sowie der Hormonhaushalt spielen eine große Rolle. Auch hohe Körpergewichte wirken sich positiv auf die Entwicklung von Gelenkerkrankungen wie Arthrose aus. Das liegt an der erhöhten mechanischen Beanspruchung der Gelenke und dem erhöhten Fettgewebsstatus, der den Metabolismus reizt. Im weißen Fettgewebe finden sich viele Zytokine, kleine Proteine, die die Kommunikation zwischen Zellen beeinflussen und sich begünstigend auf den Verlust von Knorpelmaterial auswirken können, wie die Adipokine Adiponectin und Leptin zeigen. Ob mechanische Überbelastung oder erhöhter Fettgewebsanteil eine größere Rolle spielen, bleibt zu klären. Arbeit und Freizeitaktivitäten können auch Risikofaktoren sein, wenn Gelenke über längere Zeit über- oder fehlbelastet werden, was das Verletzungsrisiko erhöht. Sportbedingte Verletzungen oder anhaltender Stress auf der Arbeit sind Beispiele. Auch Bewegungsmangel und kohlenhydratreiche Ernährung könnten zu den Risikofaktoren zählen, was jedoch nicht hinreichend belegt ist. Gelenkbezogene Risikofaktoren umfassen aufgetretene Gelenktraumata, angeborene oder erworbene Fehlstellungen, Veränderungen in der Gelenkkonfiguration, frühere operative Eingriffe und mechanische Belastungen. Es gibt auch Verbindungen zwischen kardiovaskulären Erkrankungen wie koronarer Herzkrankheit, Herzinfarkt, Herzinsuffizienz oder Angina pectoris und einer erleichterten Ausbildung von Arthrose.
Das Risiko, an einer Form von Arthrose zu erkranken, ist demnach, wie eingangs erwähnt, nicht gering. Doch wie merkt man, dass man sie hat, wenn sie erst einmal da ist? Genau das schauen wir uns im nächsten Kapitel an.
Symptome und Diagnose
Die Symptomatik der von Arthrose betroffenen Personen lässt sich ebenfalls in mehrere Unterkategorien teilen. Im Allgemeinen lassen sich daher verschiedene zeitliche Ebenen voneinander differenzieren. Befindet sich die Gelenkerkrankung erst seit kurzer Zeit in der Ausbildung, gestaltet sich die Symptomlage bei den Patienten meist erst einmal still und schleichend, bis die Erkrankten häufig von sogenannten Anlaufschmerzen im betroffenen Gelenk nach Ruhephasen sprechen. Mit diesem Begriff bezeichnet man Gelenkschmerzen (Arthralgien), die sich zu Beginn des Einsetzens einer Bewegung kenntlich machen. Es reichen demnach ein längeres Sitzen oder Stehen, denen Bewegungen wie Aufstehen oder Loslaufen folgen, um den Anlaufschmerz auszulösen. Ebenso prominent sind in diesem Stadium Belastungsschmerzen, die üblicherweise nach anstrengenden und längerfristigen Belastungen des Gelenks auftreten. Zu der Gruppe der akuten Schmerzen bei einer Arthrose gehören außerdem Nachtschmerzen und ausstrahlende Schmerzen, die sich in umliegenden Gewebearten ausbreiten.
Diese Symptome entwickeln sich ebenfalls in einem etwas fortgeschritteneren Stadium der Gelenkerkrankung. Belastungsunabhängige Bewegungsschmerzen und Ruheschmerzen verdeutlichen dabei, dass es keine Einzelauslöser für Schmerzreizungen mehr braucht, da das Gewebe bereits zu stark geschädigt ist. Auch Entzündungsprozesse wie ein Gelenkerguss bei einer aktivierten Arthrose sowie Krepitationen, also das hör- und fühlbare Knirschen von offengelegten Knochen bei Reibungskontakten, deuten auf einen bereits schwerwiegenderen Krankheitsverlauf hin. Schmerzen, die mehr als drei Monate andauern oder wiederkehren, werden als chronische Schmerzen verzeichnet. Entwickelt sich eine solche andauernde Arthrose mit der Zeit weiter, kann es in der Folge zu Instabilitätserscheinungen, Bewegungseinschränkungen und Einsteifung nach Ruhephasen im betroffenen Gelenk kommen. Auch die umliegenden Gelenke können dann aufgrund von Fehlbelastungen gefährdet sein. Abschließend lässt sich festhalten, dass sich die Zusammensetzung sowie die Ausprägung der Symptome grundsätzlich von Mensch zu Mensch unterscheiden können. Die vorhandene Symptomatik sollte dabei immer der Grundbaustein für die darauffolgende klinische Diagnose sein. Arthrosezeichen, die mittels Röntgenaufnahmen festgehalten wurden, zeigen häufig keinen Zusammenhang mit der dargestellten Symptomatik.
Wir halten damit fest: Arthrose-Erkrankungen können anhand ihrer gezeigten Symptome grundsätzlich in verschiedene Verlaufsphasen eingeteilt werden. So kann sich eine stumme Arthrose, das heißt eine, die bislang ohne Symptome verläuft, allerdings radiologisch nachweisbar wäre, mit der Zeit in eine schmerzhafte, aber noch nicht aktivierte Arthrose entwickeln. Bei Nichtbehandlung geht sie dann in die aktivierte Form, sprich in den entzündlich-aktivierten Zustand über. Das zeigen in der Regel lokale Entzündungszeichen sowie unspezifisch angestiegene Werte der Entzündungsparameter unseres Körpers. Das letzte Stadium einer Arthrose-Erkrankung, auf das sich anhand der Symptomatik schließen lässt, nennt sich die dekompensierte Arthrose. In diesem fortgeschrittenen Stadium treten bereits erwähnte chronische Beschwerden und Einschränkungen in der Funktionalität der Mono- oder Polyarthrose auf.
Stellt ein Patient Teile dieser Symptomatik an sich selbst fest, wird er sich in der Regel zunächst seinem Hausarzt vorstellen. Das ist auch notwendig, um im Rahmen der klinischen Untersuchung zunächst eine Anamnese aufzustellen, die das spätere Fundament der Diagnostik bildet. Die untersuchende Person erkundigt sich dabei unter anderem danach, wo die Gelenkschmerzen genau auftreten, wann und wie sie möglicherweise begonnen haben, welche Haltungen und Bewegungen die Beschwerden verbessern oder verschlechtern und welchen Charakter sowie welche Intensität die Gelenkschmerzen aufweisen. Es folgt eine Inspektion, das heißt eine genaue Betrachtung der betroffenen Region nach möglicherweise Schwellungen, Rötungen und pathologischen Proportionsmaßen. Dem schließen sich die Palpation, das Abtasten sowie die Bewegungs- und Funktionsprüfung an. Dabei werden die Gelenkkontur, umgebende Muskulatur und die Bandstabilität begutachtet. Auch sollte ein möglicherweise aufgetretener Gelenkerguss festgestellt oder ausgeschlossen werden. In der Bewegungs- und Funktionsprüfung werden dann auch die Bewegungsgrade des Gelenks mit aktiven und passiven Bewegungsabläufen geprüft – wichtig dabei: Schmerzen und Bewegungseinschränkungen sollten ausfindig gemacht und lokalisiert werden. Bei Bedarf können sich dem noch spezielle Funktionstests anschließen, die die Erstuntersuchung ergänzen und abrunden sollen.
Ein weiterer möglicher Bestandteil der diagnostischen Mittel zur Untersuchung von Arthrosen stellen Labordiagnostika dar. Auch wenn die Laborwerte meist unauffällig sind und sich nur manchmal nach oben ausschlagende Entzündungsparameter zeigen, so bleibt die Abnahme von Laborwerten keinesfalls ohne Nutzen. Mit ihren Werten lassen sich zum einen eine septische Arthritis ausschließen, zum anderen ermöglichen sie uns die Differenzierung zwischen degenerativen und entzündlichen sowie rheumatischen Prozessen.
Das alles sind Zustände, die sich dagegen in der bildgebenden Diagnostik der Arthrose nicht so leicht identifizieren lassen. Die wohl bekannteste und auch heute noch am meisten in dem Gebiet genutzte Bildgebung ist die konventionelle Röntgenaufnahme. Sie wird beim betroffenen Gelenk in zwei Ebenen angefertigt, um sich leichter ein dreidimensionales Bild der Stelle vorstellen zu können. Genutzt werden kann sie dabei, wie bereits erwähnt, als eine Ausgangsuntersuchung, aber auch Verlaufskontrollen sind mit ihr möglich. Mögliche Befunde, bekannt als typische Arthrosezeichen, bilden sich wie folgt ab:
Verschmälerung des Gelenkspalts: meist asymmetrischer Form
Subchondrale Sklerose: Verdichtung der Spongiosa, einem Teil des Knochengewebes, unterhalb des Gelenkknorpels; verursacht durch den Verlust von Gelenkknorpel und reaktive gewebliche Umbauvorgänge bei erhöhter Belastung
Osteophyten: knöcherne Anbauten, die sich typischerweise an den Rändern eines Gelenks anlagern; entstehen als Reparaturmechanismus bei zu starker mechanischer Belastung und dienen der Stabilisierung des Gelenks bzw. besseren Verteilung der Belastungen
Subchondrale Geröllzysten: unter dem Knorpelgewebe befindliche, mit Bindegewebe und/oder Flüssigkeit gefüllte Zysten
Deformierung der Gelenkfläche mit ggf. freien Gelenkkörpern
Osteoporose
Verkalkung der Gelenkkapsel
Subluxationen: nicht vollständige Ausrenkung eines Gelenks, bei der noch Berührungspunkte mit der Gelenkfläche bestehen
Radiologisch graduiert werden können diese Befunde mithilfe der Klassifikation nach Kellgren und Lawrence. Heutzutage gibt es bereits verschiedene Varianten dieses Einteilungssystems, welches sich aufgrund seiner einfachen Anwendung bei guter Reproduzierbarkeit zwischen früheren Systemen durchsetzen konnte und nun standardmäßig laut WHO auch in der Auswertung von epidemiologischen Studien eingesetzt wird. Eine dieser Modellformen sieht wie folgt aus:
Arthrosegrad 0
: keine Arthrose – radiologischer Befund (rB): Normalbefund
Arthrosegrad 1
: fragliche Arthrose – rB: zweifelhafte Abnahme der Gelenkspaltweite; diskrete (fragliche) Osteophyten möglich („osteophytic lipping“)
Arthrosegrad 2
: minimale Arthrose – rB: mögliche Verminderung der Gelenkspaltweite; definitiver Osteophytennachweis
Arthrosegrad 3
: moderate Arthrose – rB: eindeutige Verminderung der Gelenkspaltweite, multiple Osteophyten, geringe bis mäßige subchondrale Sklerose, mögliche Deformität der gelenksbildenden Knochenanteile
Arthrosegrad 4
: schwere Arthrose – rB: deutlich fortgeschrittene Verminderung der Gelenkspaltweite, große Osteophytenbildungen, schwere subchondrale Sklerose, eindeutige Deformität der gelenkbildenden Knochenanteile
Wichtig im Hinterkopf zu behalten ist, dass mit der konventionellen Röntgenaufnahme keine Weichteilgewebestrukturen dargestellt werden können, da sie diese nicht abbilden kann. Auffälligkeiten können außerdem erst im Vergleich von zeitlich unterschiedlich aufgenommenen Röntgenbildern festgestellt werden. Neben dem Röntgen als diagnostisches Mittel können auch Magnetresonanztomographien, kurz MRTs, oder Computertomographien, CTs, für die Diagnostik zurate gezogen werden. Diese bieten ergänzend die Möglichkeit, auch Weichgewebe darzustellen und dementsprechend bewerten zu lassen. Mögliche Befunde sind hier intraartikuläre Pathologien, Knochenmarksödeme, Stressfrakturen (überbegrifflich für Ermüdungs- und Insuffizienzfrakturen genutzt) und Knorpelläsionen. Außerdem ist hier bereits ohne auffällige konventionelle Röntgenaufnahmen eine Diagnosestellung möglich, wodurch der Schweregrad der Arthrose bestimmt und dokumentiert werden kann. Nicht standardmäßig eingesetzt werden hingegen nuklearmedizinische Methoden. Dafür können jedoch in speziellen Fällen ergänzend Arthroskopien, also Endoskopien für Gelenke, angeordnet werden. Diese lassen sich häufig bei Kniegelenken finden und können gleichzeitig dazu dienen, therapeutische Maßnahmen am von der Arthrose betroffenen Gelenk einzuleiten.
Auf dem Weg zur Diagnosestellung gilt es schließlich einige Differenzialdiagnosen zu treffen. Als Differenzialdiagnosen bezeichnet man im medizinischen Sprachgebrauch Krankheiten, die eine ähnliche oder in weiten Teilen gleiche Symptomatik aufweisen. Der behandelnde Arzt stellt damit sicher, dass neben der Arthrose nicht vielleicht noch andere Ursachen auf die vorhandene Symptomatik zutreffen. Solche Differenzialdiagnosen können im Falle von Arthrose-Erkrankungen folgende sein:
Chondrokalzinose
Gicht
Rheumatoide Arthritis
Spondylarthritis
Hämophilie
Hämochromatose
Nun, da wir die wesentlichen Grundzüge des Arthrose-Krankheitsbildes kennengelernt haben, bleibt uns doch die Frage: Wie therapiert man eine Arthrose eigentlich? Auch wenn diese Gelenkerkrankung bislang nicht heilbar ist und die genauen molekularbiologischen Mechanismen zur Entstehung noch nicht abschließend geklärt sind, gibt es mehrere Möglichkeiten, um eine Arthrose zu therapieren. Diese werden gerne auch in Kombination angewandt. Das Therapiemuster wird dabei gemeinsam mit dem Arzt auf den Patienten angepasst, denn was dem einen hilft, taugt nicht unbedingt einer anderen Patientin. Therapieziel ist dabei jedoch immer, die klinischen Symptome so gut es geht zu mindern und wenn möglich am besten prophylaktisch einzugreifen. Damit Sie zumindest ein paar erste Eindrücke von diesem weiten Therapiefeld gewinnen können, werden wir uns mit ihnen etwas genauer in den nächsten Kapiteln, jeweils eingeteilt in Oberkategorien, beschäftigen. Beginnen wir dabei damit, was Sie schon heute problemlos zur Arthroseprävention tun können: Augen auf beim Lebensmittelkauf und Sport frei!
Die Grundlagen: Ernährung und Nährstoffe
Entzündungshemmende Nährstoffe
Noch immer unterschätzen viele Menschen die Kraft der Ernährung. Nicht umsonst ist das Sprichwort „Du bist, was du isst.“ auch heute noch in aller Munde. Dabei dient die Ernährung besonders in Zeiten wie diesen nicht mehr nur dem Überleben, sondern steuert auch die Art und Weise, wie wir leben. Doch was hat das mit unserer Arthrose-Erkrankung zu tun?
Nun, wie bei vielen anderen Erkrankungen auch kann sich unser Ernährungsverhalten positiv oder negativ auf sich entwickelnde oder bereits bestehende Erkrankungen auswirken. So verhält es sich ebenfalls mit der Arthrose. Insbesondere bei bereits aktivierten Arthrosen, die häufig schmerzhafte Entzündungen und Schwellungen an den Gelenken vorweisen, kann es deshalb sinnvoll sein, auf den vermehrten Konsum von sogenannten antiinflammatorischen Nährstoffen zu achten. Antiinflammatorisch bedeutet dabei nichts anderes als „entzündungshemmend“. Wie der Name bereits sagt, sollen solche Lebensmittel dabei helfen, Entzündungen entgegenzuwirken und sie im besten Fall so stark wie möglich abzuschwächen. An dieser Stelle ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass Entzündungen im eigentlichen Sinn die Funktion erfüllen, unseren Körper vor körperfremden Erregern zu schützen. Physiologischerweise sind sie damit sehr nützliche Abwehrsysteme unseres Körpers, die für uns genau dann einen Vorteil erbringen, wenn sie uns damit vor potenziellen und unmittelbaren Gefahren schützen.
Entzündungen und deren wichtige Aufgabe:
Wenn der Körper mit einer Bedrohung konfrontiert wird, setzen Immunzellen chemische Signalstoffe frei, die Entzündungsprozesse auslösen. Diese Signale ziehen weitere Immunzellen an die betroffene Stelle, um Krankheitserreger oder beschädigte Zellen zu bekämpfen.
Zudem erhöht sich die Durchblutung im entzündeten Gewebe, was zu Rötung und Schwellung führt. Diese erhöhte Blutversorgung bringt wichtige Nährstoffe und Immunzellen zur verletzten Stelle, wodurch die Reparatur und Heilung in Gang gesetzt werden. Entzündungen tragen auch dazu bei, die Ausbreitung von Infektionen einzudämmen, indem sie die Aktivität von Immunzellen wie Makrophagen und Neutrophilen steigern, die schädliche Mikroben in sich aufnehmen und zerstören.
Darüber hinaus führen Entzündungsprozesse zur Bildung von schützenden Molekülen, die die Heilung unterstützen und die Funktion des Gewebes wiederherstellen.
Da sich jedoch unsere Lebensumstände in den letzten Jahrzehnten drastisch verändert haben und die meisten von uns kaum mehr existenziell bedrohlichen Gefahrensituationen ausgesetzt sind – man denke an Hungersnöte, Dreck und Seuchen, Fressfeinde und das nackte Überleben – sollten Entzündungen in größerem Maßstab nicht mehr an der Tagesordnung vieler von uns sein. Nicht zu vergessen dabei der heutige Einsatz von Antibiotika, mit deren Hilfe sich in kürzester Zeit diverse Bakterienarten im Körper bekämpfen lassen – sowohl die hilfreichen als auch die schädlichen. Angefangen bei der chronischen Form der Arthrose zeigt sich jedoch: Chronische Entzündungen werfen ein neues Problem unseres Zeitalters auf. Entzündungen treten plötzlich in einem Ausmaß auf, das für unsere Vorfahren sicherlich nicht angedacht war. Statt einer weitläufigen Verbesserung des körperlichen Zustandes hinsichtlich Entzündungsparametern erfahren wir durch ihren chronischen Charakter eine zeitweise, teilweise sogar jahrelange Schwächung der Immunantwort unseres Körpers. Auch wenn das Problem in der Regel nicht allein damit gelöst ist, seine Ernährung umzustellen und mehr darauf zu achten, welche Lebensmittel dem eigenen Körper guttun, so kann diese Auseinandersetzung dennoch einen nicht zu unterschätzenden Beitrag hin zu einem besseren Allgemeinbefinden leisten. Außerdem lassen sich potenzielle weitere Ursachen wie mangelnder Schlaf, unzureichende Bewegung oder psychische Belastungen erst dann zuverlässig untersuchen, wenn die Organe des Ernährungstraktes sich beruhigt haben und zu ihrer gewöhnlichen Arbeit übergehen können. Wie schafft man also die Vorlage für eine antiinflammatorische Ernährung?
Der offensichtlichste Grundsatz dabei lautet: Finger weg von Lebensmitteln, die die Entwicklung von Entzündungen begünstigen können. Welche das genau sind, sieht zwar im Spezifischen für jede Person etwas anders aus, da jeder Organismus individuell auf bestimmte Nährstoffe reagiert. Grundsätzlich lassen sich jedoch bestimmte Nahrungsmittelgruppen festhalten, die dafür bekannt sind, bei einer Mehrheit von Menschen zu größeren Problemen im Stoffwechsel beizutragen. Um genau diese Klassen kümmern wir uns nun. Welche Nahrungsmittel sollten wir demnach im täglichen Konsum reduzieren?
Hoch verarbeitete Lebensmittel
Häufig sind diese im Supermarkt in Kühlregalen, Tiefkühlregalen, Tuben, Kartons, Plastikverpackungen – kurz gesagt: fast überall im Supermarkt zu finden. Auch Discounter, Fast-Food-Ketten sowie nicht selten Restaurants machen von solchen Lebensmittelmischungen Gebrauch. Als Faustregel kann man sagen, dass man sie meist überall dort entdecken kann, wo es schnell, kostengünstig und gleichzeitig erschwinglich, lange haltbar, praktisch und möglichst geschmacksintensiv zugleich sein soll – perfekt auf die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Zwecke abgestimmt. Allerdings schlecht für all die, deren somatische Intelligenz zu verstehen geben möchte, dass ihnen die Fertigsuppentüte oder Cola Light am Abend nach der Arbeit ziemlich auf den Magen schlägt. Ein Problem an hoch verarbeiteten Lebensmitteln ist, dass sie häufig Inhaltsstoffe wie ein Zuviel an Salz, Zucker und Zusatzstoffen enthalten, auf die unsere natürliche Darmflora nicht ausgelegt ist. Außerdem bringen sie nicht selten einen hohen Energieumsatz bei einem gleichzeitig zu niedrigen Vitamin-, Ballaststoff- und Mineralstoffgehalt mit sich. Ein weiterer Aspekt ist ferner, dass durch den hohen Verarbeitungsgrad auch die Ausbildung potenziell toxischer Verbindungen begünstigt werden kann. Schadstoffe aus den Verpackungen gehen schließlich nicht selten auf die Produkte über.
Nahrungsmittel, die unter diese Kategorie fallen, können zum Beispiel sein:
(kohlensäurehaltige) Erfrischungsgetränke,
süße und salzige Snacks,
Schokoriegel,
Kekse,
Eiscreme,
Margarine,
diverse Tiefkühlfertiggerichte wie Tiefkühlpizza oder Back-Camembert und Schmelzkäse,
Geflügelnuggets,
Würstchen,
gezuckerte Cerealien,
Pommes frites,
Instantsuppen sowie
pflanzliche Alternativen für Fleisch, Fisch, Milch, Joghurt und Käse.
Der häufige Verzehr solcher Lebensmittel steht deshalb scharf im Verdacht darauf, zahlreiche chronische Krankheiten wie unter anderem Magen-Darm-Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Demenz, Depression, Krebs und Adipositas zu begünstigen.
Im Falle von Arthrose kann die erhöhte Zufuhr von Zusatzstoffen wie Emulgatoren und künstliche Süßstoffe Entzündungen im Körper vorantreiben. Man vermutet, dass dabei das Darmmikrobiom eine große Rolle spielen könnte, da sich durch die Veränderung der Nahrungszusammensetzung auch die Zusammensetzung und das Zusammenspiel der Bakteriengemeinschaft im Darm verändert, womit auch das Immunsystem geschwächt wird. Wie sich das molekularbiologisch und biochemisch genau abbildet, kann allerdings erst mit zukünftigen weiteren Forschungen geklärt werden.
Wichtig zu beachten ist, dass es bei diesen Lebensmitteln jedoch nicht nur darauf ankommt, wie sie prozessiert und verarbeitet werden. Natürlich muss man sich auch regelmäßig die Frage danach stellen, woher eigentlich die Ausgangsstoffe zur Verarbeitung solcher Nahrungsmittel bezogen werden. Tierische Produkte aus Massentierhaltungen kombiniert mit dem konstanten Einsatz von Antibiotika sowie weiteren Medikamenten verlieren ebenso an natürlichen Nährstoffen wie über weite Strecken transportiertes und/oder künstlich gereiftes Obst und Gemüse.
Im Körper schnell anflutender Zucker
Wie bei so vielen Dingen auch gilt: Zucker ist nicht gleich Zucker. Lebensmittel, die allerdings ohne Wasser und Faserstoffe süß auf unserer Zunge liegen, gelten in der Regel als entzündungsfördernd. Die deutsche Bevölkerung nimmt mit rund 32,2 kg im Jahr 2022/2023 pro Kopf und einem daraus errechneten Wert von 91 Gramm pro Tag immer noch weitaus mehr Zucker zu sich, als es die WHO empfiehlt. Laut der Weltgesundheitsorganisation sollte sich der Konsum von Zucker bei Erwachsenen auf ein Maximum von 50 Gramm pro Tag beschränken. Dieser Wert bezieht sich grundsätzlich auf alle Lebensmittel und umfasst damit ebenso zuckerhaltige Getränke wie Softdrinks, Nektare und Säfte, die laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) gleichzeitig den größten Zuckeranteil ausmachen. Noch besser wären laut WHO jedoch nur 25 Gramm Zucker pro Tag, da diese Reduktion zusätzliche gesundheitliche Vorteile mit sich bringt.
Auswirkungen von zu viel Zucker
Um die Problematik hinter einem zu hohen Zuckerkonsum zu verstehen, werfen wir kurz einen Blick auf die Verwertung der Kohlenhydrate im Körper. Mit der Nahrungsaufnahme gelangt Glucose in unseren Organismus. Das bewirkt, dass unser Blutzuckerspiegel im Blut steigt und der Körper gesunder Menschen darauf reagiert, indem Insulin von den sogenannten Beta-Zellen der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird. Sie transportieren den Zucker aus dem Blut in die Zellen und sorgen damit dafür, dass der Blutzuckerspiegel wieder gesenkt wird. Dies ist der physiologische Zustand unseres Körpers. Nimmt dieses System jedoch Schaden, so steigen die Werte im Blut entweder zu stark an oder fallen zu rapide ab, was für ein Ungleichgewicht im Stoffwechselvorgang sorgt. Das körpereigene Insulin kann die aufgenommene Glucose dann nicht mehr richtig aufnehmen und verwerten, sodass das Hormon von extern mittels einer Spritze zugeführt werden muss.
Konsumieren wir nun auf Dauer zu viel Zucker, so kann der Körper überbelastet werden, indem er chronisch Insulin produziert. Dies sorgt folglich für einen Anstieg von Entzündungen im Körper. Ferner führt es zu einem langfristigen Abschwächen der Leistung der insulinproduzierenden Zellen, da die Bauchspeicheldrüse Probleme damit entwickelt, genug Insulin für die Senkung des Blutzuckerspiegels bereitzustellen. Was folgt, ist ein ständig zu hoher Blutzuckerspiegel, den wir heute bei Typ-2-Diabetikern beobachten können.
Doch welche Zuckerarten können grundsätzlich und in hohen Mengen als entzündungsfördernd beschrieben werden? Da hätten wir einmal die Monosaccharide wie Glucose und Fructose, Disaccharide wie der typische Haushaltszucker, auch Saccharose genannt, und Zucker, die in verhältnismäßig natürlichen Lebensmitteln wie Honig, Sirupen, frisch gepressten Fruchtsäften und -konzentraten vorkommen. Zwar kann der Grundsatz „Je natürlicher, desto besser.“ nicht immer auf alle Lebensmittel und Menschen angewandt werden. In diesem Fall kann man sie jedoch durchaus als Leitlinie nutzen und ruhig einmal auf ein Stück Kuchen beim Bäcker verzichten.
Bestimmte Sorten echter Getreide
Bestimmte Proteine im Weizen können tatsächlich eine mögliche Ursache chronischer Entzündungen sein. Diese Proteine heißen Amylase-Trypsin-Inhibitoren (ATIs), welche im Darm zu Immunreaktionen führen und von dort aus allerdings noch in weitere Gewebe des Körpers ausschweifen können. ATIs sind in Pflanzen vorkommende Proteine, die den Zweck erfüllen, den Organismus zu schützen, indem sie Schädlinge abwehren. Am Beispiel von Insekten wie Mehlwürmern, Mehlkäfern und anderen Kornparasiten können wir beobachten, dass ihre Verdauungsenzyme gehemmt werden, womit die Pflanze bei der Entwicklung vor Fressfeinden geschützt wird. Außerdem helfen ATIs dem Organismus bei der Entwicklung des Samenkorns im Stoffwechsel. Interessanterweise machen diese Proteine nur etwa vier Prozent des Weizenproteins aus.





























