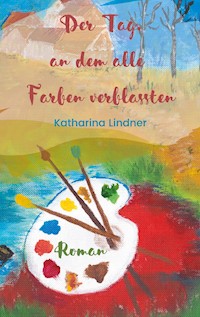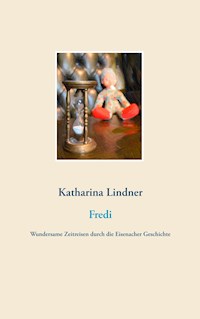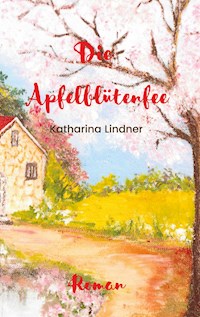
4,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Merle hat ein Haus von ihrer unbekannten Oma geerbt und sich von ihrem Mann getrennt. Sie möchte in der Fremde ein neues Leben beginnen. Obwohl sie freundlich empfangen wird, mag ihr das Loslassen ihres alten Lebens nicht recht gelingen. Merle fällt es schwer, auf eigenen Füßen zu stehen. Auf dem Gelände eines verfallenen Anwesens begegnet ihr die Baumnymphe Silvana, die verzweifelt ist, seit die Familie, die einst dort wohnte, wegzog. Mensch und Nymphe entschließen sich, die Körper zu tauschen: Silvana sucht fortan nach ihrer Familie, während Merle ihre Probleme hinter sich lässt. Doch als die Frau den Tausch rückgängig machen will, weigert sich die Fee, in ihren Baum zurückzukehren. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt und Merle braucht die Unterstützung der weisen Kräuterhexe Karsta, um nicht auf ewig in Silvanas Baum gefangen zu bleiben. Ein modernes Märchen, das die Frage nach dem Wert des eigenen Lebens stellt. Magisch, tiefsinnig, zauberschön!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1 – Merle
Kapitel 2 – Silvana
Kapitel 3 - Karsta
Kapitel 4 – Merle
Kapitel 5 - Karsta
Kapitel 6 – Silvana
Kapitel 7 – Merle
Kapitel 8 – Silvana
Kapitel 9 - Karsta
Kapitel 10 – Merle
Kapitel 11 – Silvana
Kapitel 12 - Karsta
Kapitel 13 – Merle
Kapitel 14 – Silvana
Kapitel 15 - Karsta
Kapitel 16 – Merle
Kapitel 17 – Silvana
Kapitel 18 – Merle
Kapitel 19 – Silvana
Epilog
Prolog
Vernunftbegabte Menschen glauben nicht an Feen und diesen ganzen esoterischen Firlefanz.
Wohl gibt es eine Menge Leute, die in Kirchen, Moscheen, Synagogen und anderen jahrtausendalten Gotteshäusern zu einem unsichtbaren Schöpfer beten, doch wenn das Gespräch auf Nymphen, Feen und Kobolde kommt, verziehen die Menschen halb milde, halb belustigt ihre Gesichter: Solche Geschichten sind etwas für Kinder. Und nur in Kinderzimmern finden sich Wesen, zumeist produziert von einer einfallsreichen Spielzeugindustrie, die in schreienden Farben oder zünftigem Pastell in den Regalen sitzen und die kindliche Fantasie ausbremsen.
Mit diesen Spielwaren aus Kunststoff haben echte Feen selbstverständlich nichts gemein. Echte Feen verfügen über keine Lobby in der aufgeklärten Welt und deshalb existieren sie offiziell nicht, ganz im Gegensatz zu ihren künstlichen Nachbildungen in den Spielzimmern gelangweilter Grundschulkinder.
Merle, die Vierunddreißigjährige, die von sich selbst sagt, sie treffe zielsicher jede Entscheidung ihres Lebens falsch, glaubte auch nicht an Feen.
Sie glaubte an gar nichts: nicht an einen Gott, nicht an das Schicksal, nicht an Tarotkarten, Schutzengel, eine Welt nach dem Tod oder den Sinn des Lebens. Auch nicht an Freunde, Familie, Selbstverwirklichung oder Erfüllung.
Alles was sie glaubte, war, dass morgens die Sonne auf- und abends wieder unterging. Und das tat sie auch nur, weil es unmöglich schien, diese deutlich erkennbare Tatsache zu verleugnen. Ansonsten trug Merle das Misstrauen gegen menschliche, tierische und sonstige Geschöpfe aller Art an jedem Tag ihres Lebens wie eine eigene Haut spazieren und verbaute sich damit so manche Erkenntnis, die vielleicht hilfreich und erfreulich gewesen wäre. Die Skepsis gegenüber allem steuerte sie durch den Alltag wie ein Segelboot: Nicht angenehm, weil einem ständig latent übel war, aber zuverlässig, und ein sicheres Gefängnis auf stürmischer See.
Zwischenmenschliche Inseln waren zu gefährlich, um sie anzulaufen, weshalb Merle sie bis auf wenige Ausnahmen grundsätzlich umrundete, ohne anzulegen. Sie musste so sein, sagte sich Merle selbst immer wieder, weil sie ohne Vater bei einer überforderten Mutter aufgewachsen war. Das Alleinsein lag ihr im Blut.
Über Feen und eine ernsthafte Diskussion ihrer Existenz hätte Merle den größten Teil ihres Lebens über herzhaft gelacht. Aber das war, bevor sie das bäuerliche Anwesen ihrer Oma erbte, in dessen unmittelbarer Nachbarschaft DER Apfelbaum stand. Es war, bevor sie der unglücklichen, sehnsuchtsvollen Nymphe Silvana begegnete, die unbedingt eine menschliche Gestalt besitzen wollte. Es war, bevor es Silvana – getrieben von ihrem innigen Wunsch, ein Mensch zu werden – gelang, Merle ihren Körper und ihr Leben zu stehlen.
Es war, bevor sie selbst ihre menschliche Identität verlor und zum Kampf rüsten musste, um die Fee zurück in ihren Baum zu sperren, und sich ihr Leben, das sie vorher als selbstverständlich und manchmal sogar als wertlos betrachtet hatte, zurückzuerobern.
Kapitel 1 – Merle
Ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, wenn das auch leider nicht sehr viel ist: Ich wollte dieses Haus nicht!
Weder war ich scharf auf das vollgestopfte Gebäude mit dem ganzen nutzlosen Krempel, noch auf das Schlafzimmer mit den Kiefernholzmöbeln aus den Siebzigern, in denen meine mir völlig unbekannte Großmutter wenige Wochen zuvor gestorben war. Ich wollte den verwilderten Garten nicht bestellen, aufhübschen oder auch nur ansehen. Ich wollte kein Dachbodengerümpel und keinen Kellerschrott, für den es einen Container brauchen würde, um ihn zu entsorgen. Ich wollte die moosigen roten Ziegel und die verwitterten schwarzen Klinkersteine nicht, die geblümten Gardinen an den ungeputzten Scheiben, das angelaufene Silberbesteck in der vollgekrümelten Schublade, die Stickdeckchen an den Wänden, die staubigen Gläser mit dem eingemachten, undefinierbaren Zeug in der Speisekammer. Ich wollte nichts davon!
Und am allerwenigsten wollte ich meinen Vater, den ich bis dahin nie zuvor getroffen hatte! Er enttäuschte mich, weil er genauso war, wie ich befürchtet hatte. Und weil er seinen Unmut darüber, das Grundstück samt Haus und Garten nicht selbst geerbt zu haben, an mir ausließ. Aber das kam erst später und es dauerte eine Weile, bis mir klar war, wie ich diesen Unmut ändern konnte. Zu dem Zeitpunkt konnte ich nichts mehr tun, um mein mir zufällig zugefallenes Eigentum zu schützen, denn ich steckte in dem verdammten Baum auf dem Grundstück gegenüber fest. Und da war es auch nicht mein Vater, den ich als Bedrohung empfand, sondern ein Wesen, dessen Existenz sich kein noch so fantasievoller Autor hätte ausdenken können, ohne dabei an der Realität zu scheitern.
Aber der Reihe nach, denn Märchen, selbst die echten, werden chronologisch erzählt. Auch die, in denen ein eigennütziges Zauberwesen dem Schriftsteller den Stift aus der Hand nimmt, um das Märchen selbst fertigzuschreiben.
Es war ein Abend Anfang April, als ich meinen Rollkoffer über den schon warmen Asphalt zog. Bereits kräftige Sonnenstrahlen fielen schräg durch die Äste der zumeist noch unbelaubten Bäume. Einige vorwitzige Bäumchen zeigten sich bereits mit einem zartgrünen Blätterflaum, während zahlreiche Sträucher ihre Blüten in voller Pracht entfaltet hatten. Gelb, weiß und rosa leuchtete es mir entgegen, während ich die Straße entlangging, die Handtasche um den Leib geschlungen, die Hand fest um den Koffergriff gekrallt. Den Taxifahrer, der mich am Bahnhof des kleinen Ortes mitten im norddeutschen Nichts abgeholt hatte, hatte ich gebeten, mich an der Kreuzung, die zu meinem neuen Zuhause führte, rauszulassen. Ich wollte erst mal die Lage checken. Vielleicht konnte ich bei einem vorsichtigen Blick über den Zaun sogar den Mann beobachten, bevor er sich mir als mein Vater offenbaren würde.
Ich stellte mir vor, dass er in Gummistiefeln und gestricktem Pullover in den noch leeren Beeten kniete und das Unkraut beseitigte, um die frischen Pflänzchen, die in einer Schubkarre neben ihm standen, einsetzen zu können. Er würde mich erblicken, aufsehen, sich die Handschuhe abstreifen und mich mit einem Lächeln und einer Umarmung willkommen heißen. Er würde nach altem Schrank, Gießkanne und Muttererde riechen und hätte eine dunkle Kappe auf dem Kopf, an dessen Rändern sich Schweißflecken abzeichneten.
Es war einer dieser Kleinmädchenträume, der sich mir bereits seit Jahrzehnten aufdrängte, ohne dass ich etwas dagegen tun konnte. Sie hatten sich nie erfüllt und mir war schon lange klar, dass sie dies auch nicht tun würden. Trotzdem konnte ich nicht damit aufhören, ihnen nachzuhängen.
Komisch, dass sich diese Vorstellung gerade jetzt so penetrant in mein Hirn schob, wo doch all meine übrigen Lebensträume, die nichts mit meinem Vater, aber doch viel mit Familie zu tun hatten, gerade in Rauch aufgegangen waren.
Ich gelangte zum Gartentor und verfluchte die klappernden Rollen des Koffers, die meine Ankunft verraten würden.
Das Gebäude war groß und unspektakulär. Dunkelrote Wände aus Klinkersteinen, die wie getrocknetes Blut wirkten. Ein rotes Dach, zwei Gaubenfenster im obersten Stockwerk, zwei Fenster im untersten, jeweils rechts und links der Tür. Die mittlere Etage besaß die meisten Fenster, sie lagen dicht an dicht und versprachen helle Räume, immerhin. Weiß gestrichene Fensterrahmen, alle Scheiben mit buntgemusterten Gardinen zugehängt. Die würde ich als erstes entfernen, wenn es mein Haus wäre, schoss es mir durch den Kopf. Eine Sekunde später fiel mir ein, dass es ja mein Haus WAR. Und es war in keinem besonders guten Zustand.
Das Gebäude wirkte zwar solide, aber ungepflegt. Es war deutlich zu erkennen, dass sich seit Jahrzehnten keine liebevolle und fachkundige Hand seiner angenommen hatte. Die Platten auf dem Gehweg zeigten unterschiedliche Höhen, als hätte sich der Boden bewegt wie eine kriechende Schlange. Sie wiesen außerdem abgeplatzte Ecken und grünen Bewuchs in den Fugen auf. Der Vorgarten versteckte sich hinter meterhohen Gebüschen und der Zaun aus altersschwachen Holzlatten wirkte wie ein windschiefes Gebilde, das ein Riese zufällig im Vorbeigehen hatte fallen lassen. Schräg hinter dem Haus sah ich einen baufälligen Schuppen, eine überdachte Veranda mit Klappstühlen, deren Polster über die Zeit verblichen waren und ein weites Feld, das sich auf Hunderte Meter erstreckte, aber nicht mehr zum Grundstück gehörte. Ein freundlicher und milder Mensch hätte das Anwesen liebevoll als „shabby chic“ bezeichnet.
Auf mich, die ich keinerlei Gespür für Kitsch und Romantik besaß, wirkte es verwahrlost. Hatte meine verstorbene Großmutter im Alter keine Kraft und Energie mehr besessen, um ihr Heim zu pflegen? Oder war es ihr nicht wichtig genug gewesen? Hatte sie auf die Meinung vorbeigehender Leute, die verständnislos mit dem Kopf schütteln, keinen Wert gelegt?
Ich hievte meinen Koffer über den unebenen Boden und atmete tief durch, als ich vor der Eingangstür stand. Ameisen und allerlei anderes Getier wuselten über den Stein und verlieh den dazwischen wuchernden Grasbüscheln den Eindruck geschäftiger Lebendigkeit. Ich strich mir das Haar zurück und fixierte die dunkelblau gestrichene Haustür einen Moment zu lang. Denn bevor ich den namenlosen Klingelknopf drücken konnte, wurde die Tür aufgerissen und ein braunes Augenpaar fing meinen erschrockenen Blick auf.
Der Mann, der mein Vater war, trug keine Gummistiefel, hatte keine Gießkanne in der Hand und roch auch nicht nach Erde. Er war in geschmackvolle Freizeitkleidung in hellen Tönen gehüllt. Das Polohemd in Himmelblau und die Cargohose in Sand gehörten ebenso einer höheren Preisklasse an wie die blitzende Uhr in Übergröße am Handgelenk und die schmalen Lederschuhe. Selbst sein Haarschnitt, dunkelbraun und ohne ein einziges graues Haar, wirkte teuer.
„Merle“, empfing mich der Unbekannte, der ausgesprochen attraktiv war, ganz im Gegensatz zu mir. „Da bist du ja.“
Ich nickte, weil ich nicht wusste, was ich sagen sollte. Ja, da war ich. Mit einem zerbeulten Rollkoffer, dessen Schloss nicht mehr zuverlässig hielt, einer Leggins mit abgeschabten Knien und einer schreiend bunten Tunika, die mir in Gegenwart dieses geschniegelten Herren unpassend vorkam. Er fragte mich nicht, wie meine Fahrt gewesen war oder wie es mir ging. Er wollte nicht wissen, ob ich gut hergefunden hatte, und er bat mich auch nicht herein. Er ließ nur die Tür weit offenstehen und kehrte mir den Rücken zu. Ich folgte ihm eingeschüchtert.
Das Innere des Hauses war dank vieler Fenster und einer strahlenden Nachmittagssonne lichtdurchflutet und das war sein Verderben. Denn obwohl ich von der Diele aus nur einen kurzen Einblick in die Küche zur Rechten und das Wohnzimmer zur Linken erhielt, fiel mir sofort allerlei Gerümpel ins Auge. Vollgestopfte Arbeits- und Kommodenflächen beherbergten allerlei staubigen Krimskrams, von Porzellanhunden über Bücher, Geschirr und Strickzubehör. Es gab keine freie und saubere Stelle. Selbst die Möbelfülle erschlug das überforderte Auge: Blumige Plüschsessel, mit Troddeln verzierte Lampenschirme, wild durch die Jahrzehnte gewürfelte Schränke, Stühle und Tische. Die Muster der Sofakissen passten nicht zu den Polstern, die Tischdecken wiesen neben hässlichen Verzierungen auch Flecken auf und die Gegenstände in diesem Haus wirkten, als hätte man sie besser auf drei Haushalte verteilt. Ich schluckte und sah mich um. Mein Vater, dem ich gefolgt war, wies mit einer Handbewegung auf die Couch.
„Ich bin Martin“, sagte er. „Nenn mich bitte so. Willst du was trinken?“
„Nein.“ Ich ließ mich vorsichtig auf dem Sofa nieder, das einen muffigen Geruch verströmte. Durchgesessene Federn, die es zum Knarren und Quietschen brachten, wenn ich mich bewegte. Daneben ein aufgeklappter Sekretär, auf dem sich Papiere stapelten und ein Füller ohne Hülle, der eingetrocknet war. Halbblinde Scheiben, davor diese unsäglichen Vorhänge, halb zugezogen. Scheußliche Ölgemälde in dunklen Farben an den Wänden. Abblätternde Blümchentapete in wildem Mustermix.
Augenblicklich sehnte ich mich nach der sauberen, reizarmen Wohnung, die in den letzten Jahren mein Zuhause gewesen war. Glas und Beton, Weiß und Grau, wenig Stoff, keinerlei Krempel. Es war nicht mehr mein Zuhause, erinnerte ich mich. Bei dem Gedanken daran kamen mir fast die Tränen und ich biss mir auf die Lippen. Mein Vater, oder vielmehr Martin, verbesserte ich mich, sollte nicht denken, dass ich ein schwaches, weinerliches Mäuschen war, das sein Leben nicht auf die Reihe bekam.
„Ich hab keinen Durst“ lehnte ich sein Angebot erneut ab, weil er schweigend betrachtet hatte, wie ich mich umsah und die Stirn runzelte. Er setzte sich mir gegenüber in den Sessel und stützte die Ellbogen auf die Knie.
„Gut“, sagte er, „es ist sowieso nichts zu trinken da. Zu essen auch nicht. Ich hoffe, du hast einen Snack dabei, sonst musst du dir im Supermarkt an der Hauptstraße was holen.“
Ich holte tief Luft. Natürlich hatte ich nichts dabei, ich hatte nicht mal vor Antritt der Reise heute Morgen gefrühstückt. Aber neben allen anderen Leidenschaften, die Menschen üblicherweise Vergnügen und Genuss bereiten, machte ich mir auch aus Essen eher wenig. Es diente zur Nahrungsaufnahme und die war eine gewisse Zeit entbehrlich.
Mein Vater schaute mich aufmerksam an. Was mochte er denken? Man hatte mir oft gesagt, ich sähe meiner Mutter ziemlich ähnlich: Zierlich, klein, blond mit ausdrucksstarken braunen Augen zeichnete mich ausgerechnet eine absolute Mittelmäßigkeit aus: Nichts an mir war besonders oder auffällig. Ich war eine Person, die nicht im Gedächtnis blieb, wenn man ihr auf der Straße begegnete oder im Rahmen einer Veranstaltung mit ihr sprach. Das hatte Vorteile, denn man konnte sich in der Masse verstecken und weckte keine Aufmerksamkeit, die man nicht haben wollte.
Bei meiner Mutter war es ähnlich gewesen. Bis zu ihrem Tod letzten Sommer war sie so blass und mager geworden, dass sie mehr ein ätherisches Wesen als ein Mensch zu sein schien. Sie erweckte Mitleid statt Bewunderung und verlor Stück für Stück ihren spröden Liebreiz, bevor sie ihrem Ende entgegen litt. Aber vor über dreißig Jahren musste mein Vater ja irgendetwas an ihr reizvoll gefunden haben.
Ich kannte keine Details, denn meine Mutter hatte sich bis zuletzt geweigert, mit mir über diese Zeit mit meinem Vater zu sprechen. Ich wusste nur, dass sie ihn verlassen hatte, als ich drei Jahre alt gewesen war, um in die nächstgelegene Großstadt zu ziehen und dort mit mir ein neues Leben anzufangen. Der Kontakt war abgebrochen, weil sie ihn verhindert und er sich nicht bemüht hatte. Eigene Erinnerungen an meinen Vater hatte ich keine.
Ich fragte mich nun, ob er sie – oder mich – in all den Jahren vermisst hatte. Und ob er sich darüber freute, dass ich hier aufgetaucht war.
Meine Antwort auf diese Frage bekam ich umgehend, und sie war nicht positiv:
„Du musst hier die Dokumente unterschreiben. Es ist nur ein formeller Akt. Die Sache ist rechtskräftig und ich werde nicht dagegen vorgehen. Obwohl ich es könnte.“ Er schob mir einen Aktenstapel zu und kramte in seiner Hosentasche nach einem Kuli, den er mir auf den Tisch warf. „Du bist jetzt Eigentümerin dieses schönen Grundstücks samt Haus. Übrigens mein Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin. Herzlichen Glückwunsch.“
Seiner Stimme entnahm ich, dass er mich nicht nur nicht vermisst hatte, sondern dass er mich sogar hasste. Sein Blick besagte, dass er mich am liebsten mit einem Strick am Treppengeländer aufgeknüpft hätte. Und wer konnte es ihm verdenken? Immerhin saß ich mir gerade auf SEINEM Erbe den Hintern platt, das mir völlig ohne Zutun in den Schoß gefallen war, während er leer ausging. Warum hatte meine Großmutter so entschieden? An seiner Stelle wäre ich wohl auch sauer gewesen. Hinzu kam, dass er sich an meine Mutter erinnert fühlen musste, die ihn vor Jahren hatte sitzenlassen.
Andererseits – was konnte ich dafür, dass seine Mutter ihn in der Erbfolge übergangen hatte? Oder dass meine Mutter sich gegen ein Leben mit ihm entschieden hatte? Beide Frauen hatten sicher ihre Gründe für ihre Entscheidungen gehabt und es stand mir nicht zu, darüber ein Urteil zu fällen.
Beim Gedanken an meine Mutter und an das Chaos, das mein eigenes Leben zu diesem Zeitpunkt darstellte, traten mir wieder die Tränen in die Augen. Die Unordnung und der Dreck im Raum trugen dazu bei, dass ich noch weniger Luft bekam, jedenfalls fühlte es sich so an. Ich atmete tief ein. Sollte ich auf diesen sarkastischen Kommentar antworten? Welche Floskel war angebracht? Ich hoffte, er würde bald gehen und mich in Ruhe lassen!
Zwischen seinen Brauen entstand eine Falte, als ich wortlos die Papiere ungelesen unterzeichnete und ihm den Kuli reichte. Es war warm im Zimmer und Staub tanzte in der Luft. Ein perfekter Tag, um sich die selbstgehäkelte, muffige Decke neben mir über den Kopf zu ziehen und die ganze Welt auszusperren. Einschließlich des verlorenen Ex-Mannes und des nie gekannten und nie vermissten Vaters, der sich als kaltherziges Arschloch entpuppte.
„Wie geht’s Doris?“ Nun gewann die Neugier doch die Oberhand. Und nicht nur die: Seine Lippen zitterten, er knetete sich nervös die Hände. Doris Stadler war ihm auch Jahrzehnte nach ihrem Weggang nicht gleichgültig.
„Tot“, quetschte ich hervor. Nannte keinen Zeitpunkt, erklärte keine Ursache. Das Schicksal meiner Mutter ging ihn nichts mehr an.
Sein Blick wurde starr. Es war, als fiele eine Klappe. Bevor das Gefühl dich vernichtet, musst du das Gefühl vernichten. Alles, was ich gerade noch zu erkennen geglaubt hatte – Sehnsucht, Schmerz, Zorn, Zuneigung – erstarb wie der Laut eines Radios, dessen Stecker gezogen wird. Martin hatte sich gut unter Kontrolle. Wie erwartet zeigte er die Anteilnahme eines Grönlandgletschers und negierte jegliche eigene emotionale Beteiligung.
„Ach“, antwortete er und verzichtete auf Beileidsbekundungen. Ich brauchte sie auch nicht, sie wären sowieso nicht ehrlich gemeint gewesen. Trotzig spähte ich durch das feine Haar, das mir wie ein Vorhang vor das Gesicht fiel.
„Du siehst aus wie sie.“
Ja klar, das musste ja kommen. Immerhin, dachte er wohl erleichtert, sah ich nicht aus wie ER. Bis auf die Augenfarbe verband uns nichts. Ich ging ihm gerade einmal bis zur Schulter und war in Körperbau und Gestalt sein genaues Gegenteil. Er war groß, kräftig und bewegte sich, als habe er einen Stock im Hintern. Ich war feingliedrig, schmal und zerbrechlich.
Allerdings war sein weltmännischer und fitter Auftritt auch ein Stück weit Fassade, denn seine Hautfarbe gefiel mir überhaupt nicht. Mit seinem gräulichen Teint unter der Sonnenbräune, den dunklen Augenringen und dem gelblich eingefärbten Augenweiß sah er aus wie ein Workaholic, der sich die Nächte um die Ohren schlug. Oder wie ein Kranker, der sich im Morgengrauen heimlich seine Dosis Medikamente aus der Klinik abholte, bevor er sein gewohntes Äußeres wie ein Superman-Kostüm überwarf und sich mit vorgegaukelter Kraft ins Alltagsleben stürzte. Oder wie ein Drogenabhängiger, der nach dem nächsten Schuss gierte und dem es nur unter größten Mühen gelang, das sorgfältig errichtete Selbstbild weiter aufrechtzuerhalten.
Was genau war es, was er verbarg? Weil meine eigene Lage so trostlos und traurig war, nahm ich mir vor, sein unangenehmes Geheimnis zu ergründen. Das würde mich ablenken. Und meinen Kopf beschäftigen, während meine Hände mit einer Million Griffe dafür sorgen mussten, dieses heillose Chaos hier zu beseitigen. Aber erst mal musste ich mich ausschlafen. Ausruhen, wegdämmern, aus der Realität flüchten. Martin loswerden.
„Ich wohne an der Hauptstraße über dem Gasthaus“, sagte Martin unwillig.
„Ist es deine Gaststätte? Bist du Kneipier?“ Erstaunt sah ich auf. Das passte überhaupt nicht zu ihm.
„Nein, ich bin Anwalt.“ Er sagte es in einem sonderbaren Ton, als sei ich geistig zurückgeblieben. „Die Gaststätte ist schon seit Jahrzehnten geschlossen. Ich habe das Gebäude gekauft, weil es billig war. Ich wohne darüber in einer kleinen Wohnung.“
„Und wo ist deine Kanzlei?“
„Nirgends.“ Ungeduldig, als sei es eine Zumutung, einem solch begriffsstutzigen Ding wie mir einen simplen Sachverhalt begreiflich zu machen, schüttelte er mit dem Kopf und schob die gefalteten Papiere in seine Tasche.
„Ich bin in Frührente.“
Kurze, knappe Ansagen. Bloß nicht zu viel verraten. Die ungeliebte, gegen den Willen heimgekehrte Tochter könnte ja auf die Idee kommen, brisante Informationen gegen ihn zu verwenden!
„Bist du krank?“ Bei meiner Frage regte sich kein Gefühl. Ich war nur neugierig. Wie ein Detektiv setzte ich die ersten Bröckchen zu einem Gebäck zusammen, von dem fraglich war, wie schmackhaft es war: Fahle Haut, gelbliche Augen, zittrige Hände plus Arbeitsunfähigkeit ergab etwas ziemlich Gravierendes. Und er hauste über der stillgelegten Kneipe? Konnte er sich nichts Besseres leisten oder war es eine Art Protest gegen seine eigensinnige Mutter, die offenbar sehr genau gewusst (und mitgeteilt) hatte, was sie wollte?
„Auch wenn es nicht so aussieht, das Haus ist vor einigen Jahren saniert worden“, wich er mir aus. „Die Heizungsanlage ist zuverlässig und auch sonst sollte alles funktionieren. Müll musst du neu anmelden. Und die Gebühren überweisen.“ Er deutete auf einen Zettel, den er für mich auf dem Tisch hatte liegen lassen.
„Ich wünsch dir viel Spaß beim Aufräumen“, ergänzte er in spöttischem Ton. „Meine Mutter war eine Sammlerin. Du wirst deine Freude an ihrem Besitz haben.“
Ja, das hatte ich auch schon gemerkt. Aber das machte nichts. Ein bisschen freute ich mich sogar auf das Räumen: Da ich ja nun keine Familie und auch keinen Job mehr hatte, fiel ich wenigstens nicht gänzlich in ein bodenloses Nichts.
„Hast du eigentlich gar keinen Mann?“, brummte Martin, als könne er meine Gedanken lesen. Missbilligung hatte den Spott abgelöst. „Kommst hier so ganz allein an mit deinem mickrigen Köfferchen? Ist das alles, was du besitzt? Hast es ja weit gebracht im Leben …“ Er zog die Nase kraus und deutete auf meinen Rollkoffer, den ich in der Tür hatte stehenlassen.
Ich schüttelte mit dem Kopf. Das war gelogen, denn ich hatte einen Mann. Aber es war auch wiederum die Wahrheit, denn der Mann war mir vor Kurzem abhandengekommen. Oder nicht?
Ich blickte selbst nicht mehr durch. Einzig die Tatsache, dass das Köfferchen meinen ganzen Besitz enthielt, entsprach den Fakten. Ich brauchte weder einen Umzugswagen noch muskulöse Helfer. Alles in unserem stylishen und sauberen Zuhause in der City gehörte Christoph, und selbst mein Job in einer Marketingagentur war an die Nähe zu meinem ehemaligen Zuhause und damit an meine Ehe gebunden gewesen. Und an die Beziehungen meines Mannes. Doch das vor meinem Vater zuzugeben war mir peinlich.
„Meine anderen Sachen kommen später“, behauptete ich deshalb. „Ich kann ja schlecht alles allein schleppen, noch dazu in einem Zug.“
Martin grinste. Grübchen erschienen neben seinen Mundwinkeln. Lausbübisch und frech sah er damit aus, doch das Äußere konnte nicht über seine spitze Zunge hinwegtäuschen:
„Die reiche Unternehmer-Ex lässt ihren Hofstaat erst später einfliegen. Dann wird das miefige Bett deiner Omi mit dem Rüschenhimmel ja wirklich eine neue Erfahrung für dich, wo du doch Schampus, Häppchen und seidene Laken gewöhnt bist.“
„Du hast mich im Internet gegoogelt.“
„Klar“, gab er zu. „Dich und deinen Mann. Wo ist der eigentlich abgeblieben? Du bist ja ziemlich verwöhnt worden und musstest wohl keinen Tag deines Lebens arbeiten. Oder bist du deinem Mann mit seinem erfolgreichen Start-Up ein bisschen zur Hand gegangen und hast ihm die lästigen, unbedeutenden Aufgaben abgenommen, während er das große Geld gescheffelt hat? Es war ziemlich dämlich, sich so abhängig zu machen. Spätestens in der Midlife-Krise erweist sich dieses Konstrukt für Frauen oft als ziemlich verheerend, wenn eine Jüngere daherkommt.“
„Ich arbeite nicht in der Firma meines Mannes und habe das auch nie getan“, gab ich empört zurück. Wollte sagen: Ich bin unabhängig. Aber das stimmte nicht. Mit Christophs Verlust war mir auch die Möglichkeit, meine berufliche Tätigkeit weiter auszuüben, genommen worden. Man kannte sich in der Branche und hatte mir mit dem Hinweis auf eine angespannte Auftragslage den festen Job unter dem Hintern weggezogen. Hin und wieder fielen noch Freelancer-Aufträge für mich ab, aber von einem stabilen Lebensumfeld konnte keine Rede mehr sein. Mein Vater hatte den Nagel auf den Kopf getroffen: Ich war arbeitslos. Und mannlos. Und heimatlos.
„Wir haben uns getrennt“, erklärte ich das unbedingt Nötigste. Er kommentierte diese Offenheit sofort mit einem nächsten Hieb:
„Soso“, sagte er. „Dann liege ich mit meiner Theorie, dass es schlecht ist, sich abhängig zu machen, ja gar nicht so falsch. Und nun, alles auf Anfang, aber ohne einen Cent in der Tasche? Da hast du ja schlechte Deals abgeschlossen, Töchterlein.“
Ich zuckte bei seinen Worten zusammen. Woher zum Teufel nahm er die Dreistigkeit, so mit mir zu sprechen? Ich wollte wütend und empört sein, aber alles, was ich empfand, waren Scham und Traurigkeit.
Ja, ich hatte ein paar falsche Abbiegungen im Leben genommen, aber rechtfertigte das solch zynische Worte? Zwar hatte keine Jüngere mich von Christoph getrennt, sondern es waren unsere mittlerweile unvereinbaren Lebensvorstellungen gewesen, doch schmälerte dieser Grund nicht meinen bodenlosen Schmerz. Erneut schlugen Wellen unterschiedlichster Gefühle über mir zusammen. Ich wollte dieses Haus nicht! Ich wollte diesen Vater nicht! Ich wollte nicht den Müll und das Gerümpel, das Grundstück oder dieses Gespräch! Auch Christoph wollte ich nicht mehr und meine Tätigkeit als sein kleines, in der Branche belächeltes Anhängsel! Alles, was ich wollte, war Ruhe und Frieden, eine Auszeit, um wieder zu mir selbst und meinen eigenen Bedürfnissen zu finden! Und eine Heimat.
Mir wurde klar, dass beides so schnell auch hier nicht zu finden war. Da ging mein Vater in den Flur und kam mit einer Hundeleine zurück.
„Mit dem Haus erbst du Mandy, die alte Trethupe. Sie ist noch bei mir, aber ich bringe sie dir morgen vorbei. Kümmere dich gut um sie, sie war der Augapfel meiner Mutter.“
Entgeistert starrte ich ihn an. Ein Hund? Ich sollte zwangsweise einen Hund adoptieren? Bitte nicht! Egal, ob groß oder klein, ob freundlich oder bissig, ob hübsch oder hässlich – ich mochte keine Hunde! Sie haarten, stanken und beanspruchten ständig Aufmerksamkeit! Kosteten Geld! Mussten erzogen werden! Machten Lärm! Pinkelten alles voll! Und wer zur Hölle nannte seinen Hund „Mandy“?
Meine fehlende Begeisterung war mir vermutlich anzusehen, denn Martin grinste wieder und zeigte erneut diese hübschen Grübchen.
„Sie ist gut erzogen“, sagte er in einem fast versöhnlichen Ton. „Sie ist ein liebes Geschöpf, du brauchst keine Angst vor ihr zu haben.“
„Ich hab keine Angst!“, fauchte ich, noch verärgert von seinen indiskreten und angriffslustigen Fragen. Den Folgesatz „Ich mag keine Tiere“, sparte ich mich, ohne genau zu wissen, weshalb.
„Dann ist es ja gut. Morgen kriegst du Mandy und die ganzen Unterlagen wegen der übrigen Dinge, die noch zu klären sind. Strom, Gas, Wasser. Solche Sachen.“ Martin drehte sich herum und hob die Hand zum Gruß. Er machte sich nicht die Mühe, mir einen Abschiedsgruß zuzurufen.
Als er weg war, sprang ich auf, um hinter ihm herzulaufen. Besser, ich klärte das mit dem Hund gleich! Es war doch eine prima Idee, wenn ER die Töle behielt und Muttis Augapfel einen geruhsamen Lebensabend in der kleinen Wohnung über der Kneipe bescherte! Aber etwas hielt mich zurück. Vielleicht war es mein Gewissen, das mir vorhielt, man dürfe sich aus einem Erbe nicht nur die Rosinen rauspicken. Vielleicht war es auch der uneingestandene Wunsch, die Wärme eines lebendigen Wesens zu spüren. Auch, wenn es stank und Geld kostete!
Ich verharrte jedenfalls auf halbem Wege und Martin war auch viel zu schnell davongeeilt, um ihn noch zu erwischen.
Es lohnt auch nicht, sagte ich mir, im Stillen längst voller Groll. Martin war nur ein weiterer Baustein meiner Brücke, die mitten in den Untergang führte. Jede Hoffnung, er oder dieses mir überraschend in den Schoß gefallene Zuhause würde mein Leben in irgendeiner Art bereichern, war zu Staub zerfallen. Es war ohnehin eine naive Kleinmädchenhoffnung gewesen. Nichts für eine Frau, die mit beiden Beinen mitten im Alltag stehen sollte.
Traf das auf mich zu? Ich blickte mich in dem Zimmer um, das voll von dem Gerümpel einer toten alten Frau war. Wie sollte ich es schaffen, diesen hässlichen, überfüllten Ort wohnlich zu gestalten? Und wollte ich das überhaupt? Es traf sich zwar glücklich, dass sich mir dieses Exil bot, weil ich mit meiner Trennung von Christoph auch mein Dach über dem Kopf verloren hatte und sowieso nicht gewusst hätte, wohin ich hätte gehen sollen. Aber dieses Haus war weit davon entfernt, ein Paradies werden zu können. Und mein Vater, der nun noch einzige lebende Verwandte, war alles andere als eine Familie, die mich auffangen, trösten und beschützen würde. Innerhalb weniger Wochen war das ganze Gebilde, das meinem Leben seine Struktur gegeben hatte, über mir zusammengestürzt, ohne dass ich etwas hätte dagegen tun können. Was blieb, waren ein kaltschnäuziger Erzeuger ohne jedes Interesse an Austausch und Nähe und eine Müllhalde mit vier Wänden und einem Dach.