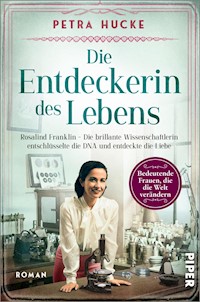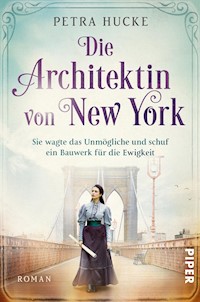
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Eine Frau, die aus Liebe zu ihrem Mann zur Heldin wurde New York, 1865. Die frisch verheiratete Emily Warren Roebling gerät in Panik, als sie und ihr Mann mit der Fähre im vereisten East River stecken bleiben: Es wäre nicht der erste folgenschwere Fährunfall. Doch die Passagiere kommen mit dem Schrecken davon. Wie gut, dass die Stadt endlich den Bau einer Hängebrücke genehmigt hat. Emily ahnt zu diesem Zeitpunkt nicht, dass sie diejenige sein wird, die diese kolossale Aufgabe zu Ende bringen muss. Denn ihr Mann, der Chefingenieur der Brooklyn Bridge, wird schwer krank. Sie übernimmt gegen erbitterte Widerstände die Führung der enormen und gefährlichen Baustelle. Sie will ihrem geliebten Mann zeigen, dass sie an ihren gemeinsamen Traum glaubt. Und der Welt beweisen, dass eine Frau ein Weltwunder schaffen kann.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Architektin von New York« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Lektorat: Dr. Annika Krummacher
Covergestaltung und -motiv: Johannes Wiebel | punchdesign
unter Verwendung von shutterstock.com und Richard Jenkins Photography
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht und dafür keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Teil 1
1 – Washingtons raue Hand …
2 – Männer in Arbeitskleidung …
3 – »Endlich bist du da!« …
4 – Am Nachmittag gingen …
5 – »Sydney, bleib stehen«, …
6 – Washington verlangsamte …
7 – Emily drückte Washington …
8 – Emily lag auf dem Bett …
9 – Thüringen. Emily spitzte …
10 – »Zwölf Pfund«, flüsterte …
11 – Während Emily und …
12 – Das Dampfschiff Maid …
13 – Der Frühsommer hielt …
14 – In Trenton begannen …
Teil 2
15 – Es war so schnell …
16 – Wash knotete sich …
17 – Stockdunkel. Höllendunkel. …
18 – Eine Woche in Cold …
19 – Zwei Wochen später …
20 – Die Zeitungen feierten …
21 – Der New Yorker Caisson …
22 – Es klopfte laut. …
23 – Die East River Bridge …
24 – Immer war sie bei …
25 – Bereits die Einladung …
Teil 3
26 – Nie hätte Emily gedacht, …
27 – Zu Hause wartete ein …
28 – In den nächsten Tagen …
29 – Ende November …
30 – Emily rieb sich müde, …
31 – Sammy kommt! Und er …
32 – Thomas Edison bekam …
33 – Im Juni fuhren sie nach …
34 – Emily drehte sich vor …
35 – Am 19. Mai wurden …
Nachwort
Teil 1
1
Manhattan, New York,Januar 1865
Washingtons raue Hand war das Einzige, was Emily warm hielt. Nach den vielen Stunden in der Kutsche war sie ausgekühlt, und die Knochen schmerzten von der unbequemen Sitzposition. Vielleicht war es doch keine gute Idee gewesen, gerade im Januar nach Long Island zu fahren, aber ihre Cousine Fanny war seit der Geburt ihres zweiten Kindes krank, und alle befürchteten das Schlimmste. In ihrer Kindheit hatten die beiden Mädchen ganze Sommer miteinander verbracht, und nun wollte sie sie unbedingt noch einmal sehen.
Erst vor einer Woche hatte Emily in ihrem Geburtsort Cold Spring mit Washington Augustus Roebling Hochzeit gefeiert. Es war ein schönes Fest gewesen: Washingtons Schwester hatte in der kleinen Backsteinkirche die Orgel gespielt, und den aufrichtigen Blick ihres Mannes, als er ihr ewige Liebe geschworen hatte, würde sie niemals vergessen.
Aber jetzt, allein mit ihm in der Kutsche, musste sie ein Lachen unterdrücken – denn ihrem eigentlich so attraktiven Mann stand im Schlaf der Mund offen. Wenn Emily seit ihrer Hochzeit eines erfahren hatte, dann, dass Wash überall schlafen konnte, selbst auf einer holprigen Landstraße. Das hatte er im Krieg gelernt. Schon nach einigen Meilen Fahrt hatte er ihre Hand genommen und war zufrieden eingeschlafen, so tief, dass sein Kopf hin und her schwankte und seine dunkelblonden Haare durch die Reibung am Stoff in alle Richtungen abstanden.
Dabei gab es draußen inzwischen so viel zu sehen! Längst hatten sie die endlosen, braunen Felder und die tiefschwarzen Baumskelette vor grauem Himmel hinter sich gelassen und die aufgescheuchten Krähen, die empört den klappernden Pferdehufen hinterherriefen. Nur der Hudson River begleitete sie treu auf der rechten Seite.
Mittlerweile hatten sie New York City erreicht, die größte Stadt Amerikas. Wenn man an einem trüben Tag wie heute den Kopf in den Nacken legte, hatte man den Eindruck, als würden die mehrstöckigen Gebäude bis in die Wolken reichen. An sonnigen Tagen hingegen grüßte einen dort oben ein knallblauer Himmel, der zu spotten schien: Und wenn ihr euch noch so anstrengt, mich werdet ihr nie erreichen.
Doch es gab immer wieder ehrgeizige Ingenieure und Architekten, die diese Herausforderung nur allzu gern annahmen. Die Insel Manhattan war klein, und mehr und mehr Menschen wollten hier leben. Ein stetiger Strom von Einwanderern kam aus Europa, ein Schiff nach dem anderen erreichte den New Yorker Hafen, in die Breite ging es nicht, also mussten sie in die Höhe bauen.
Ihr Wagen war im immer dichteren Verkehr langsamer geworden, und der arme Kutscher draußen auf dem Bock musste sich durch all die Karren und Karossen kämpfen. Emily beugte sich vor, um mehr zu sehen, ließ aber Washingtons Hand nicht los. Die Menschen hatten sich in lange, dicke Wollmäntel gehüllt, in die sich der Schmutz der Straßen eingeschrieben hatte, und eilten die Gehwege entlang, sprangen mit schlafwandlerischer Sicherheit auf die Straßen und wichen den Fuhrwerken aus. Sie selbst käme bestimmt sofort unter die Räder, dachte Emily, schließlich war sie in der Provinz aufgewachsen. Es war schon über drei Jahre her, dass sie auf dem Weg zu Fanny und ihrem ersten Neugeborenen ein paar Tage in New York verbracht hatte mit ihrer Mutter und ihrer Schwester.
Sie beschloss, Washington nun doch aufzuwecken. Er verpasste einfach zu viel. Noch einmal betrachtete sie ihn, die langen Wimpern, die drei Sommersprossen auf der Nase, die ihm auch im tiefsten Winter blieben, und seinen gepflegten Schnurrbart, der sie kitzelte, wenn er ihr etwas ins Ohr flüsterte oder sie küsste. Nichts war schöner, als von ihm geküsst zu werden. Überall. Ein wohliger Schauer durchlief sie.
Dann hob sie den Fuß und trat ihrem geliebten Ehemann vor das Schienbein.
Erschrocken fuhr er auf. »Sind wir schon da?«
Emily lachte auf und streichelte ihm über die glatt rasierte Wange. »Noch nicht, aber bald.«
»Ah, Manhattan«, sagte Washington mit einem Blick aus dem Fenster. Er beugte sich vor, um sich das Bein zu reiben, und sah sie vorwurfsvoll an. »Mrs Roebling, du bist die brutalste Frau, der ich jemals begegnet bin.«
»Tut mir leid. Das liegt nur daran, dass ich meine Füße nicht mehr spüre. Da fehlt mir das nötige Feingefühl.«
Er grinste. »Ein blauer Fleck wird mich schon nicht umbringen.«
Sag mir doch, liebe Emmie, hatte er ihr einmal aus dem Krieg geschrieben, was Liebe ist? Sich zu küssen, sich zu kitzeln, sich zu umarmen? Sind es Liebesbriefchen, oder wenn man sich gegenseitig unterm Tisch vor die Schienbeine tritt? Ich glaube, das muss es sein – die Schienbeine.
Er streckte sich und stopfte ihr die dicke Pelzdecke wieder um die kalten Füße. Die Wärmflaschen waren schon längst ausgekühlt. In diesem Moment ruckelte die Kutsche, und Wash musste sich festhalten. Die Pferde beschleunigten ihre Schritte.
»Schau, wir fahren einen Umweg über den Broadway. Hier ist es weniger eng.«
Emily kuschelte sich unter seinen Arm, und sie sahen gemeinsam nach draußen. So nah am Fenster spürte sie einen Luftzug und schnupperte.
»Pferdeäpfel«, sagte Wash.
»Kohle und Ruß«, ergänzte sie.
»Gekochte Kartoffeln.«
»Fleisch oder Wurst.«
»Abfall.«
»Achselschweiß.«
»Sauerkraut.«
»Die Atemluft von neunzigtausend Menschen.«
Die Stadt war immer wieder imposant, und mit Wash war solch ein Ausflug ohnehin etwas ganz Besonderes. Er sah Städte anders als die meisten Menschen, und ihr gefiel dieser Blick, der bis hinter die Fassaden drang.
Normalerweise schlenderten nachmittags viele junge Frauen über den Broadway und landeten letztendlich bei Tiffany’s. Sie gingen ins Theater und in die Oper und tranken Champagner – oder sie trafen sich im neuen Central Park, um auf dem gefrorenen See Schlittschuh zu laufen. Emily erinnerte sich, wie wunderbar es gewesen war, Hand in Hand mit ihrer Schwester auf dem eisigen Weiß dahinzugleiten, sodass die Schneekristalle knirschten und aufstoben. Bis es dunkel wurde und so kalt, dass nur noch eine dampfende Tasse heißer Schokolade am Rande der Eisbahn sie wieder aufwärmen konnte.
Derzeit allerdings war alles anders, und Emily meinte von der Sicherheit der Kutsche aus die Unruhe in den Gesichtern der Menschen lesen zu können. Der Sezessionskrieg war noch immer nicht entschieden, und die Menschen konnten ihre Freiheit nicht genießen, ja, schämten sich fast dafür. Während im Süden geschossen und getötet wurde, eilten sie hier weiter zur Arbeit und zum Einkaufen, doch sie taten es mit ernsten Mienen und dem Gedanken daran, dass sie sich erst vor zwei Jahren Lincolns Einberufung widersetzt und die Stadt mit Krawallen ins Chaos gestürzt hatten.
»Der Marble Palace«, murmelte Washington, »siehst du?«
Die Kutsche hielt an einer Straßenecke, und Emily konnte das helle Gebäude in Ruhe betrachten.
»Warst du schon mal drin?«, fragte sie.
»Nein. Aber angeblich gibt es dort wirklich alles.«
»Ein Kaufhaus …« Sie sprach das seltsame Wort langsam aus.
»Kurzwaren aller Art, fertig geschneiderte Kleidung, Kosmetik. Alles zu festen Preisen.«
»Und ist es wirklich aus Marmor?«
»Tuckahoe-Marmor aus Upstate. Siehst du die großen Fenster?«
»Ja.« Leider war die Weihnachtszeit schon vorbei, aber sie hatte gelesen, wie wunderschön die Schaufenster dann immer geschmückt waren, voller Lichter und winterlich dekorierter Waren. Vielleicht würde sie es sich nächstes Jahr ansehen können, wenn sie auf dem Weg zu einem vorweihnachtlichen Besuch in Cold Spring hier wieder vorbeikämen. Bis dahin würden sie in Cincinnati leben, wo Washington einen Auftrag für seinen Vater ausführen sollte. Sie war gespannt – so weit im Westen war sie noch nie gewesen.
Die Kutsche fuhr weiter, und Washington entdeckte schon das nächste interessante Gebäude.
»Was ist denn jetzt mit den Fenstern vom Marble Palace?«, hakte Emily nach. Wash öffnete den Mund, um ihr zu antworten, aber sie kam ihm zuvor. »Warte, ich glaube, ich weiß, worauf du hinauswillst. Die Fenster sind so groß, dass die Struktur dahinter sehr stark sein muss. Das Gebäude selbst kann also nicht aus Marmor sein.«
»Sondern?«
»Gusseisen?«, fragte sie nach einem kurzen Moment.
»Genauso ist es. Der Stein ist nur Fassade. Schau, siehst du die Baustelle da vorn?«
Emily reckte den Kopf. »Man erkennt nicht viel.«
»Noch nicht. Aber warte mal ein paar Monate. Das Haus soll ganze hundertdreißig Fuß hoch werden und einen Personenaufzug bekommen. Für eine Versicherungsgesellschaft.«
»Da sind die Wolken wirklich nicht mehr fern«, murmelte Emily.
Sie erreichten den Fähranleger an der Fulton Street, die drüben in Brooklyn unter demselben Namen weitergeführt wurde.
»Willst du in der Kutsche bleiben?«, fragte Wash, aber das Blitzen in seinen Augen zeigte ihr, dass er die Antwort schon kannte. Natürlich wollte Emily nicht sitzen bleiben. Sie wollte alles sehen, auch wenn die Überfahrt nur zehn Minuten dauern würde.
Steifgefroren kletterten sie aus der Kutsche. Trotz ihrer einundzwanzig Jahre fühlte Emily sich in diesem Moment wie eine achtzigjährige Urgroßmutter. Bald standen sie mitten in der Menschenmenge. Wash hielt ihre Hand, damit sie sich nicht verloren, und ließ sie nur kurz los, um ihr die Pelzmütze tiefer über die Ohren zu ziehen. Nach den langen Stunden allein in der Kutsche war es fast überwältigend, all diese fremden Gesichter um sich herum zu sehen, aus denen Atemwolken in die salzige Luft stiegen.
Sie hörte singendes Irisch und hartes Deutsch, das sie zwar nicht verstand, aber erkannte, weil Washingtons Vater, der vor über dreißig Jahren aus Preußen eingewandert war, in ihrer Anwesenheit einige Male Deutsch mit seiner Gattin gesprochen hatte. Sie hörte die böse Stimme einer Frau, die sich darüber empörte, dass der Boss ihr das Gehalt gekürzt habe, weil sie zwei Minuten zu spät gekommen sei, und dann den mitleidigen Chor ihrer Freundinnen, die solche Ungerechtigkeiten nur allzu gut kannten. Ein alter Mann summte vor sich hin. Er trug keine Mütze und hatte knallrote Ohren.
In diesem Moment teilten sich im Westen die Wolken und ließen die Strahlen der niedrig stehenden Sonne hindurch. Emily musste die Augen zusammenkneifen. Zwischen den Menschen konnte sie den East River zwar nicht sehen, aber das glitzernde Wasser tauchte die ganze Stadt in funkelndes Licht. Dann wurde der Laufgang auf das Dampfschiff der New York and Brooklyn Union Ferry Company geöffnet, Hunderte Passagiere bezahlten ihre zwei Cent, drängten sich an Bord und zogen das Ehepaar Roebling mit sich. Ein hochgewachsener Mann im feinen Mantel schob sich an Emily vorbei, sodass sie ins Stolpern geriet. Wash hielt sie am Arm fest.
»Finanzleute haben es immer eilig«, murmelte Wash mit Blick auf den Kerl, der sich mit hocherhobener Nase an weiteren Menschen vorbeidrängte.
»Wie furchtbar für ihn, dass er seine Zeit damit vergeuden muss, nach Brooklyn überzusetzen.«
Der alte Mann mit den roten Ohren drehte sich zu ihr um. »Und das ist nicht der Einzige, meine Dame. Die gesamte Wall Street fährt für ihren kurzen Nachtschlaf nach Brooklyn Heights. Früher kannte ich fast alle, die hier rüber sind, aber inzwischen sind wir zum Schlafsaal von Manhattan geworden. Jetzt wollen sie auch noch eine Brücke bauen.« Er schüttelte den Kopf. »Diese Schnösel werden uns überrennen.«
Emily kniff Wash durch den Mantel in den Arm.
»Wohnen Sie schon lange in Brooklyn, Sir?«, fragte der, als wäre nichts geschehen. Aber der Mann war schon verschwunden, um sich einen Platz in der Herrenkabine zu suchen.
»Ich hätte schon nichts gesagt, Em«, flüsterte Washington ihr ins Ohr. »Willst du rein ins Warme?«
»Meine Füße schon, aber ich möchte lieber draußen bleiben. Komm, wenn wir uns an die Reling stellen und du mich fest im Arm hältst, ist es warm genug.«
Sie schoben sich an der rechten Seite des Decks entlang, bis sie in der Mitte der Fähre standen. Schon legte das Schiff ab und tutete so laut, dass Emily die Vibrationen im ganzen Körper spürte. Die Sonne war noch ein Stück tiefer gesunken und brachte nicht nur das Wasser zum Funkeln, sondern auch zahllose Eisschollen, die sich drehten und verschoben wie in einem gemächlichen Tanz. Über den Lärm des Schiffs hinweg hörte sie nichts, aber die knirschenden, malmenden Geräusche des Eises kannte sie nur zu gut vom Hudson River in Cold Spring, wenn der Frühling kam. Manchmal kreischte er laut wie ein ruheloser Geist, an anderen Tagen saß ein Adler oder eine Robbe auf den großen Schollen und ließ sich flussabwärts treiben. Allerdings fuhren dort oben bei starkem Frost keine Schiffe, weil das Eis einfach zu gefährlich war und einen Bootskiel schnell zerquetschen konnte.
Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und beugte sich vor, sicher in Washingtons Armen. Was, wenn das Eis auch hier …
Noch bevor Emily ihren Gedanken zu Ende formuliert hatte, begann es zu knirschen, so laut, dass es den Motor und die Stimmen der Passagiere übertönte. Und es hörte gar nicht mehr auf, bis das Boot zum Stillstand kam.
»O Gott«, flüsterte eine Frau.
Alle hoben die Köpfe und blickten nach links und rechts. Die Türen zu den beheizten Innenkabinen wurden geöffnet.
»Wir stecken fest, oder?«, fragte Emily leise.
»Fürchte auch.« Washington zog sie noch ein Stück dichter an sich.
Emilys Zähne begannen zu klappern. Was, wenn das Schiff leckgeschlagen war? In dem eisigen Wasser würde niemand überleben. Ihr schossen Tausende Gedanken durch den Kopf. Vor Angst wurde ihr noch kälter, wie damals, als sie in einem See in der Nähe von Cold Spring eingebrochen war. Sie hatte nur überlebt, weil ihr dreizehn Jahre älterer Bruder GK sie beherzt an ihren beiden Zöpfen wieder aus dem Wasser gezogen hatte. Ein schreckliches Erlebnis – aber es hatte sie nicht davon abgehalten, am nächsten Tag wieder auf dem Eis herumzuschlittern. Allerdings durfte GK sie danach nicht mehr liebevoll an den Zöpfen ziehen wie früher. Er war ganz enttäuscht gewesen, als sie alt genug geworden war, um ihre Haare hochstecken zu dürfen. Stolz hatte Emily sich ihm präsentiert, als er vom Pionierkorps zu Besuch gekommen war.
»Wo ist meine kleine Schwester hin?«, hatte er gerufen. »Ich sehe nur eine fremde junge Dame.«
Und ein Jahr später hatte diese junge Dame ihn zum Second- Corps-Officers-Ball begleitet, wo er ihr Washington Roebling vorstellte, seinen Freund und Aide-de-camp, in den Emily sich trotz oder wegen seiner tapsigen Tanzversuche sofort verliebt hatte. Und nun stand Wash als ihr Mann neben ihr und würde mit ihr untergehen. Nein, er durfte nicht sterben! Auch wenn sie selbst auf den Meeresboden sinken würde – ihr Washington musste am Leben bleiben. Er hatte noch so viel vor. Wenn er sich zur Kutsche durchkämpfen und sich an eines der Pferde klammern könnte … Dann würde er es bis zum Ufer schaffen … Hektisch sah Emily sich um. Ihr Blick streifte den New Yorker Pier, und sie stutzte. Dann schloss sie die Augen und spürte, wie von tief unten im Bauch das Lachen aufstieg.
»Was ist denn so lustig?«, fragte Wash amüsiert.
»Ach, weißt du, ich hab uns schon alle sterben sehen. Elend erfroren. Und dann schaue ich zurück und sehe, dass wir noch so nah am Ufer sind, dass man wahrscheinlich einfach eine Leiter hinüberlegen könnte.«
Außerdem hatte sie sich gleich heldenhaft für ihn opfern wollen – nichts da, sie wollte gefälligst auch weiterleben.
»Der Wall-Street-Kerl mit seinen langen Beinen könnte sogar springen.«
Die anderen Passagiere hatten ebenfalls gemerkt, dass keine Gefahr bestand, außer dass sie zu spät zum Abendessen kommen würden. Emilys Magen knurrte auch schon vernehmlich.
»Weißt du, was eine gute Idee wäre?«, fragte sie nachdenklich.
»Was denn?«
»Wenn sie hier endlich eine Brücke bauen würden.«
Washington schnaufte, und sie legte ihren Kopf an seine warme Brust.
Ja, eine Brücke nach Brooklyn … Wenn nur Washingtons Vater, seines Zeichens erfolgreicher Ingenieur und beharrlicher Kämpfer für seine außergewöhnlichen Projektvorschläge, endlich den Zuschlag für seine kombinierte Hänge- und Schrägseilbrücke bekäme. Die Great Bridge, wie er sie ganz bescheiden nannte, stand ihm bereits fertig vor Augen.
2
Manhattan, New York, Januar 1865
Männer in Arbeitskleidung kletterten behände auf dem Schiff herum, starrten ins Wasser, als ob sie nach Walen Ausschau hielten, und schwangen sich zurück aufs Deck.
Wale mochte es hier durchaus geben, denn der East River war kein Süßwasserfluss, sondern ein oft schlecht gelaunter Meeresarm, der sich durch die Lower Bay und dann die Upper Bay verengte und östlich an Manhattan vorbeifloss. Wenige Meilen weiter nördlich wurde er wieder breiter und ging in den Long Island Sound über, an dessen äußerem Ende Fanny und ihr Mann George lebten. So aufregend Emily das Reisen auch fand – im Moment wäre es ihr lieber gewesen, schon in Montauk am knisternden Kamin zu sitzen.
»Es wird bestimmt noch eine Weile dauern, bis sie uns hier rausholen«, sagte Wash. »Komm, wir gehen lieber rein in die Kabine.«
»Hm.« Emily blieb stehen und verfolgte fasziniert, wie die Männer sich einen Überblick verschafften. Einer von ihnen winkte in Richtung Fahrerkabine, woraufhin ein Tuten ertönte und der Schornstein eine große, schwarze Rauchwolke ausstieß.
Im Handumdrehen hatten sie den New Yorker Pier wieder erreicht, und die Arbeiter vertäuten das Schiff. Unter den Passagieren hatte sich Empörung breitgemacht. Immer diese Fähren. Man konnte sich einfach nicht auf sie verlassen. Einige Leute machten Scherze, doch sie klangen bitter. Emily und Washington näherten sich langsam wieder dem Laufgang. Der Mann in dunkelblauer Uniform, der ihnen vorhin das Geld abgenommen hatte, gab es den Fahrgästen wieder zurück.
»Es tut mir leid, wir müssen erst auf den Eisbrecher warten.«
»Wie lang wird das noch dauern?«, fragte eine Dame.
»Eine Stunde oder zwei. Ich kann es nicht genauer sagen.«
»Gottverfluchter Kahn«, schimpfte ein Mann, und die Frauen sogen empört die Luft ein. Konnte er sich nicht ein bisschen gewählter ausdrücken?
»Es tut mir leid, mein Herr«, sagte der Uniformierte, »aber wir mussten rasch zurückfahren, damit wir nicht ganz stecken bleiben.«
»Eine gute Entscheidung, Sir«, sagte Washington und nahm das Geld in Empfang.
Auf der Landungsbrücke standen schon die nächsten Passagiere bereit und blickten den Rückkehrern verwundert entgegen. Emily und Wash warteten im Gedränge vor dem Fährgebäude, bis der Kutscher mit dem Wagen kam. Die Pferde waren müde und ließen die Köpfe hängen.
»Was machen wir jetzt?«, fragte Emily. »Wir haben doch das Zimmer in Brooklyn reserviert.«
Washington fuhr sich durch die Haare. Auch er sah plötzlich erschöpft aus. »Wir müssen uns hier etwas suchen. Ich glaube nicht, dass es heute noch etwas wird mit der Überfahrt. Und es wird immer kälter.«
Emily spürte ihre Füße inzwischen gar nicht mehr und konnte sich nicht vorstellen, hier noch länger herumzustehen und abzuwarten, ob die Fähre wieder fuhr. Es war schon fast dunkel. Washington und der Kutscher beratschlagten sich.
Sie nieste.
»Gesundheit«, wünschte der arrogante Mann von vorhin im Vorübergehen.
»Danke«, sagte Emily verdattert.
Er blieb stehen und lächelte. »Sie wollten auch rüber?«
»Ja.«
»Sind Sie allein?«
Emily spürte, wie Washington neben sie trat.
»Ah, Sie haben Begleitung«, sagte der Mann.
»Roebling«, sagte Wash. »Guten Abend.«
Emily glaubte, einen besitzergreifenden Unterton herauszuhören, und musste schmunzeln. Sie war ja jetzt verheiratet, offiziell Eigentum ihres wunderbaren Mannes, und da gehörte es sich nicht mehr, mit fremden Herren zu sprechen. Nicht, dass es sich vorher gehört hatte als junges, unverheiratetes Mädchen ihrer Kreise. Anders als die Roeblings waren die Warrens nicht gerade reich, aber in Cold Spring hochgeschätzt.
»Thomas Kinsella, sehr erfreut.« Eigentlich wirkte der Mann gar nicht so arrogant. »Hören Sie, ich kenne da eine Pension, in der ich manchmal übernachte, wenn es zu spät ist, um nach Hause zu fahren. Nicht weit von hier, in der Liberty Street.«
»Das ist sehr freundlich.« Washington wollte ihn offenbar abwimmeln.
»Möchten Sie mit uns fahren?«, fragte sie stattdessen schnell.
Thomas Kinsella deutete eine Verbeugung an. »Wenn es keine Umstände macht. Sehr gern.«
Zu dritt war es in der Kutsche doch etwas eng. Thomas Kinsella saß ihnen gegenüber und spähte aus dem Fenster. Er hatte dem Kutscher den Weg beschrieben und lehnte sich beruhigt zurück, als er merkte, dass der sich an seine Anweisungen hielt. Seine langen Beine nahmen den ganzen Raum zwischen ihnen ein.
»Was bringt Sie nach New York?«, fragte er.
»Wir sind nur auf der Durchreise«, sagte Emily. »Wir besuchen Verwandte in Montauk.«
Er schob die Hände in die Manteltaschen. »Ich hoffe doch, dass Sie in der Eiseskälte nicht noch den ganzen Weg fahren wollten.«
»Nein, wir hatten eine Unterkunft in Brooklyn.«
Washington schwieg. Die lockere Fröhlichkeit, die zwischen ihnen herrschte, wenn sie allein waren, war verschwunden. Zur Beruhigung schob Emily ihren Arm unter seinen. Ob sie wohl bald da waren? Sie wusste nicht, wie weit es bis zur Liberty Street war, sie hielten immer wieder an und ruckelten dann weiter. Eine Gaslaterne blickte durchs Fenster herein und verschwand wieder.
»Brooklyn ist ein ganz wunderbarer Ort«, sagte Thomas Kinsella. Man sah kaum noch etwas, und seine fast träumerische Stimme schien aus dem Dunkel zu kommen. »Ich muss wegen der Arbeit oft nach Manhattan und liebe die Aufregung hier, die Hektik und Emsigkeit. Ich bin übrigens Reporter. Beim Brooklyn Eagle.«
»Ach, wirklich? Wir dachten …«
»Was dachten Sie?«
»Dass Sie an der Wall Street arbeiten.«
Er lachte tief aus dem Bauch heraus. »Um Himmels willen, nein! Das Kapital und ich, wir pflegen keine allzu enge Freundschaft. Oder besser: Die Kapitalisten, die sich auf Kosten von anderen die Taschen vollstopfen, und ich, wir pflegen keine allzu enge Freundschaft. Aber ich muss gestehen, ich trage gern einen guten Mantel.« Schemenhaft sah sie, wie er über den Wollstoff strich. »Auch wenn ich noch so gern in Manhattan bin, fühle ich mich doch in Brooklyn am wohlsten, bei meiner Frau und den Kindern. Da ist noch alles anders. Wie früher im Dorf, wo einen alle kennen. Haben Sie auch Kinder?«
Emily selbst war als Zweitjüngste von sechs Geschwistern groß geworden und wollte einen ganzen Haufen Kinder. Am besten sofort. Wash hatte drei Brüder und drei Schwestern, die allesamt jünger waren, und wollte auch gern eine Familie gründen, aber, so viel wusste Emily schon, er hatte keine leichte Kindheit gehabt, und es gab wohl noch einiges, was er ihr nicht erzählt hatte.
»Geben Sie uns noch ein bisschen Zeit«, sagte sie munter, als Wash weiter schwieg. »Wir haben erst letzte Woche geheiratet.«
»Meinen herzlichen Glückwunsch, Mrs … Entschuldigen Sie meine Unhöflichkeit, aber ich kann mir Namen einfach nicht merken. Keine gute Sache in meinem Beruf.«
»Emily Warren Roebling.«
Thomas Kinsella schwieg kurz und fragte dann: »Haben Sie etwas mit John A. Roebling zu tun?«
»Das ist mein Vater«, sagte Wash.
»Ah.« Kurz herrschte Schweigen, nur von draußen hörte man Stimmen und ein lautes Lachen. »Nun, Mr Roebling wird ja dann bald dafür sorgen, dass die Fähren nicht mehr benötigt werden. Eine Brücke wird wohl nicht so leicht zufrieren.«
»Oh, das kann man so nicht sagen.« Washington setzte sich aufrechter hin. »Natürlich werden Sie auf einer Brücke nicht zwischen Eisschollen stecken bleiben, aber es kann sich überraschend schnell eine ganz beachtliche Eisschicht bilden, insbesondere in den salzigen Winden des East River. Außerdem muss man beim Bau der Pylone und bei der Wahl des passenden Materials die Kraft des Eises und die Auswirkungen von Wasser und Kälte bedenken.«
Emily lächelte im Dunkeln. Ihr Wash war nicht gut darin, mit Fremden zu plauschen, aber mit Brücken kannte er sich aus. Ganz der Vater, auch wenn er das nicht hören wollte.
»Sind Sie auch Architekt?«, fragte Thomas Kinsella.
»Ingenieur«, sagte Wash. »Ich habe am Rensselaer Institute in Troy studiert.«
Der Kutscher hielt an und klopfte an die Tür. Wash stürzte geradezu hinaus, vermutlich um nicht länger mit dem fremden Mann auf so engem Raum gefangen zu sein. Die von Thomas Kinsella empfohlene Pension war in einem zweistöckigen Gebäude untergebracht. Es war so alt, dass Emily den Eindruck bekam, es würde nur noch von den links und rechts angrenzenden Häusern aufrecht gehalten. Doch im Inneren war es sehr gemütlich. Über dunkle Stufen wurden sie nach oben geführt.
»War nett, Ihre Bekanntschaft zu machen«, sagte Thomas Kinsella, dessen Zimmer gleich neben der Treppe lag. Sie reichten sich kurz die Hände, und während Wash nebenan schon die Tür ihres Pensionszimmers öffnete, hörte Emily, wie Thomas Kinsella murmelte: »Überraschend nett. Bei dem Vater.«
Bestürzt sah sie ihn an, aber er zwinkerte ihr nur kurz zu und verschwand.
Mit einem Stöhnen ließ Emily sich aufs weiche Bett fallen und schloss die Augen. Ein Feuer brannte, und es war wunderbar warm. Wash kniete sich vor ihr hin, schnürte ihre Stiefel auf und zog sie ihr von den Füßen. Dann drehte er Emily vorsichtig um und löste die Bänder und Ösen ihres Kleides. Kurz musste sie doch noch aufstehen, damit er ihr es abstreifen konnte. Als er die Bettdecke anhob, damit sie im Unterkleid darunterschlüpfen konnte, klopfte es, und sie hörten die leise Stimme der Gastwirtin. »Heißes Wasser für Sie.«
Emily blieb zwischen den Laken liegen, die dufteten, als wären sie in einem frischen Wind getrocknet worden, während Washington den Wasserkrug dankend im Empfang nahm und auf dem Waschtisch abstellte. Emily dämmerte schon weg und verlor sich in einzelnen Traumfetzen – das glitzernde Eis auf dem Fluss, die Krähen über den Feldern, das Bett schwankend im Rhythmus der Kutsche.
Ein Plätschern holte sie wieder zurück in das halbdunkle Pensionszimmer. Wash stand vorgebeugt am Waschtisch, den Rücken zu ihr. In der Rechten hielt er einen Krug, aus dem er sich dampfendes Wasser über die linke Hand laufen ließ, bis die Schüssel voll war. Dann goss er es zurück in den Krug, nahm ihn in die Linke und ließ das Wasser über die rechte Hand fließen, bis die Schüssel wieder voll war.
Emily beobachtete ihn verwundert. Ihr fiel ein, dass sie ihre Frisur noch gar nicht gelöst hatte. Sie setzte sich auf, zog die Nadeln heraus und spürte die schweren Haare auf den nackten Schultern.
Wash nahm das Seifenstück zwischen die Hände, rubbelte, bis Schaum entstand, und legte es wieder zur Seite. Eine halbe Ewigkeit lang reinigte er sich die Hände, jeden Finger einzeln, fuhr um die Nägel herum, rieb die Handflächen aneinander, dann die Handrücken. Die Seifenflüssigkeit tropfte in die Waschschüssel.
»Wash?«
Ihr Mann hielt inne.
»Kommst du ins Bett?«
Nach einem kurzen Schweigen tauchte er die Hände ins Wasser, ließ sie abtropfen und trocknete sie dann an dem weißen Handtuch ab. Sorgfältig hängte er es wieder auf.
Als er sich neben sie legte, schmiegte sie sich an ihn. Er schloss die Arme um sie, und sie spürte seine heißen Hände an ihrem Rücken. Was war das nur für ein seltsames Ritual gewesen? Aber bevor sie ihn danach fragen konnte, war sie eingeschlafen.
3
Montauk, Long Island, Januar 1865
»Endlich bist du da!« Mühsam richtete Fanny sich auf der Chaiselongue auf und streckte ihre dünnen Arme aus. In zwei Schritten war Emily bei ihr. Am liebsten wollte sie die Cousine fest an sich drücken, aber schon bei der leichtesten Berührung spürte sie Fannys Rippen unter dem losen Wollkleid. Schnell blinzelte sie die Tränen weg, zwang sich zu einem Lächeln und sprang auf.
»Das hier ist mein Washington.« Sie schob ihn auf Fanny zu. Ihre Cousine war blass, aber die Augen funkelten fröhlich, während sie Wash einige Sekunden lang gespielt streng musterte – war er ein würdiger Gatte für Emily? Sie kam wohl zu einem positiven Ergebnis, denn sie streckte die Hand aus, und Washington berührte sie vorsichtig.
»Ich bin doch nicht aus Zucker.« Fanny schien kräftig zuzudrücken, woraufhin sich Washingtons Gesicht öffnete und er grinste.
»Herzlich willkommen im schönen Montauk«, sagte George. »Ich hoffe, ihr seid auf dem Weg nicht erfroren.«
»Unsere Pensionswirtin hat uns die Wärmflaschen gefüllt und uns für die Kutsche einen verbeulten Eimer mit heißen Kohlen gegeben, auf die wir die Füße stellen konnten.«
»Oh, wie geschickt! Das müssen wir uns merken.« Fanny richtete den Blick kurz zur Decke, als wartete sie, dass ein Schwindel vorbeiging. Sie hatte sich aufgerichtet, doch George setzte sich gleich neben sie, damit sie nicht etwa auf die Idee kam aufzustehen.
Vorhin an der Tür hatte er gesagt, im Moment gehe es Fanny ganz gut. »Vor allem, weil ihr geliebtes Cousinchen zu Besuch kommt.« Er hatte Emily dankbar die Hand auf den Arm gelegt. »Der Arzt war heute früh hier und klang zum ersten Mal seit Langem nicht völlig hoffnungslos. Sie soll trotzdem liegen bleiben und sich keinesfalls anstrengen.«
»Du selbst siehst aber auch müde aus«, hatte Emily gesagt. Natürlich. Neben dem Neugeborenen gab es ja auch noch den dreijährigen Sammy, und George machte sich große Sorgen um seine Frau.
»Sammy ist ein Wirbelwind und nur noch aufgedrehter, seit das Baby da ist. Die beiden halten mich auf Trab.«
»Wo ist er denn? Schläft er?«
George hatte leise gelacht. »Nein, der wehrt sich mit Händen und Füßen dagegen, schlafen zu müssen. Wieso sollte er sein Leben im Bett vergeuden? Er ist mit den größeren Nachbarskindern draußen beim Spielen, aber müsste gleich reinkommen.«
Dann waren sie in die Stube getreten. Emily sah sich neugierig um. Da, neben dem Kamin, stand die Wiege.
»Das ist unsere Charlotte.«
Emily beugte sich über die Wiege. Mit den vielen weißen Rüschen an der Bettwäsche sah das Baby aus, als ob es in einer Wolke liege.
»Acht Wochen«, sagte der Vater leise, aber unüberhörbar stolz, »zweiundfünfzig Zentimeter, nach dem Füttern schwer wie ein Sack Kartoffeln, blaue Augen, zehn Zehen, zehn Finger.«
Acht Wochen, und Fanny blutete noch immer.
»Das ist es doch wert, oder?« Emily fuhr zusammen, als sie die Stimme ihrer Cousine so dicht hinter sich hörte. Sie war nun doch aufgestanden, gestützt von Wash. »Schau sie dir an, unser kleines Wunder. Unser zweites kleines Wunder. Willst du sie halten?«
»Nur, wenn du dich wieder hinsetzt.«
Folgsam kehrte Fanny mit Wash zur Chaiselongue zurück. George hob das winzige Bündel aus der Rüschenwolke, und Emily setzte sich zwischen Fanny und Wash. Dann streckte sie die Arme aus und nahm das Baby in Empfang. Staunend betrachtete sie es. Charlotte hatte überraschend viele dunkle Haare. Ein paar dunkle Locken spitzten unter dem Mützchen hervor. Plötzlich blinzelte das Baby und öffnete seine tiefblauen Augen.
Emily schaute verstohlen zu Wash und stellte fest, dass er sie voller Liebe anblickte. Falls es möglich gewesen wäre, hätte sich ihr Herz noch weiter geöffnet. Bald, schien er ihr zu versprechen.
Von draußen erklang ein Lachen und Rumpeln. Kurz war das Heulen des Windes zu hören, der die Fenster klappern ließ, dann wurde die Haustür wieder geschlossen. Plötzlich schien die kleine Welt wieder größer. Da draußen war das Meer! Emily konnte es kaum erwarten, gleich morgen früh an den Strand zu gehen. Wenn sie nur Fanny mitnehmen könnte, um wie früher gemeinsam mit ihr nach Muscheln und Krebsen zu suchen. In ihrem Mädchenzimmer in Cold Spring lag eine ganze Reihe ihrer geliebten Sanddollars aufgereiht, die sie holen würde, sobald sie wusste, wo sie endgültig leben würden.
»Mommy!« Sammy kam auf Socken, aber mit Mütze und Schal hereingetapst, gefolgt von einem größeren Jungen, der sich kurz an die Schläfe tippte und wieder verschwand.
»Danke, Micky«, rief George ihm hinterher.
Mitten im Laufen blieb Sammy stehen – mit offenem Mund starrte er die beiden fremden Menschen an. Emily hockte sich hin und lächelte ihm zu, aber er rannte an ihr vorbei und kletterte seiner Mutter auf den Schoß, die ihm die Mütze auszog und einen Kuss auf den wilden, dunklen Schopf drückte.
»Das sind deine Tante Emily und dein Onkel Washington.«
»Hallo, Sammy«, sagte Wash, und aus der Sicherheit der mütterlichen Arme grinste Sammy sie nun doch an.
»Setzt euch doch bitte.« George wies auf die Sessel, in denen Wash und Emily es sich bequem machen sollten. »Ich mache euch einen Tee.«
Er humpelte in die Küche. Fanny blickte ihm nach. Nicht nur er schien sich Sorgen um sie zu machen, umgekehrt galt es genauso.
»Wie geht es ihm?«, fragte Emily vorsichtig.
Fanny verzog das Gesicht und hob die Schultern, aber als Sammy zu ihr aufblickte, lächelte sie plötzlich. »Gut geht es ihm. Wir sind froh, dass wir ihn hier haben. Er kümmert sich um uns und macht sogar Tee.«
Emily schämte sich – sie hätte vor dem Kleinen nicht nach der Kriegsverletzung seines Vaters fragen sollen. Schließlich bekam Sammy ja schon mit, wie schlecht es seiner Mutter seit der Geburt des Schwesterchens ging.
Später, als Sammy endlich im Bett lag, saßen sie zu viert um den Kamin, unterhielten sich, sahen eine Weile schweigend den Flammen zu und sprachen weiter. Emily hielt Washingtons Hand in ihrem Schoß und spielte an seinem Ehering herum. Wash wirkte zufrieden, die Anspannung der Reise schien von ihm abgefallen zu sein.
George knetete sein Bein kurz über dem Knie. Er hielt es ausgestreckt und rutschte hin und wieder auf dem Sessel herum. Als er aufstehen wollte, um das Feuer zu schüren, kam Washington ihm zuvor. George hievte sich dennoch hoch und stellte sich neben ihn an den Kamin, mit einem Ellbogen am Sims abgestützt.
»Da stehen unsere beiden Männer«, flüsterte Fanny. »George und Washington.«
Emily kicherte. »Sehr präsidentiell.«
»Unsere beiden Gründerväter.« Fanny prustete los.
Im flackernden Licht sah es so aus, als hätte sie wieder ein wenig Farbe im Gesicht. Würde sie doch noch gesund werden? Emily wollte alles dafür tun, dass es ihr wieder besser ging, und entschied kurzerhand, dass sie eine Weile bleiben würden.
Noch am selben Abend schrieb Washington auf ihr Drängen einen Brief an seinen Vater und einen zweiten an seinen Stellvertreter in Cincinnati, einen Mr Lamb, der keineswegs so lammfromm war, wie sein Name vermuten ließ, sondern derbe Witze und Wortspiele liebte. Wash verstand sich gut mit ihm und hatte ihn sogar zur Hochzeit eingeladen, wo er sich mit seinen Scherzen weitestgehend zurückgehalten hatte. Nur ein paar schlüpfrige Anmerkungen hatte er gemacht, mit denen er nicht ganz danebengelegen hatte. An jenem Tag war nämlich nicht nur die Hochzeit von Wash und Emily gefeiert worden, sondern auch die Heirat von Emilys Bruder Edgar und seiner Verlobten. Deren Kleid war sicherheitshalber erst kurz vor dem großen Tag fertig geschneidert worden. Offiziell hieß es, man könne in Kriegszeiten keine zwei großen Feste feiern, aber da Emilys Kleid ein halbes Vermögen gekostet hatte, war dieser Grund nicht besonders überzeugend. Und Cornelia war unübersehbar in anderen Umständen gewesen.
Während Mr Lamb sich darüber lustiggemacht hatte, fand Emily das trotz ihrer katholischen Erziehung nicht weiter tragisch. Washington war bis kurz vor der Hochzeit noch in der Armee gewesen, und von Briefen wurde man nicht schwanger, aber wer weiß, was sonst geschehen wäre. In den wenigen Nächten, die sie im selben Haus verbracht hatten, waren sie auch öfter über den Flur geschlichen.
Washington hatte ihr gleich zu Anfang gestanden, dass er es mit der Religion nicht so hatte.
»Die Roeblings sind leider gewaltige Heiden«, hatte er gesagt. »Wir haben uns nie für irgendeinen Glauben interessiert, aber es ist gewiss ganz gut, wenn wir zwei ab und zu mal in die Kirche gehen, damit die Nachbarn beruhigt sind. Meinetwegen auch zu den Katholiken.«
»Glaubst du denn gar nichts?«
»Der Spiritismus gefällt mir, auch wenn die Nonnen aus deiner Klosterschule mich wahrscheinlich einen Häretiker schimpfen würden.«
Am nächsten Morgen wachte Emily auf, sobald es draußen hell wurde. Das Gästezimmer von Fanny und George war nicht viel größer als eine Abstellkammer, aber sie hatte gut geschlafen. Sie kuschelte sich an Washingtons Rücken und spürte seinen Atemzügen nach. Als sie die Decke noch ein Stück höher ziehen wollte, weil ihr Nacken kalt wurde, bewegte Wash sich.
»Wollte dich gar nicht aufwecken«, flüsterte sie.
»Ach, so wache ich aber gern auf.«
Sie drückte sich fest an ihn. Jetzt konnte geschehen, was geschehen sollte, und kein Skandal würde folgen. Es dauerte tatsächlich eine ganze Weile, bis sie aus dem Bett kamen, aber schließlich stand Emily auf. »Wir müssen unbedingt an den Strand. Ich kann das Meer riechen, du auch?«
Gleich nach dem Frühstück zogen sie sich an. George gab Washington eine dicke Wolljacke, Emily lieh sich eine von Fanny und zog sie unter den Mantel.
»Geh ruhig mit, George«, sagte Fanny. »Aber Sammy bleibt hier, er hat sich gestern einen Schnupfen geholt.«
George zögerte und stieg dann doch in seine Stiefel. Es war nicht mehr ganz so windig wie am Tag zuvor. Linkerhand lag ein großer, wintertrüber See mit ein paar Möwen darauf. Nach zwanzig Minuten erreichten sie die Dünen und schlängelten sich zwischen ihnen hindurch zum Wasser hinunter.
Das Meer! Emily atmete einige Male tief ein und wollte gleich darauf zulaufen, bis sie mit den Schuhspitzen das Wasser berührte. Doch George musste sich konzentrieren, um auf dem unzuverlässigen Untergrund nicht ins Stolpern zu kommen. Emily versuchte ihn mit Kommentaren über das schöne Wetter abzulenken, aber er konnte kaum auf sie eingehen.
Schließlich blieb er stehen. »Verdammtes Bein«, sagte er.
»Verdammter Krieg«, erwiderte Emily. »Hoffentlich ist er bald vorbei.«
Es schien zumindest so. Washington hatten sie ja auch schon entlassen, er war unverletzt geblieben, trotz des furchtbaren Blutbads in Gettysburg, das er miterlebt hatte.
»Ein paar Monate gebe ich ihnen noch«, sagte George.
»Kannst du denn arbeiten?«
George schüttelte den Kopf und zog das Kinn tiefer in den Schal, wie eine Schildkröte, die sich verstecken wollte. »Ein Fischer ohne zwei funktionierende Beine ist kein Fischer. So kann mich niemand mehr gebrauchen.« Er wandte sich zum Wasser, die Hände tief in den Taschen. »Wenn man von hier lossegelt, kommt man erst in Europa wieder an Land.«
»Möchtest du dahin?«, fragte Emily. Sie hatte immer gedacht, gerade Fischer, die viele Tage oder Wochen auf dem weiten Meer verbrachten, fühlten sich besonders an ihre Heimat gebunden. Deswegen war Fanny auch mit ihm hergezogen, nachdem sie die Warren-Sippe davon hatte überzeugen können, dass sie wirklich so weit unter ihrem Stand heiraten wollte. Das Häuschen in Montauk hatten sie von Fannys Geld gekauft.
»Aufregend wäre es schon«, sagte George. »Aber wahrscheinlich muss ich mich Richtung Land orientieren und schauen, wo ich Arbeit finde.«
Washington verzog nachdenklich den Mund und setzte zweimal an, bevor er sprach. »Wir könnten versuchen, dich in unserer Fabrik unterzubringen. Da gibt es Tätigkeiten, bei denen man nicht viel herumlaufen muss. Vielleicht finden wir auch etwas im Büro.«
»Welche Fabrik?«
Davon hatte Fanny ihm wohl noch nicht erzählt. Eine Stahlseilfabrik war ja auch viel weniger interessant als die Arbeit als Ingenieur und Architekt, für die Washingtons Vater John bekannt war. Der Großteil des Familienvermögens stammte jedoch aus Trenton, der Hauptstadt von New Jersey, wo er schon vor über fünfzehn Jahren die Roebling Wire Company gegründet hatte. Sie stellte Stahldrähte für die Bauindustrie her – und natürlich auch für Johns eigene Hängebrücken.
Emily war kurz nach ihrer Verlobung im letzten April zum ersten Mal nach Trenton gereist, auf Einladung von Washingtons Eltern.
Mein Vater freut sich, dich kennenzulernen, hatte Wash ihr geschrieben. Er wird dir nicht nur unser Haus, sondern auch seine Firma zeigen wollen, auf die er so stolz ist. Ich hingegen finde Trenton öde und trist. Immer wenn ich ein paar Tage da bin, glaube ich, bald vor Langeweile zu sterben. Aber es ist großartig, dass du meine Mutter kennenlernen wirst, eine wunderbare Frau, die alles erträglich macht.
Kurz darauf war ein weiterer Brief gekommen. Leider kann ich dich nicht wie geplant aus Cold Spring abholen, weil unser Trupp bei einem weiteren Vorstoß eingesetzt werden soll, aber mein Vater ist derzeit geschäftlich in Manhattan. Er möchte dich dort treffen und im Zug mit nach Trenton nehmen. Ich schicke dir noch weitere Details. Eigentlich wäre ich bei eurem ersten Treffen lieber dabei gewesen, denn er ist ein sehr spezieller Mensch. Hab keine Sorge, er wird dich natürlich gut behandeln, aber wundere dich nicht.
Rätselhafter hätte er sich nicht ausdrücken können. Ihr war nur aufgefallen, dass sämtliche Leichtigkeit aus seinen Worten verschwand, wann immer er über seinen Vater sprach. Entsprechend hatte Emily feuchte Hände vor Unruhe gehabt, als sie an einem Mittwoch im Mai mit ihrer Mutter am Bahnhof von Jersey City gestanden und wie vereinbart unter der großen Uhr auf ihren zukünftigen Schwiegervater gewartet hatte.
Sie erkannte ihn sofort. John Augustus Roebling hatte zwar einen Vollbart und mit seinen sechzig Jahren ein hageres Gesicht voller Falten, aber die auffälligen Wangenknochen und vor allem die Augen erinnerten sie so sehr an Washington, dass sie sofort Zutrauen zu ihm fasste.
»Sie müssen Washingtons junge Braut sein«, sagte er mit einem knappen Lächeln und verbeugte sich.
»Emily Warren, ich bin erfreut, Sie kennenzulernen, Mr Roebling. Und das ist meine Mutter Phoebe Lickley Warren.«
Emily war stolz auf ihre schöne Mutter, die sich aufrecht hielt wie eine Königin. Ihr war nicht anzusehen, dass sie sechs Kinder verloren, sechs weitere großgezogen und vor fünf Jahren ihren Mann beerdigt hatte. Ihr Haar war immer noch dunkel und genauso schwer zu bändigen wie das ihrer Tochter. Emily konnte meist erahnen, was sie dachte, und wusste schon bald, dass auch ihre Mutter Washingtons Vater vertrauenswürdig fand und ihm ihre Tochter bedenkenlos mitgeben würde. Nach einer kurzen Unterhaltung mahnte Mr Roebling, dass sie sich beeilen müssten, um den Zug zu erreichen.
Sie hasteten gemeinsam zum Gleis, Emily küsste ihre Mutter zum Abschied, und schon saßen sie im Zug, der sich wie ein großes, behäbiges Tier in Bewegung setzte und sie die etwa siebzig Meilen nach Trenton bringen würde.
»Es riecht etwas unangenehm«, bemerkte Mr Roebling. »Darf ich das Fenster aufmachen?«
»Selbstverständlich.«
Der Geruch von Dauerwurst wurde kurz durch Rußgestank übertüncht, bis der Zug einen Bogen fuhr und ein frischer Wind dröhnend ins Abteil kam. Mr Roebling blieb stehen und sah aus dem Fenster. Seine sorgfältig zurückgekämmten Haare flatterten ihm um den Kopf. Nach einer Weile stellte Emily sich neben ihn. Nervös spielte sie mit einem Ohrring herum. Mr Roebling hob den Arm und zeigte nach vorn.
»Wir fahren gleich über den Hackensack River«, sagte er. »Über das Aussehen der Brücke kann man sich streiten, aber die Konstruktion ist robust, und Schroeder hat sie in beeindruckender Geschwindigkeit hochgezogen.«
»Wie groß ist die Stützbreite?«, fragte Emily.
Verdutzt sah Mr Roebling sich zu ihr um. Wahrscheinlich wunderte er sich, dass sie solche Fachbegriffe kannte. Das Blau seiner Augen war ein wenig dunkler als das von Washington, aber das konnte am Alter liegen.
»Knapp über tausendzweihundert Fuß.«
»Es ist eine Fachwerkbrücke, oder?«
»Gerberträger-Fachwerk, um genau zu sein.« Mr Roebling schloss das Fenster mit einem Ruck, und sie ließen sich in der plötzlichen Stille des Abteils auf zwei gegenüberliegende Sitze nieder. Emily reichte mit den Fußspitzen nur knapp auf den Boden.
»Ist Ihr Vater auch im Bauwesen tätig?«, fragte er.
Emily prüfte, ob der Fahrtwind ihre Frisur durcheinandergebracht hatte, was auch Mr Roebling dazu brachte, sich die Haare glatt zu streichen. »Nein, er war Abgeordneter für den Bundesstaat New York und hat für Cold Spring als Vorsitzender im Stadtrat gesessen. Außerdem hat er in die West Point Foundry investiert.«
»Die Waffenfabrik? Richtig, die ist ja bei Ihnen da oben. Direkt in Cold Spring? Dabei klingt der Name so idyllisch.«
»Stellen Sie sich einmal einen schönen Frühlingstag vor, an dem man am geöffneten Fenster sitzt, einen Brief schreibt oder ein Buch liest, die Vögel zwitschern hört – und dann wird plötzlich eine Runde Parrott-Geschütze getestet. Sie werden immer direkt auf den Storm King Mountain gerichtet. Sehr idyllisch, unser Cold Spring.«
Er lachte heiser. »Dafür haben uns die Parrotts bislang gute Dienste geleistet.«
»Von der einen oder anderen Explosion einmal abgesehen«, sagte Emily trocken. Richtig gut war der Ruf der Geschütze nämlich nicht. »Mein jüngster Bruder Bobby heißt übrigens mit Zweitnamen Parrott. Mein Vater war nämlich mit Mr Parrott befreundet, dem Erfinder. Und als Kind neigte Bobby zu Wutausbrüchen, die einer Explosion nicht unähnlich waren.«
Mr Roebling schmunzelte. »Mein Zweitname ist Augustus, aber ich kann nicht behaupten, dass ich mich erhaben fühle. Außer vielleicht, wenn ich auf einer neu gebauten Brücke stehe. Was mich zu meiner Frage zurückbringt, woher Sie wissen, was eine Fachwerkbrücke ist. Hat mein Sohn Ihnen schon Unterricht gegeben?«
»Ihr Sohn auch, ja, aber vor allem mein Bruder Gouverneur Kemble – benannt übrigens nach einem anderen Freund unseres Vaters. Wir nennen ihn einfach GK. Er hat in West Point Ingenieurwesen studiert.«
»Aber natürlich, den Generalmajor habe ich doch letztes oder vorletztes Jahr kennengelernt. Verstehen Sie sich gut?«
»Sehr. GK ist viel älter als ich, aber ich habe ihn furchtbar gern, und er hat mir schon früh gezeigt, wie wunderbar poetisch nicht nur die Pflanzenkunde, sondern auch die Statik ist.«
»Poetisch, so, so.«
Im Gang liefen mehrere junge Männer vorbei und grölten ein Lied, das sie wohl nur selbst erkannten. Der Zug schwankte, und einer der Meistersänger wurde gegen ihre Abteiltür geschleudert. Er richtete sich wieder auf und winkte entschuldigend.
»Unmöglich.« Aus Mr Roeblings Stirnfalten wurden tiefe Furchen. Er sprang auf, öffnete die Schiebetür und blickte den Männern wütend hinterher. Einige Minuten blieb er auf dem Gang stehen, sah sich um und aus dem Fenster und kehrte zurück ins Abteil.
»Ich freue mich jedenfalls, Miss Warren, Sie in unserer Familie begrüßen zu dürfen. Ich nehme an …« Er nahm Platz, schlug ein Bein über das andere und lehnte sich zurück. »Ich nehme doch stark an, dass Sie meinen Sohn aus dem richtigen Grund heiraten?«
Was meinte er damit?
»Ich heirate ihn, weil ich ihn liebe.«
»Das ist der richtige Grund, meinen Sie nicht?«
»Doch, auf jeden Fall.«
»Eine Ehe ohne Liebe ist nicht besser als Selbstmord.«
Er blickte dabei aus dem Fenster, sodass sie seinen Gesichtsausdruck nicht lesen konnte.
Als sie in Trenton ankamen, brachte sie ein offener Zweispänner quer durch die Stadt. Die Luft roch nach Maiglöckchen.
»Hier wohnen unsere Arbeiter«, sagte Mr Roebling und zeigte auf eine Reihe roter Backsteinhäuser. Die Kutsche rumpelte über das Kopfsteinpflaster, sodass Emily sich festhalten musste.
»Sind Sie oft in der Fabrik oder eher auf einer Ihrer Baustellen?«
»Das kommt auf die Bauphase an. Ich schaue hier regelmäßig nach dem Rechten, aber Ferdinand übernimmt immer mehr die Leitung der Firma, und auch Charles scheint sich dafür zu interessieren. Anders als Washington.«
Warum klang er so bitter, wo sein ältester Sohn ihn doch tatkräftig auf den Baustellen unterstützte? Sollte er sich gleichzeitig noch um die Fabrik kümmern? In ihr grummelte es, aber sie schob den Ärger zur Seite. Auf Ferdinand und Charles war sie schon sehr gespannt. Washington hatte sie als ein unschlagbares Duo bezeichnet. Auch seine Schwester Elvira wohnte noch im Elternhaus. Von Washingtons anderen Geschwistern wusste Emily bislang nur wenig.
Sie ließen die Arbeiterhäuser hinter sich und fuhren eine Weile durch Weizenfelder, aus denen blaue Kornblumen und roter Klatschmohn hervorblitzten. Schließlich kam hinter hochgewachsenen Bäumen ein Anwesen zum Vorschein. Siebenundzwanzig Räume, hatte Wash ihr geschrieben. Sogar eine mit mehreren Fenstern versehene Kuppel gab es, die viel Licht ins Innere lassen musste. Emily folgte ihrem Gastgeber in das imposante Foyer, wo in diesem Moment eine alte Standuhr schlug. Große Pflanzen gaben ihm ein leicht exotisches Flair.
»Noch einmal herzlich willkommen«, sagte Mr Roebling und wies mit der Hand auf die beiden Frauen, die dort warteten. »Das sind meine Gattin, Mrs Johanna Roebling, und meine Tochter Elvira. Sie beide müssten etwa gleich alt sein.«
Mrs Roeblings Gesicht war durch die schwere Krankheit gezeichnet. Sie war hohläugig, und ihr glattes Haar war so dünn, dass es sich kaum noch zu einem Knoten zusammenfassen ließ. Aber der Blick aus ihren braunen Augen war warm, und sie begrüßte Emily mit großer Herzlichkeit, während Elvira sie wie einen Ehrengast umsorgte und verwöhnte.
Es war eine stille Familie, ein stilles Haus, das erst etwas lebhafter wurde, als Charles und Ferdinand zum Dinner heimkamen. Charles war mit seinen fünfzehn Jahren noch ein halbes Kind mit weicher Miene, aber Ferdinand hatte mit dreiundzwanzig schon die Gesichtszüge seines Vaters. Die sanfteren Züge der mütterlichen Seite hatten sich offenbar nur bei Elvira durchgesetzt. Hinter ihnen her schlich ein Junge, der versuchte, so wenig wie möglich aufzufallen.
»Edmund sitzt normalerweise noch nicht zum Dinner bei Tisch, wenn Gäste da sind«, sagte Mr Roebling mit einem Blick auf seinen jüngsten Sohn, der bei der Ansprache widerwillig die Schultern straffte. »Aber wir machen heute eine Ausnahme, Miss Warren, da Sie ja im Grunde schon Familie sind.«
»Herzlich willkommen im Irrenhaus«, hörte sie Ferdinand murmeln. Elvira ließ laut klappernd ihren Löffel fallen und starrte ihren Bruder entsetzt an. Wie konnte er so etwas sagen?
Emily musste ein Lachen unterdrücken. Die Fröhlichkeit blieb ihr jedoch im Halse stecken, als sie das plötzliche Schweigen am Tisch bemerkte. Mr Roebling hatte aufgehört, seine Suppe zu essen, und starrte, mit dem Löffel in der fest geschlossenen Faust, auf den Tisch. Die übrige Familie speiste weiter, völlig geräuschlos – kein Klirren, kein Schlucken war zu hören. Emily versuchte Elviras Blick zu erhaschen, aber die schaute sie nur kurz an, lächelte entschuldigend und bedeutete ihr, ebenfalls ihre Suppe zu essen.
Emily erinnerte sich, wie wütend ihr zukünftiger Schwiegervater wegen der grölenden jungen Männer im Zug geworden war. Sie waren unbeeindruckt weitergelaufen, aber Emily war sich sicher: Hätten sie sein hartes Gesicht und die weißen Fingerknöchel gesehen, dann hätten sie ebenfalls erschrocken ihre Köpfe eingezogen.
Zum Hauptgericht hatte der Jähzorn des Vaters nachgelassen. Er erkundigte sich nach Emilys Familie und wollte wissen, ob sie eine Schulbildung genossen habe. Einen freundlichen Plauderton fand er zwar nicht, sondern fragte sie eher aus, aber das war ihr recht.
Während einer kleinen Gesprächspause fiel ihr Blick auf Edmund, der fast genauso elend aussah wie seine kranke Mutter. Er hatte die ganze Zeit noch nichts gesagt.
Sie lächelte ihn an. »Wie alt bist du, Edmund?«
»Elf.«
»Bist du der Jüngste?«
»Ja.«
»Möchtest du später auch Ingenieur werden wie deine Brüder?«
Er zuckte mit den Schultern, aber seine Mutter stupste ihn fast unmerklich an, damit er antwortete.
»Ich weiß es noch nicht«, sagte er.
»Wo gehst du denn zur Schule?«
Edmund blieb regungslos sitzen. Man hätte die berühmte Stecknadel fallen hören können, bis die beiden Dienstmädchen hereinkamen und die Teller abräumten.
Emily war heilfroh, als sie sich nach einem Kaffee im Salon zurückziehen konnte. Ferdinand brachte sie noch bis zur Treppe. »Ich hoffe, Washy hat Sie vorgewarnt. Roebling senior ist kein freundlicher alter Herr, der jederzeit seine geliebten Kinder herzt. Edmund ist neulich von seiner dritten Schule geflogen, deswegen ist das momentan ein heikles Thema.«
»Oh.«
»Aber ich glaube, der Senior mag Sie.«
Emily schwieg. Eigentlich hatte sie eine gute Menschenkenntnis, und ihr erster Eindruck von Mr Roebling am Bahnhof war so gut gewesen, dass sie nun verwirrt und irgendwie von sich selbst enttäuscht war.
»Ich habe Ihnen«, fuhr Ferdinand fort, »oben einen Brief von Washy hingelegt, in dem er Ihnen bestimmt eine gute Nacht wünscht.«
»Oh, vielen Dank. Die wünsche ich Ihnen auch.«
Sie eilte die Stufen hoch, viel zu ungestüm für eine Dame. Von unten hörte sie ihn leise lachen.
Das Gästezimmer war mehr als geräumig. Elvira hatte ihr einen Blumenstrauß auf die Kommode gestellt. Neben der Vase lag Washingtons Brief, den sie ungeduldig aufriss. Sie hätte ihn gern so viel gefragt.
Ich kann es kaum erwarten, dich morgen zu sehen. Behandelt meine Familie dich gut? Haben Ferdinand und Charles dir schon eine Führung durch die Fabrik angeboten? Hast du schon den Kanal neben dem Haus gesehen, durch den das Wasser für die Fabrik schießt? Hast du schon Tilton kennengelernt, den Brückenwärter? Und Mitchell, den Schleusenwärter? Sie sind gewiss ganz grün vor Neid geworden, weil ich eine so wunderschöne Verlobte habe.
Emily öffnete das Fenster, um den Maiduft in den Raum zu lassen, und sprang ins Bett. Morgen würde Wash da sein, vielleicht schon zum Frühstück, und ihr alles zeigen.
Dann lag sie lange da und konnte nicht einschlafen. Das silberne Mondlicht legte sich über die dunklen Möbel, doch wach hielt sie vor allem das ewige Gluckern des Kanals. Sie stand auf, zog sich den Morgenrock über und schlich den Korridor entlang zum Bad. Immer noch glaubte sie es plätschern zu hören – das Geräusch hatte sich in ihren Ohren festgebissen.
Sie öffnete die Tür und erstarrte.