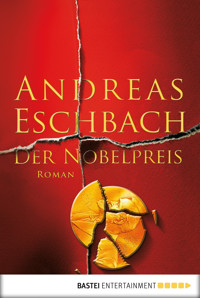19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Können Tote wieder auferstehen? Eine junge Frau ist vor vielen Jahren nicht mehr aus dem brasilianischen Regenwald zurückgekehrt. Nun taucht sie plötzlich wieder auf. Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews kommen auf verschiedenen Wegen mit ihrer Rückkehr in Verbindung und in gewohnt detektivischer Manier ziehen sie ihre Schlüsse. Irgendwann kreuzen sich ihre Wege und die drei Freunde von einst müssen sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
AndreasEschbach
DieAuferstehung
Roman
Prolog
Atalaia do Norte ist die westlichste brasilianische Gemeinde im Amazonas. Sie liegt am Ufer des Rio Javari, der zugleich die Grenze zu Peru bildet. Nicht, dass die Einwohner hier sich viel um Grenzen kümmern würden. Die Gegend ist flach, der Blick reicht weit – man könnte fast glauben, bis an die Enden der Welt –, und was man sieht, ist vor allem Wald. Anderswo sind große Teile des Regenwalds abgeholzt worden, um Platz für Ackerflächen zu schaffen, doch hier steht er noch, so unberührt, wie ein Dschungel im 21. Jahrhundert nur sein kann.
An jenem Mittwochnachmittag Ende August lag schwüle Mittagshitze über dem Ort. Das Thermometer zeigte 34° Celsius, und nur ein paar magere Hunde schlichen auf den größtenteils nicht asphaltierten Straßen herum. Wer nicht unterwegs sein musste, blieb im Schatten.
In der Markthalle am Ende der Rua Costa e Silva war so gut wie nichts los. Auf grob gezimmerten Holztischen, die, genau wie das Gebäude, gelb und blau gestrichen waren, wurde Gemüse feilgeboten, dazu riesige Melonen und Bananen in allen Variationen, von gelben, fleckigen Bündeln bis hin zu ganzen Bananenstauden, an denen die Früchte noch grün waren. Hinter den Tischen saßen Frauen auf Plastikstühlen und unterhielten sich mit träger Gelassenheit. Sie trugen leichte Kleider oder T-Shirts und Röcke, und alle hatten sie Zehensandalen an den Füßen.
Unter einem Vordach nebenan standen ein paar knallbunte, neu aussehende Motorräder. Junge Männer lümmelten darauf herum, redeten und warteten, dass die Hitze nachließ.
Bis einem von ihnen das Kanu auffiel.
»Olá«, sagte er zu seinen Freunden und wies auf den Fluss hinaus, wo ein Kanu, von Westen kommend, quer über den breiten, braunen, träge dahinfließenden Rio Javari auf die Stadt zuhielt.
Es war ein Kanu, wie es manche der Indigenen immer noch verwendeten. Was an sich nichts Ungewöhnliches war, denn in Atalaia do Norte lebten Menschen jedweder Herkunft friedlich zusammen, und jemandem in Stammestracht und mit Pfeil und Bogen in der Hand zu begegnen, war keine Seltenheit.
Doch zwischen den beiden Männern, die das Kanu mit kraftvollen Bewegungen ihrer Paddel vorantrieben, saß eine weiße Frau mit auffallend hellen blonden Haaren, die in der Sonne leuchteten wie Gold. Und das war ein ungewohnter Anblick.
Bis das Kanu das Ufer erreicht hatte und zwischen all den Fischerbooten, die hier ankerten, anlegte, standen die jungen Männer schon am Ufer, neugierig, was das zu bedeuten hatte. Auch die Händlerinnen hatten ihre Marktstände im Stich gelassen und beobachteten das Geschehen.
Was geschah, war, dass die Frau ausstieg und den beiden Männern im Boot zunickte, die nur Lendenschurze trugen. Die Männer erwiderten das Nicken stumm, stießen sich dann sofort wieder ab und fuhren davon, in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Die Frau dagegen erklomm, barfuß und unbeholfen, das Ufer.
Derjenige, der das Kanu als Erster entdeckt hatte, trat rasch vor, reichte ihr die Hand und half ihr herauf.
Aus der Nähe betrachtet sah die Frau bedauernswert aus. Sie trug einen primitiven Lendenschurz und ein uraltes, zerrissenes T-Shirt, und sie war so schmutzig, als hätte sie wochenlang im Schlamm geschlafen. Zahllose Stiche und Kratzer zierten ihre blasse Haut. Die blonden Haare schienen mit einer Machete gestutzt worden zu sein.
»Please«, sagte sie mit rauer, erschöpfter Stimme. »Take me to the Police Station.«
Die jungen Männer musterten einander. So viel Englisch verstand jeder von ihnen, der Touristen wegen, die es ab und zu in den Ort verschlug.
»Polícia«, sagte der, der ihr geholfen hatte. »Yes. Come with me.«
Klar, dass er sie zu seinem schicken, knallroten Motorrad führte. Sie schien kein Problem damit zu haben, lächelte dankbar. Er ließ den Motor an, seine Freunde taten dasselbe, und so fuhren sie die blonde Frau im Konvoi durch die Stadt, bis in die Rua João Batista zur örtlichen Polizeistation.
Auch dort hatte man der Ruhe gepflegt, doch das unüberhörbare Nahen der Motorräder schreckte die Polizisten beizeiten auf. Wachsam und mit hochgezogenen Brauen verfolgten sie, wie all die jungen Männer hereindrängten, die halb nackte, verwahrloste Frau mit den blonden, übel zugerichteten Haaren in ihrer Mitte.
Ob einer von ihnen Englisch spräche, erkundigte sich die Frau, ehe jemand dazu kam, etwas zu sagen.
Als der Delegado de Polícia das bestätigte, sagte sie: »Ich bin amerikanische Staatsbürgerin. Bitte verständigen Sie die US-Botschaft. Sagen Sie ihnen, ich sei von den Toten auferstanden.«
1
Dinge zu reparieren ist das Beste, was Sie für die Umwelt tun können. Es hilft ihr mehr, als wenn Sie sich vegan ernähren, aufs Auto verzichten und Ihr Gemüse selbst anbauen.«
Der Mann, der das sagte, war Mitte fünfzig, stämmig, mit leicht gelockten, dunklen Haaren und ersten grauen Strähnen. Sein dünner Kinnbart ließ ihn aussehen wie einen alt gewordenen Piratenkapitän. Er stand inmitten eines Vierecks aus langen Tischen, an denen eine Menge Leute saßen, die geräuschvoll mit Werkzeug an allerhand zerlegten Toastern, Radios, Computern, Mikrowellenherden und anderen Geräten herumschraubten. Es roch nach Öl und Staub und verbranntem Lötzinn. Der Hausmeister würde deswegen nachher wieder meckern und den Saal kräftig durchlüften.
Der Name des Mannes war Justus Jonas, und was hier stattfand, war der Reparierkurs, der jeden Mittwochnachmittag den Gemeindesaal von Rocky Beach in eine Lehrwerkstatt verwandelte. Früher hatte der Nebenraum ausgereicht, aber irgendwann hatten sie in den großen Saal umziehen müssen. Was auch seine Nachteile hatte: Durch die hoch gelegenen Fenster fiel zwar Licht ein, doch um die Arbeitsflächen richtig auszuleuchten, musste man zusätzlich alle Strahler einschalten.
Es herrschten angenehme Temperaturen, wie überhaupt der September einer der angenehmsten Monate in Rocky Beach war. Die größte Sommerhitze war überstanden, aber der Herbst ließ noch auf sich warten.
Matteo Torres saß abseits des Geschehens hinter einem Tisch, vor sich eine Kasse und neben sich mehrere große Kisten mit Werkzeug, deren Griffe alle mit Goldfarbe lackiert und mit der Aufschrift GC Jonas versehen waren. Viele Teilnehmer brachten eigenes Werkzeug mit, aber man konnte auch Werkzeug ausleihen, gegen ein Pfand von jeweils zwanzig Dollar, das man am Ende wieder zurückbekam.
Ein schüchtern lächelndes Mädchen kam mit einem Torx-Schraubenzieher an, der aus der Kiste stammte. »Ich glaube, ich brauche den eine Nummer größer«, sagte sie leise.
Matteo warf einen Blick auf die Gravur. »Also einen 8er«, stellte er fest. »Moment.« Er fand den 8er-Torx auf Anhieb, sie tauschten, dann zog das Mädchen wieder ab.
»Hersteller wollen natürlich nicht, dass Sie kaputte Dinge reparieren«, fuhr Justus Jonas fort. »Hersteller wollen, dass das, was Sie kaufen, kurz nach dem Ende der Garantie kaputtgeht, damit Sie es wegwerfen und ein neues Gerät kaufen. Deswegen verändern sie ihre Produkte auch ständig. Sie sollen das Gefühl haben, dass Sie dadurch etwas Neues und Besseres bekommen. Was in den meisten Fällen reine Illusion ist.«
Seit Matteo als Assistent für Justus Jonas arbeitete, hatte er ihn das schon oft sagen hören, aber seltsam, es klang immer so, als formuliere er den Gedanken zum ersten Mal. Nachhaltigkeit war dem Mann ein echtes Anliegen, das stand fest.
»Und diese Strategie«, fuhr Justus fort, »funktioniert leider. Es gibt Statistiken, wonach sechzig Prozent aller Dinge, die ein amerikanischer Haushalt kauft, nach sechs Monaten auf dem Müll gelandet sind. Und jetzt überlegen Sie mal, was das heißt! Kann es wirklich unsere Aufgabe im Leben sein, die gesamten Ressourcen des einzigen Planeten, den wir haben, nach und nach in Müll zu verwandeln?«
Die Köpfe rings um den Tisch nickten beifällig. Es lagen nicht nur geöffnete Geräte herum, sondern auch Stiefel und Winterjacken. Leute, die das erste Mal teilnahmen, staunten oft, dass jemand wie Justus Jonas auch mit Nadel und Faden umgehen konnte, genau wie mit Ahlen, Locheisen und Riemenschneidern.
»Mehr und mehr werden Geräte so gebaut, dass man sie gar nicht mehr reparieren kann!«, rief er. »Das dürfen wir nicht akzeptieren! Als ob es nicht genug wäre, dass sie so konstruiert werden, dass sie vorzeitig kaputtgehen. Hier, dieser Drucker zum Beispiel, den einer von Ihnen letztes Mal mitgebracht hat … Sie waren das, Bill, nicht wahr?«
Er richtete seine Handkamera auf das Gerät, dessen Teile vor ihm auf dem Tisch lagen. Das, was die Kamera sah, erschien auf einem der großen Bildschirme.
»An sich ist der Drucker tadellos konstruiert. Elegant, könnte man sagen. Da hat jemand gewusst, was er tut. Aber … das Gerät hat eine Schwachstelle. Und die ist so schwach, dass mir keiner erzählen kann, das sei ein Versehen: dieses Zahnrad hier.«
Auf dem Bildschirm sah man ein Zahnrad aus Plastik, dem ein Zahn fehlte.
»Es ist ein zentrales Element, denn es treibt die Belichtungstrommel an. Und es ist empfindlich. Jedes Mal, wenn man eine neue Druckerpatrone einsetzt, kann es passieren, dass ein Zahn überbelastet wird und ein Riss entsteht. Ein Riss in Plastik hat die Tendenz, größer zu werden, also ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Zahn abbricht. Dann blockiert der Transport, und der Drucker verweigert seinen Dienst – alles wegen eines einzigen winzigen Stücks Plastik.«
Justus Jonas reckte sich, sah in die Runde. »Der Trick dabei ist, dass man dieses Zahnrad nicht nachkaufen kann. Es hat nicht mal eine Bestellnummer. Warum? Weil diese Firma nicht will, dass Sie Ihren Drucker reparieren. Sie will, dass Sie ihn wegwerfen und einen neuen kaufen. Nämlich das diesjährige Modell, das angeblich viel besser ist.«
Auf dem Bildschirm sah man nun, wie seine vergrößerte Hand ein zweites, golden schimmerndes Zahnrad neben das kaputte aus blassem Plastik legte.
»Ich habe dieses Zahnrad nachgebaut, aus einem Stück Messing für fünfzig Cent. Zugegeben, das können Sie nicht, denn dazu braucht man eine spezielle Fräsmaschine. Zufällig besitze ich eine – übrigens ein ebenfalls sehr altes Gerät, das ich bei einer Firmenauflösung günstig erworben habe und erst reparieren musste. Okay. Ich setze dieses Ersatzteil mal ein, dann sehen wir, ob es was bringt.«
Jetzt bastelte niemand mehr. Alles sahen gebannt zu, wie Justus Jonas das schimmernde Teil einsetzte und den Drucker wieder zusammenbaute, der übrigens noch aussah wie neu. Er schloss seinen betagten Laptop an, drückte eine Taste – und der Drucker spuckte mit leisem Summen ein sauber bedrucktes Blatt Papier aus.
Jemand klatschte Beifall, die anderen fielen ein.
»Sehen Sie? Ein schlichter Eingriff, und das Gerät ist von den Toten auferstanden. Und weil bei diesem neuen Zahnrad keine Zähne mehr ausbrechen werden, dürfte der Drucker noch jahrzehntelang gute Dienste tun.« Justus Jonas stöpselte das Gerät aus und übergab es seinem glücklich strahlenden Besitzer.
Die Runde beruhigte sich wieder. Jemand fragte: »Apropos, Mr Jonas – was halten Sie von der Meldung, dass in Brasilien eine Frau aufgetaucht ist, die von den Toten auferstanden sein soll?«
»Was liest du denn für Zeitungen?«, meinte ein anderer grinsend.
»Das stimmt so nicht«, warf eine ältere Dame ein, die heute ihren Plattenspieler repariert hatte. »Die Frau, die letzte Woche wiederaufgetaucht ist, war sieben Jahre im Amazonasdschungel verschollen. Darum ging es.«
»In dem Bericht, den ich gelesen habe, stand, sie heiße Therese H. und sei Amerikanerin«, wusste ein Vierter.
»Das ist garantiert nicht der richtige Name«, meinte die Dame. »Den dürfen Zeitungen nicht einfach so nennen.«
»Ich habe gelesen, sie hätte den Behörden gesagt, sie sei von den Toten auferstanden«, erklärte derjenige beharrlich, der das Thema aufgebracht hatte.
Dann blickten alle Justus Jonas an, als erwarteten sie von ihm ein abschließendes Urteil in dieser Sache.
Matteo war nicht entgangen, wie Justus Jonas’ Gestalt sich während dieses Wortwechsels versteift hatte, ein untrügliches Zeichen dafür, dass er sich ärgerte. Wobei er sich selten ärgerte. Aber wenn er den Eindruck gewann, die ganze Zeit nur vor eine Wand geredet zu haben, dann brachte ihn das zuverlässig auf die Palme.
»So etwas wie Auferstehung von den Toten gibt es nicht«, erklärte er nun in leisem, aber scharfem Ton, »denn, wenn jemand ins Leben zurückkehrt, dann war er vorher quasi definitionsgemäß nicht tot. Erstens. Und zweitens geht es in diesem Kurs um Gegenstände. Um Geräte. Maschinen. Nicht um Menschen. Falls ich Ihnen den Eindruck vermittelt haben sollte, man könne alles reparieren, sei an dieser Stelle ausdrücklich und unmissverständlich gesagt, dass es durchaus Dinge gibt, die irreparabel sind.«
Die Worte verhallten in betretener Stille, schienen einen Moment lang zwischen den kahlen Wänden des Saals zu schweben und nicht zu wissen, wohin sie sollten.
Dann sagte Justus Jonas: »Okay. Es ist ohnehin Zeit; machen wir Schluss für heute. Denken Sie daran, dass wir uns erst am dritten Mittwoch im Oktober wiedersehen. Falls Sie bis dahin wieder etwas zu reparieren haben.«
Matteo sah auf die Uhr und wunderte sich. Es stimmte nicht, dass der Kurs schon vorbei war. Gut zwanzig Minuten hätten sie noch gehabt. Zudem stand erst mal eine mehrwöchige Pause an, weil der Gemeindesaal für die alljährliche Ausstellung der Künstler von Rocky Beach benötigt wurde.
Aber niemand erhob Einwände, alle packten zusammen, und diejenigen, die Werkzeug geliehen hatten, kamen zu ihm, um es gegen ihr Pfand einzutauschen.
Das mit der Frau aus dem Dschungel hatte Matteo ebenfalls gehört. In den Nachrichten am Wochenende war es eine von diesen Meldungen gewesen, mit denen man die Sendezeit füllte, wenn nicht genug von Belang passiert war in der Welt. Der Moderator hatte einen Witz darüber gemacht, aber Matteo wusste schon nicht mehr, was für einen.
***
Justus fragte sich, warum ihn die Diskussion so geärgert hatte. Eine harmlose Assoziation. Er hätte es abtun und einfach weitermachen sollen. Vor allem hätte er sich nicht aufregen sollen.
Andererseits: Wenn die Leute das Wesentliche dessen, was er ihnen beizubringen versuchte, nicht begriffen, hatte man dann nicht das Recht, erbost zu sein?
Er ging Matteo zur Hand, half ihm, die Sachen hinauszutragen. Der Hausmeister wartete, klapperte schon ungeduldig mit seinem großen Schlüsselbund. Alle Türen standen weit offen, eine warme Brise zog durch den Saal. Man roch den nahen Ozean.
Als sie sämtliche Gerätschaften im Kofferraum seines alten Mercedes verstaut hatten, war die Sonne schon hinter die meerwärts gelegenen Gebäude gesunken und warf lange Schatten über den Platz vor dem Gemeindehaus. Ein paar der Teilnehmer standen immer noch beisammen und redeten. Der Hausmeister schloss die Türen geräuschvoll, gleich darauf rasselten die Schutzgitter herab.
»Alles drin«, verkündete Matteo und schlug den Kofferraumdeckel zu. »Wir können.«
»Danke«, sagte Justus. Was täte er nur ohne den jungen mexikanischen Studenten, der ihm seit drei Jahren als Chauffeur diente?
Was übrigens eine Frage war, auf die er bald eine Antwort würde finden müssen.
Er stieg ein, setzte sich wie immer auf die Rückbank. Justus legte Wert darauf, zu leben, was er predigte. Sein Wagen war über zwanzig Jahre alt, vielfach repariert, aber nach wie vor top in Schuss. Einst hatte er einem Popmusiker gehört, der inzwischen in Vergessenheit geraten war. Der hatte den Mercedes seinerzeit vergolden lassen, von vorne bis hinten, alles, mit Ausnahme der Fenster und Scheinwerfer.
Das Gold war allerdings nur hauchdünn gewesen. Regen, Temperaturwechsel und der in den kalifornischen Winden allgegenwärtige Staub hatten es nach und nach abgetragen, was den Wagen heute eher schäbig denn kostbar aussehen ließ. Doch Justus hatte sich bislang nicht dazu durchringen können, ihn neu lackieren zu lassen. Irgendwie hatte er das Gefühl, dass er damit den Charakter des Fahrzeugs verraten würde.
Matteo schwang sich hinters Steuer, nahm seine Brille ab, um sie rasch zu putzen, und ließ dann den Motor an.
»Matteo«, sagte Justus, »ich nehme an, Sie werden die Herbstpause wieder für Bewerbungen nutzen?«
»Ja, Mr Jonas«, erwiderte der hagere Student. »Ich habe es mir zumindest vorgenommen.«
»Sie sagen mir aber rechtzeitig, wenn ich mich nach Ersatz für Sie umsehen muss?«
»Ja, natürlich.« Das dunkelhaarige Haupt vor ihm wiegte sich zweifelnd hin und her. »Falls es je dazu kommt.«
»Sieht der Arbeitsmarkt für Finanzanalysten so schlecht aus?«, fragte Justus. Matteo Torres hatte am CFA Institute Los Angeles studiert und sein Zertifikat schon seit Anfang des Jahres in der Tasche, bisher aber keinen Job gefunden. In den Kreisen, in die er mit dieser Ausbildung wollte, schien eine mexikanische Herkunft immer noch ein Stigma zu sein.
Matteo räusperte sich. »Sagen wir so: Je öfter ich Ihnen zuhöre, desto wählerischer werde ich, was die Firmen angeht, für die ich arbeiten will. Ich möchte nicht mitverantwortlich dafür sein, dass unnötiger Müll entsteht.«
Justus musste lächeln. »Und als Analyst können Sie das ja auf den Cent genau feststellen … Tja. Das wird nicht leicht.«
Im Grunde wäre es ihm recht gewesen. Aber er durfte in diesem Fall nicht an sich denken. Der junge Mann hatte sein Leben noch vor sich, und in seinem Teilzeitjob als Assistent und Fahrer für ihn verkaufte er sich weit unter Wert.
»Darf ich Sie auch etwas fragen, Mr Jonas?«
Justus hob verwundert die Brauen. »Natürlich.«
»Das, was Sie da zum Schluss gesagt haben, über Dinge, die irreparabel sind … Als die Leute angestanden haben, um ihr Werkzeug zurückzugeben, habe ich gehört, wie sich ein paar darüber unterhalten haben. Jemand hat behauptet, Sie hätten eigentlich etwas ganz anderes damit gemeint, und die Übrigen haben alle genickt und ja, ja gesagt und dass es ein Jammer sei.« Matteo suchte seinen Blick im Rückspiegel. »Was hat das zu bedeuten?«
Justus blickte aus dem Fenster. Die Sonne stand tief über dem Pazifik, das Wasser schimmerte wie flüssiges Gold.
Und er fühlte sich plötzlich sehr müde.
»Das ist eine lange Geschichte«, sagte er. »Und ich will eigentlich nicht darüber reden.«
2
Seltsamerweise kam der Paketbote donnerstags immer eine Stunde später als sonst, meist gegen halb elf. Die Quencher Literary Agency bekam naturgemäß täglich sehr viele Pakete: Belege von Büchern, die die Agentur vermittelt hatte, ausländische Bücher, deren Verlage ein amerikanisches Verlagshaus suchten, und mitunter auch dicke Manuskripte von älteren Autoren, die sie aus alter Gewohnheit lieber ausgedruckt schickten statt per E-Mail. Ein hochbetagter Autor beliebter Kriminalromane, den sie vertraten, schrieb sogar noch auf einer Schreibmaschine, mit Kohlepapier und Durchschlägen.
Bob Andrews erkannte den Paketboten an seiner Art zu klingeln: kurz-lang, lang-kurz. Die anderen kannten das Signal auch, aber nur Bob wusste, dass es der Morse-Code für den Buchstaben P war, P wie Post.
Die Agentur belegte das gesamte oberste Stockwerk eines älteren, sandbraun gestrichenen vierstöckigen Geschäftsgebäudes in Mid-Wilshire, einer der weniger bekannten Nachbarschaften von Central Los Angeles. Das Gebäude ließ einiges zu wünschen übrig, doch die Lage war großartig, fand Bob: Es war nicht weit nach Downtown, und vor allem war es nicht weit bis Koreatown, was bedeutete, dass man mittags die Auswahl aus mindestens zwanzig guten Restaurants hatte. Von denen man sich zudem immer sagen konnte, dass man womöglich von zukünftigen Filmstars bedient wurde, denn auch Hollywood war nahe.
Und vom Stadtteil Culver City aus, wo er wohnte, brauchte er, wenn er Glück hatte, nur eine Viertelstunde mit dem Auto. Wenn er in die Rushhour geriet, allerdings eher eine ganze Stunde.
Als er die schwere Eingangstür zuschlagen hörte, was bedeutete, dass der Bote mit seiner Sackkarre wieder fort war, stand Bob auf und ging in den Empfangsbereich, wo Mrs Randall schon anfing, die Pakete zu sortieren.
»Heute was für mich dabei?«, fragte er.
Mrs Randall schüttelte den wie immer tadellos frisierten Kopf. »Wieder nicht. Wenn Sie sonst nichts auf dem Schreibtisch haben, werden Sie sich heute freinehmen müssen.«
»Na«, meinte Bob, »ganz so schlimm ist es noch nicht.«
In diesem Moment ging die Eingangstür wieder auf, und Sebastian Quencher, der Inhaber der Agentur, kam herein. Er war sichtlich gut gelaunt, wie meistens, wenn er von einem seiner ausgedehnten Frühstücke mit alten Bekannten aus dem Verlagswesen kam.
»Ah, Andrews!«, rief er aus. »Ich habe was für Sie. Kommen Sie doch gleich mit in mein Büro, falls Sie Zeit haben.«
Quencher war ein Urgestein, eine Kanonenkugel auf zwei Beinen, mit einer spiegelnden Glatze, dafür aber einem wallenden Patriarchenbart. Nach einer erfolgreichen Karriere als Lektor in verschiedenen Verlagen hatte er vor über zwanzig Jahren seine Agentur gegründet, und Bob Andrews war einer seiner ersten Mitarbeiter gewesen. In all der Zeit hatte Quencher immer wieder aufsehenerregende Deals abgeschlossen und oft einen guten Riecher für Trends und Bestseller bewiesen: Keine Frage, dass Bob Zeit hatte und ihm neugierig folgte.
Quenchers Büro war das einzige, das über einen Balkon verfügte. Der allerdings nutzlos war, des vielen Verkehrs wegen, was man sofort merkte, wenn man eine der schallisolierten Terrassentüren öffnete. Ebenfalls im Unterschied zu den anderen, eher nüchtern eingerichteten Büros war dieses holzgetäfelt. An den Wänden hingen zahlreiche aufwendig gerahmte nautische Karten, und auf dem Schreibtisch thronte, unter Glas, ein detailliertes Modell der hochseetüchtigen Jacht, die Quencher seit ein paar Jahren sein Eigen nannte. Sie lag in Cabrillo Marina vor Anker, und er, seine Frau und sein Bruder unternahmen damit regelmäßig Exkursionen entlang der Westküste.
»Setzen Sie sich, Bob, setzen Sie sich«, forderte Quencher ihn auf und trat an das Sideboard aus edlem Kirschholz, auf dem etliche Flaschen nicht minder edlen schottischen Whiskys standen, ein weiteres seiner kostspieligen Hobbys. »Sie wollen, wie üblich, nichts?«, fragte er, während er nach einem Glas griff.
»Wie üblich«, erwiderte Bob.
Quencher goss sich zwei Fingerbreit der goldgelben Flüssigkeit ein und ließ sich dann hinter dem Schreibtisch nieder.
»Sagen Sie, Bob«, begann er, »haben Sie von dem Mädchen gehört, das sieben Jahre im Dschungel verschollen war und letzte Woche wieder aufgetaucht ist?«
Bob furchte die Stirn. Ja, da klingelte was. »Da kam eine Meldung im Radio, glaube ich. Am Montag auf der Herfahrt. Wieso?«
»Was halten Sie davon?«
Bob hob die Schultern. »Höchste Zeit, dass der Kongress aus der Sommerpause kommt, würde ich sagen. Die Medien wissen schon nicht mehr, was sie bringen sollen.«
»Das Verrückte ist«, meinte Quencher und sah dem Whisky zu, den er in seinem Glas rotieren ließ, »dass die Geschichte stimmt. Ein guter Freund von mir, Miller, der früher bei Doubleday war – ich habe Ihnen bestimmt mal von ihm erzählt, oder?«
»Ja«, sagte Bob, um die Sache abzukürzen. Die Liste von Quenchers guten Freunden war endlos; unmöglich, auf dem Laufenden zu bleiben.
»Also – sein Bruder ist beim Grenzschutz, CBP, und hatte mit der Rückholung der Frau zu tun. Dreiundzwanzig war sie, als sie verschwunden ist, demnach ist sie jetzt dreißig. Galt als tot, aber nun ist sie zurückgekehrt.« Quencher nahm einen Schluck. »Jedenfalls, er hat mir ihren Namen verraten.«
»Oh«, machte Bob. »Darf er das denn?«
»Natürlich nicht.« Quencher grinste breit. »Ist ihm so rausgerutscht. Kann ja passieren. In den Zeitungen heißt sie Therese H., und er hat mir verraten, dass das H. für Hitfield steht.«
»Hitfield?« Bob traute seinen Ohren nicht.
Quencher nickte begeistert. »Da ist mir sofort wieder eingefallen, was Sie mir mal erzählt haben, nämlich, dass Sie den Großvater kannten, nicht wahr? Albert Hitfield?«
Bob fühlte sich leicht benommen. »Kann man so sagen. Ist aber lange her.«
Albert Hitfield war in jungen Jahren Privatdetektiv gewesen, in Brooklyn, New York, bis ihn ein Unfall gezwungen hatte, diesen Beruf aufzugeben. Er hatte sich aufs Schreiben verlegt, auf Basis seiner eigenen Erfahrungen Krimis verfasst, die auf Anhieb zu Bestsellern wurden, und im Zuge ihrer Verfilmung auch im Filmgeschäft Fuß gefasst. Bob war ihm als Teenager das erste Mal begegnet – aber wenn er heute daran zurückdachte, war ihm, als sei das ein ganz anderer Bob gewesen als der, der er heute war …
Quencher stellte das Glas beiseite und schlug mit den Handflächen auf die lederne Schreibtischunterlage. »Frischen Sie den Kontakt mit der Familie auf, Bob! Bringen Sie die Frau dazu, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Oder sie einen unserer Ghostwriter aufschreiben zu lassen. Ich sehe einen Markt für dieses Buch!«
»Hmm«, machte Bob unbehaglich. An diesen Teil seiner Vergangenheit hatte er eigentlich nicht mehr rühren wollen.
Es war nur so – wenn Sebastian Quencher einen Markt sah, half kein Widerspruch.
Quencher verlegte sich darauf, ungeduldig mit den Fingern zu trommeln. »Und schnell bitte. Ich möchte noch mal einen richtigen Knaller landen, ehe ich in den Ruhestand gehe!«
***
An diesem Tag ging Bob Andrews nicht mit seinen Kollegen zum Lunch. Er holte sich nur ein Sandwich vom Deli an der Ecke und verbrachte die Mittagspause vor dem Computer, um sich anhand dessen, was er im Internet fand, ein Bild davon zu machen, was eigentlich passiert war.
Seine Recherche ergab Folgendes: Vor sieben Jahren war ein Filmteam von National Geographic bei Dreharbeiten im Amazonasgebiet von einem Tropensturm überrascht worden. Der Sturm war ungewöhnlich heftig gewesen, hatte ungewöhnlich weit im Inneren des Festlands gewütet und war zu einer ungewöhnlichen Jahreszeit aufgetreten: ein deutliches Zeichen der Veränderungen, die mit der Aufheizung des globalen Klimas einhergingen. So hatte man das damals kommentiert.
Besagter Tropensturm hatte das Gebiet, in dem die Filmcrew gedreht hatte, quasi hinweggeschwemmt. Mehrere Leute hatten nur noch tot geborgen werden können, andere waren seither verschollen, darunter ebenjene junge Frau, die letzte Woche überraschend wieder aufgetaucht war.
Das war zu dieser Zeit alles an ihm vorübergegangen. Vor sieben Jahren, da hatten er und Abigail ganz andere Sorgen gehabt. Ihr Sohn Dominic, damals dreizehn, war an seiner Schule in eine Drogengeschichte verwickelt worden, hätte als Zeuge gegen eine Bande älterer Mitschüler aussagen sollen, doch diese hatten ihn bedroht und unter Druck gesetzt. Es hatte ein glimpfliches Ende gefunden, aber bis dahin war es ein Albtraum gewesen.
Immerhin hatte Bob seither ein paar gute Freunde beim Los Angeles Police Department.
Bob sah auf sein knallgelbes Notizbuch hinab, in dem er sich Stichworte notiert hatte. Tracy, fiel ihm wieder ein. Niemand hatte je Therese zu ihr gesagt. Tracy Hitfield, so hatten sie alle genannt. Die Tochter von Alec Hitfield, dem Sohn jenes Autors, dem es so lange Zeit gelungen war, zu verheimlichen, dass er überhaupt eine Familie hatte.
Auf einmal war es Bob, als sei das alles erst gestern gewesen und als läge der ganze Weg, der ihn auf verschlungenen Pfaden hierhergeführt hatte, noch vor ihm.
Plötzlich fiel ihm ein, dass er Alec, seine Frau Carrie und die kleine Tracy einmal getroffen hatte – aber wo? Das Kind war damals, na, vielleicht zwei Jahre alt gewesen, ein tapsiger, blonder Wonneproppen.
Ewig her. Und oh Wunder, trotzdem hatte er die Nummer des Hitfield-Anwesens immer noch in seiner Adressdatei. Sie stimmte auch noch, als er sie anhand des Telefonverzeichnisses von Malibu überprüfte.
Die Zeiger hatten endlich zwei Uhr nachmittags erreicht. Eine Zeit, zu der man anrufen konnte, ohne beim Lunch zu stören. Bob holte tief Luft, griff nach dem Telefonhörer und wählte.
Es klingelte sechsmal, dann hob jemand ab. »Bei Hitfield«, sagte eine förmlich klingende Stimme. »Sie wünschen?«
»Hallo«, begann Bob in seiner fröhlichsten Stimmlage, »mein Name ist Bob Andrews, ich bin ein alter Freund der Familie. Mit wem spreche ich, wenn ich fragen darf?«
»Selena«, sagte die förmliche Stimme. »Ich bin zuständig für … das Sekretariat.« Sie sagte es auf eine Weise, die unprofessionell klang und so, als habe sie es noch nicht oft sagen müssen. Mit anderen Worten, Selena war eine Hausangestellte, der man die Aufgabe übertragen hatte, Tracy abzuschirmen.
»Selena«, wiederholte Bob, »wie gesagt, ich bin ein alter Freund der Familie, und als ich gehört habe, dass Tracy wieder da ist, musste ich mich einfach melden. Sagen Sie, könnte ich vielleicht mit ihr sprechen? Oder mit ihrem Vater, Alec?«
»Tut mir leid«, sagte Selena. »Ich darf persönliche Anrufe nur von Leuten durchstellen, die hier auf einer Liste stehen. Und Sie stehen nicht darauf, Sir.«
Mist. »Verstehe. Dann fragen Sie Alec … also, Mr Hitfield … er kennt mich sicher noch. Es ist eine Weile her, aber wir kennen uns. Die Sache ist die, dass ich Literaturagent bin, und ich möchte Tracy gern vorschlagen, ein Buch über ihre Erlebnisse herauszubringen. Selbstverständlich würde ich ihr bei allem helfen, beim Schreiben, bei der Verlagssuche und so weiter.«
»Da muss ich nachfragen«, sagte Selena. »Moment.«
Der Hörer wurde beiseitegelegt, Bob hörte, wie sich hallende Schritte entfernten. Richtig, diese große, dunkle Eingangshalle! In der die mehr oder weniger echten Erinnerungsstücke an Hitfields größte Fälle hingen. Die zwei riesigen Regale aus schwarzem Holz mit den unterschiedlichen Ausgaben all seiner Bücher, in sämtlichen Sprachen, in denen sie erschienen waren …
Jetzt fiel ihm auch wieder ein, wo er Tracy und ihren Eltern begegnet war: in der Eisdiele von Seaview Hill! Es war ein sonniger Tag im August gewesen, der Tag, an dem er Abigail zum ersten Mal mit zu seinen Eltern genommen hatte. Sie hatten damals schon Heiratspläne geschmiedet, da hatte man Leute mit kleinen Kindern natürlich mit anderen Augen gesehen.
Die Schritte kamen schlurfend zurück, der Hörer wurde raschelnd wieder aufgenommen. »Hallo? Tut mir leid, Miss Hitfield hat daran kein Interesse.«
»Aber –«, rief Bob.
»Guten Tag, Mr Andrews.« Und KLACK, war die Verbindung abgebrochen.
Bob legte enttäuscht auf. Nun, immerhin eine klare Antwort. Die auch nicht auf Unkenntnis gründete; schließlich entstammte Tracy einer Schriftstellerfamilie und wusste, was ein Nein in so einem Fall hieß.
Normalerweise hätte es Bob dabei bewenden lassen. Doch er spürte, dass es ihm bei dieser Sache nicht so leichtfallen würde, sie einfach abzuhaken. Er hätte zu gern mehr über diese überraschende Wiederkehr in Erfahrung gebracht – nur wie?
***
Gegen sechs Uhr abends schimmerten die Klauenfüße aus Messing wie Gold, und die Badewanne, die sie trugen, sah aus wie neu. Was sie nicht war, denn niemand stellte mehr solche Badewannen her. Was dieses Stück wiederum zu einer Antiquität machte. Justus Jonas hatte sie zwei Monate zuvor aus einem Haus gerettet, das abgerissen werden sollte, und Fergus und Stjepan hatten den halben Donnerstag damit verbracht, sie wieder auf Hochglanz zu polieren.
»War ’ne Höllenarbeit«, meinte Fergus.
»Ja, war so«, pflichtete ihm Stjepan bei.
»Aber sieht jetzt gut aus.«
»Ja, echt schön«, fand Stjepan. »Oder, Chef?«
Justus nickte. »Habt ihr großartig gemacht. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch täte.«
Die beiden grinsten breit, stießen sich mit den Ellbogen an.
»Stellt sie vorne in den Ausstellungsbereich. Dorthin, wo die Musiktruhe gestanden hat, die wir vorgestern verkauft haben.« Justus hatte keinen Zweifel, dass ihnen dieses Schmuckstück viel Geld einbringen würde. Es war genau die Art antiker Gebrauchsgegenstand, den sich Leute, die es sich leisten konnten, gern ins schick renovierte Loft stellten. »Und dann habt ihr Feierabend.«
»Alles klar, Chef«, sagte Stjepan und stieß Fergus an, sich in Bewegung zu setzen.
Fergus und Stjepan waren zwei Helfer, die Tante Mathilda vor fünfzehn Jahren ›zugelaufen‹ waren, wie sie sagte, und die seither genauso zum Inventar des Schrottplatzes gehörten wie Tante Mathilda selber. Die beiden waren nicht die hellsten Lichter – Fergus hatte die Schule früh verlassen und konnte nur mit Mühe lesen, Stjepan hatte eine dunkle Vergangenheit, über die er nie sprach –, aber sie waren groß, stark und verlässlich. Stjepan besaß außerdem einen Lastwagenführerschein.
Justus widmete sich wieder der Reparatur eines Rennrads, das ihm jemand aus Rocky Beach für einen symbolischen Dollar überlassen hatte. Seit einem schweren Sturz sei der Rahmen verzogen, hatte er gemeint, da sei nichts mehr zu retten.
Diese Art Geschwätz konnte Justus rasend machen. Er war entschlossen, zu beweisen, dass da sehr wohl noch was zu retten war.
Und dann würde er das Rad für mindestens fünfhundert Dollar verkaufen.
Die Werkstatt befand sich, vor neugierigen Blicken verborgen, im hintersten Teil des Schrottplatzes, auf der dem Tor gegenüberliegenden Seite, hinter einem wahren Gebirge von altem Zeug, das seit Jahrzehnten so manches Geheimnis versteckte. Genauso, wie es auch schon vor einem halben Jahrhundert gewesen war. Nur die technische Ausstattung hatte sich seither deutlich verbessert.
Justus war gerade dabei, das am schlimmsten verbogene Rohr behutsam mit einer Gasflamme zu erwärmen, als er unverkennbare, schleppende Schritte hinter sich hörte: Tante Mathilda.
»Justus«, sagte sie, »da ist eine Dame, die dich sprechen will.«
»Eine Dame?«, wiederholte Justus, ohne den Blick von der Stelle zu nehmen, die er bearbeitete. »Sag ihr, sie soll sich einfach umsehen. Und dass wir um halb sieben schließen.«
»Habe ich ihr schon gesagt, aber sie will ausdrücklich dich sprechen.«
Justus warf ihr einen konsternierten Blick zu. Was hatte er mit irgendwelchen Damen zu schaffen?
Und was hatte es mit dieser Dame auf sich, dass sie Tante Mathilda dazu brachte, ihn in seiner Werkstatt zu stören? Was er, wie sie genau wusste, nicht schätzte.
»Geh hin, Junge«, sagte sie. »Ich denke, es ist wichtig.«
Justus schaltete seufzend den Brenner ab. »Wenn du meinst …«
Tante Mathilda war fast neunzig Jahre alt und nicht mehr gut zu Fuß, aber es war immer noch aussichtslos, sich ihr zu widersetzen, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte.
Nach dem Tod von Onkel Titus war es ihr ein paar Jahre lang schlecht gegangen, und eine Weile hatte es so ausgesehen, als wolle sie ihm schnellstmöglich folgen. Doch dann hatte sie sich berappelt und war nun, abgesehen davon, dass ihr einst grauer Pagenkopf schneeweiß geworden war, wieder ganz die Alte. Gut, sie saß öfter und länger in ihrem gusseisernen Gartenstuhl auf der Terrasse als früher, trank den Kaffee dünner und brauchte eine Brille zum Lesen, aber auf ihren Sinn fürs Kaufmännische war noch immer Verlass.
Die Dame, wie Tante Mathilda sie genannt hatte, war eine mondän wirkende Frau, nur wenig jünger als Justus selber, auf jeden Fall über fünfzig, in einem teuren Kostüm, teuer frisiert. Durch das noch offen stehende Tor erspähte Justus einen blausilbernen Cadillac, der ihr gehören musste, denn sonst war niemand da.
Zudem kam ihm die Frau vage bekannt vor. Film vermutlich, sagte sich Justus, während er, sich die Hände an einem Handtuch sauber reibend, auf sie zuging. In der Umgebung von Los Angeles – insbesondere in den Straßen Hollywoods – wimmelte es nur so von Leuten, die man irgendwann schon einmal im Kino gesehen hatte.
Sie bedachte ihn mit einem wohlwollenden Lächeln und streckte ihm die Hand entgegen.
»Vielleicht besser nicht«, meinte Justus und zeigte seine immer noch ölige Handfläche vor. »Sie wollten mich sprechen?«
Sie nickte. »Wenn Sie Justus Jonas sind, ja.«
»Der bin ich. Womit kann ich dienen?«
Sie begann, in ihrem schimmernden Handtäschchen zu kramen. »Ich bin gekommen, um mich zu erkundigen,« sagte sie dabei, »ob das hier noch gilt.«
Damit hielt sie Justus eine uralte, zerknitterte Visitenkarte hin.
3
Justus nahm ihr die Karte behutsam ab, mit einem Gefühl, wie es ein Archäologe empfinden mochte, der auf einen verblüffenden Fund gestoßen war. Nur dass er hier einem Relikt aus seiner eigenen Vergangenheit begegnete, das unter den Sedimenten vieler Jahre, ja Jahrzehnte, eines ganzen Lebens verborgen gelegen hatte.
»Die drei Detektive gibt es schon lange nicht mehr«, sagte er mit einem seltsamen Schmerz in der Brust. Bestimmt eine Verspannung. Er hatte heute zu viel in der Werkstatt gestanden. »Tut mir leid.« Er hob die Karte hoch. »Darf ich fragen, woher Sie die haben?«
Wobei … wahrscheinlich hatte sie sie irgendwo gefunden. Sie hatten damals tausende dieser Karten verteilt, die konnten ja nicht alle verschwunden sein.
Sie ging gar nicht auf seine Frage ein, sondern zupfte ihm das zerdrückte Stück Papier wieder aus der Hand und fragte: »Wollen Sie nicht wenigstens hören, worum es geht?«
Justus musterte sie nachdenklich, unschlüssig, ob er das wollte oder nicht.
»Die drei ???«, fuhr sie fort, die Karte betrachtend. »Das Fragezeichen, hat mal jemand gesagt, sei das universelle Symbol des Unbekannten. Die drei Fragezeichen stünden für offene Fragen und ungelöste Rätsel.«
Moment mal! Das waren seine Sprüche gewesen damals! Justus musterte die Frau abermals. »Sagen Sie, kann es sein, dass wir uns schon mal begegnet sind?«
Sie nickte knapp. »Ja, sind wir. Das letzte Mal auf der Beerdigung meines Vaters.« Sie holte eine andere Visitenkarte hervor, eine nagelneue diesmal. »Mein Name ist Mary Blanche Kingsley, geborene Hitfield. Sie kennen meinen Bruder Alec.«
MBK Filmproduction Ltd., stand auf der Karte, neben einem Logo in den Farben Blau und Silber.
Justus wusste nicht, was er sagen sollte. »Meine Güte«, murmelte er schließlich. »Wie lange das alles her ist …«
»Ich habe damals ganz anders ausgesehen«, sagte sie. »Auf der Beerdigung, meine ich. Es hätte mich extrem gewundert, wenn Sie mich vorhin gleich erkannt hätten.«
»Mary Blanche«, wiederholte Justus, von vergessen geglaubten Erinnerungen überwältigt. »Sie waren seinerzeit eine Art Sagengestalt. Alecs Schwester, die man nie zu Gesicht bekam. Die in einem Internat in der Schweiz lebte. Angeblich. Niemand war sich sicher, ob Sie wirklich existierten.«
»Womit wir beim Thema wären«, erklärte sie.
Sie standen beide immer noch mitten in der kiesbestreuten Einfahrt. Fergus und Stjepan machten sich gerade auf den Heimweg, winkten fröhlich herüber, als sie durchs Tor hinausgingen. Es fing langsam an, zu dämmern.
Justus schob die Visitenkarte in die Brusttasche seines Hemdes und wies in Richtung der Terrasse, wo es neben der Theke, auf der sie an Tagen mit viel Andrang die Kasse aufstellten, ein paar Sitzgelegenheiten gab. »Wollen wir uns nicht setzen?«
»Ja, gerne«, sagte Mary Kingsley hoheitsvoll.
Sie stapften die wenigen Schritte bis zur Terrasse empor, und als sie saßen, brachte Tante Mathilda zwei Gläser und einen Krug mit selbst gemachter Zitronenlimonade. »Schön, wie um diese Zeit eine kühle Brise vom Ozean hochweht, nicht wahr?«, meinte sie. »Ich bin in der Küche, wenn ihr etwas braucht.« Damit tippelte sie wieder davon.
Mary Kingsley sah ihr nach. »Von Ihrer Tante habe ich immer nur Erzählungen gehört«, bekannte sie leise. »Es hat etwas Unwirkliches, zu sehen, dass es sie tatsächlich gibt.«
»Dann wissen Sie jetzt, wie es uns mit Ihnen ging«, meinte Justus und schenkte ihr ein.
Sie schmunzelte, nahm ihr Glas auf und begann zu erzählen. »Ins Internat geschickt hat mich mein Vater, weil ich ein schrecklich schwieriges Kind war. Ich habe es dort gehasst, aber rückblickend muss ich sagen, es war genau die richtige Entscheidung. Wieder nach Hause gekommen bin ich in der Zeit, als Dad sein Büro praktisch in die Filmstudios verlagert hat – ich glaube, damals ging es gerade um die Verfilmung von Eiskalte Rechnung. Das mitzuerleben fand ich faszinierend, also habe ich mich an der Filmhochschule eingeschrieben, habe einen meiner Mitschüler geheiratet, mich zwei Jahre später wieder scheiden lassen und eine Weile als Produktionsassistentin gearbeitet. Nach dem Tod meines Vaters habe ich mich mit meinem Erbteil selbstständig gemacht, eine Filmfirma gegründet und mich auf Dokumentarfilme spezialisiert, vor allem Naturfilme, aber auch alles andere – es gibt ja so viel Interessantes in der Welt.«
»Verstehe«, sagte Justus, nahm einen kräftigen Schluck Limonade und verbot sich Spekulationen, worum es wohl gehen mochte. Einfach zuhören war angesagt.
»Vor sieben Jahren war ich im Auftrag von National Geographic in Brasilien, im Amazonas, um eine Gruppe von Insektenforschern zu begleiten. Es war ein großer Auftrag, ein wichtiger Auftrag – und eine enorme Herausforderung, anspruchsvoller als alles, was ich bis dahin je gemacht hatte. Wir haben am Rand des Vale do Javari gedreht, einer Region, in der noch zahllose Stämme ohne jeglichen Kontakt zur Zivilisation leben. Vale heißt Tal, aber der Name führt in die Irre; tatsächlich ist das Gebiet größer als ganz South Carolina. Riesig also, und weitgehend unerforscht.«
»Klingt spannend«, bekannte Justus.
»Oh, spannend war es. Es ging ja um Insekten, und die sind verdammt schwierig zu filmen. Erstens, weil sie so winzig sind, zweitens, weil sie machen, was sie wollen, und drittens und viertens, weil das Ganze in einem Dschungel stattfindet, in dem es heiß und feucht ist und man mit tausend Widrigkeiten kämpfen muss.« Ihr Blick glitt davon, über den Schrottplatz, auf den sich silbernes Halbdunkel senkte. Eigentlich aber, so hatte Justus den Eindruck, blickte sie in die Vergangenheit. »Wir waren derart auf unsere Arbeit konzentriert, dass wir nicht bemerkt haben, wie sich ein Tropensturm zusammenbraut. Wobei so etwas in diesen Breiten blitzschnell geht, von einer Stunde auf die andere, oft noch schneller. Vielleicht wären wir aufmerksamer gewesen, wenn uns nicht alle versichert hätten, dass zu dieser Jahreszeit nichts zu befürchten sei. Jedenfalls, der Sturm brach über uns herein, und es war, als habe die Sintflut begonnen. Es hat alles weggespült, unser ganzes Lager, die Leute, die Ausrüstung, alles.«
Justus entsann sich dunkel, dass dieser Sturm damals Thema in den Nachrichten gewesen war. Man hatte ihn als Zeichen dafür verstanden, dass sich das Klima schneller als erwartet änderte.
»Ich erinnere mich«, sagte er. »Es hieß, im Amazonas seien namhafte Wissenschaftler Opfer eines Sturms geworden.«
»Ja. Die Hälfte aller Leute, die dabei waren, sind gestorben oder spurlos verschwunden. Ich selber habe mit viel Glück überlebt, aber …« Sie hielt inne, stellte ihr Glas auffallend behutsam ab, holte tief Luft. »Meine Nichte hat mich damals begleitet. Tracy. Sie wollte mit, wollte sehen, wie es bei so einer Expedition zugeht, und sie hat mich nicht groß überreden müssen, sie mitzunehmen, ich habe sie sogar darin bestärkt. Wir haben es als tolles Abenteuer betrachtet. Aber Tracy war am Ende unter den Verschollenen. Die Suchmannschaften haben keine Spur mehr von ihr gefunden.«
Justus spürte, wie in seinen Gedanken ein paar Puzzlesteine zusammenfanden. »Reden wir gerade womöglich von der Frau, die letzte Woche in Brasilien aufgetaucht sein soll?«
Mary Kingsley bedachte ihn mit einem rätselvollen Blick. »Genau das ist die Frage. Ob diese Frau wirklich Tracy Hitfield ist. Das ist es, was Sie für mich herausfinden sollen.«
Justus musterte sie verwundert. Er hatte mit allen möglichen Anliegen gerechnet, aber nicht damit. »Das heißt, Sie zweifeln daran?«
»Wäre ich sonst hier?«
»Wer sollte es denn sonst sein?«
»Das ist nicht die Frage«, erwiderte sie heftig. Dann setzte sie sich ruckartig zurecht, atmete tief durch und fuhr fort: »Ich werde einfach ein seltsames Gefühl nicht los. Sie sieht aus, wie Tracy heute aussehen würde, sie benimmt sich wie Tracy, sie redet wie Tracy, sie weiß noch alle möglichen Dinge von früher … gut, abgesehen von ein paar Erinnerungslücken hier und da, das ist ja verzeihlich … aber manchmal, in manchen Momenten, da habe ich trotzdem den Eindruck, es mit einer ganz anderen Person zu tun zu haben.«
»Sie hat sieben Jahre im Dschungel überlebt«, gab Justus zu bedenken. »So etwas verändert einen Menschen zweifellos.«
Mary Kingsley hob nur hilflos die Hände und ließ sie wieder in ihren Schoß fallen. »Ja. Das sage ich mir auch. Aber davon will das Gefühl nicht weggehen.«
»Die Behörden haben sie doch bestimmt identifiziert?«
»Davon gehen alle aus. Ich weiß aber nicht, wie das konkret abgelaufen ist. Ich weiß nur, dass Alec mich letzten Donnerstag angerufen und gesagt hat, Tracy ist wieder aufgetaucht, und am Samstag war sie dann tatsächlich da.«
»Das Einfachste wäre, einen Gentest machen zu lassen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Dafür ist mein Bruder nicht zu gewinnen. Er ist absolut überzeugt, dass seine Tochter zurückgekehrt ist.«
»Und Sie nicht?«
»Nein«, gestand Mary Kingsley, aber in der Art, wie sie es sagte, schwangen seltsame Töne mit, die Justus nicht zu deuten wusste. »Deswegen bin ich zu Ihnen gekommen. Mein Unbehagen ist nicht konkret genug, als dass ich mich an die Polizei wenden möchte. Nicht mal an irgendeinen Privatermittler. Doch ich erinnere mich noch gut, wie oft mein Vater über die drei ??? gesprochen hat, vor allem über Sie.«
Justus verzog das Gesicht. »Schmeichelhaft zu hören, aber das ist ein halbes Leben her. Die letzten Jahrzehnte habe ich mich nur als Kleinunternehmer und Umweltaktivist betätigt. Ich bin aus der Übung.«
Sie lächelte wehmütig. »Ich bin sicher, dass das so etwas ist wie Fahrradfahren: Man verlernt es nicht.«
Justus horchte in sich hinein, aber da war nur ein wildes Durcheinander widerstreitender Impulse. »Ich muss erst darüber nachdenken«, sagte er, zog ihre Visitenkarte wieder heraus und nahm sie näher in Augenschein. »Erreiche ich Sie unter dieser Nummer?«
»Ja, jederzeit«, erwiderte Mary Kingsley und erhob sich elegant. »Ich werde auf Ihren Anruf warten. Vielen Dank.«
Damit ging sie, ohne sich noch einmal umzusehen.
***
Als der Cadillac weg war, kam Tante Mathilda aus dem Haus.
»Und?«, wollte sie wissen. »War es wichtig?«
»Ich weiß es nicht«, bekannte Justus. »Sie will, dass ich wieder einen Fall übernehme.«
»Ah«, machte Tante Mathilda. »Und? Zahlt sie gut?«
»Wir haben nicht über Geld gesprochen.«
Sie schüttelte missbilligend den Kopf. »Hättest du aber tun sollen. Ehe man nicht über Geld spricht, weiß man nicht, wie wichtig den Leuten eine Sache ist.«
***
Am nächsten Morgen dachte Justus immer noch über das Gespräch vom Vorabend nach.
Eigentlich, sagte er sich, hätte Mary Kingsley unendlich glücklich sein müssen, dass ihre Nichte nach sieben Jahren, in denen man sie für tot gehalten hatte, wieder aufgetaucht war. Warum war sie es nicht?
Und wer sollte die Frau denn sonst sein, wenn nicht die, die sie zu sein behauptete?
Hinter der ganzen Sache steckte mehr als nur die Unsicherheit einer Frau, die sich zweifellos sieben Jahre lang mit Schuldgefühlen geplagt hatte. Bloß was?
Er sagte Fergus und Stjepan, was sie heute tun sollten, dann verzog er sich ins Büro, weckte den Computer auf und suchte erst mal nach Informationen über Mary Blanche Kingsley, geborene Hitfield.
Eine Google-Suche lieferte vier Millionen Einträge. Die Wikipedia listete Filme auf, die sie gedreht, und Preise, die sie bekommen hatte, wusste von Lehrtätigkeiten an ihrer alten Filmhochschule und dass der Mann, mit dem sie verheiratet gewesen war, Arthur Kingsley hieß und heute Spezialeffekte machte. Es gab jede Menge Fotos von ihr, Videos von Ansprachen, Danksagungen, Filmpremieren und Interviews, viele Äußerungen anderer, die ihre Bildgestaltung lobten, ihre Kameraführung, ihre Themenwahl, und immer wieder sagte jemand, ihre Filme hätten etwas an sich, an dem man einen Kingsley-Film sofort erkenne.
Die Website ihrer Firma sah eindrucksvoll aus, wartete mit atemberaubenden Fotos und jeder Menge Trailern auf und sparte nicht mit Eigenlob. Was allerdings, wie Justus wusste, in dieser Branche einfach dazugehörte.
Erinnerungen wurden wach. Mit Alec Hitfield hatte er ab und zu Kontakt gehabt, das stimmte. Aber Alec war vier Jahre älter als er, was, wenn man selber fünfzehn oder sechzehn ist, einen gewaltigen Altersunterschied darstellt. Zudem war Alec ein Schöngeist, hatte Literaturwissenschaft studiert und verwaltete heute die Rechte an den Büchern seines Vaters, die, was man so hörte, nach wie vor viel Geld einbrachten. Wenn er sich damals länger mit Alec unterhalten hatte, dann über technische Dinge. Alec hatte sich schon mit dem Internet ausgekannt, als die meisten Menschen noch nicht einmal das Wort gehört hatten, und hatte ihm eine Menge erklärt.
Mary dagegen … Justus erinnerte sich an sie als an ein ätherisches Wesen, das ab und zu durch das Anwesen der Hitfields geschwebt war. Er hatte seinerzeit höchstens zwei- oder dreimal Worte mit ihr gewechselt, und keine bedeutsamen. Auf der Beerdigung ihres Vaters hatte er sie gar nicht wahrgenommen, wenn er ehrlich war.
Justus rechnete zurück. Zwanzig Jahre war das schon her! Er seufzte. Unfassbar, wie schnell die Zeit verging.
Er musste daran denken, wie sie sich damals trickreich Zugang zum Büro von Albert Hitfield verschafft hatten, und daran, wie er ihn letztlich dazu gebracht hatte, ihnen ihren ersten Detektivauftrag zu erteilen: Indem er ihn nachgemacht hatte, und das so täuschend echt, dass Hitfield sich schließlich entsetzt ergeben hatte. Er werde sie beauftragen, hatte er versprochen, aber nur unter der Bedingung, dass Justus ihn nie wieder imitiere.
Justus drehte sich zur Seite, wo ein großer, alter Spiegel mit verschnörkeltem Rand darauf wartete, restauriert zu werden. Justus musterte sein Spiegelbild, veränderte seine Haltung, ließ die Backen hängen, senkte die Augenbrauen … Ja, er konnte es noch. Einzig der Bart störte.
Dann lehnte er sich zurück, begann, seine Unterlippe zu kneten. Was sollte er tun? Wie sollte er sich entscheiden?
Wobei … war das überhaupt eine Frage? Er wusste doch, dass ihm diese Sache ohnehin keine Ruhe lassen würde.
Und war nicht sowieso er immer der Kopf der drei ??? gewesen? Derjenige, der die Fälle gelöst hatte?
Wieder musterte er sich in dem alten Spiegel. Er hatte mal als schlauer Kopf gegolten, als jemand, der alle austricksen konnte, wenn es sein musste – wo war dieser Justus Jonas geblieben?
Das Leben war dazwischengekommen. Hatte den cleveren Justus aufgesogen und platt gebügelt, ihn zu jemandem gemacht, der alte Radios und Bügeleisen reparierte und nur versuchte, über die Runden zu kommen.
Tracy Hitfield. Im Amazonas verschwunden und sieben Jahre später wieder aufgetaucht. Ein Wunder, konnte man sagen.
Und eine Tante, die nicht an Wunder glaubte.
Interessante Geschichte, sagte sich Justus. Warum sollte er es nicht auch alleine hinbekommen, Klarheit in dieser Angelegenheit zu schaffen? So schwer konnte das nicht sein.
Er nahm die Visitenkarte der MBK Filmproduction Ltd. zur Hand und wählte die darauf angegebene Mobilnummer.
Mary Kingsley meldete sich nach dem dritten Klingeln.
»Justus Jonas hier«, sagte Justus. »Ich bin bereit, Ihren Auftrag zu übernehmen.«
»Wunderbar.«
»Können wir es so machen«, fuhr Justus fort, »dass ich Ihnen einfach die Zeit in Rechnung stelle, die ich dafür aufwenden muss, zu einem Stundensatz von einhundert Dollar?« Ehe man nicht über Geld spricht, weiß man nicht, wie wichtig den Leuten eine Sache ist.
Offenbar war Mary Kingsley die Sache äußerst wichtig, denn sie sagte: »Ja, kein Problem. Was immer es kostet.«
4
Bei Google zu arbeiten hielten viele für den Traumjob schlechthin. Das hörte Peter Shaw immer wieder. Er hatte auch tatsächlich wenig Grund, sich zu beklagen. Aber an einem sonnigen Freitag wie diesem dachte selbst er schon ans Wochenende, und den Vormittag mit Verwaltungskram verbringen zu müssen, konnte einem da durchaus wie eine Strafe vorkommen.
»Hmm, wofür war das noch mal?«, murmelte er und scrollte weiter abwärts. Natürlich lief alles am Bildschirm ab, waren alle Vorgänge höchstmöglich automatisiert, alle Abläufe optimiert. Intelligent nannte man das.
Trotzdem musste es einen Verantwortlichen geben, der Kostenanträge abzeichnete – oder sie mit Rückfragen versehen zurückschickte –, der Rechnungen billigte und Zahlungen freigab. Und dieser Verantwortliche war er.
Dabei war es mehr oder weniger Zufall, dass er hier saß. Peter Shaw hatte nach der Schule Geografie studiert und danach als Reisejournalist gearbeitet. Für einen Reiseführerverlag war er jahrelang durch die halbe Welt gereist, um die Angaben in den Büchern für Neuauflagen zu überprüfen. Das war eine aufregende Zeit gewesen, manchmal sogar zu aufregend. Dann war das Internet aufgekommen. Gedruckte Reiseführer kamen aus der Mode, und als Peter die Chance bekam, bei einer der ersten Firmen zu arbeiten, die digitale Karten für Navigationssysteme entwickelten, zögerte er nicht.
In die damit verbundenen Problemstellungen hatte er sich rasch reingefuchst, hatte sich dafür sogar mit Mathematik angefreundet, mit der er in der Schule auf Kriegsfuß gestanden hatte. Es hatte nicht lange gedauert, bis man ihm gesagt hatte, er sei unentbehrlich. Dann war Google aufgetaucht, rasend schnell zu einem Giganten gewachsen und hatte unter anderem die Firma aufgekauft, in der Peter gearbeitet hatte. So war er Teil des Google Maps-Projekts geworden, in dem er heute eine leitende Stellung innehatte. Zu seinem Job gehörte es, Satellitenbilder und Luftaufnahmen einzukaufen, mit Straßenbauämtern überall auf der Welt Informationen über geplante Straßen auszutauschen und den Teams auf die Finger zu schauen, die neue Restaurants, Hotels oder Supermärkte in die Datenbank eintrugen.
Und ab und zu hatte er auch so nervtötenden Kram zu erledigen wie das jetzt.
Was für eine angenehme Unterbrechung, als jemand an die Trennwand klopfte, die Peters Arbeitsplatz von den anderen abteilte, die sich an derselben Arbeitsinsel befanden, im Moment aber alle verlassen dalagen, und fragte: »Störe ich?«
Es war Norman Keeney, der gern mal durch die Gänge streifte, wenn er Bewegungsdrang verspürte, und andere von der Arbeit abhielt.
»Stören? Aber gar nicht!«, rief Peter aus und klickte die Kostenanträge weg. »Setz dich und erzähl!«
Norman war der ungewöhnlichste Computerfreak, den Peter kannte. Und er kannte etliche, in den lichten Hallen des Googleplex wimmelte es davon. Man konnte Norman wahrscheinlich nachts wecken, ihm irgendeine entlegene Frage stellen und er würde die korrekte Antwort heraussprudeln. Peter selber hatte ihm schon so manchen toten Computer anvertraut, und Norman hatte ihn wieder zum Leben erweckt.
Aber er ließ es nicht raushängen, belaberte niemanden mit Computerkram und entsprach auch sonst nicht dem Klischee: Er hielt an seinem Arbeitsplatz penibel Ordnung, kleidete sich geschmackvoll – und Pizza konnte er nicht ausstehen!
Um nichts davon ging es. Norman kam, weil er am Abend zuvor bei einem Konzert der Hot Pistons Reunion Tour gewesen war und versprochen hatte, zu berichten.
»War abgefahren«, meinte er, während er sich einen der freien Stühle heranzog, um sich hineinzufläzen. »Man kann sagen, was man will, die alten Herren haben’s immer noch drauf.«
»Haben sie auch ›Low To The Ground‹ gespielt?«, wollte Peter wissen.
»Aber hallo. Das war der Höhepunkt. Der Saal hat getobt.« Norman schüttelte sich. »War ein ziemlicher Dampf dort drinnen übrigens. Du kennst ja das Slim’s. Nicht gerade die gemütlichste Location, mit diesen blöden Säulen mitten im Zuschauerraum.«
»Hach ja, das Slim’s.« Peter ärgerte sich, dass er zu spät von dem Konzert erfahren und keine Karte mehr bekommen hatte. »Ich war ewig nicht mehr dort.«
»Dann solltest du mal wieder hin. Ich habe den Eindruck, lange machen die’s nicht mehr.«
Peter holte sich die Website des Clubs auf den Schirm, studierte den Veranstaltungskalender. »Es müsste eben wieder so was in der Art sein. Macht ja keinen Spaß, sich als alter Sack unter lauter Junggemüse zu mischen und über sich ergehen zu lassen, was die heutzutage für Musik halten …«
In diesem Moment klingelte sein Telefon. Ein Anruf von außen.
»Entschuldige.« Peter hob ab. »Shaw?«
»Hallo, Peter«, hörte er eine bekannte Stimme sagen, »hier ist Bob Andrews.«
»Bob?«, entfuhr es Peter. »Na, so eine Überraschung.«
Norman erhob sich, lächelte verstehend. »Ich sehe schon, die Pflicht ruft«, flüsterte er Peter zu und hob grüßend die Hand. »Wir sehen uns.« Dann huschte er davon, wie er gekommen war, und ließ nur den Geruch seines Aftershaves zurück.
»Störe ich gerade bei einer Besprechung?«, wollte Bob wissen.
»Nein, nein«, sagte Peter rasch. »War nur Norman, ein Kollege, der gestern bei einem Konzert der Hot Pistons gewesen ist. Du erinnerst dich vielleicht.«
»Die Hot Pistons? Gibt’s die denn noch?«
»Haben sich wieder zusammengetan und sind auf Tour. Sag bloß, das ist dir entgangen!«
Bob Andrews hatte, ehe er Literaturagent geworden war, bei einer Musikagentur gejobbt, bei einem gewissen Sax Sandler, und unter anderem auch mit der Band Hot Pistons zu tun gehabt. Später hatte er deren Leadsänger dazu gebracht, seine Autobiografie zu schreiben.
Insofern also ein seltsamer Zufall, dass Bob ausgerechnet in diesem Moment anrief. Nach so vielen Jahren Sendepause auf beiden Seiten.
»Lass uns nicht davon anfangen, was mir alles entgangen ist«, meinte Bob seufzend. »Ich rufe an, weil ich heute zufällig in der Gegend bin und dich etwas fragen müsste. Aber nicht am Telefon, dazu ist das Thema zu sensibel. Meinst du, wir könnten uns irgendwo zum Lunch treffen?«
»Ja, klar«, sagte Peter. Das kam ihm grade recht und bewahrte ihn davor, sich womöglich nur eine Veggie-Bowl zu holen und durchzuarbeiten. »Hast du schon eine Idee, wo?«
»Dein Revier, Peter. Aber ich lade dich ein.«
»Das wird ja immer besser.« Einer der Vorteile, bei Google zu arbeiten, war der, dass alle Informationen blitzschnell auf dem Schirm erschienen. Obendrein hatte Peter Tastenkürzel für die Seiten, die er häufig brauchte, und die Restaurantkarte der Umgebung war eine davon. »Wie wär’s mit dem Andalusia in Palo Alto? Ist ein Spanier, extrem gut. Die Gambas mit Knoblauch sind göttlich. Man darf hinterher allerdings nicht mehr unter Leute.«
»Sollte mein Navi finden«, meinte Bob. »Wann?«
»Sagen wir, ein Uhr? Ich reserviere uns online einen Tisch.«
»Prima. Dann bis später.«
Nach diesem Telefonat konnte sich Peter erst recht nicht mehr auf den Verwaltungskram konzentrieren. Er beschloss, den Rest auf Montag zu verschieben.
Mann, wie lange war das her, dass Bob und er sich gesehen hatten? Drei Jahre mindestens. Wenn nicht vier. Noch länger, seit er Bob und Abigail daheim besucht hatte. Obwohl er sich dort immer wohlgefühlt hatte. Abigail war eine überaus sympathische Gastgeberin. Aber Los Angeles, das hieß fünf Stunden Fahrt, Minimum. Und es gab so wenig, was ihn dorthin zog.
Das erste Mal zusammen hatte er die beiden bei der Taufe ihrer Tochter gesehen, Carolyn. Es kam ihm vor, als sei das gestern gewesen, dabei musste das Mädchen inzwischen … Er rechnete nach, erschrak: sechsundzwanzig? Meine Güte, wie die Zeit verging.
Solange man jung war, glaubte man, eine Ewigkeit liege vor einem, in der man alle Möglichkeiten hatte. Tja, aber so war es nicht. So ein Leben war schneller vorbei, als man es sich vorstellen konnte.
Und wer, dachte Peter, wüsste das besser als ich?
***
Die Borduhr zeigte 1 Minute nach 1 Uhr, als Peter auf den Parkplatz vor dem Andalusia einbog. Als er einen kanariengelben VW Beetle in einer der Buchten stehen sah, wusste er, dass Bob schon da war.
Das Restaurant war in einem Stil erbaut, den die meisten Leute für spanisch halten würden – tiefes Vordach mit runden, staubig wirkenden Dachziegeln, Rundbogenfenster, viel dunkles Holz und dergleichen –, aber in Wahrheit war es eher die Art, wie man in Mexiko baute. Pueblo-Stil. Doch die Karte, das wusste Peter von früheren Besuchen, bot tatsächlich spanische Küche.
Die Terrasse war gut besucht, das Zeltdach darüber spendete angenehmen Schatten, war aber ein Stilbruch. Kleine, rustikale Holztische, Korbstühle, bunte Sitzkissen. Peter wandte sich an den Kellner, sagte seinen Namen und dass er reserviert hatte.
»Ah ja, Ihr Gast ist schon da«, meinte der Mann. »Folgen Sie mir, Señor.«
Es ging nach drinnen, an einen Tisch, der abgeschirmt in einer Art Separee stand. Bob saß auf der Sitzbank zwischen einem Berg bunt bestickter Kissen, hatte ein Glas Wasser vor sich stehen und sah ein wenig verloren aus. Und im Grunde noch genau so, wie Peter ihn in Erinnerung hatte: immer noch schlank, das Haar immer noch strohblond und kräftig – nur die Brille war eine andere.
»Hallo, Bob«, sagte Peter und setzte sich auf den Korbstuhl gegenüber. »Wartest du schon lange?«
Bob schüttelte den Kopf. »Keine fünf Minuten. Hab im Stau gestanden und hatte Zweifel, ob ich es schaffe.« Er reckte sich. »Sag mal, wäre es draußen auf der Terrasse nicht angenehmer?«
»Bestimmt«, sagte Peter. »Aber wenn du etwas zu besprechen hast, das du nicht mal einer Telefonleitung anvertrauen willst, dann tun wir das besser hier drinnen. Draußen ist es in spätestens zwanzig Minuten so voll, dass dir die Leute praktisch auf dem Schoß sitzen.«
»Ah, okay«, meinte Bob und ließ sich wieder zurücksinken. »In dem Fall …«
Der Kellner tauchte auf, brachte die Karten, erkundigte sich nach Getränkewünschen.
»Ich muss erst sehen, was ich nehme«, erklärte Peter.
»Für mich noch ein Wasser, bitte«, sagte Bob.
Der Kellner nickte und entfernte sich wieder.
»Du wirkst nervös«, stellte Peter fest, während er die Speisekarte auffaltete. »Wenn das hier ein Film wäre, würdest du mir jetzt gleich eröffnen, dass der Geheimdienst hinter dir her ist, weil du zu viel weißt. Dann würdest du mir versichern, dass du mich in nichts hineinziehen willst und nur einen Gefallen brauchst, aber natürlich würdest du mich trotzdem in irgendwas hineinziehen, und in ein paar Stunden würden wir um unser Leben rennen.« Er sah Bob an. »Richtig geraten?«
Bob sah ihn verdutzt an, lachte dann. »Nein, nein, ganz falsch. Ich treffe nachher eine Professorin an der UC Berkeley, eine Biochemikerin, seit Jahren heiße Kandidatin für den Nobelpreis … na ja, und ich will sie überreden, rechtzeitig vorher ein Buch über ihr Leben zu schreiben. Das ist es, was mich nervös sein lässt.«
»Das machst du also immer noch. Leute dazu bringen, über ihr Leben zu schreiben. Musiker, Wissenschaftler …«
»Vor allem Wissenschaftler.«
Peter nickte in Richtung Parkplatz. »Ich habe gesehen, was Autos anbelangt, bist du back to the roots?«
»Ja, habe ich mir geleistet«, gab Bob zu. »Die Zeit der großen Familienkutschen ist vorbei, schon lange. Heute muss ich jeden Tag damit rechnen, Großvater zu werden.« Er gab einen Lacher von sich. »Unglaublich, oder?«
»Ja«, sagte Peter. »Wir werden alt. Sogar wir.«