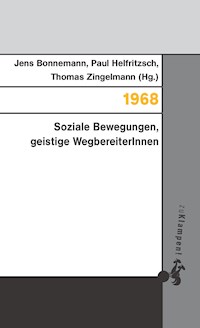Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
Was ist eine Ausstellung? Was macht man, wenn man ausstellt? Kann man sinnvollerweise behaupten, dass Ausstellungen einen Erkenntniswert haben? Thomas Zingelmann entwickelt in seinem Buch anhand zahlreicher Alltagsbeispiele einen differenzierten Ausstellungsbegriff, mit dem es möglich ist, verschiedene Formen und Funktionen von Ausstellungen zu unterscheiden und den Erkenntniswert von Ausstellungen sinnvoll zu begründen. Die mit der Behauptung, dass Ausstellungen zur Erkenntnis beitragen, verbundenen Ansprüche variieren von Vermittlungsfunktionen bis hin zur These, dass Ausstellungen den Wissenschaften äquivalent seien. Man erwartet von Ausstellungen, dass sie mit ihren je eigenen Mitteln zu den verschiedensten Themen Erkenntnisse erzeugen. Dieser Erkenntnisanspruch wird in der Regel kaum begründet, noch in den Kontext gegenwärtiger erkenntnistheoretischer Debatten eingebettet. Allerdings ist diese Diskussion oftmals noch durch eine andere Eigentümlichkeit gekennzeichnet: Was eine Ausstellung ist oder was man macht, wenn man ausstellt, wird wie eine Selbstverständlichkeit behandelt. Eine Philosophie des Ausstellens, die versucht, einen Erkenntniswert von Ausstellungen zu begründen, muss zuallererst aufweisen, was eine Ausstellung ist. Die Arbeit versteht sich im Sinne einer (formalen) Alltagsästhetik, welche Form und Funktion des Selbstverständlichen, Routinierten und Unauffälligen untersucht. Der Autor zeigt, dass Ausstellungen für den Selbst- wie den Weltbezug von Bedeutung sind.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Zingelmann
Die Ausstellung
Ästhetik und Epistemologie des Zeigens
Meiner
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹http://portal.dnb.de› abrufbar.
eISBN (PDF) 978-3-7873-4402-4
eISBN (ePub) 978-3-7873-4455-0
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2023. Alle Rechte vorbehalten. Dies betrifft auch die Vervielfältigung und Übertragung einzelner Textabschnitte durch alle Verfahren wie Speicherung und Übertragung auf Papier, Transparente, Filme, Bänder, Platten und andere Medien, soweit es nicht §§ 53 und 54 URG ausdrücklich gestatten. Konvertierung: Bookwire GmbH
www.meiner.de
Für Links mit Verweisen auf Webseiten Dritter übernimmt der Verlag keine inhaltliche Haftung. Zudem behält er sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Inhalt
Einleitung
1. Ausstellung und Erkenntnis: ein selbstverständlicher Anspruch?
a) Das Selbstverständnis im Ausstellungswesen
b) Die Behauptungen in der Forschung
c) Fehlende Erkenntniskritik: Fragen einer Philosophie des Ausstellens
2. Der Begriff des Ausstellens
a)Stand der Dinge: Positionen der Ausstellungstheorien
b)Platzieren: Ausstellen als Zeigen
c)Kollektion und Konstellation: Grundbegriffe einer Ausstellungsphilosophie
3. Der Erkenntniswert von Ausstellungen
a) Nicht-propositionale Erkenntnis: Ästhetik und Epistemologie
b) Welche Erkenntnisse produzieren Ausstellungen? Vier Vorschläge
c) Die expositorische Erkenntnis
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Internetquellen
Dank
Meiner Lehrerin Sabine Butzlaff gewidmet
Einleitung
Ästhetik ist heute immer auch Alltagsästhetik. Das ist keine Selbstverständlichkeit.
Denn: Die Geschichte der Ästhetik ist auch eine Geschichte der Berührungsängste. Orientiert man sich an den drei großen Klassikern der Ästhetik – Alexander Gottlieb Baumgarten, Immanuel Kant und Georg Wilhelm Friedrich Hegel –, dann erscheint die Ästhetik als eine Disziplin, die ihren Gegenstandsbereich immer weiter verengte: von Wahrnehmung über Schönheit zu Kunst. Die Zuständigkeit der Ästhetik betraf dann nur noch einen geringen Ausschnitt möglicher Phänomene. So war Ästhetik schließlich synonym mit Kunstphilosophie.
Aber: Man hat es heute glücklicherweise mit einer Entwicklung der Ästhetik zu tun, die eine gegenläufige Tendenz nimmt: Ihr Gegenstandsbereich weitet sich konsequent aus. Damit werden Themen möglich, die die Klassiker noch nicht vor Augen hatten – zum Teil auch nicht vor Augen haben konnten, wie beispielsweise die Fotografie. Hat die Ästhetik danach gefragt, was ein künstlerisches Bild ist, fragt sie inzwischen, was überhaupt ein Bild ist. Damit werden Gegenstände für die Ästhetik interessant, die vorher keiner Beachtung gewürdigt wurden.
Wie kam es zu dieser Entwicklung? Genau genommen beginnt diese indirekt sogar schon mit Hegel, und zwar durch seinen Schüler Karl Rosenkranz. Dieser ist insbesondere durch seine Ästhetik des Häßlichen bekannt geworden. Es lassen sich womöglich auch schon früher Arbeiten in der Geschichte der Philosophie finden, die nicht eines der drei Kernthemen der Ästhetik betreffen, von denen man aber avant la lettre sagen würde, dass es sich um Ästhetiken handelt. Das Besondere an Rosenkranz ist jedoch, dass er es explizit macht. Es geht ihm dezidiert darum, das Hässliche als ein ästhetisches Phänomen aufzufassen. Wenn auch Rosenkranz dem Schönen noch normativ verhaftet bleibt, so ist es sein Verdienst, dass er den Zuständigkeitsbereich der Ästhetik wieder öffnet.
Mit Beginn des 20. Jahrhunderts vollzieht sich dann die Expansion der Ästhetik: Es entwickelt sich die systematische Einsicht, dass es nicht die Themen sind, über die sich die Ästhetik definiert. Damit wird die Perspektive möglich, dass Baumgarten eine Vermögens-, Kant eine Erfahrungs- und Hegel eine Objektästhetik geschrieben hat. Je nach Perspektive können spezifische Vermögen oder Handlungen, Erfahrungen und Objekte zum Thema einer Ästhetik werden. So gibt es heute eine kaum noch überschaubare Fülle an ästhetischen Themen. Das kann die schon angesprochene Hässlichkeit sein, das Erotische, das Gruselige oder gar das Langweilige. Aber auch Sammeln, Konsum, Sport und Autofahren werden zu Themen der Ästhetik. Film, Mode, Kitsch und Designgegenstände werden für die Ästhetik interessant, wenn nicht gar zu ihren eigentlichen Gegenständen. Kunstphilosophie ist jetzt hingegen ein Teilbereich der Ästhetik. Die Vielfalt der Gebiete zeigt, dass auch das Alltägliche als Besonderes thematisiert und erfahren werden kann.
Das vorliegende Buch rückt ein Thema für die Ästhetik in den Vordergrund, dem bisher nur selten Aufmerksamkeit geschenkt wurde: Ausstellungen. Ausstellungen werden vornehmlich in Bezug zum (Kunst-)Museum thematisch. Aber so wie sich Kunst und Bild zueinander verhalten, lässt sich dies auch von Museum und Ausstellung sagen: So wie nicht jedes Bild ein Kunstwerk ist, ist auch nicht jede Ausstellung eine Museumsausstellung. Der Anspruch besteht darin, eine Bestimmung dessen zu geben, was eine Ausstellung ist und wie sie einen Erkenntniswert haben kann. Es geht darum, die logischen Bedingungen zu klären, unter denen eine Ausstellung zu einer Ausstellung wird. In diesem Sinn lässt sich auch sagen, dass sich das Buch die Aufgabe stellt, eine formale Ästhetik der Ausstellung zu begründen. Unter dieser Perspektive wird es möglich, den gesamten Bereich von Ausstellungen und Grenzphänomenen abzustecken und zu prüfen, welche Rolle Ausstellungen für Erkenntnis haben.
Die Ästhetik als Alltagsästhetik ermöglicht es, das Selbstverständliche, Routinierte und Unauffällige als bedeutsam für Selbst- und Weltbezug auszuweisen.
1. Ausstellung und Erkenntnis: ein selbstverständlicher Anspruch?
a) Das Selbstverständnis im Ausstellungswesen
Der Ausstellungsmacher Joachim Baur spricht in seinem Artikel »Ausstellen. Trends und Tendenzen im kulturhistorischen Feld« davon, dass, »wo auch immer wir unsern Schritt hinsetzen, […] wir auf eine Ausstellung von irgend etwas« stoßen.1 Wenn auch überspitzt formuliert, trifft Baur den Zeitgeist: Ausstellungen sind weitverbreitet und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit bei Publikum und Organisatoren. Dies lässt sich gut an der Entwicklung des Museums nachvollziehen: Das Museum ist der Ort der Aufbewahrung und Erforschung einer Sammlung, welche oft als Dauerausstellung präsentiert wird. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geht der Trend allerdings in die Richtung, das Museum als Gastraum für Wechsel- und Wanderausstellungen zu nutzen, wohingegen die Sammlung als Dauerausstellung vermehrt in den Hintergrund rückt. Diese Entwicklung hänge, so Baur, hier exemplarisch für das Kunstmuseum, eng damit zusammen, dass sich das Museum nach dem Zweiten Weltkrieg dahin entwickelt habe, auch gegenwärtige Kunst zu präsentieren, und es damit zu einer Aufgabenverschiebung »weg vom Sammeln, Konservieren und Erforschen hin zum Ausstellen, Kuratieren und Vermitteln« gekommen sei.2 Laut Wolfgang Ullrich haben wir es seit den 1960ern mit einem »Zeitalter des Ausstellens«3 zu tun. Mit dieser Entwicklung verschob, oder besser gesagt: erweiterte sich auch das Publikum und insbesondere richtete sich das Museum damit vermehrt auf ein breites Publikum aus.4 Man kann Baur in der Rede vom »Ausstellungsspektakel«5 nur zustimmen: Die Ausstellung »Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944« des Hamburger Instituts für Sozialforschung unter Leitung von Jan Philipp Reemtsma polarisierte seinerzeit in beträchtlichem Maße und stieß eine gesellschaftliche Debatte an, die ihren Gipfel am 13. März 1997 in einer Sitzung zur aktuellen Stunde im Bundestag erreichte. Aber auch die Erschließung neuer Räume und Orte für Ausstellungen abseits des Museums rechtfertigt die Rede vom Spektakel: Erinnert sei beispielsweise an die Ausstellung »mittendrin. Sachsen-Anhalt in der Geschichte«6, welche im ehemaligen Kraftwerk Vockerode stattfand.
Abseits thematischer Polarisierung und der Erschließung neuer Terrains kann man sich fragen, warum Ausstellungen eben diesen Stellenwert haben und so weitverbreitet sind. Ullrich fasst für die Kunst zusammen, was man auch als übliche Begründung für Ausstellungen lesen könnte: »Extreme Emotionen ließen sich ausgleichen und Integrationsfortschritte erzielen, ja Kunst könne sinnstiftend wirken, zu Seelenheil und zu kognitiven Mehrleistungen führen«7. Baur spricht vom Ausstellen als einer »grundlegenden Kulturtechnik«8. Ullrich konstatiert, dass man dazu neige, »Ausstellungen selbst die Veranschaulichung komplizierter Thesen zuzutrauen – und daher auch zuzumuten«9. Damit macht er auf einen Umstand aufmerksam, der auch in diesem Buch im Mittelpunkt steht: Ausstellungen liegen häufig Thesen oder Fragestellungen zugrunde, die sie durch die Praxis des Ausstellens zu beweisen, zu belegen oder zu erörtern versuchen. Ausstellungen verfolgen neben ihrer vermittelnden Funktion oft inzwischen auch eine explizit epistemische: Ausstellungen werden als Mittel zur Generierung von Erkenntnis angesehen. Dies ist insoweit besonders, als es den üblichen Anspruch, nämlich den, ein Lern- und Vermittlungsort zu sein, übersteigt und sich stattdessen als Ort der Erkenntnisgewinnung versteht. So spricht u. a. Alexandra Nöcke in ihrem Ausstellungsentwurf 50 Jahre Deutschland – Israel – Menschliche Beziehungen explizit von der Ausstellung als »Erkenntnisort«10. Es geht also vielerorts nicht mehr darum, ein gesichertes Wissen weiter zu vermitteln, sondern überhaupt erst Wissen mit den Mitteln des Ausstellens zu produzieren: »Das Museum soll Ort der Besinnung und der Erkenntnis durch historische Erinnerung sein. Es soll informieren, die Besucher darüber hinaus zu Fragen an die Geschichte anregen und Antworten auf ihre Fragen anbieten.«11 So lautet ein Auszug aus der Konzeption der Sachverständigenkommission für das Deutsche Historische Museum in Berlin aus dem Jahr 1987. Diese Sachlage lässt sich auch daran erkennen, dass es üblich ist, davon zu sprechen, dass eine Ausstellung eine These vertritt oder behauptet. Man hat es hierbei mit einem weitverbreiteten Verständnis von der Praxis des Ausstellens zu tun, dem man in Ausstellungstexten oder auch Rezensionen immer wieder begegnet. Martin Warnke beispielsweise leitet seine Rezension der Ausstellung »Macht zeigen – Kunst als Herrschaftsstrategie« mit den Worten ein: »Die Ausstellung hat eine klare These«12. Aber auch die wiedereröffnete – und hier schon erwähnte – Wehrmachtsausstellung wird in einer Rezension im Stern wie folgt betitelt: »Neue Ausstellung mit alter These«13. Diese Sätze mögen trivial erscheinen, da sie in unserem Alltagsverständnis übliche Formulierungen sind, die allerdings eine nicht zu unterschätzende Tragweite haben. Der Umstand lässt sich als epistemische Potenzierung des Ausstellens beschreiben.
Im Folgenden soll diesem Selbstverständnis nachgegangen werden, indem einige prototypische Selbstverständnisse, -beschreibungen und -behauptungen rekonstruiert werden. Was hat es damit auf sich, wenn das Museum in Relation zu Wissen, Erkenntnis und Bildung gesetzt wird? Welche sind die konkreten epistemischen Behauptungen über die Funktion des Museums? Was genau am Museum soll den epistemischen Wert garantieren? Lassen sich die Behauptungen epistemologisch typologisieren?
Museum und Erkenntnis
Was sich jedoch anhand all dieser Diskussionen feststellen lässt, ist, dass Rolle und Funktion des Museums inzwischen in überwältigendem Maße fast ausschließlich in Relation zu epistemischen Zwecken gedacht werden, ob diese nun als Wissen, Erziehung, Bildung oder Erkenntnis bezeichnet werden. Ganz gleich, ob es sich dabei um Ausstellungskataloge, -ankündigungen oder -flyer handelt: Es lässt sich kaum noch ein Museum finden, das nicht mit einer seiner Ausstellungen einen epistemischen Zweck zu erfüllen versucht. Andere Funktionen werden diesem untergeordnet. Die Unterhaltung wird der Bildung beispielsweise dienstbar gemacht. So bewirbt das DDR Museum Berlin seine Ausstellung damit, dass sie zeige, dass Geschichte nicht langweilig sein müsse.14 Oft hegen Museumsausstellungen den Anspruch, die Besucher über ein bestimmtes Thema zu informieren, indem sie Positionen, Meinungen, Objekte hierzu sammeln und zur Schau stellen. So bespricht man im Geschichtsunterricht in der Regel die deutsche Teilung und vielleicht besucht man im Rahmen einer Exkursion das DDR Museum Berlin. Die Vermittlung von Wissen über die DDR wird hier über die Interaktion oder mindestens die Zurschaustellung von typischen Objekten des – einmal mehr, ein andermal weniger – alltäglichen Lebens zu erreichen versucht. Ein Wissen soll also über den Umgang mit den Objekten generiert werden, etwa ein Wissen darüber, wie so ein Alltag wohl ausgesehen sein muss, beispielsweise durch die simulierte Fahrt mit einem Trabant P 601. Viele der Exponate werden von Texten begleitet, die die Objekte erklären und kontextualisieren. Sofern möglich, soll der Besucher dann mit diesen interagieren. So oder so ähnlich sind viele Museumsausstellungen organisiert, um Besuchern Wissen zu vermitteln – ob es sich nun um Naturgesetze, Alchimie, Knöpfe, Bienen, Barockmalerei oder die Geschichte des Buchdrucks handelt. Vornehmlich sollen Ausstellungen aber nicht mehr nur als Vermittlungsinstitution wissenschaftlicher Erkenntnisse gelten, sondern Erkenntnis selber mit den eigenen Mitteln generieren.
Ein Beispiel: Die Ausstellung »Making van Gogh. Geschichte einer deutschen Liebe« des Städel Museums bietet nicht nur eine Schau von Werken van Goghs: Darüber hinaus liegen ihr einige Fragen zugrunde: »Wie kam es, dass van Gogh gerade in Deutschland so populär wurde? Wer engagierte sich für sein Werk und wie reagierten die Künstler auf ihn?«15 Das Besondere – und eben auch Prototypische – ist nun folgende Aussage: »Die Ausstellung zeigt van Gogh als Schlüsselfigur für die Kunst der deutschen Avantgarde und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zum Verständnis der Kunstentwicklung in Deutschland zu Beginn des 20. Jahrhunderts.«16 Die Ausstellung zeigt also nicht nur die Werke, sondern etwas über die Werke van Goghs hinaus. Es handelt sich also nicht um eine Ausstellung der Werke van Goghs, sondern um eine Ausstellung über die Werke van Goghs. Zeigen bedeutet hier belegen, beweisen oder begründen. Der Einfluss van Goghs soll durch Gegenüberstellung seiner Werke mit beispielsweise denen von Max Beckmann und Ludwig Kirchner belegt werden. Ob der Besucher von dieser These überzeugt wird, hängt davon ab, ob sie visuell evident begründet werden kann. Die Exponate beziehungsweise ihre Gegenüberstellungen werden so verwendet, als ob sie Argumente wären. Die These soll bewiesen werden, indem bestimmte Dinge auf eine bestimmte Weise gezeigt werden.
Ein anderes prototypisches Beispiel: Es hat wohl nur selten im Ausstellungswesen so ein Spektakel gegeben wie jenes, das die beiden Fassungen, aber insbesondere die erste Fassung der Wanderausstellung »Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944« begleitet hat. So tourte die Ausstellung durch 34 Städte und konnte in den Jahren 1995–1999 ca. 900 000 Besucher anlocken, dabei wurde die Ausstellung jeweils mit der Rede einer bekannten Persönlichkeit eröffnet. Über die Beteiligung an und Initiierung von Kriegsverbrechen durch die deutsche Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs lagen bis zu den Neunzigerjahren die Ergebnisse ausführlicher Forschungen und genügend Beweise vor. Gleichwohl glaubte die deutsche Öffentlichkeit in weiten Teilen nach wie vor an den Mythos von der »sauberen Wehrmacht«17. Um diesen Mythos in der Öffentlichkeit zu widerlegen, organisierte das Hamburger Institut für Sozialforschung besagte Ausstellung, die sich inhaltlich vor allem auf Verbrechen während des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion konzentrierte. Das öffentliche politisch-publizistische Echo ist bis heute unerreicht: Es wurden teilweise Großanzeigen in Zeitungen geschaltet, um die Menschen von einem Besuch abzuhalten. In Bremen zerbrach beinahe die große Koalition aus CDU und SPD wegen der Eröffnung der Ausstellung, die erst aufgrund eines Senatsbeschlusses eröffnet werden konnte. Es kam sogar so weit, dass 1997 der Bundestag zweimal über diese Ausstellung debattierte. Begleitet wurde die Ausstellung auch immer wieder von Gegendemonstrationen durch Rechtsextreme. Trauriger Höhepunkt der Rezeption war ein Sprengstoffattentat 1999 in Saarbrücken. Kritik kam allerdings auch aus den Geschichtswissenschaften, die sowohl die Quellen selbst als auch den Umgang mit ihnen kritisierten, was dazu führte, dass die Ausstellung überarbeitet wurde und 2001 unter dem Titel »Verbrechen der Wehrmacht. Dimensionen des Vernichtungskrieges 1941–1944« auf erneute Wanderschaft ging.18
Beide Ausstellungen waren strukturell nicht die ersten ihrer Art, aber sie können als prototypisch gelten: Die Ausstellungen versuchen mit ihren Mitteln jeweils eine Position zu begründen oder zu beweisen. Diese Position wird insofern durch die Mittel des Ausstellens begründet, als die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung gesammelt und in Beziehung zueinander gesetzt werden. Die Ausstellungen wollen also nicht nur Ergebnisse der Wissenschaft präsentieren – denn dann könnte man auch wissenschaftliche Beiträge lesen. Was sie besonders macht, ist, dass sie den Anspruch vertreten, die Besucher nicht nur über den Ausstellungsgegenstand zu informieren, sondern darüber hinaus auch eine eigene These zu begründen: Die Verbrechen der Wehrmacht waren keine Einzelfälle, Verzweiflungstaten oder Ähnliches, sondern sie fanden systematisch statt; die Wehrmacht war an der Planung und Durchführung des Holocaust beteiligt; die Beteiligung ging nicht von einzelnen Menschen, sondern ganzen Truppenteilen aus und stieß kaum auf Widerstand; Antisemitismus und Rassismus waren weit verbreitet in der Wehrmacht; häufig wurden Befehle gegeben, die zu Kriegsverbrechen aufriefen – und auch oftmals ausgeführt wurden –; beabsichtigt war die Vernichtung der osteuropäischen Bevölkerung. Die zweite Fassung der Ausstellung legte den Fokus insbesondere auf die Zerschlagung des Mythos, dass die Soldaten und Offiziere nicht anders hätten handeln können. Es konnte gezeigt werden, dass sie, wenn sie einen Befehl verweigert hätten, lediglich mit einer Versetzung hätten rechnen müssen. Es ging den Ausstellungen um zweierlei: Zum einen sollten die Ergebnisse wissenschaftlicher Arbeiten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und zum anderen wollten beide Ausstellungen selbst eine These unter Beweis stellen. Die Ausstellungen versammelten wissenschaftliche Ergebnisse zu einzelnen Orten, Tätern, Daten und Ereignissen und versuchten somit den totalitären Terror der Wehrmacht aufzuzeigen. Damit ging der Anspruch über reine Vermittlung hinaus: Sie zeigten, wie systematisch die Verbrechen der Wehrmacht angelegt waren.
Diesen Anspruch findet man bereits 1923 und womöglich auch schon früher: Ernst Friedrich gründete in diesem Jahr das Anti-Kriegs-Museum, das durch das Zeigen von Bildern der Folgen und Konsequenzen des ersten Weltkrieges die Besucher vom Grauen des Krieges überzeugen und damit zu einem pazifistischen Wandel beitragen wollte. Ein pazifistisches Weltbild war zu dieser Zeit keine Selbstverständlichkeit, was die vielen Anfeindungen und Prozesse gegen Friedrich wegen seiner pazifistischen Bestrebungen zeigen. Im Jahr 1924 erschien das Buch Krieg dem Kriege, das das Material von Friedrichs Sammlung präsentiert, wie sie in seinem Museum ausgestellt war. Friedrich war insbesondere der Meinung, dass Bilder der Überzeugung mehr dienten als Worte.19
Prototypisch sind diese Beispiele deswegen, weil sich unzählige Ausstellungen an diesem Format orientieren: Es sollen eigene Thesen und Aussagen vorgebracht und begründet werden. Hierin liegt der epistemische Anspruch. Schaut man sich unterschiedliche Ausstellungskonzepte und -selbstverständnisse an, dann stößt man darauf, dass Ausstellungen zeigen, darstellen, vergegenwärtigen, etwas ermöglichen, inszenieren, hinterfragen, vermitteln, Thesen aufstellen, Antworten suchen, sich Antworten annähern, erzählen, sich mit etwas auseinandersetzen, etwas betrachten, nach Definitionen suchen, etwas deutlich machen, etwas augenfällig machen, etwas evozieren, Labore sind, ästhetische Erfahrung ermöglichen, Experimente erzwingen, Forschungsplattformen sind, Versuchsanordnungen sind, etwas zu erkennen geben, etwas erfahrbar machen und etwas dokumentieren sollen. Es gibt also zwar unzählige unterschiedliche, aber doch jeweils epistemische Selbstverständnisse. Zur Klarstellung: Immer wieder wird betont, dass es nicht die Ausstellungstexte sein sollen, die den spezifischen epistemischen Wert ausmachen.20 Der Erkenntniswert der Ausstellung soll vielmehr in der Praxis, also im Umgang mit oder dem Zeigen von Exponaten liegen. So auch das Selbstverständnis des Studienprogramms Kulturen des Kuratorischen der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig: »Das Kuratorische versteht sich […] als eine kulturelle Praxis, die über das Ausstellungmachen selbst deutlich hinaus geht und sich zu einem eigenen Verfahren der Generierung, Vermittlung und Reflexion von Erfahrung und Wissen entwickelt hat.«21
Ein großer Fundus für diese Form epistemischer Ansprüche an das Ausstellen bietet in Form von Selbstverständnissen der Band Themen zeigen im Raum des Deutschen Hygiene-Museums Dresden. Das Kapitel »Reflexionen. Kuratorische und gestalterische Praktiken des Ausstellens« beinhaltet viele verschiedene Zusammenfassungen verschiedener Kuratoren und Kuratorinnen über erfolgte Ausstellungen sowie Interviews, Stellungnahmen und Diskussionen hierzu. Der Titel dieses Kapitels ist doppeldeutig: Er meint nicht nur Reflexionen über das Ausstellen, sondern behauptet, dass das Ausstellen eine reflektierende Praxis sei. Das DHMD möchte durch seine Ausstellungen Standpunkte beziehen, ja sie mit den Ausstellungen begründen. Damit geht seinem Selbstverständnis nach auch einher, mit den Exponaten selbst zu argumentieren.22 Das DHMD ist dabei der Überzeugung, dass Ausstellungen anderen medialen Aufbereitungen zu einem Thema gegenüber, wie etwa einem Buch oder einer Reportage, ein Mehrwert zukommt, indem durch das Ausstellen ein Thema auf eine besondere Art erschlossen werden kann. Demgemäß stehe vor jeder Ausstellung die Frage: »Muss es eine Ausstellung sein?«23 Dass Ausstellungen in dieser Hinsicht ein epistemischer Mehrwert zukomme, versuchen die einzelnen Zusammenfassungen deutlich zu machen, was im Folgenden anhand einiger Beispiele rekonstruiert wird.
Bodo-Michael Baumunk spricht in seiner Zusammenfassung der Ausstellung »Darwin und Darwinismus. Eine Ausstellung zur Kultur- und Naturgeschichte« davon, dass Ausstellungen »am Ende ganz andere Akzente, oft sogar wortlos-selbsterklärende Pointen anstelle der ursprünglich beabsichtigten«24 setzten. Was eine wortlose Pointe sein soll, darüber wird nichts gesagt, lediglich dass die Ausstellung dies bewiesen habe und die Exponate nicht bloß Veranschaulichungsmaterial für Thesen seien. Annette Lepenies, Kuratorin der Ausstellung »Alt & Jung. Das Abenteuer der Generationen«, ist der Meinung, dass Ausstellungen »nicht die ›Wahrheit‹ eines Themas, sondern jeweils bestimmte Interpretationen davon«25 präsentieren. Die Ausstellung ist ihrer Ansicht nach ein »Lernort«26, der sich allerdings dadurch auszeichne, dass die Besucher ihr Wissen »›konstruieren‹«27, da die Ausstellung eben keine Geltungshoheit beanspruche.
Die Ausstellung »Der Neue Mensch. Obsessionen des 20. Jahrhunderts« von Nicola Lepp versuchte »die Arbeit am Menschen im 20. Jahrhundert«28 zu thematisieren. Interessant, insbesondere in epistemologischer Hinsicht, ist, dass diese Ausstellung um »eine nicht vorrangig sprachliche, sondern visuelle Argumentation«29 bemüht war. Diese Form des Ausstellens zeichne sich dadurch aus, dass »das Erzählen mit den Dingen sich vom sprachlich-logischen Erzählen dadurch [unterscheidet], dass es auf diese Kontextualisierung durch andere Dinge angewiesen ist«30. Eine klare Aufgabenstellung hatte die Ausstellung »Kosmos im Kopf. Gehirn und Denken«: Es »sollten herkömmliche Denkweisen aufgebrochen und neue Formen der Wissens- und Erkenntnisgewinnung initiiert werden«, indem »traditionelle Wissenskonzepte«31 hinterfragt wurden. Einen anderen Weg, Besucherinnen und Besucher von etwas zu überzeugen, ging die Ausstellung »Kraftwerk Religion. Über Gott und die Menschen«, da sie sich zum Ziel setzte, dass der Besucher »beim Gang durch die Ausstellung vielleicht manche sicher geglaubte Wahrheit«32 aufgeben sollte. Es ging hier also darum, spezifische Meinungen als falsch zu überführen. Die Ausstellung »Images of the Mind. Bildwelten des Geistes aus Kunst und Wissenschaft« stellte einen besonderen Anspruch an die Besucher: Die szenografische Gestaltung der Ausstellung sollte die »sinnlichen Erkenntnismöglichkeiten«33 ansprechen: »Die Szenografie leitet die Besucher*innen durch die Ausstellung und vermittelt ihnen fühlbare Erkenntnis.«34 Einen äußerst engagierten Anspruch vertrat die Ausstellung »tanz! Wie wir uns und die Welt bewegen«: Die Ausstellung »war ein Versuch, die Grenzen musealen Ausstellens zu überschreiten und durch Einbindung weiterer Erkenntniswege die Dominanz des Sehens zu überwinden«35.
Die Aufzählung ließe sich problemlos weiterführen. Es ließe sich nun einwenden, dass das Hygiene-Museum ein spezifisches Ausstellungskonzept verfolgt, das einem Ausstellen zuzuordnen ist, dass eben einen epistemischen Anspruch erhebt. Sicherlich versteht sich das Hygiene-Museum als »Diskursort«, jedoch lassen sich auch genügend Ausstellungen finden, welche darum bemüht sind, die affektive Dimension der Besucher anzusprechen. Und dieser Punkt sollte nicht unterschlagen werden: Nicht jede Ausstellung stellt sich eine epistemische Aufgabe. Ausstellen bedeutet nicht per se Erkenntnis generieren. Jedoch: Diese funktionelle Verknüpfung findet man immer häufiger und das DHMD ist ein prototypisches Beispiel, welches diesen Anspruch institutionell verankert hat. Der Philosoph und Kurator Daniel Tyradellis fasst zusammen: »Jede Ausstellung ist der Versuch einer Antwort. […] Ihr kleinster gemeinsamer Nenner ist, unter der Vorgabe mindestens eines der vier ›E‹ – Erkenntnis, Erziehung, Erinnerung und Erbauung – Räume mit unterschiedlichsten Dingen zu füllen.«36 Tyradellis ist es auch, der an der Schnittstelle zwischen Ausstellungswesen und -theorie ein vehementer Vertreter des epistemischen Potentials von Ausstellungen ist: In seiner 2014 erschienen Monografie Müde Museen. Oder: Wie Ausstellungen unser Denken verändern können versucht er zu begründen, dass das Museum oder die Ausstellung »Ort genuiner Wissensproduktion«37 ist. Aber: »Ausstellungen sind Denken im Raum. Nach dem bisher Dargestellten dürfte klar sein, dass damit weniger eine Realität als ein Anspruch formuliert ist.«38 Tyradellis – dazu wird im dritten Kapitel mehr zu sagen sein – spricht gar von einer eigenen Wissensart, die die Ausstellung konstituiere: »Das Wissen und das heißt: das Anders-Denken, entsteht aus dem Umgang mit den Dingen und mit den Wahrnehmungsweisen der Besucher. Ein solches Tun ist nicht theoretisch simulierbar; es erschöpft sich nicht in der Übersetzung existierenden Wissens, sondern stellt ein Wissen eigener Art dar«39.
Diese Struktur – und darum soll es hier gehen und nicht darum, inwieweit diese Ansprüche jeweils erfüllt werden – lässt sich in gegenwärtigen Ausstellungen zuhauf wiederfinden. Es ist der Versuch, ein Thema mit den Mitteln des Ausstellens zu erschließen und eine Antwort oder auch Position zu begründen. Man ist also vermehrt der Auffassung, dass der (Museums-)Ausstellung die Rolle zukommt, auf verschiedene Weisen eine epistemische Institution für die Gesellschaft zu sein – analog zur Wissenschaft. Bis hierhin sollte ein Ausschnitt der Selbstverständnisse, die sich im Ausstellungs- und Museumswesen finden lassen, gegeben werden. Diese Behauptungen lassen sich inzwischen aber auch in Forschungsbeiträgen finden. Man findet hier eine regelrechte epistemische Potenzierung der Ausstellungen. Im Folgenden wird ein Überblick über den gegenwärtigen Stand der Debatte um das epistemische Potential der (Museums-)Ausstellung gegeben.
b) Die Behauptungen in der Forschung
Die Behauptung, dass Ausstellungen epistemisch relevant seien, lässt sich nicht nur in den Selbstverständnissen des Ausstellungs- und Museumswesens finden, sondern auch in der Fach- und Forschungsliteratur: Seit den 1990ern erscheinen vermehrt Monografien, Sammelbände oder Beiträge, die dieses Verhältnis thematisieren oder zumindest schneiden. Von einer regelrechten Debatte lässt sich aber nur schwerlich sprechen. Es sind doch eher historische, pädagogische oder gestalterische Aspekte von Ausstellungen, die in der Forschungsliteratur vor allem besprochen werden. Theorien im Sinne philosophischer Begriffsarbeit markieren dabei nur einen marginalen Teil, da dieses Forschungsfeld philosophisch bisher kaum erschlossen ist. Dementsprechend muss, wer dem Verhältnis von Ausstellung und Erkenntnis nachgehen will, vornehmlich im Bereich der Museumsforschung recherchieren. Dort wird deutlich, dass zwischen den Ansprüchen von Museumsausstellungen und der Geschichte des Museums ein enger Zusammenhang besteht.
Funktionswandel des Museums
Das Selbstverständnis, das dem im Jahr 2018 erschienenen Band Themen zeigen im Raum des Deutschen Hygiene-Museums in Dresden zugrunde liegt, steht prototypisch für diesen Trend in der Museums- und Ausstellungslandschaft überhaupt: Das Museum ist »ein Ort gesellschaftlicher Selbstreflexion«40. Auch wird festgestellt, dass es aufgrund der Vielfalt der Museumslandschaft immer schwieriger wird, eine Definition der Institution Museum aufzustellen. Diese Behauptung wird evident, wenn man sich vor Augen hält, welches Spektrum an Themen und Ausrichtungen angeboten wird: Neben den klassischen Kunst- und Technikmuseen finden sich vermehrt auch Heimat- und Spezialmuseen wie das Bratwurstmuseum, das Artistenmuseum, das Knopfmuseum, das Bienenmuseum, das Regenschirmmuseum, das Zusatzstoffmuseum oder auch das Spielkartenmuseum. Es gibt kein Thema, das nicht musealisiert werden könnte. Die Geschichte und Ausdifferenzierung des Museums ist hierbei wissenschaftlich gut erschlossen und schon seit den 1980er Jahren fester Bestandteil der Forschung. Die Zahl der Studiengänge und Lehrstühle, welche sich weitestgehend auf Museen spezialisieren, ist in den letzten Jahren angewachsen. Es sprechen also strukturelle und institutionelle Gründe dafür, dass das Museum als Forschungsthema weiterhin und zunehmend von Interesse ist.41 Wissenschaftliche Debatten haben gezeigt, wie bedeutsam und anschlussfähig das Thema ist. Die Zahl der Beiträge zum Museum als wissenschaftlichem Gegenstand ist kaum noch überschaubar. Sicher ist: Es gibt Fragestellungen und Probleme, die mehr und intensiver diskutiert werden als andere, und damit auch eher Kernthemen der wissenschaftlichen Forschung zum Museum. Darunter fällt nach wie vor sicherlich die Frage, ob das Museum eher ein Ort der Reflexion oder der Unterhaltung ist.42 Aber auch pädagogische und didaktische Fragen und Probleme stehen oft im Zentrum der Forschung, weil gesamtgesellschaftliche Entwicklungen neue Konzepte erfordern, beispielsweise im Zusammenhang mit der Digitalisierung.43 Besser formuliert: Wenn man sich einen Überblick verschafft hat, dann zeigt sich, dass es pädagogische, szenografische und didaktische Arbeiten sind, die das Gros der Museumsforschung ausmachen. Arbeiten aus diesen Bereichen bilden ein oft zwiespältiges Genre, da sie versuchen, den Spagat zwischen wissenschaftlicher Literatur und Anleitung zu schaffen.44 Hat man es hier noch mit Themen zu tun, die das Museum im Allgemeinen und in seiner Gegenwart betreffen, differenziert sich die Vielfalt der Themen ins Unendliche aus, sobald man die verschiedenen Museumstypen in Betracht nimmt. Denn es handelt sich nicht nur um allgemeine, kategoriale Abhandlungen zum Museum45, sondern es geht oftmals um spezifische Museumstypen46 – Kunst-, Technik-, Geschichts- und Amateurmuseum beispielsweise – oder um bestimmte Museen47 oder bestimmte Museumsausstellungen48. Nimmt man dann noch angrenzende Bereiche hinzu, wie das Science Center, die Wunderkammer und das Schaudepot49, dann wird es rasch unübersichtlich.
Neben diesen museumsspezifischen Arbeiten, also zu allem, was Museen als Museen betrifft, gibt es allerdings auch noch Beiträge – und hier bewegt sich ein Großteil der aktuellen Veröffentlichungen –, die das Museum in Bezug zu anderen Themen setzen. Es geht dann darum, welche Rolle das Museum in Relation zu Politik, Gesellschaft, Bildung, Erziehung und Kunst spielt.50 Das Museum wird insbesondere als vergesellschaftende Instanz identifiziert.51 Ausgehend von den Postcolonial Studies steht hierbei zur Debatte, inwieweit Museen durch ihre Sammlungen und deren Präsentationen Diskriminierung und Rassismus begünstigen oder reproduzieren.52 Darüber hinaus wird auch diskutiert, welche Möglichkeiten Museen haben, um zur Demokratisierung beizutragen und die Integration der Bürger zu unterstützen.53
Diese thematische Vielfalt im Bereich Museum ist sicherlich kein Alleinstellungsmerkmal. Man kennt dies auch aus anderen Bereichen wie Sprache, Raum, Körper oder Bild. Von einem museal turn54 zu sprechen, ist der Sache daher nicht angemessen, wenn auch das Museum mit all seinen Aspekten mehr und mehr in den Fokus der Forschung rückt. Dass das Museum dann der Ausgangspunkt für grundlegende Forschungsfragen sein soll, ja gar der unhintergehbare Horizont für das In-der-Welt-Sein oder das Denken55, wie etwa die Sprache beim linguistic turn, ist vermessen. Denn es gibt Kulturen, die keine Museen haben, aber doch in der Welt sind.
Man kann es so formulieren: Die Funktionen, die dem Museum zugesprochen werden, sind vielfältig. Üblicherweise werden dem Museum drei grundlegende Aufgaben zugeteilt: das Sammeln, Bewahren und Ausstellen.56 Hinsichtlich der Ausstellungsfunktion wird dann weiter ausdifferenziert. Typisch ist etwa folgende Forderung: »Ausstellungen sollen unterhalten, bilden und neue Erkenntnisse vermitteln.«57 Der Ausstellung werden also auch unterschiedliche Funktionen – hier im Verbund – zugesprochen. Diese lassen sich dann weiter zergliedern, denn Unterhaltung und Bildung lässt sich auf verschiedene Weisen bewerkstelligen und verstehen.
Abseits dieser thematischen und funktionellen Vielfalt fällt jedoch auf, dass ein bestimmtes Thema verhältnismäßig konstant seit rund 40 Jahren von Interesse ist: In welcher Relation steht das Museum zur Erkenntnis? Auf welche Art erfüllt das Museum oder die Museumsausstellung eine epistemische Funktion? Nach der Rolle der Erkenntnis im Museum fragt etwa Bernadette Collenberg-Plotnikov: »Ist das Museum vor allem ein Ort der Dokumentation, der Gewinnung und Zirkulation wissenschaftlicher Erkenntnis? Wandelt sich die Erkenntnisfunktion des Museums? Ist die Erkenntnisfunktion gefährdet, wenn Museen zunehmend einem Bedürfnis nach Unterhaltung zu entsprechen suchen?«58
Es ist insbesondere der Tagungsband Das Museum. Lernort contra Musentempel59 aus dem Jahr 1976, der für nachhaltigen Furor in der Museumsdebatte sorgte, da er bereits im Titel die beiden womöglich kaum zu vereinbarenden Hauptpositionen nennt. Aber schon in dieser Debatte zeichnet sich ein Trend ab – oder begründet ihn vielleicht sogar –, der heute maßgeblich die Sicht auf Funktion und Rolle des Museums bestimmt. In besonderem Maße wird im besagten Band eine Position stark gemacht, die heute als eine Art Gemeinplatz in der Debatte um das Museum gelten kann: Museen sind Institutionen, in und durch die Menschen etwas über sich und die Welt lernen.60 Der epistemische Wert des Museums wird dann in der Ausstellungsfunktion gesehen, ohne dass dies ausschließt, dass auch die anderen Funktionen zur Erkenntnisgewinnung beitragen. Diese Idee – die der Position, dass es sich beim Museum lediglich um einen Ort der kontemplativen Besinnung handle, konträr entgegensteht – setzt sich immer weiter durch. Dies lässt sich an Bemühungen zeigen, die darin bestehen, ein möglichst großes Publikum zu erreichen und damit möglichst vielen Menschen ein spezifisches Thema in Bildungsabsicht näher zu bringen. Genau genommen sind die Beschreibungen des Museums oder der Ausstellungen als Bildungs- und Wissenschaftsinstitutionen gar nicht so neu: Beispielsweise spricht schon Siegfried Giedion 1929 vom Museum als »Versuchslaboratorium«61. So zeigt auch Walter Hochreiter in seiner Arbeit Vom Musentempel zum Lernort. Zur Sozialgeschichte deutscher Museen 1800–1914, wie ein funktioneller Wandel stattgefunden beziehungsweise sich das Selbstverständnis geändert hat. Es lässt sich also feststellen, dass der epistemische Anspruch an Museen nicht unbedingt eine Modeerscheinung ist, sondern dass sich eine zumindest begriffliche Orientierung – insbesondere an den Naturwissenschaften62 – schon seit rund 100 Jahren zeigt. Dies dürfte auch damit zusammenhängen, dass um die Zeit der Jahrhundertwende erstmals thematische Ausstellungen eröffnet werden und nicht nur Sammlungsschauen von Objekten zu sehen sind.63 So oder so wird deutlich, dass der Ausstellungsfunktion im Museum vermehrt ein epistemischer Wert zugestanden wird.
Zwei Prototypen musealer Erkenntnis
Trotz der übersichtlichen Forschungslage zeigt sich, dass es in der Debatte zwei argumentative Grundpositionen gibt. Anke te Heesen thematisiert explizit das Verhältnis des Ausstellens zur Wissensgenerierung in kultur- und wissenschaftshistorischer Perspektive, vor allem in dem Sammelband Dingwelten. Das Museum als Erkenntnisort64. Hier werden die beiden Grundpositionen bezüglich epistemischer Ansprüche an Ausstellungen besonders ersichtlich: Museale Erkenntnis hat entweder die Form naturwissenschaftlicher oder reflexiver Erkenntnis.
Die Position, dass die museale vergleichbar mit naturwissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung sei, ist dabei wohl die häufigste Auffassung. Exemplarisch sei hier der Sammelband Wissenschaft im Museum. Ausstellung im Labor genannt: Ausstellungen seien mindestens strukturell ähnlich zu Laboren, Experimenten oder Versuchsanordnungen, wenn sie nicht sogar als solche bezeichnet werden.65 Es wird dann entweder historisch aufzuzeigen versucht, dass es schon immer eine Verschränkung von naturwissenschaftlicher Erkenntnis und Formen des Ausstellens gegeben habe, oder eben systematisch, indem untersucht wird, inwieweit man es entweder mit einem analogischen oder identischen Verhältnis von naturwissenschaftlicher und ausstellerischer Erkenntniserzeugung zu tun hat. Das heißt, dass es eine Position gibt, die eine Nähe – wenn nicht gar eine Identifizierung – mit der Naturwissenschaft oder ihren Methoden behauptet. Anke te Heesen und Margarete Vöhringer machen in Ihrem Sammelband folgende Feststellung: »Doch die Rolle des Präsentierens von Wissen und damit die Herausbildung der Ausstellungsbewegung selbst ist bislang kaum beleuchtet worden. Mit ihr stellt sich die Frage, wie die Praxis des Darstellens im Raum wiederum mit Wissen(-schaft) in Verbindung zu bringen wäre. […] Inwiefern sind die dem Museums- oder Ausstellungsraum zugewiesenen Verfahren bereits Teil eines Erkenntnis- und Arbeitsprozesses?«66 Gefragt wird dann beispielsweise, ob »nicht das räumliche Präsentieren im Labor als wissenschaftliche Praxis verstanden werden«67 müsse. Dabei beruft man sich auf die sogenannte Historische Epistemologie, für die stellvertretend Karin Knorr-Cetina und Hans-Jörg Rheinberger68 genannt seien. Ausstellen steht dann auf einer Ebene mit den Praxen des Beobachtens, Experimentierens oder Messens.69
Die andere Position zur Erkenntnisform von Ausstellungen sieht eine Nähe zu Formen geisteswissenschaftlicher oder künstlerischer Erkenntnisgenerierung: Ausstellen als Form der Reflexion. Hierbei wird dann beispielsweise vom »diskursiven Museum«70 oder dem Museum als »Diskursort«71 gesprochen. Man beruft sich auf Alexander Gottlieb Baumgarten oder auf Immanuel Kant. In dieser Argumentation dominieren Ansätze, die eine Verschränkung künstlerischer mit philosophischer Erkenntnisgenerierung behaupten. Auf den Punkt gebracht soll das heißen, dass in Ausstellungen Philosophie betrieben wird – bloß ohne Sprache. Das wohl bekannteste Beispiel für diese Überzeugung und ein entsprechend umgesetztes Ausstellungskonzept ist Les Immatérieux des Philosophen Jean-Francois Lyotard.72 Ähnliche Überzeugungen findet man aber auch in dem 2018 erschienen Band Das Museum als Provokation der Philosophie. Beiträge zu einer aktuellen Debatte.73 Aber auch der Band Evidenzen des Expositorischen geht der Frage nach, ob die Ausstellung ein Medium der Reflexion sei.74 Es kommt gar zu Meta-Fragen wie: »Ist eine Ausstellung immer auch eine Reflexion über das Ausstellen oder sollte sie es zumindest sein?«75
c) Fehlende Erkenntniskritik: Fragen einer Philosophie des Ausstellens
Auch wenn sich die genannten Beispiele in ihrer jeweiligen Position zum Verhältnis von Ausstellung und Erkenntnis unterscheiden, so teilen sie doch bemerkenswerterweise eine gemeinsame Ansicht: Ausstellen ist dann eine epistemisch relevante Tätigkeit, wenn sie entweder im Museum erfolgt oder diese Tätigkeit irgendwo erfolgt, wo sie sich mit der im Museum vergleichen lässt, beispielsweise im Labor (stellvertretend seien noch einmal die beiden Titel Das Museum als Erkenntnisort und Wissenschaft im Museum genannt). Das Museum selbst ist demzufolge der entscheidende Faktor dafür, dass Ausstellungen eine epistemische Funktion zukommt. Dies hat mit einer weit verbreiteten Sprechweise zu tun, in der die Wörter ›Ausstellung‹ und ›Museum‹ nahezu äquivok verwendet werden. Mindestens aber lässt sich feststellen, dass, wenn von Ausstellungen die Rede ist, damit entweder Museums- oder Kunstausstellungen gemeint sind. Auch wenn explizit beispielsweise vom »Ausstellungswesen«76 die Rede ist, täuscht doch dieser allgemeine Begriff darüber hinweg, dass nur die musealen Ausstellungsphänomene im Fokus der jeweiligen Arbeit stehen oder aber es um die Ausstellung von Kunst geht.77
Zwar wird – und dafür ist die Studie von Mai ganz prototypisch – oft auf die Geschichte des Ausstellens verwiesen, in der den Weltausstellungen eine erhebliche Bedeutung zukommt, aber Weltausstellungen sind keine musealen Ausstellungen und sind oder waren nicht nur darauf bedacht, Kunst auszustellen. Es lässt sich also eine Verengung des Ausstellungsbegriffs konstatieren. Dies ist insofern problematisch, als es bedeutend mehr Beispiele und auch Formen des Ausstellens gibt, als in der Forschungsliteratur behandelt werden. Denn wenn dem Ausstellen ein Erkenntniswert beigemessen wird, gilt dieser dann auch für Ausstellungen abseits des Museums? Ein anderes Problem ist, dass diese historischen Arbeiten in der Regel eher an den Erscheinungsformen als am Begriff interessiert sind. Dementsprechend wird schon vorweg mit einem impliziten Verständnis von Ausstellung gearbeitet, etwa wenn konstatiert wird, dass sich die Erscheinungsformen von Ausstellungen historisch wandeln.78 Gerade bei Autoren wie Gottfried Korff79 wird ganz selbstverständlich vom epistemischen Potential von Ausstellungen gesprochen – aber eben in Museen. Selbst Autoren wie Alexander Klein80, die einen umfassenderen Ausstellungsbegriff haben, reduzieren ihn, sobald es um das epistemische Potential von Ausstellungen geht, auf museale Formen. Vergegenwärtigt man sich das Beispiel der Wanderausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht, verwundert diese verbreitete Ansicht, die Praxis des Ausstellens mitsamt einem epistemischen Anspruch institutionell zu binden. Sicherlich finden die meisten der Ausstellungen mit epistemischem Anspruch in Museen statt, aber eben nicht ausschließlich. Dazu, warum nun das Museum diesen epistemischen Stellenwert hat und andere Orte des Ausstellens kaum bis gar keine Erwähnung finden – obwohl der Erkenntniswert mittels Ausstellungsfunktion behauptet wird –, wenn es um den Zusammenhang von Ausstellung und Erkenntnis geht, wird nichts gesagt. Es geht in der Debatte mit Selbstverständlichkeit immer ums Museum. Dadurch wird nahegelegt, dass sich der epistemische Wert dadurch ergibt, dass die Ausstellung im Museum stattfindet, und nicht dadurch, dass es sich überhaupt um eine Ausstellung oder um eine spezifische Form davon handelt. Die Forschungsliteratur tendiert dazu, eine Relation zwischen Ausstellung und Erkenntnis nur dann zu behaupten, wenn man das Museum mit in Betracht zieht.81 Es lässt sich darüber hinaus der Schluss ziehen, dass es innerhalb dieser Debatte einen selbstverständlichen Gebrauch des Ausstellungsbegriffs gibt. Genau diese Selbstverständnisse werden allerdings nicht artikuliert oder thematisiert.
Nun wird dem Museum, wie bereits erwähnt, klassischerweise eine dreifache Funktion zugewiesen: Sammeln, Bewahren, Ausstellen. Wie Anke te Heesen hervorhebt, ist das Ausstellen jedoch eine noch junge Funktion des Museums.82 Dass Museen überhaupt ausstellen, in dem Sinne, dass sie ihre Exponate der breiten Öffentlichkeit zugänglich und erfahrbar machen, sei nach te Heesen durch das Aufkommen und den großen Erfolg des Ausstellungswesens im 19. Jahrhundert zu erklären. Diese Funktion ist es auch, die den Kern über die Debatte des epistemischen Werts oder der epistemischen Funktion des Museums ausmacht. Es geht also nicht darum zu behaupten, dass die Sammlung von Gegenständen und deren Erforschung und Aufarbeitung die genuine epistemische Leistung des Museums sei: Man ist sich darüber einig, dass hier ein erkenntnisgewinnender Prozess stattfindet. Vielmehr wird behauptet, dass der (Museums-)Ausstellung aufgrund ihrer spezifischen Funktion eine epistemische Leistung zukommt und sie sich somit von vermeintlich anderen erkenntnisgenerierenden Prozessen unterscheidet, sich aber eben auch als solche qualifiziert. Das Museum bietet den Anlass zu überprüfen, inwieweit die Behauptung, dass Ausstellungen Erkenntnis generieren, sinnvoll ist. Denn inwieweit Ausstellungen ein Erkenntniswert zukommt, ist bisher mehr behauptet als begründet worden. Dementsprechend liegt der Fokus einer Philosophie der Ausstellung auf der gesamten Breite des Ausstellens. Das hat zur Folge, dass der Gegenstandsbereich der Philosophie des Ausstellens über den des Museums hinausgeht: denn, so die Überzeugung, ausgestellt wird auch an anderen Orten. Sicherlich ist es so, dass es vornehmlich die Museumsausstellungen sind, in welchen Ansprüche dieser Art auffindbar sind. Ob aber sinnvoll behauptet werden kann, dass Ausstellungen Erkenntnis generieren, ist eine kategoriale Frage: Es geht darum zu klären, ob die Relation Ausstellung und Erkenntnis überhaupt sinnvoll gedacht werden kann, ohne schon im Spezifischen über das Museum reden zu müssen. Die These ist, dass Erkenntnis nicht deswegen generiert wird, weil es sich um ein Museum handelt, sondern weil auf eine bestimmte Art ausgestellt wird.
Ausstellungen beziehen Stellung: Sie versuchen, mit ihren Mitteln nicht nur einen Überblick über ein Thema zu geben oder einen spezifischen Wissensstand wiederzugeben, sondern einen eigenen Standpunkt, eine Meinung, eine Position mit eben diesen Mitteln zu begründen. Ausstellungen haben also in diesen Fällen Thesen zur Grundlage – die sie oft auch als Titel tragen. Lediglich eine These zur Debatte zu stellen, kann jedoch nicht hinreichendes Merkmal für Wissen sein, die These muss in irgendeiner Form bewiesen werden. Und an diesem Punkt wird es vage: Wie Ausstellungen Erkenntnisfunktionen übernehmen, was an Ausstellungen Erkenntnis ist, wer überhaupt das Erkenntnissubjekt ist, ist oftmals nicht klar.
Dass die Behauptung, dass Ausstellungen Erkenntnis generierten, ein inzwischen häufig anzutreffendes Selbstverständnis und auch Thema wissenschaftlicher Abhandlungen ist, ist ersichtlich geworden. Die Beispiele haben deutlich gemacht, dass mit diesem Anspruch allerdings auch unterschiedliche epistemische Ziele beziehungsweise Verständnisse verbunden sind, denn es zeigt sich bei näherer Betrachtung, dass ein ungemein weites Begriffsfeld bedient wird. Es sind beispielsweise Begriffe wie Argumentation, (ästhetische) Erfahrung, Erkenntnis, Evidenz, Experimentalanordnung, Labor, Methode, Reflexion, Wissen und Wissenschaft, die in Selbstverständnistexten und der Forschungsliteratur häufig – wenn nicht gar inflationär – gebraucht werden. In nahezu allen Ausstellungen, die von sich behaupten, dass sie einen epistemischen Anspruch haben, sollen die Ausstellung selbst oder ihre Exponate so etwas wie ein Beweis oder ein Argument darstellen, wenn nicht gar eine ganze Debatte abbilden, also »multiperspektivisch«83 sein.
Genau dieser Hintergrund macht Ausstellungen in philosophischer Hinsicht interessant. Denn es stellt sich die Frage, was in diesen Kontexten überhaupt mit Erkenntnis gemeint ist. Man hat es hier mit einem – in der Philosophie – höchst kontrovers diskutierten Begriff zu tun, gerade dann, wenn es um Erkenntnis geht, die man als nicht-propositional bezeichnet. Dass die Erkenntnisse in und durch Ausstellungen nicht in Form von Propositionen auftreten, scheint unstrittig, weil Ausstellungen keine Propositionen sind. Unter einer Proposition versteht man in der Regel den wahrheitsfähigen Inhalt einer Behauptung. Wenn André zu wissen meint, dass Federica Geburtstag hat, dann ist die Proposition Federica hat Geburtstag. So wird zwar, wie gezeigt wurde, oft behauptet, dass Ausstellungen diese oder jene Aussagen treffen. Doch das lässt sich in diesem Sinn nur vom Titel oder dem begleitenden Ausstellungstext behaupten: denn die Objekte in den Ausstellungen können weder wahr noch falsch sein. Vor dem Hintergrund des Ausstellens stellt sich also die klassische Frage, was Erkenntnis ist und welche Möglichkeiten Menschen haben, diese zu gewinnen. Der philosophische Mehrwert liegt darin, dass man sich das Problem der Erkenntnis über ein vielversprechendes und aktuelles Thema erschließt, das das Nachdenken darüber, was Wissen und Erkenntnis ist, neu herausfordert. Dazu, ob sich dieser Zusammenhang von Ausstellung und Erkenntnis nun rechtfertigen – oder womöglich auch abstreiten – lässt, fehlt es an einer systematischen, dezidiert epistemologischen Begründung. Aufgrund dieses Begründungsdefizits sagt Ullrich vollkommen zu Recht, dass »eine Medienkritik, die differenziert analysiert, wozu Ausstellungen geeignet sind und wozu nicht, […] jedenfalls noch auf sich warten [lässt]. Vielmehr geschieht vieles erstaunlich unreflektiert, über fundamentale Unterschiede zwischen Sprechen und Zeigen wird naiv hinweggegangen.«84
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass vielerorts ein epistemisches Potential des Ausstellens behauptet wird. Diese Behauptung bleibt aber aus mehreren Gründen vage und wird kaum expliziert. Eines der Probleme betrifft die Unbestimmtheit des Erkenntnis- und Wissensbegriffs, da entweder nicht klar herausgestellt wird, worin die epistemische Funktion oder der epistemische Wert besteht, oder aber nicht begründet wird, wie dieser einzulösen ist. Auffällig ist, dass diese Behauptungen institutionell an das Museum gebunden werden. Dadurch bleibt aber undurchsichtig, ob nun das Museum oder aber die Ausstellung die entscheidende Variable ist. Gemeinhin lesen sich viele der Behauptungen so, dass Museen die Orte seien, an denen sich das epistemische Potential der Ausstellungen realisiert. Was das aber mit dem Museum als solchem zu tun hat, wird nicht expliziert. Das führt zu einer zweiten Problemlage: Dass nur schwach begründet wird, wie Ausstellen zu einer Erkenntnis führt, hat nicht nur damit zu tun, dass der Begriff der Erkenntnis unterbestimmt ist; der des Ausstellens respektive der Ausstellung ist es ebenfalls. Um die verschiedenen Ansätze eines Ausstellungsbegriffs nachvollziehen zu können, ist es daher sinnvoll zu sondieren, in welchem Kontext diese aufgestellt werden, wenn begriffliche Begründungen ausbleiben. Es muss also nachvollzogen werden, wer sich mit welchem Anspruch mit Ausstellen und Ausstellungen auseinandersetzt.
Dieser Umstand ist das Grundproblem der Debatte: Ohne einen klar definierten Ausstellungsbegriff lässt sich überhaupt nicht sinnvoll eine Relation zum Begriff der Erkenntnis behaupten. Man hilft sich mit anderen Begriffen wie dem des Zeigens, Darstellens und Präsentierens. Aber auch hier gilt, dass nicht klar wird, was all diese Praktiken auszeichnet. Ab wann kann man sinnvollerweise davon sprechen, dass etwas ausgestellt ist? Wodurch unterscheidet sich das Luftfeuchtigkeitsmessgerät im Ausstellungsraum von Exponaten? Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit man es mit einem Ausstellen zu tun hat und nicht mit einem Präsentieren oder ähnlichen Akten? Oder kann man jenes mit diesem identifizieren? Bevor klar sein kann, dass womöglich musealen Formen des Ausstellens epistemische Funktionen zukommen können, muss zuerst geklärt sein, was Ausstellen in seiner Allgemeinheit überhaupt ist. Es muss einen Begriff des Ausstellens geben, der die unterschiedlichen Ausstellungsphänomene unter sich versammelt und gleichzeitig diese auch differenzieren kann. Es scheint eine lohnende Überlegung zu sein, die Praxis des Ausstellens nicht per se darüber zu definieren, wo ausgestellt wird, sondern darüber, was man macht, wenn man ausstellt. Im Nachfolgenden soll überprüft werden, was das Ausstellungswesen unter Ausstellen versteht – unter Beachtung dessen, unter welchen Aspekten das Thema Ausstellung thematisiert wird.
Die Philosophie des Ausstellens wird durch die Frage geleitet, was ein sinnvoller Begriff des Ausstellens sein kann, mit welchem man dann das Verhältnis zur Erkenntnis begründen kann. Was behauptet man notwendigerweise, wenn man sagt, dass etwas ausgestellt ist? Was kann man vom Ausstellen behaupten, das dann für alle Ausstellungsphänomene gilt? Inwieweit kann, wenn man von diesem Begriff ausgeht, behauptet werden, dass Ausstellen einen Erkenntniswert hat? Geht man mit der Behauptung mit, dass Ausstellungen zuweilen Thesen oder Behauptungen aufstellen – beispielsweise gleich im Titel –, muss man klarstellen: Wenn Ausstellungen für ihre Thesen und Behauptungen argumentieren, dann nicht in einer üblichen Weise. Die Exponate in einer Ausstellung sind keine Aussagen – egal ob es sich dabei um Bilder, Texte, Dokumente, Videos oder Dinge handelt. Wie aber soll es dann möglich sein, diese Thesen zu beweisen, eben Erkenntnis zu generieren? Wie können dann Ausstellungen epistemisch relevant sein, wenn der Modus der Erkenntnisgenerierung, ja die Art der Erkenntnis selbst, nicht klar ist?
Um diese Frage beantworten zu können, muss geklärt sein, was überhaupt Erkenntnis ist und ob es eine nicht-propositionale Form von Erkenntnis geben kann. Diese klassische Frage bildet den roten Faden. Die Frage nach dem Erkenntniswert von Ausstellungen ist herausfordernd und provozierend, weil gefragt werden muss, mit was für einer Art von Erkenntnis man es zu tun hat. Die Frage, die damit verbunden ist, lautet, was man über die Welt und auch sich selbst wissen kann und wie. Zu wissen, wie sich Schmerz anfühlt, oder zu wissen, wie man Auto fährt, oder zu wissen, dass die Erde sich um die Sonne bewegt, sind grundverschiedene Wissensformen. Welche Formen von Wissen gibt es und welche Möglichkeiten, diese zu erlangen? Und in welchem Verhältnis steht die Ausstellung zu diesen? Man findet sich nämlich nicht in einer Situation wieder, in der Behauptungen durch Gründe bewiesen werden, sondern in einer Konstellation von verschiedenen Objekten.
Anhand des Themas der Ausstellung und des Ausstellens soll im Folgenden ein Beitrag zur Diskussion um nicht-propositionale Erkenntnis geleistet werden. Man hat es nämlich mit einer für diese Fragestellung komplexen, aber auch interessanten Situation zu tun: Einerseits begegnet man dem schon erwähnten verbreiteten Selbstanspruch – gleich ob intern aus dem Ausstellungswesen oder extern in der wissenschaftlichen Literatur. Hier bedarf es einer Analyse und Kritik des Möglichkeitshorizonts von Ausstellungen. Andererseits sind viele Ausstellungen multimedial organisiert: Die Präsenz und Konstellation der Exponate scheint ein wichtiger Ansatzpunkt zu sein, um das Verhältnis von Ausstellung und Erkenntnis zu klären: Denn genau dieses Charakteristikum der Multimedialität – und das fängt schon beim Verhältnis von Text und Exponat an – wirft grundlegende Fragen und Probleme auf: Welche Rolle kommt verschiedenen menschlichen Vermögen im Erkenntnisprozess zu, etwa der Wahrnehmung oder verschiedenen Vergegenwärtigungsleistungen wie etwa dem Erinnern? Sind die Bedingungen für eine mögliche Erkenntnisfunktion in ostentativen Handlungen zu suchen? Wer ist das Erkenntnissubjekt in Ausstellungen – der Ausstellungsmacher oder der Rezipient? Die Frage nach dem Verhältnis von Ausstellung und Erkenntnis eröffnet also einen spannenden Fragekomplex, der an viele verschiedene Debatten in der Erkenntnistheorie anknüpft: Gerade am Beispiel des Ausstellens lassen sich grundlegende Einsichten in die menschliche Erkenntnisfähigkeit gewinnen. Die Philosophie des Ausstellens wird durch die Frage geleitet, welches die epistemischen Möglichkeiten und Grenzen des Ausstellens sind.
Es soll der These nachgegangen werden, inwieweit es eine Relation zwischen Ausstellung und Erkenntnis geben kann. Dieser Wechsel im Selbstverständnis hat eine Potenzierung der Praxis des Ausstellens zur Folge. Somit rückt Ausstellen in den Fokus als epistemische Praxis und es stellt sich die Frage, ob Ausstellen so etwas wie eine wissenschaftliche Methode sein kann. Damit werden Ausstellungen philosophisch relevant und von besonderem Interesse: Es ist der Begriff der Erkenntnis, welcher problematisch wird, denn die Praxis der Wissenschaft ist eine ganz andere als die des Ausstellens. Aber ist Wissenschaft die einzige Möglichkeit, Welt- und Selbstverständnis zu erlangen? Von welcher Form kann die durch Ausstellungen gewonnene Erkenntnis sein und wie ist die Praxis zu beschreiben, durch die sie produziert wird? Haben Ausstellungen überhaupt einen Erkenntniswert und wenn ja, wie? Oder hat man es hier mit einer problematischen Verwendung von Begriffen zu tun?
Damit diese epistemologischen Fragen beantwortet werden können, ist es zwingend erforderlich, einen Begriff der Ausstellung