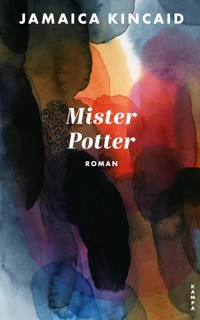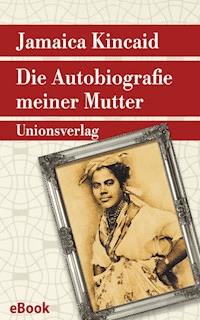
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Erst im hohen Alter schafft es Claudette Richardson, sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Sie berichtet von ihrer Lebensreise in Dominica: Die eigene Mutter stirbt bei der Geburt, sie wächst bei einer Pflegemutter auf. Wie soll sie, gefangen in innerer Einsamkeit, lieben lernen? Stattdessen entdeckt sie ihren Eros und heiratet zuletzt einen reichen weißen Mann, der sie nie glücklich machen kann. Jamaica Kincaids Roman handelt von Müttern und Töchtern, Widerstand, Lust und Macht und dem Erbe der Kolonialzeit: unerbittlich, verstörend und berückend. Auf der Weltempfänger-Bestenliste (Dez. 2013)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 289
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Claudette Richardson erzählt ihre Lebensreise in Dominica: Die eigene Mutter stirbt bei der Geburt, sie wächst bei einer Pflegemutter auf. Wie soll sie, gefangen in innerer Einsamkeit, lieben lernen? Stattdessen entdeckt sie ihren Eros und heiratet zuletzt einen reichen weißen Mann, der sie nie glücklich machen kann.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Jamaica Kincaid (*1949) wanderte mit 16 Jahren von Antigua in die USA aus, wo sie zunächst als Au-pair-Mädchen arbeitete. Ihre Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sie unterrichtet Literatur am kalifornischen Claremont McKenna College und an der Harvard University.
Zur Webseite von Jamaica Kincaid.
Christel Dormagen (*1943) studierte Germanistik und Anglistik. Nach kurzer Tätigkeit als Lehrerin begann sie, als Journalistin für Printmedien und Radio sowie als freie Übersetzerin zu arbeiten.
Zur Webseite von Christel Dormagen.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Jamaica Kincaid
Die Autobiografie meiner Mutter
Roman
Aus dem Englischen von Christel Dormagen
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die amerikanische Erstausgabe erschien 1996 unter dem Titel The Autobiography of My Mother im Verlag Farrar, Straus & Giroux, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1996 im Wolfgang Krüger Verlag, Frankfurt am Main.
Originaltitel: The Autobiography of My Mother
© Jamaica Kincaid 1996
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Jan Matoska und Mara Zemgaliete
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30847-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 04:41h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE AUTOBIOGRAFIE MEINER MUTTER
1 – Meine Mutter starb in dem Augenblick, als ich …2 – Es ließ sich vielleicht nicht vermeiden, dass ich …3 – Auf der Straße zwischen Roseau und Potter’s Ville …4 – Was lässt die Welt sich drehen? Wer hätte …5 – In den Momenten, wenn Philip in mir war …6 – Die Haut meines Vaters hatte die Farben der …7 – Die Gegenwart ist immer vollkommen. Wie glücklich ich …Mehr über dieses Buch
Über Jamaica Kincaid
Über Christel Dormagen
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Jamaica Kincaid
Zum Thema USA
Zum Thema Karibik
Zum Thema Frau
Für Derec Walcott
1
Meine Mutter starb in dem Augenblick, als ich geboren wurde, und so stand mein ganzes Leben lang nichts zwischen mir und der Ewigkeit; in meinem Rücken war immer ein kalter, schwarzer Wind. Zu Beginn meines Lebens habe ich nicht wissen können, dass dies so sein würde; ich habe es erst in der Mitte meines Lebens begriffen, genau zu dem Zeitpunkt, als ich nicht mehr jung war und feststellte, dass ich von manchen Dingen, die ich bisher im Überfluss besessen hatte, weniger besaß und von manchen Dingen, die ich kaum je besessen hatte, mehr. Und diese Erkenntnis von Verlust und Gewinn ließ mich zurück und nach vorne schauen: An meinem Anfang war diese Frau mit einem Gesicht, das ich nie gesehen hatte, aber an meinem Ende war nichts, es war niemand zwischen mir und dem schwarzen Raum der Welt. Mir wurde nun klar, dass ich mein Leben lang an einem Abgrund gestanden hatte, dass mein Verlust mich verletzlich, hart und hilflos gemacht hatte; als ich dies begriff, wurde ich überwältigt von Traurigkeit und Scham und Selbstmitleid.
Als meine Mutter starb und mich als kleines Kind dem Angriff der ganzen Welt überließ, nahm mein Vater mich und gab mich in die Obhut der Frau, die er auch dafür bezahlte, dass sie ihm seine Wäsche wusch. Es ist möglich, dass er sie auf den Unterschied zwischen den beiden Bündeln hinwies: Das eine war sein Kind, nicht sein einziges Kind auf der Welt, aber das einzige Kind mit der einzigen Frau, die er bis dahin geheiratet hatte; das andere war seine schmutzige Wäsche. Er wird das eine wohl vorsichtiger behandelt haben als das andere, er wird für den Umgang mit dem einen wohl sorgfältigere Anweisungen gegeben haben als für den mit dem anderen, er wird für das eine wohl aufmerksamere Pflege erwartet haben als für das andere, aber für welches, das weiß ich nicht, denn er war ein sehr eitler Mann, sein Äußeres war ihm sehr wichtig. Dass ich eine Last für ihn war, weiß ich; dass seine schmutzige Wäsche eine Last für ihn war, weiß ich; dass er nicht wusste, wie er selbst für mich sorgen sollte oder wie er selbst seine Wäsche waschen sollte, weiß ich.
Er hatte mit meiner Mutter in einem sehr kleinen Haus gelebt. Er war arm, aber nicht, weil er gut war; er hatte noch nicht genügend schlimme Dinge getan, um reich zu werden. Dieses Haus stand auf einem Hügel, und er war den Hügel hinabgestiegen und hatte in der einen Hand sein Kind, in der anderen seine Wäsche balanciert, und er hatte beides, Bündel und Kind, einer Frau übergeben. Sie war nicht verwandt mit ihm oder mit meiner Mutter; sie hieß Eunice Paul, und sie hatte schon sechs Kinder, das jüngste war noch ein Baby. Deshalb hatte sie in ihren Brüsten noch Milch für mich, aber in meinem Mund schmeckte sie sauer, und ich wollte sie nicht trinken. Ma Eunice wohnte in einem Haus, das weit entfernt von anderen Häusern lag, und von dort hatte man einen freien Blick auf das Meer und die Berge, und wenn ich unruhig war und keinen Trost fand, setzte sie mich in den Schatten eines Baums, und beim Anblick jenes Meeres und jener Berge, beide so mitleidlos, weinte ich bis zur Erschöpfung.
Ma Eunice war nicht unfreundlich: Sie behandelte mich genauso, wie sie ihre eigenen Kinder behandelte – was aber nicht heißt, dass sie zu ihren eigenen Kindern freundlich war. An einem Ort wie diesem ist Brutalität die einzig wirkliche Erbschaft, und Grausamkeit ist manchmal das Einzige, was freigebig ausgeteilt wird. Ich mochte sie nicht, und ich vermisste das Gesicht, das ich nie gesehen hatte; ich schaute über meine Schulter, um zu sehen, ob jemand kam, so als ob ich erwartete, dass jemand käme, und Ma Eunice fragte mich, wonach ich denn Ausschau hielt, anfangs meinte sie es als Scherz, aber als ich nach einiger Zeit immer noch nicht damit aufhörte, glaubte sie, ich könne Geister sehen. Ich konnte ganz und gar keine Geister sehen, ich hielt einfach nur Ausschau nach jenem Gesicht, dem Gesicht, das ich nie sehen würde, selbst wenn ich unsterblich wäre.
Ich habe diese Frau, der mein Vater mich überließ, nie lieben können, diese Frau, die nicht unfreundlich zu mir war, die aber nicht freundlich sein konnte, weil sie nicht wusste, wie – und vielleicht konnte ich sie nicht lieben, weil auch ich nicht wusste, wie. Als ich ihre Milch nicht trinken wollte und noch keine Zähne hatte, fütterte sie mich mit fester Nahrung, die durch ein Sieb gestrichen war; als ich Zähne hatte, war das Erste, was ich tat, sie ihr beim Füttern in die Hand zu graben. Es entschlüpfte ihr ein leises Geräusch, eher überrascht als vor Schmerz, und sie verstand mein Tun als das, was es war – mein erster Akt der Undankbarkeit –, und die restliche Zeit, die wir noch zusammen waren, blieb sie auf der Hut vor mir.
Bis zu meinem vierten Lebensjahr sprach ich nicht. Das machte niemanden auch nur eine Minute weniger glücklich; ohnehin gab es niemanden, der sich deswegen hätte beunruhigen können. Ich wusste, dass ich sprechen konnte, doch ich wollte nicht. Ich sah meinen Vater alle vierzehn Tage, wenn er seine saubere Wäsche abholte. Er war für mich nie jemand, der meinetwegen zu Besuch kam; für mich war er jemand, der seine saubere Wäsche abholte. Wenn er kam, wurde ich zu ihm gebracht, und er fragte mich dann, wie es mir ging, aber das war eine Formalität; er rührte mich nie an und sah mir nie in die Augen. Was gab es in meinen Augen zu sehen? Eunice wusch und bügelte und faltete seine Wäsche; wie ein Geschenk war sie dann in zwei saubere Baumwolltücher eingeschlagen und lag auf einem Tisch, dem einzigen Tisch im Haus, und wartete darauf, dass er kam und sie holte. Seine Besuche waren sehr regelmäßig, und als er einmal nicht zur üblichen Zeit erschien, da fiel es mir auf. Ich sagte: »Wo ist mein Vater?«
Ich sagte das in Englisch – nicht in französischem Patois oder in englischem Patois, sondern in normalem Englisch –, und das hätte das Überraschende sein sollen: nicht dass ich sprach, sondern dass ich Englisch sprach, eine Sprache, die ich nie jemanden hatte sprechen hören. Ma Eunice und ihre Kinder sprachen die Sprache von Dominica, und das ist französisches Patois, und mein Vater benutzte, wenn er zu mir sprach, auch diese Sprache, nicht weil er keine Rücksicht auf mich nahm, sondern weil er glaubte, ich verstünde nichts anderes. Aber niemand bemerkte etwas; sie staunten nur über die Tatsache, dass ich schließlich gesprochen und mich nach dem Fernbleiben meines Vaters erkundigt hatte. Dass ich meine allerersten Worte in der Sprache eines Volkes geäußert hatte, das ich nie mögen oder lieben würde, ist mir heute kein Rätsel; fast alles in meinem Leben, an das ich unauflöslich gebunden bin, ist eine Quelle des Schmerzes.
Ich war damals vier Jahre alt und sah die Welt als eine Reihe miteinander verbundener weicher Linien – wie eine Kohlezeichnung; und so sah ich, wenn mein Vater kam, um seine Wäsche abzuholen, nur, dass er plötzlich auf dem schmalen Pfad auftauchte, der von der Hauptstraße zur Tür des Hauses führte, in dem ich wohnte, und dass er, wenn er seine Angelegenheiten erledigt hatte, wieder verschwand, indem er dort, wo der Pfad mündete, in die Straße einbog. Ich wusste nicht, was jenseits des Pfades lag, ich wusste nicht, ob er, wenn er aus meinem Blickfeld verschwand, noch mein Vater war oder ob er sich danach in etwas völlig anderes verwandelte und ich ihn nie mehr in der Gestalt meines Vaters wiedersehen würde. Ich hätte das in Ordnung gefunden. Ich wäre überzeugt gewesen, dass dies der Lauf der Welt ist. Ich sprach nicht, und ich wollte nicht sprechen.
Eines Tages zerbrach ich, ohne es zu wollen, einen Teller, den einzigen Teller seiner Art, den Eunice jemals besessen hatte, einen Teller aus Knochenporzellan, und die Worte »es tut mir leid« wollten nicht über meine Lippen. Die Traurigkeit, die sie bei diesem Verlust zeigte, faszinierte mich; sie war so voller Gram, so überwältigend, so tief, als wäre ein geliebter Mensch gestorben. Sie packte den Sack, der ihr Bauch war, sie riss an ihren Haaren, sie schlug sich auf die Brust; dicke Tränen rollten ihr aus den Augen und über die Wangen, und sie flossen so reichlich, dass es mein kleines Ich nicht überrascht hätte, wenn aus ihnen, wie in der Sage oder im Märchen, eine neue Wasserquelle entsprungen wäre. Sie hatte mich wiederholt davor gewarnt, diesen Teller anzufassen, denn sie hatte gesehen, wie ich ihn mit hartnäckiger Neugier betrachtete. Immer wieder schaute ich ihn an und sann über das Bild nach, mit dem er bemalt war, ein Bild von einer weiten Wiese, auf der lauter Gras und Blumen in den zartesten Abstufungen von Gelb, Rosa, Blau und Grün zu sehen waren; am Himmel stand eine Sonne, sie schien, aber sie brannte nicht grell; die Wolken waren leicht und wie zum Schmuck darüber verstreut, nicht dick und aufgetürmt, nicht wie Vorboten dräuenden Unheils. Dieses Bild war nichts weiter als eine Wiese mit Gras und Blumen an einem sonnigen Tag, doch es strahlte etwas aus von heimlichem Überfluss, von Glück und Stille; darunter stand in goldenen Buchstaben das eine Wort HIMMEL. Natürlich war es keineswegs ein Bild vom Himmel; es war das Bild einer idealisierten englischen Landschaft, aber das wusste ich nicht, ich wusste nicht, dass es so etwas wie die englische Landschaft gab. Und ebenso wenig wusste Eunice es; sie glaubte, dass dieses Bild ein Bild vom Himmel war, denn heimlich verhieß es ein Leben ohne Sorgen, Pflichten und Mangel.
Als ich den Porzellanteller zerbrach, der mit diesem Bild bemalt war, und Ma Eunice deshalb so schrecklich weinen musste, tat es mir nicht sofort leid, es tat mir auch nicht kurz danach leid, es tat mir erst sehr viel später leid, und da war es längst zu spät, ihr das zu sagen, sie war gestorben; vielleicht ist sie in den Himmel gekommen, und die Verheißung auf jenem Teller hat sich erfüllt. Als ich den Teller zerbrach und nicht sagen wollte, dass es mir leidtat, verfluchte sie meine tote Mutter, sie verfluchte meinen Vater, und sie verfluchte mich. Die Worte, die sie benutzte, waren ohne Bedeutung; ich verstand sie, aber sie taten mir nicht weh, denn ich liebte sie nicht. Und sie liebte mich nicht. Sie zwang mich, mit den Händen über dem Kopf und einem großen Stein in jeder Hand, auf ihrem Steinhaufen niederzuknien, der, wie es sich fügte, an einer Stelle lag, die den ganzen Tag Sonne bekam. Sie wollte, dass ich so lange in dieser Haltung aushielt, bis ich die Worte »es tut mir leid« sagte, aber ich wollte sie nicht sagen, ich konnte sie nicht sagen. Es hatte nichts mit meinem Willen zu tun; jene Worte konnten nicht über meine Lippen kommen. Ich blieb so lange in dieser Haltung, bis sie völlig erschöpft war und aufhörte, mich und all die zu verfluchen, von denen ich abstammte.
Wieso hätte diese Strafe einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen sollen, geprägt, wie sie war, von der Beziehung zwischen Fänger und Gefangenem, Herrn und Sklaven und geleitet von dem Motiv: die Großen und die Kleinen, die Mächtigen und die Ohnmächtigen, die Starken und die Schwachen, und das vor einem Hintergrund aus Erde, Meer und Himmel und mit Eunice, die über mir stand und sich mit jeder Silbe, die über ihre Lippen kam, in immer neue wütende, unmenschliche Dinge verwandelte – in ihrem Kleid aus dünner, schlecht gewebter Baumwolle, dessen Oberteil in Farbe und Muster überhaupt nicht zum Rock passte, und mit ihrem ungekämmten, seit vielen Monaten ungewaschenen Haar, das sie unter einem alten Stück Stoff verborgen hatte, der noch länger nicht gewaschen worden war als ihr Haar? Das Kleid wiederum – es war einst neu und sauber gewesen, und Schmutz hatte es alt gemacht, aber Schmutz hatte es auch wieder neu gemacht, indem er ihm Schattierungen verlieh, die es vorher nicht gehabt hatte, und Schmutz würde es schließlich völlig auseinanderfallen lassen, obwohl sie keine schmutzige Frau war, sie wusch ihre Füße jeden Abend.
Der Tag war klar, es war keine Regenzeit, einige Männer warfen draußen auf dem Meer die Netze aus, aber sie fingen nicht besonders viele Fische, weil es ein klarer Tag war; und drei ihrer Kinder aßen Brot, und sie rollten das Innere des Brots zu kleinen kieselähnlichen Kugeln und bewarfen mich damit, während ich dort kniete, und lachten mich aus; und der Himmel war wolkenlos, und es ging kein Wind; eine Fliege flog vor meinem Gesicht hin und her, manchmal landete sie in meinem Mundwinkel; eine überreife Brotfrucht fiel vom Baum, und das Geräusch klang wie eine Faust, die auf den weichen, fleischigen Teil eines Körpers trifft. An all dies, all dies kann ich mich erinnern – wieso hätte sie einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen sollen?
Während ich dort kniete, konnte ich drei Landschildkröten sehen, die in dem schmalen Spalt unter dem Haus ein und aus krochen, und ich verliebte mich in sie, ich wollte sie in meiner Nähe haben, ich wollte für den Rest meines Lebens jeden Tag nur mit ihnen sprechen. Lange nachdem meine Tortur beendet war – und zwar in einer Weise, die Ma Eunice nicht gefiel, da ich nicht sagte, dass es mir leidtat –, nahm ich alle drei Schildkröten und setzte sie auf ein eingezäuntes Stück Erde, wo sie nicht kommen und gehen konnten, wie es ihnen gefiel, sodass ihr Überleben vollständig von mir abhing. Ich brachte ihnen in kleinen Muschelschalen Gemüseblätter und Wasser. Ich fand sie wunderschön, ihre dunkelgrauen Panzer mit schwachen gelblichen Kringeln, ihre langen Hälse, ihre urteilslosen Augen, die langsame Entschiedenheit ihres Kriechens. Doch sie zogen sich in ihre Gehäuse zurück, wenn ich es nicht wollte, und wenn ich sie rief, kamen sie nicht heraus. Um ihnen eine Lektion zu erteilen, holte ich etwas Schlamm aus dem Flussbett und füllte damit die kleinen Löcher, aus denen immer ihre Hälse hervorkamen, und ich ließ zu, dass er trocknete. Ich bestreute den Platz, auf dem sie lebten, mit Steinen, und danach vergaß ich sie für viele Tage. Als sie mir wieder einfielen, ging ich zu dem Platz, wo ich sie zurückgelassen hatte, um nach ihnen zu schauen. Sie waren mittlerweile alle tot.
Es war der Wunsch meines Vaters, dass ich zur Schule gehen sollte. Das war ein ungewöhnliches Anliegen; Mädchen gingen nicht zur Schule, keines der Mädchen von Ma Eunice besuchte eine Schule. Ich werde nie erfahren, was ihn dazu brachte, so etwas zu tun. Ich kann mir nur vorstellen, dass er so etwas für mich wünschte, ohne besonders darüber nachzudenken, denn schließlich – was konnte eine Schulbildung jemandem wie mir schon bringen? Ich kann nur sagen, was ich nicht hatte; ich kann es nur an dem messen, was ich hatte, und im Unterschied entdecke ich das Elend. Und doch und doch … das war der Grund dafür, dass ich zum ersten Mal sah, was hinter dem Pfad lag, der von meinem Haus wegführte. Und ich kann mich so gut erinnern, wie sich der Stoff von meinem Rock und meiner Bluse anfühlte – ganz rau, weil er neu war. Ein grüner Rock und eine beige Bluse – eine Uniform, und in Farbe und Schnitt imitierte sie Farbe und Schnitt einer Schule, die irgendwo anders war, irgendwo weit weg; und ich trug ein Paar braune flache Stoffschuhe und braune Baumwollsocken, die mein Vater mir besorgt hatte, woher, wusste ich nicht. Und wenn ich erwähne, dass ich nicht wusste, woher diese Sachen kamen, wenn ich sage, dass ich mich über sie wunderte, dann will ich eigentlich sagen, dass es das erste Mal war, dass ich so etwas wie Schuhe und Socken trug, und sie machten, dass meine Füße wehtaten und anschwollen, und ich kriegte Blasen, die aufplatzten, aber man zwang mich, sie so lange zu tragen, bis meine Füße sich an sie gewöhnt hätten, und das taten meine Füße – wie alles an mir. Jener Morgen war ein Morgen wie jeder andere, so normal, dass er schon besonders war: An manchen Stellen war es sonnig, an anderen nicht, und beides (Sonniges, Wolkiges) nahm ganz bequem verschiedene Teile des Himmels ein; es gab das Grün der Blätter, die rote Explosion der Blüten an den leuchtend bunten Bäumen, die fahlgelben Früchte der Cashewbäume, den Duft der Limonen, den Duft der Mandeln, den Kaffee in meinem Atem, den Rock von Eunice, der mir ins Gesicht wehte, und die Gerüche zwischen ihren Beinen, die hochwirbelten und die ich nie vergessen werde, und immer wenn ich mich selber rieche, muss ich an sie denken. Der Fluss stand niedrig, und so hörte ich nicht das Geräusch von Wasser, das über Steine eilt; der Wind wehte nur schwach, und so raschelten die Blätter nicht in den Bäumen.
Ich hatte diese Empfindungen, dass ich schaute, roch und hörte, während ich auf dem Weg zu meiner Schule den Pfad entlangwanderte: Als ich bei der Straße ankam und meine neu beschuhten Füße darauf setzte, war es das erste Mal, dass ich dies tat. Ich war mir dessen bewusst. Es war eine Straße aus kleinen Steinen und festgetretener Erde, und jeder Schritt, den ich machte, war unbeholfen; der Boden gab nach, meine Füße rutschten weg. Die Straße lief vor mir her und verschwand in einer Kurve; wir marschierten auf diese Kurve zu, und dann kamen wir zu der Kurve, und hinter der Kurve fing wieder dieselbe Straße an und führte zu noch einer Kurve. Vor dem Ende der letzten Kurve kamen wir zu meiner Schule. Es war ein kleines Gebäude mit einer Tür und vier Fenstern, es hatte einen Holzfußboden, eine kleine Echse krabbelte über einen Balken in der Decke; drei lange Pulte waren hintereinander aufgereiht; ein großer hölzerner Tisch und ein Stuhl standen vorne vor den drei langen Pulten; an der Wand hinter dem hölzernen Tisch und dem Stuhl hing eine Landkarte; oben auf der Landkarte standen die Wörter »Das britische Weltreich«. Das waren die ersten Wörter, die ich lesen lernte.
Immer waren in jenem Raum nur Jungen; ich saß erst mit anderen Mädchen in einem Schulzimmer, als ich älter war. Ich hatte keine Angst vor dieser neuen Situation: Ich wusste damals nicht, wie das geht, und weiß heute nicht, wie das geht. Ich hatte keine Angst, weil meine Mutter schon gestorben war, und das ist das Einzige, wovor ein Kind wirklich Angst hat; als ich geboren wurde, war meine Mutter tot, und ich hatte schon all die Jahre mit Eunice gelebt, einer Frau, die nicht meine Mutter war und die mich nicht lieben konnte, und ohne meinen Vater, von dem ich nie wusste, wann ich ihn wiedersehen würde, und so hatte ich in dieser Situation keine Angst um mich. (Und wenn es nicht wirklich stimmt, dass ich damals keine Angst hatte, so war es nicht das einzige Mal, dass ich mir meine Verletzlichkeit nicht eingestand.)
Wenn ich heute von jenen ersten Tagen klar und verständig spreche, so erfinde ich nichts, und es sollte nicht verwundern; zu jener Zeit prägte ich mir alles, was geschah, mit einer Schärfe ein, die mir heute selbstverständlich vorkommt; damals hatten diese Dinge noch keine Bedeutung, sie hatten keinen Zusammenhang, ich kannte die Geschichte von Ereignissen noch nicht, ich kannte ihre Vorgeschichte nicht. Meine Lehrerin war von methodistischen Missionaren ausgebildet worden; sie gehörte zum afrikanischen Volk, das konnte ich sehen, und für sie bildete das eine Quelle der Demütigung und des Selbsthasses, und sie trug die Verzweiflung wie ein Kleidungsstück, wie einen Umhang oder einen Stock, auf den sie sich ständig stützte, wie ein angeborenes Recht, das sie uns weiterreichen wollte. Sie liebte uns nicht; wir liebten sie nicht; wir liebten einander nicht, nicht zu jener Zeit, zu keiner Zeit. Wir waren sieben Jungen und ich. Die Jungen gehörten auch alle zum afrikanischen Volk. Meine Lehrerin und diese Jungen schauten mich an und schauten mich an: Ich hatte dichte Augenbrauen; mein Haar war buschig, dick und wellig; meine Augen standen weit auseinander, und sie hatten die Form von Mandeln; meine Lippen waren auf unerwartete Weise breit und schmal. Ich gehörte zum afrikanischen Volk, aber nicht ausschließlich. Meine Mutter war eine karibische Frau, und wenn sie mich ansahen, dann war es das, was sie sahen. Das karibische Volk war besiegt und dann ausgelöscht worden, beseitigt wie das Unkraut in einem Garten; das afrikanische Volk war besiegt worden, hatte aber überlebt. Wenn sie mich ansahen, sahen sie nur das karibische Volk. Sie irrten sich, aber das sagte ich ihnen nicht.
Ich begann damals sehr freimütig zu reden – mit mir selbst immer wieder, mit anderen nur, wenn es unbedingt nötig war. In der Schule sprachen wir englisch – ordentliches Englisch, kein Patois –, und untereinander benutzten wir französisches Patois, eine Sprache, die als ganz und gar nicht anständig galt, eine Sprache, die Menschen aus Frankreich nicht sprechen und nur mit großer Mühe verstehen konnten. Ich redete mit mir selber, weil ich anfing, den Klang meiner eigenen Stimme zu mögen. Sie hatte etwas Süßes für mich, sie verringerte meine Einsamkeit, denn ich war einsam und sehnte mich nach Menschen, in deren Gesichtern ich etwas von mir selbst wiedererkennen konnte. Denn wer war ich? Meine Mutter war tot; meinen Vater hatte ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen.
Ich lernte sehr schnell lesen und schreiben. Mein Gedächtnis, meine Fähigkeit, mir Dinge zu merken, mich an die winzigste Einzelheit zu erinnern, zu behalten, wer was wann gesagt hatte – all das wurde für ungewöhnlich gehalten, so ungewöhnlich, dass meine Lehrerin, die nur in Form von Gut und Böse zu denken gelernt hatte und deren Urteil in derlei Dingen immer falsch war, sagte, ich sei böse, ich sei besessen, und um zu bekräftigen, dass daran kein Zweifel bestehen konnte, verwies sie wieder auf die Tatsache, dass meine Mutter zum karibischen Volk gehörte.
Meine Welt damals – still, sanft und pflanzenhaft in ihrer Empfindlichkeit, den machtvollen Launen anderer unterworfen und vom Tageslauf bestimmt, der jeden Morgen mit der fahlen Eröffnung von Licht anfing und mit dem plötzlichen Einbruch der Dunkelheit zu Beginn jeder Nacht endete –, diese Welt war ein Geheimnis für mich und gleichzeitig eine Quelle manchen Vergnügens: Ich liebte das Gesicht eines grauen Himmels, durchlässig, körnig, feucht, der mich an unzähligen Morgen zur Schule begleitete und sanfte Wasserpfeile auf mich niedersandte; das Gesicht desselben Himmels, wenn er ein hartes, Schutz verweigerndes Blau zeigte, als Hintergrund für eine grausame Sonne; die strenge Hitze, die schließlich ein Teil von mir wurde, so wie mein Blut; die schwer beladenen Bäume (manche Äste hatten den Umfang kleiner Baumstämme), die so ungehindert wuchsen, als bestünde Schönheit nur in Größe, und ich konnte sie alle auseinanderhalten, wenn ich die Augen schloss und auf das Geräusch der Blätter horchte, die raschelnd aneinanderrieben; und ich liebte jenen Augenblick, wenn die weißen Blüten der Zeder zu Boden fielen, mit einer Lautlosigkeit, die ich hören konnte, anfangs waren die Blütenblätter noch frisch, ein sanfter Kuss aus Rosa und Weiß, einen Tag später dann waren sie zertreten, verwelkt und braun, eine Plage für das Auge; ich liebte den Fluss, der zu einer kleinen Lagune geworden war, als er eines Tages einfach seine Richtung änderte und an dessen Ufer ich gerne saß, Vogelfamilien zusah und Fröschen, die ihren Laich ablegten, dem Himmel, der von Schwarz zu Blau wechselte und von Blau zu Schwarz, und dem Regen, der ins Meer hinter der Lagune fiel, aber nicht auf den Berg, der hinter dem Meer war. An diesem Platz war es, wo ich zum ersten Mal von meiner Mutter träumte; ich war auf den Steinen eingeschlafen, die rings um mich den Boden bedeckten, und mein kleiner Körper war in sie hineingesunken, als seien es Federn. Ich sah meine Mutter eine Leiter herunterkommen. Sie trug ein langes, weißes Gewand, dessen Saum ihr genau bis an die Fersen reichte, und das war alles, was von ihr zu sehen war, nur ihre Fersen; sie stieg und stieg herunter, doch mehr wurde nicht von ihr enthüllt. Nur ihre Fersen und der Saum ihres Gewandes. Zuerst wollte ich unbedingt mehr sehen, und dann reichte es mir, dass ich einfach nur ihre Fersen sah, die zu mir herunterstiegen. Als ich erwachte, war ich nicht mehr das Kind, das ich gewesen war, bevor ich einschlief. Ich sehnte mich danach, meinen Vater zu sehen, und wollte für immer in seiner Nähe sein.
An einem Tag, dessen Anfang ich nicht als irgendwie auffällig in Erinnerung habe, lernte ich die Grundbegriffe für das Schreiben eines gewöhnlichen Briefs. Ein Brief hat sechs Teile: die Adresse des Absenders, das Datum, die Adresse des Empfängers, die Anrede oder Grußformel, den Brief selber, das Ende des Briefs. Es war vollkommen klar, dass ein Mensch mit der Aussicht auf ein Leben, wie es mich erwartete – das Leben einer Frau, die noch dazu arm ist –, niemals in die Verlegenheit kommen würde, einen Brief zu schreiben, doch das Gefühl von Befriedigung, das alle empfanden, die daran beteiligt waren, mir diese Sache beizubringen, nämlich einen Brief zu schreiben, muss ungeheuer gewesen sein. Ich wurde geschlagen und mit schlimmen Wörtern beschimpft, als ich einen Fehler machte. Damals machte es mich nicht wütend, dass ich Briefe von Leuten abschreiben musste, deren Klagen oder Ansichten oder Freuden mich gar nicht interessierten – ich war zu jung, um zu begreifen, dass Eitelkeit eine Waffe sein kann, ebenso gefährlich wie jedes Messer; ich wollte einfach nur meine eigenen Briefe schreiben, Briefe, in denen ich sagen würde, was ich über mein Leben dachte, so wie es mir mit sieben Jahren erschien. Ich fing einen Brief an meinen Vater an. Ich schrieb: »Mein lieber Papa«, in prächtiger, kunstvoller Schönschrift, einer Schönschrift, geboren aus Schlägen und groben Wörtern. Ich sagte ihm, dass ich von Eunice in Wort und Tat misshandelt wurde und dass er mir fehlte und dass ich ihn sehr liebte. Ich schrieb dies immer und immer wieder. Es war ohne Einzelheiten. Es war einfach der klagende Schrei eines kleinen, verwundeten Tiers: »Mein lieber Papa, Du bist der einzige Mensch, den ich noch habe auf der Welt, niemand liebt mich, nur Du kannst das, ich werde mit Wörtern geschlagen, ich werde mit Stöcken geschlagen, ich werde mit Steinen geschlagen, ich liebe Dich über alles, nur Du kannst mich retten.« Diese Worte waren ganz und gar nicht für meinen Vater gedacht, sondern für die Person, von der ich nur die Fersen sehen konnte. Nacht um Nacht sah ich ihre Fersen, nur ihre Fersen, die herunterkamen, um bei mir zu sein, die herunterkamen, um für immer bei mir zu sein.
Ich schrieb diese Briefe ohne jede Absicht, sie meinem Vater zu schicken. Ich wusste nicht, wie man das macht, sie abschicken. Ich faltete sie so zusammen, dass sie, wenn man sie durchriss, acht kleine, kleine Quadrate bilden würden. Das hatte keine geheimnisvolle Bedeutung; ich tat das nur, damit ich sie besser unter einen großen Stein draußen vor dem Tor zu meiner Schule stecken konnte. Jeden Tag legte ich nach der Schule einen Brief dorthin, den ich an meinen Vater geschrieben hatte. Ich schrieb diese Briefe immer heimlich, während der kurzen Zeitspanne, die man uns als Pause gewährte, oder wenn ich meine Aufgabe, ohne dass es bemerkt wurde, schon erledigt hatte. Ich tat dann so, als sei ich vollkommen mit dem beschäftigt, was mir aufgetragen war, und schrieb einen Brief an meinen Vater.
Diese kleinen Hilferufe brachten mir keine unmittelbare Erleichterung. Ich erkannte mein Unglück, aber dass es gelindert werden könnte – dass mein Leben sich ändern könnte, dass seine Bedingungen sich ändern könnten –, das kam mir nicht in den Sinn.
Meine Briefe blieben kein Geheimnis. Ein Junge namens Roman hatte gesehen, wie ich sie in das Versteck legte, und entfernte sie hinter meinem Rücken. Er hatte kein Verständnis, kein Mitleid; jegliche Neigung, die Schwachen zu schützen, war in ihm zerstört worden. Er gab meine Briefe unserer Lehrerin. In meinen Briefen an meinen Vater hatte ich geschrieben: »Alle hassen mich, nur Du liebst mich«, aber ich hatte nicht gewollt, dass diese Briefe tatsächlich meinem Vater geschickt würden, und sie waren auch nicht wirklich an meinen Vater gerichtet; wenn mich jemand gefragt hätte, ob ich wirklich glaubte, dass mich alle hassten, dass nur mein Vater mich liebte, dann hätte ich darauf keine Antwort gewusst. Doch die Reaktion meiner Lehrerin auf meine Briefe, dieses kleine Gekritzel, war eine besondere Erfahrung für mich. Sie glaubte, wenn ich »alle« schrieb, meinte ich sie und nur sie. Sie sagte, meine Worte seien eine Lüge, verleumderisch, sie sagte, dass sie sich für mich schäme und dass sie keine Angst vor mir habe. Meine Lehrerin sagte all das vor den anderen Schülern meiner Schule zu mir. Sie dachten, ich sei gedemütigt, und sie freuten sich, dass ich so heruntergemacht wurde. Ich fühlte mich überhaupt nicht gedemütigt. Ich fühlte etwas. Ich konnte sehen, dass ihre Zähne schief und gelb waren, und ich überlegte, wie das wohl gekommen war. Sie hatte große Halbmonde aus Schweiß unter den Achseln ihres Kleids, und ich überlegte, ob ich als erwachsene Frau auch so heftig schwitzen und wie es dann wohl riechen würde. Hinter ihrer Schulter kroch eine große weibliche Spinne mit ihrem Eiersack an der Wand entlang, und ich wollte nach ihr greifen und sie mit der bloßen Handfläche zerquetschen, weil ich dachte, dass sie vielleicht die Sorte Spinne oder eine Verwandte von der Spinne war, die mir in der Nacht vorher im Schlaf die Spucke aus den Mundwinkeln gesogen und drei kleine, schmerzhafte Stiche hinterlassen hatte. Draußen nieselte es leicht, ich konnte das Geräusch auf dem Blechdach hören.
Sie schickte die Briefe meinem Vater, um mir zu beweisen, dass sie ein reines Gewissen hatte. Sie sagte, dass ich ihre Strafpredigten, die sie nur aus Liebe zu mir gehalten habe, als Ausdruck von Hass missverstanden hätte, und das zeige, dass ich der Sünde des Hochmuts schuldig sei. Und sie sagte, sie hoffe, dass ich lernte, die beiden zu unterscheiden: die Liebe und den Hass. Bis heute versuche ich, die beiden zu unterscheiden, und kann es nicht, weil sie häufig ein so ähnliches Gesicht haben. Als sie das damals sagte, habe ich ihr genau ins Gesicht geblickt, um herauszufinden, ob es stimmte, dass sie mich liebte, und um zu sehen, ob ihre Worte, die so oft eine Serie harter Schläge zu sein schienen, in Wirklichkeit der Ausdruck von Liebe waren. Ihr Gesicht kam mir da nicht liebevoll vor, aber vielleicht täuschte ich mich – vielleicht war ich zu jung, um zu urteilen, zu jung, um zu verstehen.