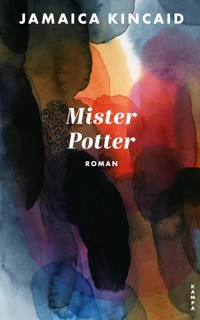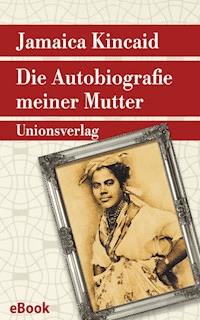16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: AKI Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit 17 ließ Jamaica Kincaid ihre Heimat Antigua hinter sich. Zwanzig Jahre später kehrt sie zurück. Erst jetzt lernt sie ihren jüngsten Bruder Devon kennen, der drei war, als sie fortging. Sie kann sich nicht erinnern, ob sie einst Zuneigung für ihn empfunden hat, und versteht sein Englisch nur mit Mühe. Er hat sie sich anders vorgestellt - fett vor allem, denn auf Antigua entspricht es der Mode, fett zu sein. Als Kincaid ihren Bruder das nächste Mal sieht, liegt er im Sterben: Der charismatische, lebensfrohe, aber auch rastlose junge Mann, der ein ausschweifendes Leben geführt hat, ist an Aids erkrankt. Er stirbt im Alter von 33 Jahren. Poetisch und schockierend genau beschreibt Kincaid sein Sterben, analysiert die gesellschaftlichen Umstände seines Leidens und die Konflikte ihrer Familie, die die Zerrissenheit einer postkolonialen Gesellschaft spiegeln. Und sie geht mit sich selbst ins Gericht, erzählt von der nie vollendeten Ablösung von ihrer Mutter und ihrer immerwährenden Selbstfindung im Schreiben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 236
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Jamaica Kincaid
Mein Bruder
Für Ian (»Sandy«) Frazier
Als ich meinen Bruder nach langer Zeit wiedersah, lag er in einem Bett des Holberton Hospitals auf der Station Gweneth O’Reilly, und es hieß, er würde an Aids sterben. Er war nicht in diesem Krankenhaus geboren. Er war als einziges von uns vier Kindern zu Hause geboren. Ich erinnere mich, wie er geboren wurde. Ich war damals dreizehn. Wir hatten gerade zu Abend gegessen, gekochten Fisch, Brot und Butter, als meine Mutter mich losschickte, die Hebamme zu holen, Schwester Stevens, die an der Ecke Nevis und Church Street wohnte. Sie war eine dicke Frau, deren Pobacken bei jedem Schritt auf und ab rollten und die sehr langsam ging. Als ich ihr die Nachricht überbrachte, meine Mutter bitte sie zu kommen und ihr bei der Geburt meines Bruders beizustehen, aß sie gerade selbst zu Abend und sagte, sie komme, wenn sie fertig sei. Mein Bruder wurde mitten in der Nacht des 5. Mai 1962 geboren. Er hatte eine rötlich-gelbe Hautfarbe, als er zur Welt kam. Ich weiß nicht, wie viel er gewogen hat, denn er wurde nach der Geburt nicht gewogen. Natürlich war unser normales Leben in jener Nacht völlig durcheinander: das allabendliche Zubettgehen von uns Kindern, meiner beiden anderen Brüder und mir, der allabendliche Spaziergang unseres Vaters zu einer Brücke in der Nähe der Sportplätze – ein Gang, den ihm sein Arzt wegen seiner schlechten Verdauung und seines schwachen Herzens empfohlen hatte. Wenn die schwere Finsternis der unbeleuchteten Nacht hereinbrach, kehrte er heim, ein Hund bellte beim Geräusch seiner Schritte, die Tür ging auf und wurde hinter ihm abgeschlossen, das Klicken seines Gebisses, wenn es in ein Wasserglas fiel, sein Schnarchen und dann das erste Morgenlicht. Wir wurden zu Nachbarn geschickt. Ich weiß nicht mehr genau, zu welchen meine Brüder geschickt wurden. Ich ging zu einer Freundin meiner Mutter, einer Frau, deren sechs Jahre alte Tochter kurz nach jener Nacht der Geburt meines Bruders schwer krank wurde und auf dem Weg zum Arzt in den Armen meiner Mutter starb. Sie stieß ihren letzten Atem aus, als sie dieselbe Brücke überquerten, bis zu der mein Vater bei seinen abendlichen Spaziergängen ging. Es war der erste Mensch, der in den Armen meiner Mutter starb; nicht viel später starb eine Frau, die uns gegenüber wohnte, Miss Charlotte hieß sie, in den Armen meiner Mutter, als meine Mutter versuchte, ihr den Schmerz eines soeben erlittenen Herzanfalls zu erleichtern.
Ich hörte, wie mein Bruder seinen ersten Schrei ausstieß und dann darüber geredet wurde, was mit der Nachgeburt geschehen solle, doch ich erinnere mich nicht mehr, was beschlossen wurde, nur dass ein klein wenig davon getrocknet und an die Innenseite seiner Kleider geheftet wurde, als Talisman, der ihn vor bösen Geistern schützen sollte. Er wurde in ein Hemd gesteckt, das meine Mutter genäht hatte, doch da sie zwei andere kleine Kinder hatte, meine anderen Brüder, der eine fast vier, der andere fast zwei Jahre alt, hatte sie diesem Hemd nicht wie üblich besondere Aufmerksamkeit gewidmet, was Stickereien oder spezielle Waschungen des Baumwollstoffs bedeutet hätte; die Hemdchen, die er trug, waren schlicht. Er wurde in eine Decke gewickelt und zu ihr gelegt, beide fielen in einen tiefen Schlaf. Am nächsten Tag, als beide noch schliefen und er sich an ihren warmen Körper kuschelte, kam eine Armee roter Ameisen durch das Fenster herein und fiel über ihn her. Meine Mutter hörte ihr Kind schreien, und als sie wach wurde, sah sie ihn von roten Ameisen übersät. Wäre er allein gewesen, hätten sie ihn bestimmt umgebracht. Dies war ein Ereignis, das man meinem Bruder niemals erzählte, ein Ereignis, das alle in der Familie vergessen haben, außer mir. Eines Tages während seiner Krankheit, als meine Mutter und ich an seinem Bett standen und ihn betrachteten – er schlief und merkte es nicht –, erinnerte ich meine Mutter an die Ameisen, die ihn beinahe gefressen hätten, und sie sah mich mit misstrauisch zusammengekniffenen Augen an und sagte: »Was hast du bloß für ein Gedächtnis!« – vielleicht das, was sie an mir am wenigsten mag. Ich fragte mich einfach, ob es von Bedeutung war, dass kleine rote Biester ihn kurz nach seiner Geburt beinahe von außen getötet hätten und ihn nun kleine Biester von innen töteten; ich glaube nicht, dass es irgendeine Bedeutung hat, es ist nur etwas, worüber jemand wie ich nachdenkt.
In jener Donnerstagnacht, als ich am Telefon durch eine Freundin meiner Mutter von der Krankheit meines Bruders erfuhr – zu der Zeit sprachen meine Mutter und ich nicht miteinander (dieses Nicht-miteinander-Sprechen hat ein Eigenleben, es ist wie ein merkwürdiger Organismus, dessen Regeln, die ihn überleben lassen, bislang niemand entschlüsseln kann; meine Mutter und ich wissen nie, wann wir aufhören, miteinander zu reden, und wir wissen nie, wann wir wieder anfangen) –, da war ich in meinem Haus in Vermont und ganz damit beschäftigt, für das Wohlergehen meiner Kinder, meines Mannes und für mein eigenes zu sorgen. Als ich mit dieser Freundin meiner Mutter sprach, erzählte sie, mit meinem Bruder stimme irgendetwas nicht und ich solle meine Mutter anrufen, um Genaueres zu erfahren. Ich sagte: »Was stimmt nicht?« Sie sagte: »Ruf deine Mutter an.« Ich fragte sie mit genau diesen Worten dreimal, und dreimal antwortete sie dasselbe. Und als ich sagte: »Er hat Aids«, sagte sie: »Ja.«
Wenn sie gesagt hätte, er habe einen furchtbaren Autounfall gehabt, oder wenn sie gesagt hätte, er habe einen unheilbaren Krebs, wäre ich überrascht gewesen, denn er fuhr nicht Auto – das wusste ich. Was verursacht einen unheilbaren Krebs? Das weiß ich nicht. Doch er führte ein Leben, das man gemeinhin dafür prädestiniert hält, um sich mit dem Virus zu infizieren, das Aids verursacht: Er nahm Drogen (mit Gewissheit wusste ich nur von Marihuana und Kokain), und er hatte viele Sexualpartner (ich wusste nur von Frauen). Er war achtlos; ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich die Zeit nahm, ein Kondom zu kaufen oder es zu benutzen. Das ist ein schnelles Urteil, denn ich kenne meine Brüder nicht sehr gut, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich nicht die Mühe machte, ein Kondom zu benutzen. Vor einigen Jahren, als ich meine Familie besuchte – das heißt, die Familie, in der ich aufgewachsen bin –, saß ich einmal auf seinem Bett in dem Haus, in dem er alleine wohnte, ein Haus, zwei Armlängen vom Haus unserer Mutter entfernt, wo sie mit einem anderen Sohn lebte, einem erwachsenen Mann, und sagte ihm, er solle Kondome benutzen, wenn er mit jemandem schlafe; ich sagte ihm, er solle sich vor dem HI-Virus schützen, und er lachte und sagte, so etwas Blödes bekomme er nicht (»Me no get dat chupidness, man!«).1 Ich mag ihm lächerlich vorgekommen sein. Ich war schon so lange von zu Hause weg, dass ich sein Englisch nicht mehr ohne Weiteres verstand und ihn immer wieder bitten musste, Gesagtes noch einmal zu wiederholen; und ich sprach nicht mehr das Englisch, das er sprach, und wenn ich etwas zu ihm sagte, sah er mich an, und manchmal lachte er mich geradewegs aus. »You talk funny«, sagte er. Und außerdem war ich nicht fett; nachdem er mich zwanzig Jahre nicht gesehen hatte, war er davon ausgegangen, dass ich fett sein müsste. Dort, wo wir herkommen, werden die meisten Frauen mit der Zeit fett; es entspricht der Mode, fett zu sein.
Als ich meinen Bruder im Krankenhausbett liegen sah, sterbenskrank, waren seine Augen geschlossen, er schlief (oder war in einem schlafähnlichen Zustand, denn Schlaf, ein absolut gesunder und normaler Zustand, konnte es nicht sein, was er durchlebte, als er dort sterbend lag), seine Hände ruhten auf der Brust, eine über der anderen, genau unterm Kinn, in dieser frommen Pose eines Toten, doch er war noch nicht tot. Seine Haut war tiefschwarz, das fiel mir auf, und ich dachte, dass es mir vielleicht auffalle, weil ich an einem Ort lebe, wo niemand seine Hautfarbe hat, außer mir, und ich habe nicht wirklich seine Farbe, ich habe nur seine Farbe als ethnisches Merkmal. Doch viele Tage später sagte meine Mutter zu mir: »Er ist so schwarz geworden, die Krankheit hat ihn so schwarz gemacht.« (Sie sagte es in diesem Englisch, sie gibt sich Mühe, mit mir das Englisch zu sprechen, das ich nun auf Anhieb verstehe.) Seine Lippen waren dunkelrot und übersät mit kleinen Wunden, die goldgelb verkrustet waren. Als er die Augen aufschlug und mich sah, machte er dieses Truups-Geräusch (man beißt die Zähne zusammen, wölbt die Lippen vor und saugt mit aller Kraft Luft ein). Er sagte, er habe nicht geglaubt, dass ich ihn besuchen würde (»Me hear you a come but me no tink you a come fo’ true.«).
Zu der Zeit, als mich der Anruf erreichte und ich von der Krankheit meines Bruders erfuhr, war eine meiner vielen Annehmlichkeiten, meiner luxuriösen Freuden, The Education of a Gardener zu lesen, geschrieben von einem Mann namens Russell Page. Ich kam gerade zu dem Urteil, dass er als Gärtner, der Gärten für andere Menschen entwirft, die Persönlichkeit eines Dienenden habe, nicht die eines Künstlers, dass seine Prosa pingelig, penibel und zaghaft sei; dass ich, obwohl das Buch mich langweilte, es weiterlesen wolle, weil es einen interessanten Kontrast zu anderen Gärtnern biete, deren Bücher mir außerordentlich gefielen. (Ich dachte an all das, ehe das Telefon klingelte. Heute mag ich The Education of a Gardener sehr und möchte es bald noch einmal lesen.) Und als das Telefon klingelte, legte ich dieses Buch beiseite und hob ab, und ich erfuhr von der Krankheit meines Bruders.
Als ich das Buch das nächste Mal aufschlug, saß ich auf dem Rasen vor der Station Gweneth O’Reilly, und mein Bruder saß auf einem Stuhl neben mir. Das war viele Tage später. Er konnte kaum laufen, kaum aufrecht sitzen, er war wie ein alter Mann. Der Weg von seinem Bett zum Rasen hatte ihn erschöpft. Wir schauten auf die typische Landschaft Antiguas, auf einen angelegten Weidenhain, vermutlich vor langer Zeit angepflanzt, als Antigua noch eine Kolonie war und die Kolonialregierung für den Betrieb des Krankenhauses verantwortlich. Es war nie ein besonders gutes Krankenhaus, doch heute ist es ein schreckliches Krankenhaus, und es gehen nur Leute dorthin, die sich nichts anderes leisten können. Nahe den Weiden stand ein alter, halb toter Flammenbaum; er müsste zurückgeschnitten und gedüngt werden. In der Nähe lag ein altes windschiefes Gebäude; und die übrige Gegend war mit Kassiabäumen bewachsen. Und als ich dieses Buch, The Education of a Gardener, wieder zur Hand nahm, schaute ich meinen Bruder an, denn auch er war Gärtner, und ich fragte mich, ob er, wenn sein Leben eine andere Wendung genommen hätte, wenn er seinem Leben eine andere Wendung hätte geben können, in der Lage gewesen wäre, ein Buch mit so einem Titel zu schreiben. Hinter dem kleinen Haus, in dem er auf Mutters Grundstück lebte, hatte er eine Bananenstaude gepflanzt, einen Zitronenbaum, verschiedene Gemüsesorten, verschiedene nicht blühende Sträucher. Als ich seinen kleinen Garten hinter seinem kleinen Haus zum ersten Mal sah, war ich erstaunt darüber, und ich fragte ihn, ob er ihn allein angelegt habe, und er antwortete: »Natürlich.« (»How you mean, man?«) Ich weiß heute, dass wir, er und ich, diese Liebe zu den Pflanzen von unserer Mutter geerbt haben. Selbst in jenem Augenblick, als er und ich auf dem Rasen saßen, zog unsere Mutter an einem Spalier, das sie aus einem alten eisernen Bettgestell und alten verrosteten Zinkteilen gebaut hatte, eine Passionsblume, und ihr üppiges Wachstum war beeindruckend, denn es ist nicht leicht, auf Antigua eine Passionsblume zum Wachsen zu bringen. Sie trug Früchte in solcher Fülle, dass sie einige davon verschenkte, denn es waren mehr, als sie selbst brauchen konnte. Ihre Art, mit Pflanzen umzugehen, ist etwas, das mir sehr vertraut ist; als ich klein war, baute sie genau dort, wo nun das Haus meines Bruders steht, verschiedene Gemüsesorten und Kräuter an. Die roten Ameisen, die über ihn herfielen, als er noch nicht einmal einen Tag alt war, waren auf einige Okrabäume gekrabbelt, die sie zu nah am Haus gepflanzt hatte, und die roten Ameisen liefen vom Okrabaum durch ein Fenster auf das Bett, in dem er und meine Mutter lagen. Nachdem sie alle Ameisen getötet hatte, die über ihr Kind hergefallen waren, lief sie nach draußen und riss in einem Anfall rasender Wut die Okrabäume mitsamt den Wurzeln aus und warf sie weg.
Ich verstehe erst heute, warum Menschen ihre Vergangenheit leugnen, warum sie über sich anderes erzählen, als es wirklich war, warum sie sich ein Ich erfinden, das keinerlei Ähnlichkeit aufweist mit dem, wie sie wirklich sind, warum jemand sich fühlen möchte, als ob er oder sie nirgendwo hingehöre, von niemandem abstamme, einfach vom Himmel falle, unversehrt.
Als meine Mutter und ich eines Tages draußen im Hof waren und sie darüber klagte – obwohl ihr das nicht auffiel –, wie abhängig das eine oder andere Kind von ihr sei, und sie sich nicht bewusst war, dass sie stets hinter dem Rücken der anderen schlecht über uns sprach, bemerkte ich, dass der Zitronenbaum, den mein kranker Bruder gepflanzt hatte, nicht mehr da war; ich fragte sie danach, und sie sagte geradezu beiläufig: »Oh, wir haben ihn abgesägt, um Platz zu schaffen für den Anbau.« Ich musste auf meine Füße schauen, unmittelbar, unwillkürlich; es tat mir weh, sie das sagen zu hören, die Art, wie sie es sagte, tat mir weh, ich war peinlich berührt. Dieser Zitronenbaum wäre eines der Dinge gewesen, die von seinem Leben übrig geblieben wären. Nichts stammte von ihm; keine Arbeit, keine Kinder, keine Liebe zu irgendjemandem. Er hatte früher mal irgendeinen Job im Amt für öffentliche Bauarbeiten, doch er war zu aufmüpfig – er hatte ein loses Mundwerk, wenn ihm jemand in die Quere kam, sagte meine Mutter –, und eines Tages sagte er in einer Auseinandersetzung mit seinem Vorgesetzten etwas Unverschämtes (»He cuss dem out.«) und wurde rausgeschmissen. Jemand erzählte mir, dass er damals eine Menge Geld verdient haben soll. Er gab meiner Mutter eine beträchtliche Summe, damit sie sie für ihn verwahre, nachdem er jedoch arbeitslos geworden war, bat er sie immer wieder, ihm etwas zu geben, bis nichts mehr davon übrig war, und als er krank wurde, war er pleite, hatte keinerlei finanziellen Rückhalt. Dies schien ihn nicht zu beunruhigen; ich könnte nicht sagen, ob es für ihn von Bedeutung war. Als sein Vater, der Ehemann meiner Mutter, starb, ließ er sie als Sozialhilfeempfängerin zurück, und sie musste sich Geld leihen, um ihn beerdigen zu können. Mein Bruder hatte keine feste Freundin, keine Frau, niemanden außer seiner eigenen Mutter, die sich um ihn kümmerte; er hatte keine Kinder, als er im Sterben lag, seine Freunde hatten sich von ihm abgewandt. Niemand kam ihn besuchen, außer Familienangehörigen und Freunden seiner Mut- ter aus der Kirche.
Aber auch dies entspricht meiner Mutter voll und ganz: Als er krank war, stand sie jeden Morgen sehr früh auf und bereitete für ihren kranken Sohn Porridge und ein Getränk mit Nahrungsergänzungsmitteln, packte eine kleine Tasche und ging zu Fuß zum Krankenhaus, das ungefähr eine Meile entfernt liegt und zu dem man einen ziemlich steilen Berg hinaufgehen muss. Wenn sie gegen halb sieben das Haus verließ, stand die Sonne noch nicht so hoch, und es war noch nicht sehr heiß. Manchmal nahm sie jemand im Auto mit, doch das kam nicht oft vor. Wenn sie ins Krankenhaus kam, badete sie meinen Bruder, und währenddessen ließ sie ihn nicht merken, dass sie sah, wie die wunde Stelle an seinem Penis nicht heilen wollte, und dass sie darüber beunruhigt war. Sie hatte diese wunde Stelle rein zufällig entdeckt, als er zum ersten Mal im Krankenhaus war, und als sie ihn fragte, wie er an eine solche Sache gekommen sei, erzählte er, er habe sich irgendetwas auf einer Klobrille eingefangen. Weder glaubte sie ihm noch glaubte sie ihm nicht, als er das erzählte. Nachdem sie ihn gebadet hatte, zog sie ihm einen sauberen Schlafanzug an, den sie ihm mitgebracht hatte, und wenn seine Laken nicht gewechselt worden waren, bezog sie sein Bett frisch, und dann, wenn er im Bett saß, half sie ihm zu essen, was sie für ihn vorbereitet und mitgebracht hatte.
Als ich ihn zum ersten Mal sah, waren seine ganze Mundhöhle und seine Zunge bis hinten in den Rachen mit einem weißen Soorbelag überzogen. Er hatte eine kleine wunde Stelle neben den Mandeln, ich konnte sie sehen, wenn er den Mund weit öffnete, was ihm nur mit größter Mühe gelang. Diese Stelle machte es ihm schwer, irgendetwas hinunterzuschlucken, vor allem feste Nahrung. Wenn er das Porridge und das stärkende Getränk, die ihm meine Mutter mitgebracht hatte, zu sich nahm, musste er sich ungeheuer anstrengen, als müsste er tonnenschwere Lasten heben. Ein qualvoller Blick füllte seine Augen. Er aß und trank langsam. Unsere Mutter, die gerne kocht und gerne sieht, dass Menschen ihr Gekochtes essen, insbesondere seitdem sie weiß, dass sie eine exzellente Köchin ist, ermunterte ihn, weiter zu essen, wann immer er eine Pause einlegte (»Come on, man, yam up your food.«), und er sah sie hilflos an. Normalerweise hätte er eine scharfe Entgegnung parat gehabt, aber vermutlich fiel ihm in diesen Momenten keine ein. Nachdem sie ihm beim Frühstücken geholfen hatte, räumte sie das Zimmer auf, stopfte seine schmutzige Kleidung und die Handtücher in eine Tasche, um sie mit nach Hause zu nehmen und zu waschen; sie leerte die Bettflasche, die seinen Urin enthielt, sie rieb Salbe auf die trockene Haut seiner Arme und Beine, sie kämmte ihn, so gut sie konnte. Meine Mutter liebt ihre Kinder, ich möchte sagen, auf ihre Art! Und das stimmt ganz und gar, sie liebt uns auf ihre Art. Es ist ihre Art. Es ist ihr niemals in den Sinn gekommen, dass ihre Art, uns zu lieben, vielleicht nicht die allerbeste für uns sein könnte. Es ist ihr niemals in den Sinn gekommen, dass ihre Art, uns zu lieben, vielleicht mehr ihr gedient hat als uns. Und warum hätte es ihr in den Sinn kommen sollen? Vielleicht ist jede Liebe egoistisch? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Sie liebt und versteht uns, wenn wir schwach und hilflos sind und sie brauchen. Meine eigenen intensiven Erinnerungen an sie kreisen darum, wie sie mich gebadet und gefüttert hat. Als ich noch ganz klein und meine Nase wegen einer Erkältung verstopft war, stülpte sie ihren Mund über meine Nase, saugte den Schleim in ihren Mund und spuckte ihn dann aus; als ich noch ganz klein war, nicht gerne aß und darüber klagte, Kauen sei so mühsam, kaute sie mein Essen in ihrem Mund und schob es, nachdem sie es gut durchweicht hatte, in meinen. Ihre Liebe zu ihren Kindern, so lange sie Kinder sind, ist spektakulär und in der Geschichte der Mutterliebe unübertroffen. Erst wenn ihre Kinder versuchen, erwachsen zu sein, ist die Selbstverständlichkeit, mit der sie sie liebt, dahin; erst wenn sie in einem kalten Apartment in New York leben, hungrig und ohne einen Penny, weil sie sich entschieden haben, Schriftstellerin zu werden, und ihr in dem Wunsch nach Mitgefühl, nach einem Wort der Ermutigung, der Liebe schreiben, ist die Selbstverständlichkeit ihrer Liebe dahin. Ihre Antwort an eines ihrer Kinder, das sich in solch misslicher Lage befand, war: »Es geschieht dir recht, du versuchst immer Dinge zu tun, von denen du weißt, das du sie nicht kannst.« Genau das waren ihre Worte. Dennoch ist ihre Liebe, ob wir sterben oder im Gefängnis sitzen, wunderbar, sie ist ein großes Glück, und wir sind froh, sie zu haben. Mein Bruder lag im Sterben; er brauchte sie gerade jetzt.
In seinen überaus charmanten Erinnerungen dar- an, wie er Gärtner wurde, schreibt Russel Page:
Als ich Kind war, fand jeden Freitag auf dem alten palladianischen Buttermarkt nahe dem Stonebow in Lincoln ein Markt statt. Die Bäuerinnen fuhren früh am Morgen in ihren besten Kleidern mit Körben frischer Butter, Küken, Enten und Bünden frisch gepflückter Minze und Salbei in die Stadt. Oft nahm mich die Haushälterin meines Großvaters mit, die dort ihre Einkäufe machte, und ich erinnere mich, dass es immer im Frühjahr Bünde gefüllter mauvefarbener Primeln und schwer duftender Daphne mezereum gab. Später, als meine Leidenschaft fürs Gärtnern sich entwickelte, wünschte ich mir diese Pflanzen, konnte sie aber nie in den Gärten unserer Freunde finden. Sie schienen nur in Bauerngärten zu wachsen, in verlorenen Weilern zwischen Feldern und Wäldern. Nach und nach lernte ich die Bauern und ihre Gärten im Umkreis von einigen Meilen kennen, denn diese Leute vom Land hatten den Dreh mit Pflanzen heraus. Küchenfenster standen voll mit Töpfen, aus denen Kaskaden von Campanula isophylla, Geranien, Fuchsien und Begonien quollen, alle aus einem Setzling gezogen. Man schenkte mir Triebe von historischen Nelken und Rosen, die in keinem Katalog zu finden waren, und Sämlinge von Pflanzen, die vielleicht ein zur See fahrender Cousin mit nach Hause gebracht hatte – hier fand sich eine ganze Welt bescheidener Blumenfanatiker.
Was würde mein Bruder antworten, wenn man ihn fragte, wie sein Interesse für Pflanzen begann? Er hat gesehen, wie unsere Mutter sich mit ihnen beschäftigte. Was sonst? Dies ist es, was meine Familie, die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin, an mir hasst: Ich sage immer: Erinnerst du dich? Heute stehen hinter seinem kleinen Haus zwölf Bananenstauden, doch vor Jahren, als ich zum ersten Mal sein Interesse für Pflanzen bemerkte, war dort nur eine. Ich fragte meine Mutter, wie es komme, dass es jetzt zwölf seien, denn ich hatte keine Ahnung vom Wachstum dieser Pflanze. Sie sagte: »Na ja …« Und dann passierte etwas anderes, ein Hund, den sie aufgenommen hatte, tat irgendetwas, was sie nicht wollte, streng rief sie den Hund, und als der Hund nicht gehorchte, warf sie Steine nach ihm. Wir wandten unsere Aufmerksamkeit anderen Dingen zu. Doch eine Bananenstaude trägt ein Mal ein Bündel Früchte, und danach stirbt sie; ehe sie stirbt, treibt sie kleine Schösslinge. Einige der Stauden meines Bruders hatten Früchte getragen, starben und trieben neue Schösslinge. Der Pflanzenfreund in meinem Bruder wird nicht überleben, und all die anderen Dinge, die er vielleicht in seinem Leben war, sind gestorben; in seinem Körper lebt der Tod, treibt Blüten über Blüten, mit einer Gefräßigkeit, die wohl nichts stillen und aufhalten kann.
Ich bin so anfällig für die Bedürfnisse meiner Familie und ihren Einfluss, dass ich mich von Zeit zu Zeit von ihnen zurückziehe. Ich schreibe ihnen nicht. Ich besuche sie nicht. Ich lüge nicht, ich leugne nicht, ich ziehe mich nur zurück. Als ich erfuhr, dass mein Bruder krank war und sterben würde, versagte meine übliche Vorsicht, die ich mir zugestehe, wann immer die Bedürfnisse meiner Familie aufkommen – sollte ich sie näher an mich heranlassen oder nicht? Ich fühlte, dass ich in ein tiefes Loch fiel, doch ich versuchte nicht, mich am Fallen zu hindern. Ich fühlte, dass ich in einem großen Nebel aus Traurigkeit versank, doch ich versuchte nicht, ihm zu entkommen. Angst stieg in mir auf, er könnte sterben, bevor ich ihn wiedersähe; dann war ich geradezu besessen von der Angst, er könnte sterben, bevor ich ihn wiedersähe. Es überraschte mich, dass ich ihn liebte; ich konnte erkennen, dass es das war, was ich für ihn empfand, Liebe, und es überraschte mich, denn ich kannte ihn gar nicht. Ich war dreizehn, als er geboren wurde. Als ich mit sechzehn unser Zuhause verließ, war er drei Jahre alt. Ich kann mich nicht erinnern, für ihn eine besondere Zuneigung oder Ablehnung empfunden zu haben. Unsere Mutter erzählt mir, dass ich von den drei Brüdern den mittleren am meisten mochte, doch das scheint mir eine ihrer Erfindungen zu sein. Ich denke an meine Brüder als die Kinder meiner Mutter.
Als er ein Baby war, wechselte ich ihm für gewöhnlich die Windeln, badete ihn. Bestimmt habe ich ihn auch gefüttert. Am Ende eines Tages, als er im Krankenhaus war und ich die meiste Zeit bei ihm gesessen und beobachtet hatte, wie sein Körper das AZT vertrug, ein Medikament, das ich ihm mitgebracht hatte, da es hieß, es sei auf Antigua nicht erhältlich, sagte ich zu ihm, dass bei seiner schlimmen Krankheit wirklich nichts Gutes herauskommen könne, dass ich ihm aber dennoch danken wolle, dafür, dass mir bewusst geworden sei, dass ich ihn liebte, und er fragte, ob ich das ernst meinte (»But fo’ true?«), und ich sagte, ja, ich meinte es ernst. Und dann, als ich ihm Gute Nacht sagte und ihn verließ und die Tür hinter mir schloss, ging ich an der heruntergelassenen Jalousie seines Fensters vorbei, von seinem Bett aus, auf dem Rücken liegend, konnte er mich sehen, und er rief mir zu: »Ich liebe dich.« Das sagen sonst nur mein Mann und meine Kinder zu mir, und die Antwort, die ich ihnen jedes Mal darauf gebe, ist dieselbe, die ich ihm gab: »Ich liebe dich auch.«
Er lag in einem sehr kleinen Zimmer mit einer sehr hohen Decke, ganz allein. Im Krankenhaus geben sie Patienten, die an dieser Krankheit leiden, Einzelzimmer. Das Zimmer hatte zwei Fenster, beide gingen auf den Flur hinaus, sodass es gut durchlüftet war. Eine lange Neonröhre hing von der hohen Decke. Eine Nachttischlampe gab es nicht, doch wozu auch, es fiel mir nur auf, weil ich mich mittlerweile an so etwas, an eine Nachttischlampe, gewöhnt habe; er klagte nicht darüber. Ein kaputter Fernseher stand in der Ecke, und wenn mehr als zwei Besucher im Zimmer waren, diente er als Sitzgelegenheit. Der Raum war schmutzig. Der Linoleumboden war voller Rostflecken; er müsste dringend geschrubbt werden; einmal hat mein Bruder die Bettflasche mit seinem Urin verschüttet, sodass der Boden gewischt werden musste, es wurde mit unverdünntem Clorox gemacht. Das Zimmer hatte zwei Metalltische und einen Stuhl aus Metall und Plastik. Das Metall war verrostet, und die Unterseite der Möbel war dick verdreckt. Die Wände des Zimmers waren schmutzig, die Lamellen der Jalousien am Fenster waren schmutzig, die Rotorblätter des Ventilators waren schmutzig, und wenn er kreiste, rissen sich manchmal dicke Staubflocken los. Das war nicht gut für jemanden, der Atemprobleme hatte. Er hatte Atem- probleme.
Manchmal, wenn ich bei ihm saß, in den ersten Tagen des Wiedersehens nach so langer Zeit, als ich sah, wie er so dalag und schneller zu sterben schien als andere, wollte ich davonlaufen und in mich hineinschreien: »Was tue ich hier, ich will nach Hause.« Ich vermisste meine Kinder und meinen Mann. Ich vermisste das Leben, das ich mittlerweile führte. Wenn ich bei meinem Bruder saß, war das Leben, das ich mittlerweile führte, meine Vergangenheit, eine Vergangenheit, die mich nicht fühlen lässt, dass ich in ein Loch falle, dass ein Nebel aus Traurigkeit mich verschlingt. In diesem schmutzigen Zimmer waren andere vor ihm an derselben Krankheit gestorben. Dort hinein legen sie die Menschen, die das Virus haben, das Aids verursacht. Als man ihm anfangs mitteilte, dass sein Virus-Test positiv sei, sagte er unserer Mutter nicht die Wahrheit, er erzählte ihr, er habe Lungenkrebs, jemand anderem sagte er, er habe Bronchialasthma, aber er wusste, und meine Mutter wusste, und alle anderen, die es wissen wollten, wussten, dass ausschließlich Aids-Kranke isoliert in dieses Zimmer gelegt wurden.
Ich verließ ihn an diesem ersten Abend und stieg in ein Auto. Als ich von ihm wegging, lag er auf dem Rücken, mit geschlossenen Augen, das Neonlicht brannte. Ich fuhr in einem Mietwagen, und er trug mich an dem Wöchnerinnenhaus Magdalena vorbei, wo ich geboren bin, vorbei an dem Platz, wo früher das Totenhaus stand (ein kleines Gebäude, das einem Bauernhaus ähnelte, wo die Leichen aufbewahrt wurden, bis die Familien sie abholten), doch es steht da nicht mehr; es ist abgerissen worden, als es baufällig wurde und den Geruch der Toten nicht länger zurückhalten konnte. Dann kam ich zu einer großen Kreuzung, an der eine Ampel stand, doch sie war kaputt und das schon seit langer Zeit; sie konnte nicht repariert werden, da die dazu nötigen Teile, wo auch immer auf dieser Welt, nicht mehr hergestellt wurden – und das überraschte mich nicht, denn Antigua ist so: Teile für irgendetwas werden irgendwo auf der Welt nicht mehr hergestellt; auf Antigua selbst wird gar nichts hergestellt. Ich fuhr am Gefängnis vorbei, direkt rechts daneben liegt die Schule, die mein Bruder besuchte, als er klein war, und wo er eine Prüfung ablegte, um auf die Princess Margaret School gehen zu können, und bei dieser Prüfung, die auf der ganzen Insel abgenommen wurde, hatte er von allen Kindern das drittbeste Ergebnis. Ich fuhr an der Princess Margaret School vorbei. Als