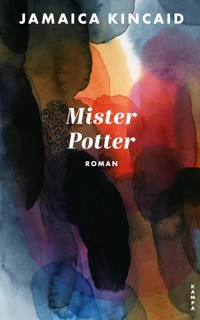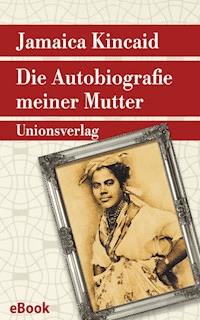Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Schon kurz nach ihrem Umzug von Antigua nach New York unternimmt Jamaica Kincaid erste Schreibversuche, bleibt in der literarischen Welt vorerst aber ein Nobody. Bis sie 1974 den Herausgeber des New Yorker trifft: William Shawn zeigt sich begeistert von ihren Texten und stellt sie ein. Kincaids eigenwillig-originellen Beiträge erscheinen fortan in der »Talk of the Town«-Kolumne. Mal legt sie als Story einfach die Spesenabrechnung vor, ein andermal tippt sie ein aufgeschnapptes Gespräch über Sting ab, statt eine Konzertkritik zu schreiben. Und auch die Absurditäten des Verlagswesens schildert sie schonungslos. Mit einem feinen Gespür für Ironie und Komik hält Kincaid in ihren Kolumnen fest, wie sie die Welt der Bücher und Partys, der Mode und Popmusik kennenlernt. Erst später druckt der New Yorker auch Kincaids fiktionale Geschichten. Ihren eigenen Stil und ihren unverwechselbaren Sound hat sie da bereits gefunden. Und so dokumentieren die zwischen 1974 und 1983 enstandenen »Talk Stories«, die hier erstmals auf Deutsch versammelt sind, eindrücklich Kincaids Entwicklung von einer jungen Autorin, die selbstbewusst ihre Beobachtungen notiert, zu einer der bedeutendsten Schriftstellerinnen unserer Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jamaica Kincaid
Talk Stories
Aus dem Amerikanischen von Anna Leube und Wolf Heinrich Leube
Kampa
Für George Trow und Sandy Frazier, für Rick Hertzberg und Veronica Geng und Tony Hiss, für Mark Singer und Suzannah Lessard und Kennedy Fraser und Jonathan Schell. Und für immer und ewig für Mr. Shawn, an den ich jeden Tag liebevoll denke und den ich niemals vergessen werde.
Vorwort
Hier eine Geschichte, die ich immer über Jamaica erzähle:
Als sie und ich vor fünfundzwanzig Jahren Redakteure beim New Yorker waren, lagen unsere Zimmer einander auf dem Flur gegenüber, und wir aßen am Ende des Tages oft gemeinsam zu Abend. Wir gingen erst spät weg, nachdem das Büro größtenteils leer war und der Berufsverkehr nachgelassen hatte, und gingen zu Fuß oder nahmen die U-Bahn von der Forty-third Street in Manhattan, wo sich der New Yorker befand, zu Jamaicas Wohnung in der West Twenty-second. Oft hielten wir unterwegs an einem Geschäft an und kauften etwas zum Kochen. Dann saß ich in ihrer Wohnung und trank drei oder vier Bier, während sie das Abendessen zubereitete, und dann aßen wir an einem kleinen Tisch und schauten uns dabei TV-Serien an wie Andy of Mayberry oder Mary Hartman oder die Miniserie Roots. Nach dem Essen unterhielten wir uns noch eine Weile, und dann ging ich nach Hause.
Auf dem Weg zu ihrer Wohnung kauften wir manchmal in einem Geschäft, das Chelsea Charcuterie hieß, für unser Abendessen ein. Das war ein kleiner Feinkostladen an der Ninth Avenue in der Nähe ihres Apartments. Heutzutage kann man Feinkostartikel wie Koriander- oder Curryhähnchensalat im A&P kriegen, aber damals gab es noch kaum solche Läden wie die Chelsea Charcuterie; dieser Laden war ein früher Vorbote des künftigen Feinkostbooms. Die Besitzer waren ungefähr in unserem Alter, sie mochten Jamaica, und sie konnte bei ihnen anschreiben. Einmal sagte sie mir, sie schulde ihnen über achthundert Dollar, ein Betrag, der so hoch war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie er jemals zurückgezahlt werden könnte. Meistens unterhielt sich Jamaica lange mit Francie, einer der Besitzerinnen, während sie überlegte, was sie kaufen sollte. Eines Abends plauderte sie mit Francie, als ein Typ mit einem lauten Ghettoblaster hereinkam und einen Zwanziger gewechselt haben wollte. Sichtlich gereizt drehte sich Jamaica nach ihm um und sagte: »Weißt du, das ist nicht die Art von Laden, wo du einfach reinkommen kannst und einen Zwanziger gewechselt haben willst.« Ich weiß noch, dass der Typ klein war, mit einem eckigen Gesicht und einem aerodynamisch geformten Kopf, der aussah, als könnte man ihn hochwerfen und er würde einen großen Kreis durch die Luft beschreiben und vor deinen Füßen landen. Der Typ drehte sich zu Jamaica um und sagte wütend und zugleich sachlich: »Lady, ich geh jetzt nach Hause, hol meine Knarre, komm zurück und knall dich ab.« Dann verließ er schnell den Laden.
Ich war dreiundzwanzig, als ich nach New York kam, und wollte Schriftsteller werden. Damals war ich immer nervös und ängstlich und erwartungsvoll, und manchmal traf ich Menschen, die waren anders als alle, die ich je getroffen hatte, Menschen, die erstaunliche Sachen machten. Dieser Moment in der Chelsea Charcuterie war in dieser Hinsicht ein Höhepunkt. So gut wie jeder, den ich kannte, mich eingeschlossen, hätte sofort den Laden verlassen. Damals waren in New York Schießereien an der Tagesordnung. Nicht weit von diesem Laden entfernt hatte es einmal eine Schießerei gegeben, und ich hatte das leuchtend rote Blut des Opfers auf dem Bürgersteig gesehen. Nachdem der dünne Typ gegangen war, setzte Jamaica seelenruhig ihren Einkauf fort. Sie überlegte, was wir für unser Abendessen noch brauchten, womöglich noch gemächlicher und gelassener als vorher. Ich wollte unbedingt raus aus dem Laden, aber ich durfte meine Angst natürlich nicht zeigen, nicht vor einem Mädchen. Und ich konnte auch nicht einfach wegrennen – das wäre gar nicht galant gewesen. Im Stillen nahm ich hin, dass meine Freundin und ich in ein paar Minuten tot sein würden, und ich schaute mich im Geschäft um in einer Stimmung selbstmitleidigen Abschieds; besonders erinnere ich mich an ein niedriges Fass aus rauem hellem Holz, gefüllt mit ghanaischen Kaffeebohnen.
Das Hochgefühl dieser Jahre bestand für mich vor allem darin, zu schauen, wer der Mutigste, wer der Coolste war. Ich hatte eine Bewertungsliste für mutige und coole Taten im Kopf: Ich sah George Trow und Tony Hiss, die jungen Veteranen des New Yorker, ein oder zwei Stunden vor Redaktionsschluss ins Büro kommen und ruckzuck Geschichten für Talk of the Town produzieren, so elegant und mühelos wie ein Seiltrick von Will Rogers. Ich sah einen Mann, der außen am World Trade Center 110 Stockwerke hochkletterte. Ich sah den Komiker Richard Pryor bei einem Live-Auftritt im Felt Forum, wie er das Publikum so zum Lachen brachte, dass das Lachen zu einem schmerzhaften Krampf wurde, den es nicht unterdrücken konnte. Ich sah, wie eine Hilfspolizistin zu einem hingefallenen Obdachlosen rannte, den ich nicht einmal mit Handschuhen angefasst hätte, und seinen Kopf sanft in ihrem Schoß wiegte, bis ein Krankenwagen eintraf. Ich sah, wie der Schauspieler John Belushi einen betrunkenen, aufdringlichen Fan, der eigentlich in Gewahrsam hätte genommen werden müssen, so abwehrte, dass die Begegnung in einen spielerischen Theaterauftritt verwandelt wurde. Aber niemand war in meinen Augen so mutig wie Jamaica. Sie versuchte nicht, zu schockieren oder »übergriffig« oder verwegen zu sein, eine solche Imitation von Mut ist sowieso meist Effekthascherei; ihr Mut war einfach so, wie sie war, und er kam ganz selbstverständlich und unverstellt von innen.
Einmal traf sie auf einer schicken New Yorker Veranstaltung Jacqueline Onassis und unterhielt sich mit ihr, und kurz danach wurde sie ihr bei einer anderen Veranstaltung zufällig noch einmal vorgestellt. Jacqueline Onassis begrüßte sie ein zweites Mal, ohne irgendein Zeichen des Wiedererkennens. Jamaica sagte: »Wir sind uns schon einmal begegnet«, und ging weg. Einmal unterhielt sich hinter uns im Kino ein Flegel sehr laut, und Jamaica forderte ihn auf, leise zu sein; daraufhin beschimpfte er sie und sagte, wenn sie sich nicht gleich umdrehen und die Klappe halten würde, würde er ihr das Gesicht zerschneiden; sie richtete ein paar markige Worte an ihn und konzentrierte sich wieder auf den Film. Einmal nahm ich sie zum Forellenfischen mit an einen tiefen, reißenden Fluss in Vermont, und sie watete in Jeans und Turnschuhen hinter mir her; erst später wurde mir klar, dass sie nicht schwimmen konnte. Manchmal fuhren wir zusammen nach Harlem, um dort in der 128th Street eine Bekannte zu besuchen oder im Apollo-Theater eine Show anzusehen. Das war in den Tagen von Black Power und Honky-go-home, und fast immer machten die Leute Bemerkungen uns gegenüber. Eine Dame mit Hut nannte Jamaica eine »schwarze Konkubine«, viele Typen stellten lautstark und obszön Spekulationen über uns an. Was immer die Leute für Grobheiten äußerten, Jamaica reagierte höflich und zuvorkommend wie eine Grundschullehrerin: »Ja, Sie haben recht, ich bin eine (was auch immer).« »Ja, es stimmt, ich mache (was auch immer).« Einmal belästigten uns Typen von den Fenstern eines Gefängnisbusses aus, und sie rief zurück, zumindest sei sie keine Kriminelle, die ins Gefängnis gebracht würde.
Dann gab es die Pyjama-Phase. Das kann ich nicht auslassen. Einmal verbrachte sie ein paar Tage im Sloan Kettering, einer Krebsklinik in Manhattan, wegen einer Operation, die schlimm hätte ausgehen können, aber zum Glück dann doch nicht schlimm war, und dort verliebte sie sich in den Pyjama, den das Krankenhaus ihr stellte. Dieser Pyjama war aus blau-weiß gestreiftem Seersucker, mit dazu passendem knielangen Bademantel und Papierpantoffeln. Dieser Pyjama gefiel ihr so gut, dass sie ihn nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus überall trug. Ich kreuzte in ihrer Wohnung auf – damals wohnte sie Downtown, in SoHo – und wollte sie ins Kino oder Uptown zu einer Veranstaltung des New Yorker begleiten; sie kam zur Tür im Pyjama, Morgenrock und in Papierpantoffeln. Ich verstehe überhaupt nichts von Mode, also hielt ich den Mund, aber beinahe hätte ich gesagt, dass man mit einem Pyjama als Abendgarderobe irgendwie verrückt aussieht. Ich wusste, sie würde ihn anbehalten, ganz gleich, was ich sagte. Es war Frühling, also war ihre Kleidung zumindest nicht unpassend für die Jahreszeit. In Manhattan ein Taxi zu bekommen, ist oft schwierig, aber ich habe gelernt, dass es noch schwieriger ist, wenn man in Begleitung einer ein Meter achtzig großen Schwarzen im Pyjama ist.
Uns ging es nur ums Schreiben. Jeder kühne Akt, den wir beobachteten oder selbst ausführten, war wie der Entwurf für eine gute Geschichte; wir lernten gerade erst, wie man schreibt, aber irgendwie war uns bewusst, dass Furchtlosigkeit der Schlüssel war. Es klingt melodramatisch, aber wir glaubten, wir müssten schreiben oder sterben, doch die Jugend ist ja an sich schon melodramatisch. Unsere Ansichten über uns selbst und andere Schriftsteller waren gnadenlos und extrem. Jamaica glaubte, das Schreiben müsse immer an erster Stelle stehen, vor dem Privatleben, und als sie fünfundzwanzig war, musste ich ihr versprechen, dass ich sie, falls sie jemals heiraten und Kinder haben würde, beiseite nehmen und ihr sagen müsse, sie sei keine Schriftstellerin mehr. (Natürlich ist sie inzwischen seit vielen Jahren verheiratet und hat zwei Kinder, das ältere ist ein Teenager.) Dieses jugendliche Ungestüm brachte Jamaica dazu, kurze Non-Fiction-Geschichten für die Sparte Talk of the Town des New Yorker und insbesondere für William Shawn, den damaligen Herausgeber der Zeitschrift, zu schreiben. Jede Story, die sie damals schrieb, war ein weiterer Schritt hin zum Schreiben, eine neue Erkundung ihrer Stimme im Rahmen dessen, was die Zeitschrift zu Inhalt und Form vorgab. In gewisser Hinsicht sind die hier versammelten Talk-Beiträge die Geschichte, wie Jamaica zur Schriftstellerin wurde.
Der erste Text, den das Magazin von ihr veröffentlichte (auf Veranlassung von George Trow, der eine kurze Einleitung dazu verfasste), war eine Reportage über eine West-Indian-Day-Parade in Brooklyn. Jamaicas Bericht hob sich dreidimensional vom umgebenden Text ab, wie eine Kombination aus normalem Druck und Blindenschrift, und kündigte eine neue Stimme im Magazin und eine künftige bedeutende Autorin an. Später sagte sie, dass sie beim Verfassen dieses Texts zum ersten Mal begriffen habe, dass Schreiben nicht etwas außerhalb von ihr war, sondern es waren einfach die Gedanken in ihrem Kopf. Seltsamerweise war ihre erste Story die einzige, unter der ihr Name auftauchte; die Artikel der Sparte erschienen damals fast alle anonym. Von da an schrieb sie Beiträge über Konzerte, Werbepartys, Leute, die damals berühmt waren, sowie die überraschende und zu Herzen gehende Beschreibung einer Versammlung der New Yorker Polizeikommissare, bei der das grellbunte Schottenkaro ihrer Jacketts wiederholt vorkam. Einige ihrer Beiträge waren Parodien auf Abenteuerromane für Mädchen im Stil von Nancy Drew, andere waren Dialoge zwischen erfundenen Personen, in denen das eigentliche Ereignis nur in kubistisch zersplitterter Form auftauchte. Einige ihrer Texte waren witzige Aufschreie vor lauter Frustration über die manchmal erdrückenden Benimmregeln des Magazins.
Schimpfwörter oder schmutzige Wörter zu benutzen oder über Sex zu schreiben, war in Talk of the Town nicht erlaubt. Über Religion durfte man nicht schreiben. Auch nicht über das aktuelle Thema der Woche, über das jeder Reporter in jeder anderen Publikation schrieb, es sei denn, man ging es auf völlig andere Weise an. Man durfte nicht zu gemein sein. Geschichten, in denen Gewalttaten oder blutige Sportarten vorkamen, waren tabu, genauso wie alles, was allzu kommerziell oder reißerisch oder gerade erst behandelt worden war. Auch sollte es bei allem immer um New York gehen oder in New York stattgefunden haben; schließlich war das nicht umsonst der New Yorker. Mr. Shawn legte seine Tabus und seine Beschränkungen nicht ausdrücklich dar – und es waren natürlich alle seine –, doch man lernte sie durch leidvolle Ablehnung von Vorschlägen und durch Geschichten kennen, die man einreichte und von denen man nie wieder etwas hörte.
Und dennoch konnte man abgesehen davon erstaunlicherweise so ziemlich tun und lassen, was man wollte. Innerhalb bestimmter Grenzen – die sogar überschritten werden konnten, wenn man Glück hatte und wusste, wie man es anstellen sollte – konnte man über alles schreiben, was man wollte und wie man wollte. Heute ist es kaum vorstellbar, dass ein wichtiges Magazin eine so eigenwillige und unkonventionelle redaktionelle Linie verfolgt, noch schwerer vorstellbar, dass eine solche Redaktionspolitik Erfolg hat, wie es beim New Yorker der Fall war. Für Jamaica war die Disziplin eine Herausforderung und die Freiheit berauschend. Einmal legte sie als Story eine Liste der Spesen vor, die für ihre Story angefallen waren. Ein andermal verfasste sie einen langen, einfühlsamen Brief in der ersten Person über eine Zugfahrt von New York nach Cleveland. In einer anderen Ausgabe schrieb sie detailliert über ein Thanksgiving-Dinner, das sie gerade zubereitet hatte und das bis hin zu den Cranberrys die haargenaue Kopie des Thanksgiving-Dinners einer Familie aus dem Mittleren Westen war, abgedruckt in einer Frauenzeitschrift. Als ihre Talk Stories immer abenteuerlicher, komplexer und raffinierter wurden, erschienen auch die fiktionalen Geschichten, die sie berühmt machen sollten, mit der Zeit im Magazin. Ihre Talk Stories dienten ebenfalls als Aufwärmübungen für ihre in vielen Anthologien erscheinenden belletristischen Arbeiten wie »Girl«, »Am Grunde des Flusses«, und »In the Night«.
Waren der Einfallsreichtum und die Zielstrebigkeit in ihren Talk Stories allein Jamaica zu verdanken, so war das redaktionelle Ohr Mr. Shawn. Die vorliegende Sammlung kann als der Bericht über eine Lehrzeit oder als sich entfaltende Zwiesprache zwischen einer jungen Schriftstellerin und einem Mann betrachtet werden, der bereits Talk Stories herausgegeben hatte, als Jamaica noch gar nicht geboren war. Eine zusätzliche Dimension erhielt ihre Beziehung dadurch, dass Jamaica, ein paar Jahre nachdem ich ihr hatte versprechen müssen, ihr zu sagen, sie sei keine Schriftstellerin mehr, wenn sie heiraten würde, Mr. Shawns Sohn Allen begegnete und ihn heiratete. (Allen, Komponist und Dozent der Musiktheorie, lernte die unverblümte Art seiner Frau sehr gut kennen; seine Antwort auf einen besonders unverhohlenen Kommentar von ihr: »Liebes, bitte! Mäßige dich!«) Kürzlich wurde ausführlich über Mr. Shawns Stärken und Schwächen als Herausgeber und als Mensch geschrieben. Die meisten sind sich einig, dass er vielleicht der beste Redakteur seiner Zeit war, ohne jedoch viele konkrete Beispiele für seine redaktionellen Fähigkeiten zu nennen. Die vorliegende Sammlung, hinter der sich die Geschichte des Werdegangs einer außergewöhnlichen Schriftstellerin verbirgt, der gestattet wurde, sich von Story zu Story freier zu entfalten, ist auch ein Beleg dafür, dass ein großartiger Redakteur seine Arbeit gemacht hat.
Für Leser, die mit Jamaicas Romanen und Erzählungen vertraut sind, geben diese Texte eine Vorstellung davon, wie sie in ihren jungen Jahren und noch ganz am Anfang ihrer Karriere war. Manche werden Texte wiedererkennen, an die sie sich erinnern, von denen sie jedoch nicht wussten, dass sie von ihr stammten. In praktisch allen kann man stilistische Elemente, die später in ihren Romanen wieder auftauchen, in einer Frühform erkennen; andere stilistische Einfälle probierte sie nur ein einziges Mal aus Lust und Laune aus. Anders als viele Talk-Beiträge und auch anders als das meiste, was in Zeitschriften geschrieben wird, stammen diese Texte, ursprünglich ohne Nennung der Autorin veröffentlicht, wie man inzwischen deutlich erkennen kann, unverkennbar von einer bestimmten Person – sie sind ganz und gar in Jamaicas Stimme verfasst und von ihrer Sensibilität geprägt.
Manche der Texte habe ich zum ersten Mal halb fertig in ihrer Schreibmaschine gesehen. Ich ging regelmäßig über den Flur in Jamaicas Büro, las, woran sie gerade schrieb, und eilte in mein Büro zurück mit dem fieberhaften Verlangen, selbst Literatur zu verfassen. Manchmal wünschte ich, die Geschichte in meiner Schreibmaschine wäre die ihre, und stellte mir vor, sie zu kopieren oder sie einfach unter einem Vorwand mitzunehmen: »Gut gemacht, Kincaid – kein Grund, noch herumzutrödeln –, ich mach das für dich fertig und sorge dafür, dass es zu Mr. Shawn kommt!« Zuzusehen, wie ein Beitrag von ihr aus dem luftleeren Raum entstand, verlieh dem Schreiben die Lebendigkeit einer Live-Action, die Wörter auf Papier normalerweise nicht haben. In meinen vernünftigeren und weniger eifersüchtigen Momenten nutzte ich meinen Neid als Inspiration und versuchte, selbst etwas zu schreiben, glücklich, auf dem gleichen Feld wie sie zu spielen.
Meistens waren wir pleite oder fast pleite in der Zeit, als wir unsere Talk Stories schrieben, aber wenn ich etwas von Jamaica gelesen oder mit ihr geredet hatte, fühlte ich mich auf einmal reich, als hätte ich mich gerade an ein dickes und lange vergessenes Bankkonto erinnert, das auf meinen Namen lautete. Ich glaube, andere Leser dieses Buchs werden nach der Lektüre das gleiche Gefühl haben wie ich. Was sie schreibt, ist eine Fülle, die sie mit uns teilt, ein Versprechen auf mehr. In diesen frühen Texten zeigt sich Jamaica Kincaid, wie in ihrem ganzen Werk, als unerschrockene und kühne Autorin, die uns die immerzu schlummernden Möglichkeiten im Schreiben und in der Welt aufzeigt.
Ian Frazier
Einleitung
Jeder Satz, jeder Abschnitt über diesen Teil meines Lebens, meines Lebens als Schriftstellerin, muss mit George Trow beginnen. Möglicherweise wird ihm das nicht gefallen, aber es ist dennoch die Wahrheit: Ich muss mit George Trow beginnen.
Als ich jung war, wollte ich schreiben, und ich wusste nicht, wie das ging, doch ich wollte es trotzdem, deshalb erzählte ich jedem, der danach fragte, was ich machte, ich sei Schriftstellerin, und wenn ich auch noch keine war, wollte ich trotzdem eine werden. In dem einen Moment wollte ich Schriftstellerin sein, und weil mir instinktiv klar wurde, dass ich in Amerika war, beschloss ich im nächsten Moment, dass ich Schriftstellerin war, und wenn mich also jemand fragte, was ich sei, sagte ich, ich sei Schriftstellerin. Ich wusste nicht genau, was das bedeutet, ich weiß es eigentlich immer noch nicht genau, aber sogar jetzt, wenn ich gefragt werde, was ich wirklich bin, sage ich, ich sei Schriftstellerin.
Als Schriftstellerin bewarb ich mich bei einer Zeitschrift, die damals Mademoiselle hieß und immer noch so heißt, um einen Job als Schriftstellerin. Sie nahmen mich nicht, und als ich meinen Freunden oder sonst wem erzählte, ich hätte mich um einen Job bei dieser Zeitschrift (die damals Mademoiselle hieß und immer noch so heißt) beworben und sei abgelehnt worden, sagten sie zu mir, dass eine Zeitschrift wie Mademoiselle keine Schwarzen Mädchen einstelle. Wie dumm von denen bei Mademoiselle, dachte ich, denn da, wo ich herkomme, waren etliche Leute, die ich kannte, Mädchen, und noch viele, viele, viele andere mehr waren Schwarz, und deshalb interessierte mich damals Mademoiselle nicht, und heute sogar noch weniger. Dann fragte ich die Redakteurin einer Zeitschrift namens Ingenue, ob ich für sie schreiben dürfe, und sie sagte Ja, auch wenn das, womit ich mich dann beschäftigte, mit Schreiben eigentlich nur insofern etwas zu tun hatte, als man dazu Tinte, Papier und Wörter brauchte. Ich fragte Leute, die als kultiviert galten, wie sie im Alter der typischen Leserinnen von Ingenue gewesen waren. Ich könnte heute behaupten, dass mich das maßlos gelangweilt habe, aber das würde überhaupt nicht stimmen, denn als Kind habe ich echte Langeweile gekannt und überlebt. Die Antworten der von mir Befragten langweilten mich nicht, denn damals hörte ich nichts, was irgendjemand sagte, ich hörte allein meine Stimme, ich interessierte mich nur für meine Story.
Die Zeitschrift Ingenue gehörte demselben Mann, dem der National Lampoon gehörte, und beide Zeitschriften waren im selben Gebäude. Ich bin bestimmt viele Male im Aufzug hinauf- und hinuntergefahren, ohne auf irgendetwas oder irgendjemand zu achten, denn ich kann mich an nichts Bestimmtes mehr erinnern, außer an eines: Eines Tages begegnete ich einem äußerst attraktiven und wunderbaren Mann (so erschien er mir auf den ersten Blick), er war freundlich (so erschien er mir nach vielen Blicken), er wechselte ein paar Worte mit mir, und am Ende sagte er zu mir, er würde mich gern seinem Freund George Trow vorstellen. Der Mann, der mich im Aufzug ansprach, hieß Michael O’Donahue und ist inzwischen tot, aber als ich ihm begegnete, stand er im Mittelpunkt einer Gruppe von Männern, die ihren Lebensunterhalt damit verdienten, Witze zu erzählen und Leute zum Lachen zu bringen. Ich hätte das vielleicht merkwürdig finden müssen, denn ich hatte vor weniger als zehn Jahren die Insel verlassen, auf der ich geboren bin und auf der ich die ersten sechzehn Jahre meines Lebens verbracht hatte; ich war damals dreiundzwanzig. Auf der Insel, auf der ich aufgewachsen bin, wurden Witze zur Unterhaltung erzählt, aber jeder machte Witze, Witze waren so üblich und alltäglich, dass einer, wenn etwas Ernsthaftes und Wichtiges zu tun war, ernsthaft und streng ankündigen musste, dass das, was jetzt zu geschehen hatte, kein Witz war.
Michael O’Donahue machte mich mit George Trow bekannt, und George freundete sich mit mir an. George schrieb damals für ein Magazin namens The New Yorker, das es inzwischen nicht mehr gibt, obwohl immer noch ein Magazin dieses Namens existiert. George war der erste Mensch, der mir zuhörte, er war der erste Mensch, den ich mit einer flapsigen Bemerkung zum Lachen brachte, er war der erste Mensch, der mir begreiflich machte, dass das, was ich sagte, von Belang war, George war der erste, der mich meine unbewusste Stimme hören ließ, bevor andere sie hörten. George nahm mich zu Veranstaltungen mit, auf denen wichtige Leute auftraten, die mit der Welt der Discos und des Humors und anderen Dingen zu tun hatten, für die er sich interessierte und von denen er meinte, sie sollten auch mich interessieren.
Damals hatte ich von nichts eine Ahnung, auch jetzt habe ich von nichts eine Ahnung, aber damals wusste ich sogar noch weniger. Ich las alles. Ich las unterschiedslos alles. Einmal beschrieb ich George etwas und nannte das Wort »utilize«, in Gebrauch nehmen, und er sagte zu mir, ich solle nie mehr »utilize« sagen, denn das Wort »use«, gebrauchen, genüge völlig; dann ging er los und kaufte mir ein Exemplar von Fowler’s Dictionary of Modern English Usage, und ich benutzte das Wort »utilize« nie wieder, und ich möchte die Leute immer korrigieren, wenn sie »utilize« sagen, aber das mache ich nicht, denn sie sind nicht ich und ich bin nicht George Trow.
Ich wohnte damals in Zimmern von anderer Leute Wohnungen, oder ich wohnte in ihren Wohnungen, solange sie in Paris waren oder eine Zeitlang mit Leuten zusammenwohnten, in die sie sich gerade verliebt hatten; ich hatte keine eigene Wohnung, weil ich kein Geld hatte. Ich vermied immer die Telefonanrufe von Leuten, die in Paris waren, oder wollte auch nicht, dass die Leute, die mir ein Zimmer ihres Apartments überlassen hatten, zur gleichen Zeit da waren, und ich vermied, dass Leute da waren oder anriefen, die mich in ihren Apartments wohnen ließen, weil sie mit jemand Neuem zusammengezogen waren, in den sie sich gerade verliebt hatten. Kann man so in New York leben? Ich weiß es nicht. Ich hatte kein Geld. Ich hatte keine Bleibe und konnte mir fast nie leisten, mein Essen selbst zu bezahlen.
Zu der Zeit, als ich Michael O’Donahue im Aufzug traf, hatte ich schon begonnen, mir einen Stil zuzulegen. Ich hatte mir das Haar auf eine kurze, jungenhafte Länge abgeschnitten und sein natürliches Schwarz auf Blond gebleicht; ich hatte meine Augenbrauen vollständig abrasiert und mit goldfarbenem Augen-Make-up Striche gezogen, wo vorher meine Brauen gewesen waren. Ich konnte mir keine neuen Kleider leisten und kaufte mir deshalb gebrauchte und trug sie, als wären es die einzigen Kleider, die ein interessanter Mensch tragen würde. Ich mochte keine Nylonstrümpfe und konnte in Stöckelschuhen nicht bequem gehen, deshalb trug ich weiße Söckchen und alte Sattelschuhe und trug sie, als wären das die einzigen Dinger, die ein interessanter Mensch an den Füßen zu tragen hätte. Ich hielt mich selbst für einen interessanten Menschen, dabei hatte ich keine Ahnung, was das bedeutete, und es war mir egal, ob irgendjemand meiner Meinung war. Eigentlich waren viele nicht meiner Meinung. Alle möglichen Leute starrten mich an, die meisten feindselig. Das störte mich überhaupt nicht. Junge Schwarze Männer und Frauen starrten mich an und lachten über mich und sagten dann irgendetwas Beleidigendes. Besonders das störte mich nicht im Geringsten; vielmehr gefiel es mir, es war mir sehr vertraut. Ich war an einem Ort aufgewachsen, wo viele jung und Schwarz waren, Männer und Frauen, und ich war angestarrt und ausgelacht worden, und man hatte mir beleidigende Worte an den Kopf geworfen: Ich war zu groß, ich war zu dünn, ich war sehr smart, meine Kleider hatten nie richtig gepasst, ich hatte kaum Busen; mein Haar blieb nicht, wo es hingehörte. Wenn mich also junge Schwarze Männer und Frauen anstarrten und über mich spotteten, dann war ich das gewöhnt, ich fühlte mich überhaupt nicht bedroht, es war mir vertraut. Und sogar heute noch, vor allem heute noch glaube ich, dass junge Schwarze Männer und Frauen die einzigen Menschen sind, deren Meinung mich interessiert, deren Aufmerksamkeit ich erregen will.
An dem Tag, als ich Michael O’Donahue im Aufzug begegnete und er mich fragte, ob ich seinen Freund George Trow kennenlernen wollte, trug ich Jodhpurs aus einem schönen beigen Baumwollköper, eine schlichte weiße Baumwollbluse, eine dunkelbraune, auf Taille geschnittene Jacke, eine braune Plastikbrosche, die aussah wie eine Herrenarmbanduhr, aber statt Zeigern und Ziffern war auf der Vorderseite meiner Brosche ein Hundekopf abgebildet; und um den Hals trug ich einen hellgelben Seidenschal, der mit einer Art kleinem Hund, kein amerikanischer Hund, bedruckt war. Ich besaß eine Anzahl lustiger Hütchen in allen möglichen Farben und aus allen möglichen Materialien. An dem Tag, als ich Michael O’Donahue im Aufzug begegnete, trug ich einen beigen Hut in Form eines kleinen runden Kuchens und hatte ihn schräg aufgesetzt, damit es kapriziös oder einfach nur stylisch aussah, eins von beidem, das war mir egal. Ich ging damals, wie ich auch heute noch gehe, ich redete damals, wie ich auch heute noch rede. Diese Kleider trage ich heute nicht mehr, nicht einmal den Schal; sie passen nicht mehr zu mir.
Ich wollte schon Schriftstellerin werden, bevor ich George begegnete, ich wollte schon Schriftstellerin werden, bevor ich Mr. Shawn begegnete. Ich weiß nicht, ob ich ohne bestimmte Vorkommnisse die Schriftstellerin geworden wäre, die ich heute bin. George nahm mich an viele Orte mit, manchmal nur als Begleitung, manchmal nur, damit ich etwas zu essen bekam. Eines Abends nahm er mich mit in ein Restaurant in der Twenty-eighth Street zwischen Lexington und Park Avenue, in dem es libanesisches Essen gab. Ich sagte etwas, ich weiß nicht mehr was, aber es gefiel George, und er lachte sein lautestes Lachen und sagte, er werde mich Mr. Shawn vorstellen, damals wusste ich nicht, wer Mr. Shawn war, aber ich war trotzdem einverstanden.
Es war ein kalter Apriltag, und ich trug keine bequeme, warme Kleidung, sondern Kleidung, die ich mochte: Ich trug ein rosa-weißes Seidenkleid, ein Kleid, das in den 1930er Jahren Mode gewesen war, und meine braune Jacke, die ich normalerweise zu den Jodhpurs trug. Wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, wie Mr. Shawn aussah, als ich ihm im Frühjahr 1974 zum ersten Mal begegnete, dann deshalb, weil er für mich genauso aussah wie zu der Zeit, als ich ihn zum letzten Mal sah, im November 1992, und kurz danach starb er. Bei jenem Mittagessen sollte ich als Erste bestellen, natürlich aus Höflichkeit, das wusste ich aber nicht, und ich bestellte das teuerste Gericht auf der Speisekarte, entweder weil ich gerade Hunger hatte oder weil ich nicht wusste, wann ich wieder etwas Gutes zu essen bekommen würde. Ich schämte mich sehr, dass George etwas bestellte, was nur halb so viel kostete wie mein Gericht, und Mr. Shawn bestellte nur Tee und ein Stück Kuchen, und als ich sah, was sie bestellt hatten, dachte ich tatsächlich, weil mein eigenes Gericht so teuer war, reichte das Geld nicht mehr für ein anständiges Essen für die beiden.
George liebte Mr. Shawn, deshalb wollte er mich mit Mr. Shawn bekannt machen und Mr. Shawn mit jemand, der vielleicht für ihn schreiben und ihm damit ein Vergnügen, eine Freude bereiten könnte; damals spürte ich, und das ist auch heute noch so, dass George mich liebte und mich in diesen Teil seiner Welt einführen wollte. Ich liebte George damals, und ich weiß, das ist auch heute noch so. Mr. Shawn glaubte nicht, dass ich eine gute Talk-Reporterin abgeben würde, aber er sagte zu George, ich solle es versuchen. Fünf Monate danach schrieb ich meinen ersten Beitrag, aber erst nachdem ich ihn geschrieben hatte, erst nachdem Mr. Shawn ihn gelesen und in eine Form gebracht, ihm Leben verliehen hatte, wusste ich, dass es ein richtiger Text war, dass es mein Text war, und durch diesen Beitrag und weil Mr. Shawn ihn akzeptiert hatte, begriff ich, was Schreiben bedeutet, das, was ich tat, was ich machen wollte, was ich jetzt mache: schreiben. Dank dieser ersten Erfahrung, als ich Mr. Shawn ein paar meiner Gedanken auf Papier mitteilte, wurde ich zu dem schreibenden Menschen, der ich heute bin.
Ich bin in St. John’s auf Antigua geboren und verbrachte dort die ersten sechzehn Jahre meines Lebens. Kurz nach meinem sechzehnten Geburtstag schickte mich meine Familie nach Amerika, wo ich arbeiten und Geld verdienen sollte, um sie zu unterstützen. Das gefiel mir ganz und gar nicht. Es gefiel mir ganz und gar nicht, dass ich weggeschickt wurde, und ich wollte ihnen auch nicht das Geld schicken, das ich verdient hatte. Als ich George kennenlernte, redete ich die ganze Zeit von meiner Familie, und zwar so zwanghaft, dass man mich für verrückt halten musste. George glaubte das nicht, und Mr. Shawn glaubte das auch nicht. Der erste Text, den ich schrieb, handelte vom Karneval, den Einwanderer aus den englischsprachigen Westindischen Inseln in Brooklyn, New York, wieder aufleben ließen. Zu sagen, ich »schrieb«, ist eigentlich irreführend, denn ich dachte nicht, ich würde schreiben; ich notierte ein paar Stichworte, Bemerkungen zu dem, was ich ein paar Tage vor dem eigentlichen Karneval gesehen hatte, und schrieb dann meine Eindrücke vom Karneval nieder. Stichworte und Bemerkungen waren zwei getrennte Dinge, und ich dachte, wenn ich sie Mr. Shawn gäbe, würde er sie George umschreiben und einen vernünftigen Text daraus machen lassen. Stattdessen wurden Stichworte und Bemerkungen genau so gedruckt, wie ich sie aufgeschrieben hatte, und diese Eigenart, dass das Geschriebene genau so gedruckt wurde, ist es, was mich bis zum heutigen Tag misstrauisch gegenüber Redakteuren, Lektoren macht, die mir vorschlagen, wie ich dieses oder jenes ändern sollte.
Soweit ich damals wusste, wollte ich Schriftstellerin werden; genau das wollte ich werden, Schriftstellerin. Ich wollte nicht ich selbst sein, ich wusste nicht, was ich selbst eigentlich war, ich wollte nur nicht ich selbst sein, wie ich mich kannte, ich wollte Schriftstellerin sein. Aber ich wusste nicht, wie man das macht, ich wusste nicht, wie Schreiben geht. In dem Moment, als Mr. Shawn meine Wörter veröffentlichte, die Gedanken, die ich im Kopf hatte, da wusste ich, ich könnte Schriftstellerin werden, und ich wurde Schriftstellerin. Die Wörter, die ich sagte, die Gedanken in meinem Kopf, das war mein Schreiben, ich musste nicht von den Leuten abstammen, die lange die Welt beherrscht hatten, ich musste nicht von den Leuten abstammen, die sich die Welt, in der ich lebte, vorgestellt und sie dann real gemacht hatten. Dieser Moment wurde mein Moment. Im Anfang war mein Wort und mein Wort wurde die Welt, wie ich sie haben wollte. Wenn das nun zu verwegen klingt, wenn es nun zu erfunden klingt, wenn es zu sehr nach nachträglicher Erkenntnis klingt, so ist es dennoch wahr: Als ich meine Wörter und meine eigenen Gedanken so sah, wie ich sie auf den Seiten eines Magazins niedergeschrieben hatte, autorisiert von Mr. Shawn (und das ist das richtige Wort dafür, »autorisiert«), da wurde ich Schriftstellerin, und diese Schriftstellerin wurde ich. Das heißt, die Person, die dies schreibt.
Bis ich über den Westindischen Karneval in Brooklyn schrieb, war ich in der Sparte Talk of the Town des New Yorker