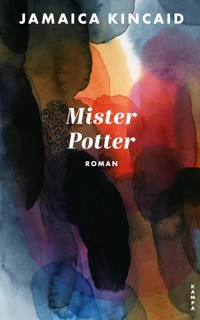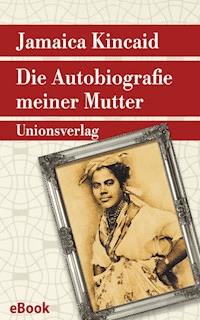Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Annie Johns Kindheit auf der Karibikinsel Antigua scheint rundum unbeschwert. Wissbegierig, fröhlich und ein wenig frech, wie sie ist, macht sie täglich neue und höchst erstaunliche Entdeckungen: dass auch Kinder sterben können zum Beispiel und wie sie aussehen, wenn sie im Sarg liegen, dass heiße Kräuterbäder gegen die bösen Geister helfen, die frühere Freundinnen von Annies Vater gegen die Familie aufgehetzt haben, dass man von einem Tag auf den anderen vom Mädchen zur »jungen Dame« werden kann - und dass dies nicht nur Gutes mit sich bringt. Denn plötzlich wendet sich Annies geliebte Mutter brüsk von ihr ab. Eine Zeit der Geheimnisse, der Rebellion und der Ablösung beginnt. Bis Annie einen emotionalen Zusammenbruch erleidet, der alles verändert.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jamaica Kincaid
Annie John
Roman
Aus dem Englischen von Barbara Henninges
atlantis
Für Allen, in Liebe
1Gestalten in der Ferne
Als ich zehn Jahre alt war, dachte ich eine Zeit lang, dass nur Leute starben, die ich nicht kannte. Zu der Zeit, als ich das dachte, hatte ich Sommerferien, und wir wohnten weit draußen an der Ford Road. Sonst wohnten wir eigentlich in unserem Haus an der Dickenson Bay Street, einem Haus, das mein Vater eigenhändig gebaut hatte, aber das brauchte ein neues Dach, und deshalb wohnten wir in dem Haus draußen an der Ford Road. Wir hatten nur zwei Nachbarn, die Lehrerin, Mistress Maynard, und ihren Mann. In jenem Sommer hatten wir eine Sau, die gerade Ferkel bekommen hatte; ein paar Perlhühner; und ein paar Enten, die Rieseneier legten, Eier, die selbst für Enten ungewöhnlich groß waren, sagte meine Mutter. Mir schmeckte nichts außer diesen riesigen Enteneiern, hart gekocht. Ich hatte nichts weiter zu tun, als jeden Tag morgens und abends das Federvieh und das Schwein zu füttern. Ich sprach mit niemandem außer mit meinen Eltern und hin und wieder mit Mistress Maynard, sofern ich sie antraf, wenn ich die Gemüseabfälle holen ging, die sie meiner Mutter zuliebe für das Schwein aufhob, denn genau die fraß das Schwein für sein Leben gern. Von unserem Hof aus konnte ich den Friedhof sehen. Dass es der Friedhof war, wusste ich nicht, bis ich eines Tages meiner Mutter erzählte, ich könne manchmal abends, wenn ich das Schwein fütterte, kleine, stockähnliche Gestalten in der Ferne auf und ab hüpfen sehen, die einen schwarz, die anderen weiß gekleidet. Mir fiel außerdem auf, dass die schwarzen und weißen stockartigen Gestalten manchmal auch vormittags auftauchten. Meine Mutter sagte, wahrscheinlich sei gerade ein Kind beerdigt worden. Kinder würden immer vormittags beerdigt. Bis dahin hatte ich nicht gewusst, dass Kinder starben.
Ich hatte Angst vor den Toten, wie alle, die ich kannte. Wir hatten Angst vor den Toten, weil man nie wissen konnte, wann sie wieder erscheinen würden. Manchmal erschienen sie einem im Traum, aber das war nicht so schlimm, weil sie einen dann meistens nur vor etwas warnten, und außerdem wachst du aus einem Traum wieder auf. Aber manchmal standen sie plötzlich unter einem Baum, an dem man gerade vorbeiging. Dann folgten sie einem womöglich bis nach Hause, und selbst wenn sie nicht bis ins Haus kommen konnten, passten sie einen vielleicht ab und folgten dir auf Schritt und Tritt; und dann ließen sie nicht mehr von einem ab, bis man mit ihnen ging. Meine Mutter wusste von vielen Leuten, die auf diese Weise gestorben waren. Meine Mutter wusste überhaupt von vielen Leuten, die gestorben waren, einschließlich ihrem eigenen Bruder.
Nachdem ich das mit dem Friedhof entdeckt hatte, stellte ich mich immer in den Hof und wartete auf die nächste Beerdigung. An manchen Tagen gab es keine Beerdigungen. »Niemand gestorben«, sagte ich dann zu meiner Mutter. An manchen Tagen erspähte ich die Pünktchen, wenn ich gerade aufgeben und hineingehen wollte. »Warum sind sie so spät dran?«, fragte ich dann meine Mutter. Vermutlich hätte es jemand nicht ertragen, dass der Sargdeckel geschlossen wurde, und da hätte der Bestatter aus Gefälligkeit den Dingen zu lange ihren Lauf gelassen, sagte sie. Der Bestatter! Auf dem Weg in die Stadt kamen wir immer an der Werkstatt des Bestatters vorbei. Davor stand auf einem kleinen Schild:
STRAFFEE & SÖHNE
BESTATTUNGSUNTERNEHMER
UNDMÖBELSCHREINER
An dem Geruch nach Pechkiefernholz und Lack, der in der Luft lag, merkte ich immer schon von Weitem, dass wir uns diesem Ort näherten.
Später zogen wir wieder in unser Haus in der Stadt, und ich hatte keine Aussicht mehr auf den Friedhof. Noch immer war niemand gestorben, den ich kannte. Eines Tages starb ein Mädchen, das kleiner war als ich, ein Mädchen, dessen Mutter mit meiner Mutter befreundet war, in den Armen meiner Mutter. Ich kannte dieses Mädchen überhaupt nicht, ich hatte sie vielleicht ein- oder zweimal flüchtig im Vorbeigehen gesehen, wenn sie mit ihrer Mutter aus unserem Hof kam, und ich versuchte, mir alles ins Gedächtnis zu rufen, was ich je über sie gehört hatte. Sie hieß Nalda; sie hatte rote Haare; sie war ganz knochig; sie mochte nichts, was man ihr zu essen gab. Dafür aß sie gern Dreck, und ihre Mutter musste sie streng beaufsichtigen, um sie daran zu hindern. Ihr Vater fertigte Backsteine an, und ihre Mutter kleidete sich in einer Art und Weise, die mein Vater nicht kleidsam fand. Ich hörte, wie meine Mutter meinem Vater genau beschrieb, wie Nalda gestorben war. Sie hatte Fieber gehabt, die Erwachsenen bemerkten, dass sie irgendwie anders atmete, da riefen sie ein Taxi und schafften sie schleunigst zu Doktor Bailey, und als sie gerade über eine Brücke fuhren, gab Nalda einen langen Seufzer von sich und wurde schlaff. Doktor Bailey stellte fest, dass sie tot war, und als ich das hörte, war ich so froh, dass er nicht mein Arzt war. Meine Mutter bat meinen Vater, den Sarg für Nalda zu machen. Das tat er und schnitzte Sträuße aus winzigen Blumen auf die Seitenwände. Naldas Mutter weinte so viel, dass meine Mutter sich um alles kümmern musste, und da Kinder nie von den Bestattern hergerichtet wurden, musste meine Mutter das kleine Mädchen für seine Beerdigung zurechtmachen. Von da an sah ich die Hände meiner Mutter mit anderen Augen. Sie hatten dem toten Mädchen über die Stirn gestrichen; sie hatten es gebadet und gekleidet und in den Sarg gelegt, den mein Vater gemacht hatte. Wenn meine Mutter aus dem Haus des toten Mädchens zurückkam, roch sie nach Pimentöl – ein Duft, von dem mir noch lange Zeit danach schlecht wurde. Eine Weile, nicht sehr lange allerdings, konnte ich es nicht ertragen, von meiner Mutter gestreichelt oder gebadet zu werden, oder dass sie mein Essen berührte. Vor allem den Anblick ihrer Hände, wenn sie reglos in ihrem Schoß lagen, konnte ich nicht ertragen.
In der Schule erzählte ich allen meinen Freundinnen von diesem Tod. Ich nahm sie einzeln beiseite, damit ich die Einzelheiten wieder und wieder berichten konnte. Sie hörten mir mit offenen Mündern zu. Dann erzählten sie mir ihrerseits von Leuten, die sie gekannt oder von denen sie gehört hatten, dass sie gestorben seien. Und ich hörte mit offenem Mund zu. Eine hatte einen Nachbarn sehr gut gekannt, der bei einem Picknick zu viel gegessen hatte und danach schwimmen gegangen und ertrunken war. Eine hatte einen Vetter, der eines Tages aus heiterem Himmel einfach tot umgefallen war. Und eine kannte einen Jungen, der gestorben war, nachdem er irgendwelche giftigen Beeren gegessen hatte. »Nicht zu fassen«, sagten wir zueinander.
Es gab ein Mädchen namens Sonia, das ich sehr liebte – und darum immer quälte, bis sie weinte. Sonia war kleiner als ich, obwohl sie fast zwei Jahre älter war, und sie war dumm – der erste echte Dummkopf, der mir je begegnet war. Sie war so dumm, dass sie manchmal nicht einmal mehr wusste, wie sich ihr eigener Name schrieb. Ich bemühte mich immer, ein bisschen früher in der Schule zu sein, um ihr meine Hausaufgaben zum Abschreiben zu geben, und im Unterricht steckte ich ihr die Lösungen von Rechenaufgaben zu. Meine Freundinnen behandelten sie wie Luft, und jedes Mal, wenn ich was Nettes über sie sagte, verzogen sie die Mundwinkel und gaben verächtliche Laute von sich. Ich fand sie schön, und das sagte ich auch. Sie hatte lange, dichte schwarze Haare, die sich flach über ihre Arme und Beine breiteten; und dann ihren Nacken und Rücken hinunterfielen, so weit man sehen konnte, bis dahin, wo sie von ihrer Schuluniform verschluckt wurden, dieselben langen, dichten schwarzen Haare, nur dass es sich hier auseinanderfächerte, als wäre ein Windhauch hineingefahren. In der Pause kaufte ich ihr immer etwas Süßes – etwas, das sich »gefrorener Spaß« nannte – mit Geld, das ich aus dem Geldbeutel meiner Mutter gestohlen hatte, und dann setzten wir uns unter einen Baum im Schulhof. Ich starrte sie unverwandt an, mal mit zugekniffenen, mal mit weit aufgerissenen Augen, bis sie unter meinem Blick ganz zappelig wurde. Dann zog ich sie an den Haaren auf ihren Armen und Beinen – erst sachte und dann schrecklich fest, zog die Haare zwischen den Fingerspitzen straff, bis sie aufschrie. Ein paar Wochen lang kam sie nicht zur Schule, und es hieß, ihre Mutter, die in anderen Umständen gewesen war, sei plötzlich gestorben. Ich konnte mich nie wieder dazu durchringen, mit ihr zu reden, obwohl wir noch zwei Jahre lang Klassenkameradinnen waren. Es war etwas so Erbärmliches, ein Mädchen, dessen Mutter gestorben war und es ganz allein gelassen hatte auf der Welt.
Nicht lange nachdem das kleine Mädchen auf der Fahrt zum Arzt in den Armen meiner Mutter gestorben war, brach Miss Charlotte, unsere Nachbarin von gegenüber, mitten im Gespräch mit meiner Mutter zusammen und starb. Wenn meine Mutter sie nicht aufgefangen hätte, wäre sie zu Boden gestürzt. Als ich an jenem Tag aus der Schule nach Hause kam, sagte meine Mutter: »Miss Charlotte ist tot.« Ich hatte Miss Charlotte gut gekannt, und ich versuchte, sie mir tot vorzustellen. Es ging nicht. Ich wusste nicht, wie man aussah, wenn man tot war. Ich wusste, wie Miss Charlotte aussah, wenn sie vom Markt kam. Ich wusste, wie sie aussah, wenn sie in die Kirche ging. Ich wusste, wie sie aussah, wenn sie ihren Hund ermahnte, er solle aufhören, mich die Straße hinauf- und hinunterzuscheuchen und mir Angst einzujagen. Einmal, als Miss Charlotte krank gewesen war, hatte meine Mutter mich mit einer Schüssel Essen zu ihr geschickt, und da hatte ich sie im Nachthemd im Bett liegen sehen. Miss Charlotte wurde in einem Sarg begraben, den nicht mein Vater gemacht hatte, und ich durfte nicht mit zur Beerdigung.
In der Schule hatten fast alle, die ich kannte, schon mal einen Toten gesehen, und nicht etwa den Geist eines Toten, sondern einen richtigen Toten. Meine Nebensitzerin hörte plötzlich auf, am Daumen zu lutschen, weil ihre Mutter ihn in Wasser gewaschen hatte, in dem ein Toter gebadet worden war. Ich sagte, ihre Mutter müsse sie angeschwindelt haben, bestimmt sei es gewöhnliches Wasser gewesen, meine Mutter würde mich nämlich auch immer genauso anschwindeln. Aber sie kannte meine Mutter und sagte, sie sehe überhaupt keine Ähnlichkeit zwischen meiner Mutter und ihrer Mutter.
Ich fing an, zu Beerdigungen zu gehen. Nicht als offizieller Trauergast, da ich niemand von den Verstorbenen kannte, und ohne die Erlaubnis meiner Eltern. Ich besuchte die Leichenhallen oder die Wohnstuben, je nachdem, wo die Toten aufgebahrt lagen, damit die Trauernden sie ein letztes Mal sehen konnten. Sobald ich die Kirchenglocke läuten hörte, wie sie immer läutete, wenn jemand gestorben war, versuchte ich herauszubekommen, wer gestorben war und wo die Trauerfeier stattfinden würde – bei den Betreffenden zu Hause oder in der Leichenhalle. Die Leichenhalle lag etwa an meinem Heimweg, aber zu den Häusern mancher Leute musste ich mitunter in die entgegengesetzte Richtung gehen. Anfangs trat ich nicht ein; ich blieb draußen stehen und beobachtete das Kommen und Gehen, hörte nahe Verwandte und Freunde unglaublich laute Schreie und Klagelaute ausstoßen und beobachtete dann, wie der Trauerzug sich zur Kirche in Bewegung setzte. Aber dann fing ich doch an hineinzugehen und schaute es mir an. Als ich zum ersten Mal tatsächlich einen Toten sah, wusste ich nicht, was ich denken sollte. Da es niemand war, den ich kannte, konnte ich keine Vergleiche anstellen. Ich hatte die Person nie lachen oder lächeln oder die Stirn runzeln oder ein Huhn aus einem Garten scheuchen sehen. Daher schaute und schaute ich, so lange ich konnte, ohne dass irgendjemand merkte, dass ich bloß aus Neugier da war.
Eines Tages starb ein Mädchen in meinem Alter. Ich kannte weder ihren Namen noch wusste ich Näheres über sie, außer dass sie so alt war wie ich und dass sie einen Buckel hatte. Sie besuchte eine andere Schule als ich, und am Tag ihrer Beerdigung bekam ihre ganze Schule frei. An meiner Schule konnten wir über nichts anderes reden als: »Hast du das bucklige Mädchen gekannt?« Ich erinnerte mich, einmal in der Bibliothek hinter ihr angestanden zu haben, um Bücher auszuleihen; damals sah ich eine Fliege auf ihrem Uniformkragen landen und darauf hin und her spazieren, da der Kragen flach auf ihrem Buckel lag. Als ich erfuhr, dass sie tot war, wünschte ich, ich hätte an den Buckel getippt, um herauszubekommen, ob er hohl war. Ich erinnerte mich auch, dass sie die Haare zu vier Zöpfen geflochten hatte und dass die Scheitel krumm waren. »Sie muss sich die Haare selber gekämmt haben«, sagte ich. Aber endlich war jemand tot, den ich kannte. Am Tag ihrer Beerdigung stürzte ich, kaum dass das letzte Amen des Abendgebets gesprochen war, aus der Schule und machte mich auf den Weg zur Leichenhalle. Als ich ankam, wimmelte die Straße von Schülerinnen aus ihrer Schule, alle in ihren guten weißen Schuluniformen. Sie liefen hin und her, sprachen leise miteinander und taten sehr wichtig. Ich hatte keine Zeit, stehen zu bleiben und sie lange zu beneiden; ich bahnte mir einen Weg zur Tür und betrat die Leichenhalle. Da war sie. Sie lag auf lila-weiße Fliederblüten gebettet in dem üblichen Sarg aus lackiertem Pechkiefernholz. Sie hatte ein weißes Kleid an, das ihr bis an die Knöchel reichen mochte, aber ich hatte keine Zeit nachzusehen. Ihr Gesicht wollte ich sehen. Ich wusste noch, wie sie an jenem Tag in der Bibliothek ausgesehen hatte. Ein ganz gewöhnliches Gesicht. Schwarze Augen, flache Nasenflügel, breite Lippen. Tot sah sie genauso aus, bloß dass ihre Augen geschlossen waren und dass sie so still dalag. Ich hatte einmal jemanden über einen anderen Toten sagen hören, es sei, als würde der Tote schlafen. Aber ich hatte schon mal jemand schlafen sehen, und dieses Mädchen hier sah nicht wie eine Schlafende aus. Meine Eltern hatten mir gerade einen Viewmaster gekauft. Mit dem Apparat wurden Bilder von den Pyramiden, vom Taj Mahal, vom Mount Everest und von Landschaften am Amazonas geliefert. Wenn er in Ordnung war, wirkten alle Szenen so lebendig, dass es war, als könnte man einfach hineingehen und auf dem Amazonas spazieren fahren, oder als stünde man am Fuß der Pyramiden. Wenn er nicht in Ordnung war, dann war es, als betrachtete man ein gewöhnliches buntes Bild. Als ich dieses Mädchen ansah, war es, als wäre der Viewmaster nicht in Ordnung. Ich starrte sie lange gebannt an – so lange, dass die Schlange der Wartenden, die auch einen Blick in den Sarg werfen wollten, immer länger und fast schon ungeduldig wurde. Während ich sie ansah, hielt ich wohlweislich die Hände fest zu Fäusten geballt, um nur ja nicht aus Versehen einen Finger auszustrecken und dann erleben zu müssen, dass er auf der Stelle verweste und mir abfiel. Schließlich ging ich weiter und setzte mich zu den Trauergästen. Die Angehörigen lächelten mir zu, bestimmt hielten sie mich für eine Schulfreundin, obwohl ich die Uniform einer anderen Schule trug. Wir sangen ein Kirchenlied, Alle Dinge licht und schön, und die Mutter des buckligen Mädchens sagte, dies sei das erste Lied gewesen, das es auswendig gelernt habe.
Ich ging nach Hause. Inzwischen war es fürs Nachhausekommen schon sehr spät, aber ich war zu aufgeregt, mir darüber Sorgen zu machen. Ich fragte mich, ob das bucklige Mädchen eines Tages, wenn ich einmal allein irgendwo hinging, unter einem Baum stehen und mich dazu verleiten würde, mit ihm schwimmen zu gehen oder von einer Frucht abzubeißen, und ob meine Mutter nicht, ehe sie sich’s versah, meinen Vater bitten müsste, einen Sarg für mich anzufertigen. Natürlich würde er vor lauter Gram nicht imstande sein, einen Sarg für mich zu machen, und würde Mr. Oatie bitten müssen, es für ihn zu tun, obwohl es ihm widerstrebte, Mr. Oatie um einen Gefallen zu bitten, weil Mr. Oatie, wie ich meinen Vater einmal zu meiner Mutter sagen hörte, so ein Blutsauger war, dass er einen für alles doppelt bezahlen ließ.
Als ich nach Hause kam, fragte meine Mutter nach den Fischen, die ich auf dem Heimweg bei Mr. Earl, einem unserer Fischhändler, hätte abholen sollen. In meiner Aufregung hatte ich es völlig vergessen. Ich dachte blitzschnell nach und sagte, als ich auf den Markt gekommen sei, hätte Mr. Earl gesagt, sie seien heute gar nicht aufs Meer hinausgefahren, weil die See zu rau war. »Ach?«, sagte meine Mutter und hob den Deckel von einer Pfanne, in der flach auf der Seite, in Butter und Zitronensaft und mit Zwiebeln bedeckt, drei Fische lagen: ein Meerengel für meinen Vater, ein Kanyafisch für meine Mutter und ein Doktorfisch für mich – für jeden von uns die Fischsorte, die er am liebsten aß. Während ich die Leichenhalle besuchte, war Mr. Earl die Warterei zu dumm geworden, und er hatte die Fische selbst bei uns vorbeigebracht. Zur Strafe musste ich an diesem Abend allein essen, draußen unterm Brotfruchtbaum, und meine Mutter sagte, sie würde mir danach keinen Gutenachtkuss geben, aber als ich ins Bett stieg, kam sie und gab mir doch einen.
2Die kreisende Hand
In den Schulferien durfte ich immer lange im Bett bleiben, bis mein Vater schon längst zur Arbeit gegangen war. Werktags verließ er das Haus mit dem siebten Glockenschlag von der anglikanischen Kirche. Ich lag wach im Bett und konnte all die Geräusche hören, die meine Eltern machten, während sie sich auf den Tag vorbereiteten. Meine Mutter richtete das Frühstück für meinen Vater, unterdessen rasierte er sich mit seinem Rasierpinsel, der einen Elfenbeingriff hatte, und einem dazu passenden Rasiermesser; dann ging er in den kleinen Schuppen hinaus, den er als Badestube für uns gebaut hatte, um rasch in kaltem Wasser zu baden, das meine Mutter auf seine Anweisung immer über Nacht im Tau draußen stehen ließ. Deshalb war das Wasser sehr kalt, und er glaubte, kaltes Wasser stärke seinen Rücken. Als Junge wäre ich der gleichen Behandlung unterzogen worden, aber da ich ein Mädchen war und obendrein nur mit Mädchen in die Schule ging, goss meine Mutter zu meinem Badewasser immer ein bisschen heißes Wasser, damit es nicht ganz so kalt war. Sonntagnachmittags, wenn ich in der Sonntagsschule war, nahm mein Vater immer ein heißes Bad; zur Hälfte wurde die Wanne mit gewöhnlichem Wasser gefüllt, dann schüttete meine Mutter Wasser aus einem großen Kessel dazu, worin sie zuvor Rindenstücke und Blätter von einem Lorbeerbaum gekocht hatte. Rinde und Blätter waren einzig wegen ihres Dufts im Wasser, er mochte ihn gern. In diesem Bad lag er stundenlang, beschäftigte sich eingehend mit seinen Tippzetteln oder entwarf Möbelstücke, die er anfertigen wollte. Wenn ich dann aus der Sonntagsschule zurückkam, setzten wir uns zu unserem Sonntagsessen an den Tisch.
Meine Mutter und ich badeten oft miteinander. Manchmal nahmen wir bloß ein gewöhnliches Bad, das nicht sehr lange dauerte. Von Zeit zu Zeit nahmen wir ein besonderes Bad, für das im gleichen großen Kessel Rindenstücke und Blüten von vielen verschiedenen Bäumen nebst allerlei Ölen aufgekocht wurden. In diesem Badewasser saßen wir dann in einem verdunkelten Raum, in dem eine sonderbar riechende Kerze vor sich hin flackerte. Während wir in der Wanne saßen, wusch meine Mutter diesen und jenen Teil meines Körpers; dann tat sie das Gleiche mit sich selbst. Mit diesen Bädern fingen wir an, nachdem meine Mutter sich mit ihrer Obeah-Frau und mit ihrer Mutter und einer vertrauten Freundin beraten hatte, und nachdem alle drei bekräftigt hatten, dass, so wie es bei uns zu Hause zuging – der kleine Kratzer auf meinem Spann, aus dem erst eine kleine Wunde und dann eine große Wunde geworden war, so lange nicht heilen wollte; der Hund, den meine Mutter kannte, noch dazu ein freundliches Tier, plötzlich herumgefahren war und sie gebissen hatte; die Porzellanschüssel, die sie eine Ewigkeit besessen hatte und in die nächste mitzunehmen hoffte, ihr plötzlich aus ihren geschickten Händen gerutscht und in tausend winzige Stückchen zersprungen war; Worte, die sie im Scherz zu einer Freundin gesagt hatte und die völlig missverstanden worden waren – dass angesichts dieser Dinge bestimmt eine der vielen Frauen, die mein Vater geliebt, aber nicht geheiratet hatte, obwohl er Kinder mit ihr hatte, meiner Mutter und mir Schaden zufügen wollte, indem sie böse Geister gegen uns aufhetzte.
Nach dem Aufstehen legte ich mein Bettzeug und mein Nachthemd zum Lüften an die Sonne, putzte meine Zähne, wusch mich und zog mich an. Dann bekam ich mein Frühstück, und da ich in den Ferien nicht in die Schule ging, zwang meine Mutter mich nicht, ein Riesenfrühstück aus Haferbrei, Eiern, einer Orange oder einer halben Grapefruit, Brot, Butter und Käse zu essen. Ich kam mit einem bisschen Brot, Butter, Käse, Haferbrei und Kakao davon. Den restlichen Tag verbrachte ich damit, meiner Mutter überallhin zu folgen und achtzugeben, wie sie alles machte. Wenn wir zum Lebensmittelhändler gingen, sagte sie mir bei allem, was sie kaufte, warum sie es tat. Jeder Laib Brot, jedes Stück Butter wurde mir aus mindestens zehn verschiedenen Blickwinkeln vorgeführt. Wenn wir auf dem Markt Krebse kaufen gingen, erkundigte sie sich bei der Verkäuferin oder dem Verkäufer, ob sie aus der Gegend von Parham stammten, und wenn sie bejahten, dann kaufte meine Mutter die Krebse nicht. In Parham befand sich die Leprakolonie, und meine Mutter war überzeugt, dass die Krebse sich ausschließlich von den Essensresten der Leprakranken ernährten. Wenn wir die Krebse aßen, würden wir selber über kurz oder lang an Lepra erkranken und fortan ein elendes Dasein in der Leprakolonie fristen.
Wie wichtig ich mich fühlte, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war. Denn viele Leute, die ihre Waren und Vorräte vor sich ausgebreitet hatten, strahlten, wenn sie sie kommen sahen, und bemühten sich nach Kräften, sie auf sich aufmerksam zu machen. Sie tauchten hinter ihren Ständen weg und förderten Dinge zutage, die sogar noch besser waren als das, was sie in der Auslage feilboten. Sie waren enttäuscht, wenn meine Mutter etwas emporhielt, es prüfend drehte und wendete, dann das Gesicht verzog und »Lieber nicht« sagte, sich abwandte und weiterging – zu einem anderen Stand, um sich zu erkundigen, ob jemand, der ihr erst vorige Woche köstliche Chayoten verkauft hatte, diesmal etwas ebenso Gutes anzubieten hatte. Dann riefen sie ihr hinterher, dass sie nächste Woche Eddo- oder Dasheen-Gemüse oder was nicht alles hereinbekämen, worauf meine Mutter in sehr ungläubigem Tonfall »Mal sehen« sagte. Wenn wir dann bei Mr. Kenneth vorbeischauten, brauchten wir nur ein paar Minuten, denn er wusste genau, was meine Mutter wollte, und hatte es immer schon für sie zurechtgelegt. Mr. Kenneth hatte mich schon als kleines Kind gekannt, und während er mir ein Stück rohe Leber zu essen gab, das er für mich aufgehoben hatte, erinnerte er mich jedes Mal an kleine Begebenheiten von damals. Rohe Leber gehörte zu den wenigen Dingen, die ich gerne aß, obendrein war meine Mutter froh, mich etwas essen zu sehen, das so gesund für mich war, und sie beschrieb mir lang und breit die Wirkung, die rohe Leber auf meine roten Blutkörperchen haben würde.
Meistens gingen wir ohne weitere Ereignisse in der heißen Vormittagssonne nach Hause. Als ich noch viel kleiner gewesen war, hatte mich meine Mutter unterwegs etliche Male plötzlich an sich gerissen, mich in ihren Rock gehüllt und mit sich geschleift, als wäre sie in größter Eile. Dann hörte ich eine böse Stimme böse Dinge sagen, und sobald wir an der bösen Stimme vorbei waren, ließ meine Mutter mich wieder los. Weder meine Mutter noch mein Vater wollten so recht mit der Sprache heraus, aber ich musste bloß zwei und zwei zusammenzählen, um draufzukommen, dass es eine der Frauen war, die mein Vater geliebt, und mit der er ein Kind oder mehrere Kinder gehabt hatte, und die ihm nicht verzieh, dass er meine Mutter geheiratet und mich in die Welt gesetzt hatte. Es war eine jener Frauen, die immer versuchten, meiner Mutter und mir Schaden zuzufügen, und die meinen Vater sehr geliebt haben müssen, denn keine von ihnen versuchte je, ihm etwas anzutun, und immer, wenn er auf der Straße an ihnen vorüberging, war es, als hätten er und diese Frauen nie etwas miteinander zu tun gehabt.