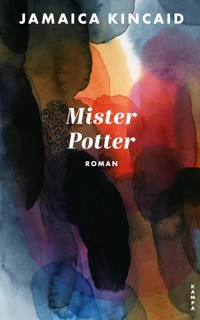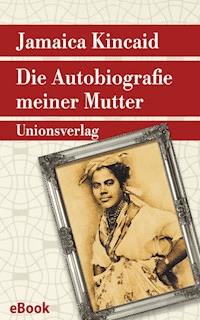9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lucy, 19 Jahre alt, kommt von den Westindischen Inseln zum ersten Mal nach New York. Als Au-pair-Mädchen lebt sie bei Mariah und Lewis, einem wohlhabenden Ehepaar mit vier kleinen Töchtern. Alles ist neu für Lucy, sie entdeckt eine vollkommen fremde Welt, die Angst macht und erschreckt. Doch die junge Frau kämpft um ihre innere Unabhängigkeit – in der schmerzvollen Distanzierung von ihrer Mutter, ihren ersten Beziehungen zu Männern und in der Auseinandersetzung mit Mariah, deren Freundschaftsangebote Lucy zurückweist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 200
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Über dieses Buch
Lucy, 19 Jahre alt, kommt von den Westindischen Inseln zum ersten Mal nach New York. Als Au-pair-Mädchen lebt sie bei Mariah und Lewis, einem wohlhabenden Ehepaar mit vier kleinen Töchtern. Alles ist neu für Lucy, sie entdeckt eine vollkommen fremde Welt, die Angst macht und erschreckt. Doch die junge Frau kämpft um ihre innere Unabhängigkeit.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Jamaica Kincaid (*1949) wanderte mit 16 Jahren von Antigua in die USA aus, wo sie zunächst als Au-pair-Mädchen arbeitete. Ihre Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sie unterrichtet Literatur am kalifornischen Claremont McKenna College und an der Harvard University.
Zur Webseite von Jamaica Kincaid.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Jamaica Kincaid
Lucy
Roman
Aus dem Englischen von Stefanie Schaffer-de Vries
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 1990 unter dem Titel Lucy im Verlag Farrar, Straus & Giroux, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1991 im Krüger Verlag, Frankfurt am Main.
Originaltitel: Lucy (1990)
© by Jamaica Kincaid 1990
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30862-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.07.2024, 05:00h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
LUCY
Armer GastMariahDie ZungeKaltes HerzLucyMehr über dieses Buch
Über Jamaica Kincaid
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Jamaica Kincaid
Zum Thema USA
Zum Thema Karibik
Zum Thema Frau
Für George W. S. Trow
Armer Gast
Es war mein erster Tag. Ich war am Abend zuvor angekommen, an einem grauschwarzen, kalten Abend – wie das Mitte Januar zu erwarten war, wenn ich das damals auch noch nicht wusste –, und auf dem Weg vom Flughafen in die Stadt konnte ich nichts deutlich erkennen, obwohl alles beleuchtet war. Man machte mich da und dort auf ein berühmtes Gebäude aufmerksam, eine wichtige Straße, einen Park, eine Brücke, die zur Zeit ihrer Errichtung als spektakuläres Bauwerk gegolten hatte. In einem Tagtraum, dem ich oft nachgehangen war, waren alle diese Orte Orte des Glücks für mich gewesen; Rettungsboote für meine kleine ertrinkende Seele, derin ich sah mich sie betreten und verlassen, und genau das – sie immer wieder zu betreten und zu verlassen – würde mir über ein schlimmes Gefühl hinweghelfen, für das ich keinen Namen hatte. Ich wusste nur, es war ein bisschen wie Traurigkeit, aber schwerer als das. Nun, wo ich diese Orte sah, wirkten sie gewöhnlich und schmutzig, abgenutzt von den vielen Menschen, die im wirklichen Leben dort ein und aus gingen, und mir kam der Gedanke, dass ich nicht der einzige Mensch auf der Welt sein konnte, für den sie ein Inventar der Fantasie waren. Es war dies nicht mein erster Zusammenprall mit den Enttäuschungen der Wirklichkeit und würde nicht mein letzter sein. Die Unterwäsche, die ich trug, war ganz neu, eigens für meine Reise gekauft, und wie ich da im Wagen saß und mich in die eine und andere Richtung drehte, um einen guten Blick auf die vor mir liegenden Sehenswürdigkeiten zu haben, wurde ich daran erinnert, was für ein unbehagliches Gefühl einem Neues geben kann.
Ich betrat einen Aufzug, was ich noch nie zuvor getan hatte, und dann befand ich mich in einer Wohnung und wurde an einen Tisch gesetzt, und man servierte mir Essen, das direkt aus einem Kühlschrank kam. Dort, wo ich soeben herkam, hatte ich immer in einem Haus gelebt, und in meinem Haus hatte es keinen Kühlschrank gegeben. Alles, was ich erlebte – die Fahrt mit dem Aufzug, in einer Wohnung zu sein, Dinge zu essen, die schon einen Tag alt waren und in einem Kühlschrank aufbewahrt wurden –, war so praktisch, dass ich mir vorstellen konnte, ich würde mich daran gewöhnen, und es würde mir sehr gefallen, aber am Anfang war das alles so neu, dass ich mit herabgezogenen Mundwinkeln lächeln musste. Ich schlief tief und fest in dieser Nacht, aber das lag nicht daran, dass ich glücklich war und mich wohlfühlte – ganz im Gegenteil; es lag daran, dass ich nichts weiter in mich aufnehmen wollte.
Dieser Morgen, der Morgen meines ersten Tages, der Morgen, der meiner ersten Nacht folgte, war ein sonniger Morgen. Nicht die Art leuchtenden Sonnengelbs, wie ich es gewohnt war, bei dem alles sich, fast erschrocken, an den Rändern einringelt, sondern eine blassgelbe Sonne, als würde das Scheinen sie so anstrengen, dass sie davon müde geworden war; aber immerhin war es sonnig, und das war hübsch und bewirkte, dass ich meine Heimat ein bisschen weniger vermisste. Und weil ich also die Sonne sah, stand ich auf und zog ein Kleid an, ein fröhliches Kleid aus Madras-Baumwolle – ein Kleid, wie ich es zu Hause für einen Tag im Grünen angezogen hätte. Es war ganz und gar falsch. Die Sonne schien zwar, aber die Luft war kalt. Immerhin war es Mitte Januar. Aber ich wusste nicht, dass die Sonne scheinen und die Luft trotzdem kalt bleiben konnte; keiner hatte mir das je gesagt. Was für ein Gefühl das war! Wie kann ich es erklären? Etwas, was ich immer gewusst hatte – so wie ich wusste, dass meine Haut braun wie eine Nuss war, die man mehrmals mit einem weichen Tuch poliert hat, oder wie ich meinen Namen wusste –, etwas, was ich als selbstverständlich betrachtet hatte, »die Sonne scheint, es ist warm«, war nicht so. Ich war nicht mehr in einer tropischen Zone, und diese Erkenntnis trat in mein Leben wie ein Wasserstrom, der einen vorher trockenen und festen Boden in zwei Landbänke teilt, von denen eine meine Vergangenheit war – so vertraut und vorhersagbar, dass selbst der Gedanke an alles, was mich damals unglücklich gemacht hatte, mich jetzt glücklich machte –, die andere meine Zukunft, ein graues Nichts, der Ausblick auf ein bedecktes Meer, auf das der Regen fiel und auf dem kein Schiff zu sehen war. Ich war nicht mehr in einer tropischen Zone, und mir war innen und außen kalt; es war das erste Mal, dass mich ein solches Gefühl überkam.
In Büchern hatte ich gelesen, dass Menschen – von Zeit zu Zeit, wenn die Handlung es erforderte – unter Heimweh litten. Da flüchtete jemand aus nicht sehr angenehmen Verhältnissen und ging woandershin, wo es viel, viel besser war, und dann sehnte er sich zurück nach dem Ort, wo es gar nicht nett gewesen war. Wie ungeduldig ich mit solchen Menschen gewesen war, denn ich fand, dass ich selbst mich in nicht sehr angenehmen Verhältnissen befand und nichts sehnlicher wollte als woandershin. Aber jetzt wäre auch ich am liebsten wieder dorthin zurückgekehrt, wo ich herkam. Dort hatte ich mich zurechtgefunden, hatte gewusst, woran ich war. Hätte ich in diesem Augenblick ein Bild von meiner Zukunft zeichnen müssen, wäre es ein großer grauer Fleck gewesen, umgeben von schwarz, schwärzer, am schwärzesten.
Was für eine Überraschung das für mich war, dass ich mich nach dem Ort zurücksehnte, wo ich herkam, dass ich mich danach sehnte, in einem Bett zu schlafen, aus dem ich herausgewachsen war, dass ich mich nach Menschen sehnte, deren winzigste, natürlichste Geste solchen Zorn in mir wachrief, dass ich sie am liebsten alle tot zu meinen Füßen gesehen hätte. Oh, ich hatte mir vorgestellt, dass ich mit diesem einzigen raschen Schritt – meine Heimat zu verlassen und an diesen neuen Ort zu kommen – alles hinter mir lassen könnte wie ein altes Kleid, das man nie wieder anzieht: meine traurigen Gedanken, meine traurigen Empfindungen und meine Unzufriedenheit mit dem Leben ganz allgemein, wie es sich mir darbot. In der Vergangenheit war der Gedanke an die Verhältnisse, in denen ich mich jetzt befand, ein Trost für mich gewesen, aber jetzt hatte ich nicht einmal mehr das, um mich darauf zu freuen, und so legte ich mich auf mein Bett und träumte davon, eine Schüssel rosaroter Seebarbe mit grünen Feigen, gekocht in Kokosmilch, zu essen, und sie war von meiner Großmutter zubereitet, weshalb sie mir so besonders gut schmeckte, denn sie war der Mensch, den ich auf der ganzen Welt am liebsten mochte, und außerdem war es das Gericht, das ich am liebsten aß.
Das Zimmer, in dem ich lag, war ein kleines Zimmer gleich neben der Küche – das Dienstmädchenzimmer. Ich war ein kleines Zimmer gewohnt, aber das hier war ein kleines Zimmer ganz anderer Art. Die Zimmerdecke war sehr hoch, und die Wände gingen bis hinauf zur Decke und umschlossen den Raum wie eine Kiste – eine Kiste für die Beförderung von Transportgütern über eine weite Strecke. Aber ich war kein Transportgut. Ich war nur eine unglückliche junge Frau, die in einem Dienstmädchenzimmer wohnte, und ich war nicht einmal das Dienstmädchen. Ich war das junge Mädchen, das auf die Kinder aufpasste und abends in die Schule ging. Wie nett sie eigentlich alle zu mir waren; sagten, ich solle sie als meine Familie betrachten und mich wie zu Hause fühlen. Ich glaubte ihnen, dass sie es ehrlich meinten, denn ich wusste, dass sie so etwas nicht zu einem Mitglied ihrer wirklichen Familie sagen würden. Denn die Familie, sind das nicht schließlich die Leute, die im Leben eines Menschen zum Mühlstein um seinen Hals werden? Am letzten Tag, den ich zu Hause verbrachte, schenkte mir meine Cousine – ein Mädchen, das ich mein Leben lang kannte, eine unangenehme Person, schon bevor ihre Eltern sie dazu zwangen, eine Adventistin vom siebenten Tag zu werden – zum Abschied ihre Bibel und hielt mir mit dem Geschenk einen kleinen Vortrag über Gott, Güte und Gnade. Jetzt lag diese Bibel vor mir auf einem Frisiertisch, und ich dachte daran, wie wir als Kinder vor meinem Haus gesessen waren und einander damit gequält und in Schrecken versetzt hatten, dass wir uns laut Passagen aus der Offenbarung vorlasen, und ich fragte mich, ob es je in meinem Leben einen Tag geben würde, an dem diese Menschen, die ich hinter mir gelassen hatte, meine Familie, nicht auf die eine oder andere Weise vor mir erscheinenwürden.
Es gab auch ein kleines Radio auf diesem Frisiertisch, und ich hatte es angedreht. In diesem Augenblick ertönte, wie um meine Gefühle zusammenzufassen, ein Lied, in dem es unter anderem hieß: »Versetz dich an meine Stelle, wenn auch nur für einen Tag; sieh, ob du die schreckliche Leere da drinnen ertragen kannst.« Ich sang mir die Worte wieder und wieder vor wie ein Schlaflied, und ich schlief wieder ein. Ich träumte, dass ich eines meiner alten Nachthemden aus Baumwollflanell in der Hand hielt, und es war bedruckt mit hübschen Szenen von Kindern, die mit Weihnachtsschmuck spielten. Die Szenen auf meinem Nachthemd waren so echt, dass ich die Kinder tatsächlich lachen hören konnte. Ich musste unbedingt wissen, woher dieses Nachthemd kam, und begann, es wild zu untersuchen, um das Etikett zu finden. Ich fand es, wo Etiketten sich im Allgemeinen befinden, hinten oben am Halsausschnitt, und es stand darauf »Made in Australia«. Aus diesem Traum weckte mich das wirkliche Dienstmädchen, eine Frau, die mir von allem Anfang an zu verstehen gegeben hatte, dass sie mich nicht leiden konnte, und zwar wegen der Art, wie ich sprach. Ich war überzeugt, dass der wahre Grund ein anderer war, aber ich wusste nicht, was. Als ich die Augen öffnete, stand das Wort »Australien« zwischen unseren Gesichtern, und da fiel mir ein, dass Australien ursprünglich eine Gefängnissiedlung für böse Menschen gewesen war, Menschen, die so böse waren, dass man sie nicht in ein Gefängnis in ihrem eigenen Land stecken konnte.
Meine Stunden von morgens bis abends wurden bald zur Routine. Ich brachte vier kleine Mädchen zur Schule, und wenn sie mittags nach Hause kamen, gab ich ihnen eine Suppe aus der Dose zu essen und danach belegte Brote. Am Nachmittag las ich ihnen vor und spielte mit ihnen. Wenn sie weg waren, lernte ich aus meinen Büchern, und abends ging ich in die Schule. Ich war unglücklich. Ich schaute auf die Landkarte. Ein Ozean lag zwischen mir und dem Ort, woher ich kam, aber hätte es etwas geändert, wenn es nur ein Glas Wasser gewesen wäre? Ich konnte nicht zurück.
Draußen war es immer kalt, und alle sagten, es wäre der kälteste Winter, den sie je erlebt hätten; aber wie sie es sagten, ließ mich vermuten, dass sie das immer sagten, wenn der Winter kam. Ich konnte ihnen keinen Vorwurf daraus machen, dass sie von einem Jahr zum anderen vergaßen, wie ungemütlich und unfreundlich das Winterwetter sein konnte. Die Bäume mit ihren nackten, reglosen Ästen sahen tot aus, und als hätte jemand sie eben bloß hingestellt, um später wiederzukommen und sie abzuholen; die Fenster aller Häuser waren dicht geschlossen, wie man Fenster verschließt, wenn man ein Haus für lange Zeit verlässt; wenn Leute durch die Straßen gingen, eilten sie dahin, als täten sie etwas hinter eines anderen Rücken, als wollten sie nicht die Aufmerksamkeit auf sich lenken, als könnten sie sich in nichts auflösen, wenn sie zu lange in der Kälte blieben. Wie sehnte ich mich danach, jemanden an einer Ecke herumstehen zu sehen, der versuchte, meine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, mich in ein Gespräch zu verwickeln, jemanden, der sich halblaut, sodass ich es hören konnte, über einen Gott beklagte, dessen Liebe und Barmherzigkeit gleichermaßen auf die Gerechten wie die Ungerechten fiel.
Ich schrieb nach Hause, um zu berichten, wie wunderbar alles wäre, und ich benutzte blumenreiche Wörter und Sätze, als lebte ich ein Leben wie auf einer Grußkarte – einer von der Sorte mit Samtband und wattierten Herzen und Rosen darauf, die für den Empfänger so kostbar sein muss, dass der Hersteller sie zum Schutz in eine Plastikfolie steckt. Alle, denen ich schrieb, sagten, wie nett es wäre, von mir zu hören, wie schön, zu wissen, dass es mir gut ginge, dass ich ihnen sehr fehle und dass sie es nicht erwarten könnten, bis ich wieder nach Hause käme.
Eines Tages sagte mir die Haushälterin, die gesagt hatte, dass sie mich wegen meiner Art zu sprechen nicht leiden konnte, sie sei davon überzeugt, dass ich nicht tanzen könne. Sie sagte, ich würde reden wie eine Nonne, ich ginge auch wie eine, und alles an mir sei so fromm, dass ihr davon übel werde und es sie zugleich krank vor Mitleid mache, wenn sie mich nur ansähe. Und so, vielleicht dem zweiten Gefühl nachgebend, schlug sie vor, wir sollten tanzen, obwohl sie ganz sicher sei, dass ich nicht wüsste, wie man tanzt. Es gab einen kleinen tragbaren Plattenspieler in meinem Zimmer, einen von der Sorte, die wie ein Toilettenkoffer aussehen, wenn man sie zuklappt, und sie legte eine Platte auf, die sie an diesem Tag erst gekauft hatte. Es war ein Lied, das damals sehr populär war – drei Mädchen, nicht älter als ich, sangen mehrstimmig und auf sehr verlogene und künstliche Weise von Liebe und so weiter. Es war trotzdem sehr schön, und es war schön, weil es so verlogen und künstlich war. Sie liebte dieses Lied und sang aus voller Kehle mit; und sie konnte wunderbar tanzen – ihre Art, sich zu bewegen, erstaunte mich. Ich konnte nicht mitmachen und sagte ihr, warum: Die Melodie ihres Liedes war so seicht, und die Worte hatten keine Bedeutung für mich. An ihrem Gesicht konnte ich ablesen, dass sie nur eines für mich empfand: Ihr wurde übel, wenn sie mich nur ansah. Und so sagte ich also, ich kenne auch Lieder, und legte mit einem Calypso über ein Mädchen los, das nach Port-of-Spain, Trinidad, durchging und dort eine herrliche Zeit verlebte, ohne irgendetwas zu bereuen.
Der Haushalt, in dem ich lebte, bestand aus einem Mann, einer Frau und den vier Mädchen. Der Mann und die Frau sahen gleich aus, und ihre vier Kinder sahen genauso aus wie sie. Auf Familienfotos, die sie über die ganze Wohnung verteilten, steckten sie ihre sechs verschieden großen, gelbhaarigen Köpfe zusammen, dass sie aussahen wie ein Blumenstrauß, der von einer unsichtbaren Schnur zusammengehalten wird. Auf diesen Bildern lächelten sie der Welt entgegen, als fänden sie alles auf ihr unerträglich wunderbar. Und es war keine Farce, ihr Lächeln. Von überall, wo sie gewesen waren, und es hatte den Anschein, als wären sie schon überall auf der Welt gewesen, brachten sie irgendein kleines Andenken mit, und jeder von ihnen konnte die Geschichte dieser Erinnerungsstücke von Anfang an erzählen. Selbst wenn ein leichter Regen fiel, bewunderten sie die Streifen, die der Regen durch die leere Luft zog.
Beim Abendessen, wenn wir uns zu Tisch setzten – und kein Tischgebet sprechen mussten (welche Erleichterung; als glaubten sie an einen Gott, bei dem man sich nicht jedes Mal bedanken muss, wenn man sich nur umdreht) –, sagten sie so nette Dinge zueinander, und die Kinder waren so glücklich. Sie verschütteten ihr Essen oder aßen überhaupt nichts davon oder machten Reime darüber, die mit dem Wort »stinkt« endeten. Wie sie mich zum Lachen brachten! Und ich fragte mich, was ich wohl für Eltern gehabt haben musste; ein solches Wort in ihrer Gegenwart auch nur zu denken, hätte mir schon eine scharfe Rüge eingetragen, und ich gelobte, falls ich je Kinder haben sollte, würde ich dafür sorgen, dass die ersten Wörter, die sie sprechen lernten, schlimme Wörterwären.
Es war eines Abends beim Essen, nicht lange, nachdem ich zu ihnen gekommen war, dass sie mich »den Gast« zu nennen begannen. Sie sagten, es sähe aus, als gehöre ich nicht dazu, als würde ich nicht mit ihnen in ihrer Wohnung leben, als wären sie nicht wie eine Familie zu mir, als wäre ich nur auf der Durchreise, nur kurz vorbeigekommen, um Hallo zu sagen und gleich wieder Adieu! Bis später! Es war sehr nett! Wie ich sie beim Essen anstarre, sagte Lewis. Ob ich denn noch nie zuvor jemanden gesehen hätte, der eine Gabel mit grünen Bohnen in den Mund steckt? Das brachte Mariah zum Lachen, aber fast alles, was Lewis sagte, machte Mariah glücklich, und dann lachte sie. Ich aber lachte nicht, und Lewis betrachtete mich besorgt. »Armer Gast, armer Gast«, sagte er immer wieder in mitleidigem Tonfall, und dann erzählte er mir eine Geschichte von einem Onkel, der nach Kanada gegangen war und dort Affen züchtete, und wie nach einer Weile der Onkel die Affen so sehr liebte und sich so an ihre Gesellschaft gewöhnt hatte, dass er Menschen kaum noch ertragen konnte. Er hatte mir die Geschichte von diesem Onkel schon früher einmal erzählt, und als er sie mir diesmal erzählte, fiel mir ein Traum ein, den ich von Lewis und Mariah geträumt hatte. Lewis hatte mich durchs Haus gejagt. Ich hatte nichts am Leib. Der Boden, über den ich lief, war gelb, wie mit Maismehl bestreut. Lewis jagte mich durch das ganze Haus, und obwohl er immer näher kam, konnte er mich nie erreichen. Mariah stand am offenen Fenster und sagte: »Fang sie, Lewis, fang sie.« Schließlich fiel ich durch ein Loch, auf dessen Grund sich blausilbrige Schlangen befanden.
Als Lewis mit seiner Geschichte fertig war, erzählte ich ihnen meinen Traum. Als ich fertig war, schwiegen sie beide. Dann sahen sie mich an, und Mariah räusperte sich, aber die Art, wie sie es tat, ließ deutlich erkennen, dass ihre Kehle keines Räusperns bedurfte. Ihre beiden gelben Köpfe trieben aufeinander zu und hüpften synchron auf und ab. Lewis gab ein glucksendes Geräusch von sich, dann sagte er: Armer, armer Gast. Und Mariah sagte, Dr. Freud zu Gast, und ich fragte mich, warum sie das sagte, denn ich wusste nicht, wer Dr. Freud war. Dann lachten sie leise und freundlich. Mit dem Traum, den ich ihnen erzählt hatte, hatte ich ihnen sagen wollen, dass ich sie in mich aufgenommen hatte, denn in meinen Träumen tauchen immer nur Personen auf, die sehr wichtig für mich sind. Ich wusste nicht, ob sie das verstanden hatten.
Mariah
Eines Morgens, Anfang März, sagte Mariah zu mir: »Du hast noch nie den Frühling erlebt, nicht wahr?« Und sie brauchte nicht auf eine Antwort zu warten, denn sie wusste es. Sie sagte das Wort »Frühling«, als wäre der Frühling ein naher Freund, ein Freund, der es gewagt hatte, für lange Zeit fortzugehen, und nun, zur leidenschaftlichen Wiedervereinigung mit ihr, zurückkehren würde. Sie sagte: »Hast du jemals gesehen, wie die Narzissen sich durch die Erde ans Licht drängen? Und wenn sie blühen und in Büscheln beisammenstehen, kommt eine Brise, in der sie alle die Köpfe senken und eine Verneigung vor dem Rasen machen, der sich vor ihnen dehnt. Hast du das je gesehen? Wenn ich das sehe, bin ich so glücklich, dass ich lebe.« Und ich dachte, Mariah fühlt sich also lebendig durch ein paar Blumen, die im Wind nicken. Wie wird ein Mensch so?