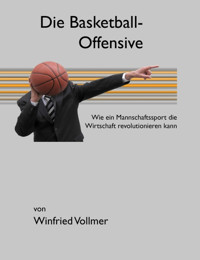
11,80 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Was lehrt Basketball die Wirtschaft? Die Hauptpersonen sind die Spieler, d.h. die Mitarbeiter, die für die Kunden tätig sind. Die Organisation um sie herum hat ihre Arbeit zu erleichtern. Anstelle eines riesigen Führungsapparates darf es nur zwei Führungskräfte geben: Einen, der auf die Wirtschaftlichkeit achtet, den anderen, dem die Qualität des Zusammenspiels obliegt. Unternehmen haben die kulturelle Aufgabe, uns Menschen das Leben zu erleichtern, zu verbessern. Dieser Anspruch geht bei einseitiger Fixierung auf die Finanzen verloren. Profitorientierung ist der Feind der Nachhaltigkeit. Finanzturbulenzen entstehen, weil die Börse als Wettbüro die Spiele dominiert. Dieses Buch zeigt einen revolutionären Ansatz für die Wirtschaft auf. Im Zentrum steht der Mensch. Er handelt als Mitarbeiter, Kunde und Investor in Personalunion. Im globalen Netzwerk von Finanz- und Warenströmen erkennt er die Zusammenhänge aber nicht. Auf der Jagd nach Sparzins und Kaufrabatten trägt er zum angespannten Klima in seinem Unternehmen bei. Das Modell Basketball hilft, die Vernetzung zu erkennen und Einzelfäden zu verfolgen. Dem Unternehmer gibt es die Möglichkeit, sich die Kräfte seines Unternehmens und die der Wettbewerber bewusst zu machen. Ausrichtung. Damit kann er Strategie und Zusammenspiel planen. Mikroökonomisch wie Makroökonomisch wird deutlich, warum nachhaltiger Erfolg nur durch Humanität und Fairplay zu bewerkstelligen ist. Dazu allerdings müssen wir aufhören, Schuldige zu suchen. Und wir müssen anfangen, Verantwortung zu übernehmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
www.tredition.de
Winfried Vollmer
Die Basketball-Offensive
Wie ein Mannschaftssport die Wirtschaft revolutionieren kann
www.tredition.de
© 2012 Winfried Vollmer
Autor: Winfried Vollmer
Umschlaggestaltung, Illustration: Dagny Lohff
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-8472-8684-4
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.tredition.de
Wir spielen alle zusammen. Doch wir wissen nicht genau wie. Zusammenhänge sind unklar. Um erfolgreich navigieren zu können, braucht man einen Plan, eine Landkarte.
Mit dem Begriff „Cognitive Maps“ bezeichnete der Psychologe E. C. Tolman Muster aus strukturierten Sinnzusammenhängen. Cognitive Maps geben Überblick.
Ich behaupte, Basketball bietet sich als Cognitive Map für die Zusammenhänge unseres Wirtschaftslebens an.
Die wesentlichen Orientierungspunkte sind allen bekannt: Ein Spielfeld, jeweils zwei Mannschaften, Schiedsrichter, Zuschauer, Spielregeln, Trainer, Stab, Verein, Vereinspräsident. Die Punkte sind von jedem Standort aus zu sehen.
Ich werde für Sie einige Wege auf dieser Landkarte gehen. Sie können mir folgen oder Ihre eigenen gedanklichen Abzweigungen nehmen. Sie werden sich auch dann nicht verlaufen.
Inhalt:
Erfolg ist Teamarbeit
1 GRUNDLAGEN
Erfolg – ohne Spaß und Sinn?
Was kann Wirtschaft vom Basketball lernen?
Ein umfassendes Modell
Vom Sinn des Spiels
Jeder trägt Verantwortung
Konsens ist die Basis von Fairness
Fairness warum eigentlich?
2 DIE NEUE SICHT AUFS UNTERNEHMEN
Die Erfindung des Basketballs
Die Evolution des Basketballs
Organismus und Organisation
Die Kehrseite des Verlierens
Die kulturelle Bedeutung der Unternehmen
Das Wesen der Mannschaft
Systematik des Zusammenspiels
Das Spielfeld als strategische Landkarte
Strategisch planen
Strategien im Überblick
Die eigenen Stärken bestimmen die Strategie
Kennzahlen verraten nicht alles!
Die Rolle des Preises
Wie sich Mannschaft und Zuschauer gegenseitig stimulieren
3 DAS LEBEN IM NETZWERK – DENKEN UND HANDELN IN NEUEN ZUSAMMENHÄNGEN
4 DIE NEUE TAKTIK
Der Coach – Portrait eines Entscheiders
Die Mannschaft – Psychologie des Zusammenspiels
Klima
Fairness in der Praxis
Picks and rolls – die Kraft der Spielzüge
Sich ständig neu erfinden
5 SCHLUSSWORT
Danksagung
Der Autor
Erfolg ist Teamarbeit
Vor einigen Jahren saß ich im Flugzeug neben einem ehemaligen Basketball-Profi aus den USA, der heute als Consultant für Unternehmen arbeitet. Er brachte mich darauf, dass Basketball und Wirtschaft eine Menge Parallelen aufweisen, ja, nach den gleichen Prinzipien arbeiten. Seine Erzählungen hatte ich in einem Gedächtnisprotokoll aufgeschrieben. Das stelle ich dem Buch als Vorwort voran, denn damit fing auch meine Beschäftigung mit dem Thema an.
Auf dem College hatte ich Basketball und Business studiert. Zunächst spielte ich einige Jahre in der NBA, dann engagierte mich ein Sponsor unseres Teams für seine Personalabteilung. Ich war mir sicher, dass erfolgreiche Unternehmen wie erfolgreiche Basketballteams nach den gleichen Prinzipien arbeiteten. Ziel ist es, Erfolg zu haben, also besser, als die Konkurrenz zu sein. Dafür braucht man Kapital, um die richtigen Spezialisten in die Mannschaft zu bekommen, und man braucht einen Coach, der das Miteinander der Spezialisten organisiert und in die richtige Richtung lenkt.
Ich wollte den Erfolg, den Sieg. Meinen Traum, in die Hall of Fame zu gelangen, konnte ich mir allerdings nicht erfüllen. Immerhin gehörte ich zwei Seasons zur Starting Five unseres Teams, bis mich eine Verletzungsserie stoppte.
Damals gab es für mich nur Training. Ich wollte immer besser werden. Nach jedem Spiel fragte ich mich, was ich besser machen könnte. Einen Sieg konnte ich nur genießen, wenn ich wusste, dass ich alles dafür gegeben hatte. Genau so wollte ich mich im Unternehmen einbringen.
Im Job fiel es mir deutlich schwerer als beim Basketball, die richtige Richtung zu finden. Es war nicht deutlich, woran ich mich messen konnte. Daher konnte ich mir nicht beantworten, ob ich alles gegeben hatte. Es gab kein greifbares Ziel. Die Zielsetzung in einem Sportteam ist klarer als in einem Unternehmen. Das gilt insbesondere für ein großes Unternehmen.
Beim Basketball waren wir zwölf Spieler, zwei Trainer, Physiotherapeut und ein Managementteam. Die Zielsetzung war immer eindeutig. Mal ging es darum, die Spieler weiter zu entwickeln, mal wollten wir die Play Offs erreichen: Es war immer eindeutig und allen klar. Gleichfalls wusste jeder in der Mannschaft, was es brauchte, um dorthin zu kommen.
Doch im Unternehmen sah die Sache anders aus. Selten waren Ziele kommuniziert, und wenn, wurde nicht deutlich, was der Beitrag des einzelnen dazu war. Jeder fühlte sich weit weg und hatte keine Ahnung, was er tun konnte, damit die Arbeit erfolgreich wird.
Es ist egal, ob Ziele quantitativ oder qualitativ sind: Es muss jemand sagen, wie man sie erreicht. Ein Ziel ohne Plan ist wie eine Sonntagspredigt, nach der jeder heimgeht und weitermacht wie bisher. Zwanzig Prozent mehr Umsatz oder Championship ist als Ziel albern, wenn keine Vorstellung über den Weg dorthin besteht. Was muss der einzelne tun, wie lautet das operative Ziel für jede Person im Team? Wird ein Gesamtziel nicht erreicht, und individuelle Ziele lagen nicht vor, kann niemand ermessen, ob er hätte besser sein können.
Heute arbeite ich als Consultant in einer Reihe von Unternehmen. Meine erste Frage dort gilt immer den Zielen. Oft haben schon die Chefs keine genaue Vorstellung. Frage ich aber Mitarbeiter nach den Visionen oder Zielen des Unternehmens, höre ich selten etwas Konkretes. Manchmal werden Ziele genannt, doch jeder erzählt mir etwas anderes. Alle arbeiten mit Kraft in unterschiedliche Richtungen. Jeder wundert sich, dass man nicht weiter kommt, und ist überzeugt, das Richtige zu tun. Die Leute sind nicht faul, was die Sache verschlimmert.
Wenn jeder alles gegeben hat, aber das Ziel verfehlt wurde, gab es Faktoren, die außerhalb des Einflusses der Mannschaft lagen. Manchmal ist der Gegner einfach besser! Die Führungskräfte müssen in der Lage sein, das zu erkennen. Sie müssen wissen, was geht und was nicht geht. Einige Dinge haben die Mitarbeiter in der Hand. Darauf muss sich die Führungskraft konzentrieren.
Der Trainer beim Sport arbeitet jeden Tag mit seinen Leuten. Er schaut sich ihre Leistungen an und sagt ihnen, wo sie sich verbessern müssen. Im Unternehmen bekommt man Aufgaben, aber es wird nicht trainiert. Man geht davon aus, dass die Leute es entweder schon können, oder es sich aneignen. Betreuung gibt es nicht. Verkäufer werden noch mal hin und wieder zu Trainings geschickt. Aber die sind weit von der täglichen Praxis entfernt, nicht einmal der Vorgesetzte ist dabei.
Der aber muss wissen, was wichtig ist. Er muss es seinen Mitarbeitern verdeutlichen. Zusätzlich muss er sich dafür interessieren, was für seine Leute wichtig ist. Beherzigt er das, kann er eine Menge bewegen.
Aber man lässt ihm im Unternehmen kaum Zeit zur Reflexion. In meiner Zeit als Manager hatte ich versucht, Elemente aus dem Sport in die Arbeit zu integrieren. Doch Verpflichtungen und Termine ließen wenig Raum für planvolle und konsequente Führungsarbeit.
Wenn jeder arbeitet, ohne zu wissen wohin, wenn nicht einmal klar wird, ob die Arbeit das Unternehmen weiterbringt, wird der Alltag mühevoll. Wer seine Werte nicht kennt, kann sich schlecht motivieren. Nur die eigene Begeisterung vermag andere anzustacheln. Weder Sportler noch Mitarbeiter sind gleich motiviert. Gibt es transparente Ziele und eine Vision, ist es für sie leichter, motiviert zu sein. Klare und erreichbare Ziele machen es der Führungskraft leichter, das Team zu motivieren.
Für jeden Mitarbeiter muss sich eine Führungskraft überlegen, wie sie ihn motivieren will. Ein Beispiel aus dem Basketball: Gehe ich zu einem Top-Spieler und sage, ich hätte etwas entwickelt, womit er viel Geld verdienen könne, wird ihn das wenig motivieren, da er genug Geld hat. Sage ich, ich könne ihm helfen, NBA-Champion zu werden, würde er mir zuhören. Ich muss mir eben überlegen, was den einzelnen Mitarbeiter bewegt: Dem einen geht es um Sicherheit, einem anderen um größeren Freiraum. Versuche ich, einen Mitarbeiter über Sicherheit zu motivieren, wenn ihm Freiraum wichtig ist, kann ich tagelang reden, ohne ihn zu erreichen. Kommt jemand gerade vom College, möchte er möglicherweise Prestige und Titel. Später, mit Familie, ist ihm das weniger wichtig. Dann möchte er nicht mehr durch die Welt reisen und bis zwei Uhr nachts arbeiten. Jeder ist zu bewegen, man muss nur den richtigen Schlüssel kennen.
Auch muss man wissen, dass sich die Dinge verändern. Früher gab es große Bartschlüssel, heute kleine Sicherheitsschlüssel. Mit einem Schlüssel von früher bekommt man heute keine Tür mehr auf. Ich muss dran bleiben, die Dinge verändern sich.
Wenn allerdings der Vorgesetzte selbst nicht motiviert ist, wird er es nicht schaffen, andere zu motivieren.
Nur der kann motiviert werden, der Engagement und Interesse für eine Sache mitbringt. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen zu erkennen, wo seine Fähigkeiten und Leidenschaften liegen. Früher hatte ich vier Jahre Tennis gespielt und hatte unglaublich wenig Erfolg. Als ich zum Basketball wechselte, ging alles sehr schnell. Dort hatte ich meine Leidenschaft gefunden. Tim Duncan war zunächst Schwimmer. Seine Veranlagung und sein Talent machten ihn schnell zu einem großen Basketballer.
Selbst wenn jemand nur 1,60 Meter groß ist, kann er Basketballprofi werden. Er kann nicht als Center spielen, aber möglicherweise als Aufbauspieler. Vielleicht hat er eine Fähigkeit, die in bestimmten Augenblicken gebraucht wird. Möglicherweise sitzt er die meiste Zeit auf der Bank, aber in bestimmten Augenblicken bringt ihn der Trainer, weil er weiß, jetzt braucht die Mannschaft etwas, das nur er bringen kann.
Wer nur einen Job sucht, ohne sich nach seinen persönlichen Fähigkeiten und Neigungen zu fragen, kann jahrelang arbeiten, ohne Fortschritt zu erzielen. Entsprechend schwierig ist es mit seiner Motivationslage.
Jeder ist für seine Karriere verantwortlich. Er hat immer eine Wahl. Wer bei etwas bleibt, was ihm nicht liegt, hat gewählt. Die befürchteten Nachteile einer anderen Entscheidung scheinen ihm dann schwerwiegender als die erhofften Vorteile. Aber es ist seine Wahl.
Dieses Bewusstsein ist wichtig: Wir machen die Dinge, für die wir uns entschieden haben, und wir erwarten uns durch sie eine Reihe von Vorteilen. Leider schauen viele nur auf die Nachteile der augenblicklichen Situation und fangen an zu meckern. Sie erwarten eine Veränderung durch andere. Wenn sie dann mit geringerer Kraft arbeiten, müssen die Kollegen mehr tun.
Von außen ist es schwer einzuschätzen, was einen Mitarbeiter wertvoll macht. Es gibt Spieler, bei denen man sich fragt, warum ausgerechnet er Profi ist. Doch dann liest man, dass der ein guter Spieler in der Kabine ist. Bei zwölf Spielern geht es nicht nur um die super Leistung auf dem Feld, sondern irgendwer muss die Mannschaft zusammenhalten. Oft sind es ältere Spieler, die mit den jüngeren gut umgehen können und sie unterstützen.
Manche Spieler haben großartiges Talent, spielen aber nur kurz. Die haben eventuell wenig Einfühlungsvermögen für die anderen Mannschaftsmitglieder und belasten das Team. Einige Spieler sitzen die meiste Zeit auf der Bank. Da ist es wichtig, dass die keine Intrigen anfangen, sondern sich vorbildlich benehmen.
In Unternehmen werden die Leistungen der einzelnen selten im Gesamtzusammenhang gesehen. Man bewertet Leistungen nach Parametern die selten offen kommuniziert werden. Die Bedeutung der einzelnen Mitarbeiter für die Gruppe wird nicht gewürdigt. Vor allem aber verbaut der einseitige Blick auf die erbrachten Leistungen die Sicht auf das Potenzial der Menschen. Viele verzichten auf Weiterbildung, weil die Vorgesetzten glauben könnten, dass sie ihre Arbeit nicht beherrschen.
Das ist im Basketball undenkbar. Selbst Michael Jordan oder Magic Johnson haben nie aufgehört, sich weiterzuentwickeln. Sie mussten sich immer wieder in ihren Teams behaupten und die strategischen Vorstellungen ihrer Trainer umsetzen. Es geht nicht nur darum, Neues zu lernen. Auch die Fundamentals müssen immer wieder geübt und geschliffen werden.
Mein Trainer war überzeugt davon, dass sein Team umso besser spielt, je besser es die Grundlagen beherrscht. Oft waren es Kleinigkeiten, die einen Leistungsschub auslösten. Es kommt ja nicht nur darauf an, dass man passt, sondern wie man passt. Nicht nur das Dribbling ist interessant, sondern wie man dribbelt, wie man wirft. Man muss auf die Fußstellung in der Verteidigung achten, oder beim Rebound die Hände hoch nehmen und in der richtigen Balance stehen. Alle Bewegungen können weiter runtergebrochen werden.
Wenn ich in einem Unternehmen bin zeige ich, wie man dribbelt: Die Fingerspitzen werden benutzt, und der Kopf ist oben, eine Hand schützt den Ball, der Ellbogen der Dribbelhand ist nahe am Körper etc. Das sind die Dinge, durch die das Spiel leichter wird, wenn man sie beherrscht. Dann frage ich, was man beherrschen muss, um in diesem Unternehmen die Arbeit erfolgreich zu erledigen. Arbeitet man mit Programmierern, muss man sich fragen: Was sind die Fundamentals beim Programmieren? Viele Mitarbeiter in den Unternehmen kennen die spezifischen Grundlagen ihrer Profession nicht, die Vorgesetzten auch nicht.
Mein Team hatte Spiele gewonnen, weil die Bewegungen automatisiert waren. Das Spiel wurde für uns leichter. Die anderen waren möglicherweise schneller, sind aber einen längeren Weg gegangen. Die waren schneller, wir waren aber vorher da. Was ist entscheidend?
Sowohl im Basketball als auch in den Unternehmen kommen Menschen aus unterschiedlichen Beweggründen zusammen. Doch im Basketball werden die Mitglieder auf das Ziel eingeschworen. Sie wissen, worum es geht. Körbe werfen und Körbe des Gegners verhindern. Das ist einfach erklärt. Die Frage jedoch ist, wie man es macht. Die einen sagen, dass der Ball zu den langen Spielern im Korbraum gepasst werden soll. Andere versuchen, hinter der Drei-Punkte-Linie die Körbe zu erzielen. Es gibt eben unterschiedliche Philosophien. Das gleiche gilt für die Frage, wie man Körbe verhindert. Einige Trainer schwören auf Manndeckung, andere auf Zonendeckung oder Kombinationen daraus.
Bei Unternehmen erkennt man selten die Philosophie. Man macht etwas, aber keiner weiß, was das Besondere daran ist oder wie in schwierigen Situationen gehandelt werden soll. Werden neue Mitarbeiter eingestellt, wird das Team nicht zusammengerufen, um die neue Situation zu überdenken. Man stimmt sich nicht ab: Wir haben neue Mitarbeiter, was bedeutet das jetzt? Vorher konnte jeder alles, aber jetzt ist ein anderes Konzept gefragt. Jetzt geht es um Spezialisierungen. Der neue Mitarbeiter kennt es nicht anders, aber viele der bisherigen Mitarbeiter haben damit Probleme. Sie haben neue Rollen, also muss mit ihnen geredet werden, damit es in der Mannschaft funktioniert. Der eine soll nicht mehr so oft werfen, sondern mehr passen. Es ist eine Verlagerung der Verantwortung.
Werden die neuen Systeme nicht besprochen, werden viele Mitarbeiter verunsichert. Aus dieser Verunsicherung resultiert sehr oft ein Gegeneinander in der Mannschaft, das umso größer wird, je offensichtlicher die Erfolge ausbleiben.
Einmal traf ich einen Ex-Profi, der in Philadelphia gespielt hatte, als das Team den bis heute gültigen Negativ-Rekord der NBA aufstellte, in der ganzen Saison nur 9 von 82 Spielen zu gewinnen. Er erzählte, dass es ihm damals sehr schlecht ging. Alle waren am Boden, hatten wenig Selbstvertrauen. Doch genau in dieser Zeit fingen die internen Kämpfe an. Man kämpfte gegeneinander. Die Guards beschuldigten die anderen Guards, ebenso die Forwards und die Center. Freunde gerieten in Streit. Jeder dachte, wenn es gemeinsam nicht funktioniert, muss ich versuchen, das Spiel an mich zu reißen, damit es wieder läuft. Aus dieser Misere kam die Mannschaft nicht mehr raus, der Streit verschärfte sich, je länger der Erfolg ausblieb, und der Erfolg blieb aus, weil man sich untereinander stritt.
Ich merkte, wie tief die Wunden bei diesem Spieler waren, es schmerzte ihn noch immer bei der bloßen Erinnerung an die Situation. Es wurden nicht nur die Spiele verloren, man verlor auch Bindungen zu Freunden. Eine Negativserie kann das Zusammenleben überschatten.
An diesem Beispiel wird die Bedeutung des Zusammenhaltes in einer Mannschaft deutlich. Man muss nicht jeden mögen, aber man muss die anderen respektieren. Das gilt für Basketball, aber auch für das Miteinander in den Unternehmen. Der Zusammenhalt in Unternehmen ist weniger stark ausgeprägt.
Jeder ist anders, jeder hat eine andere Einstellung auf dem Platz. Einige werfen gerne oder spielen lieber in der Verteidigung, andere setzen ihre Kraft ein. Eine Mannschaft besteht aus unterschiedlichen Charakteren. Einige treffen sich nach Feierabend, andere sind eher Einzelgänger. Wir trafen uns ein bis zwei Mal die Woche nach dem Training mit allen, um ein besseres Verständnis füreinander zu haben.
Das heißt nicht, dass ich jeden gleich gemocht habe, aber auf dem Spielfeld fiel der Respekt leichter. Man erkannte dann, dass derjenige, der häufig auf den Korb wirft,
überzeugt ist, dass er das Beste für die Mannschaft tut. So konnte man die Leistungen besser anerkennen. Auf der Basis des Respekts konnte das Zusammenspiel verbessert werden. Denn jede Veränderung bedeutet, dass sich die Spieler anders orientieren müssen.
Ein interessantes Beispiel ist Michael Jordan ein: Der hatte sechs Jahre die meisten Körbe der NBA geworfen, war aber nie Champion geworden. Dann kam Phil Jackson als Trainer. Der sagte ihm, Michael, Du musst Dich umstellen. Du musst weniger werfen. Klar, Du hast ein großes Talent, aber die anderen schauen nur zu. Um erfolgreich zu sein, muss jeder wissen, wo seine Verantwortung liegt. Deine Verantwortung im Augenblick ist, Verantwortung abzugeben, damit die anderen mehr Selbstvertrauen bekommen. Er tat es und wurde in den nächsten acht Jahren sechs Mal Meister. Und bei den letzten zwei Meisterschaften haben Spieler die entscheidenden Punkte gemacht, denen man es am wenigsten zugetraut hätte. Die Spieler haben mit der Zeit gelernt, dass sie auch Verantwortung übernehmen können. Jeder sollte den Zusammenhang des Unternehmens und seiner Abteilung erkennen und entsprechende Verantwortung übernehmen, aber auch abgeben. Es kommt darauf an, dass das Team insgesamt stärker wird.
In vielen Unternehmen erlebe ich schlechte Stimmung. Wenn das nicht frühzeitig erkannt wird, wird es schwierig, das Gegeneinander aus dem Team zu kriegen. Wenn man frühzeitig gegenlenkt, hat man eher Chancen.
Die Verantwortung liegt nicht nur beim Vorgesetzten. Jeder von uns trägt seine Verantwortung und darf sie nicht abschieben. Bin ich in einer guten Wurfposition, aber werfe nicht, bleibt der Korberfolg zu hundert Prozent aus. Man muss den Mut haben, den Mund aufzumachen und seine Verantwortung wahrzunehmen. Erst dann kann man feststellen, ob man etwas kann.
Würde ich wieder in einem Unternehmen arbeiten, würde ich mehr Wert auf die Verantwortungsübernahme legen. Jedem muss klar sein, was er verantwortet. Selbstverständlich gehört dazu die Anerkennung dieser Verantwortung. Zum einen von der Unternehmensführung, als von den Mitarbeitern.
Viele Top-Manager in Unternehmen greifen in die Arbeit der unteren Führungskräfte ein. Das ist immer problematisch. Das passiert auch im Basketball immer wieder. Ein Präsident, der nach dem Spiel in die Kabine kommt und den Spielern erklärt, wie sie zu spielen haben, agiert kontraproduktiv. Jeder muss in seiner Rolle bleiben. Als Spieler bin ich ja auch nicht zu denen gegangen und habe ihnen erzählt, dass sie Sponsoren holen oder den Ticketverkauf anders organisieren müssen.
Befragungen haben ergeben, dass ein Präsident, der sich in die sportlichen Belange einmischt, den Trainer abbaut. Die Spieler fragen sich, was ist das für ein Coach, der den nicht abblocken kann? Die Spieler haben ohnehin nicht zugehört, was der Präsident gesagt hat. Sie bemerken nur die Schwäche des Trainers. In Unternehmen ist das nicht anders.
Oft sabotieren sich auch die Mitarbeiter gegenseitig. Beim Basketball geschieht so etwas auch, aber nur beim Training. Im Spiel, das weiß jeder, ist so ein Verhalten schädlich. Aber beim Training wird schon einmal versucht, dem anderen eins auszuwischen. Es ist wichtig, Konflikte frühzeitig offen zu legen und zu besprechen. Da spielt der Trainer eine große Rolle.
Es kommt auf die Leidenschaft der Mannschaft an, ob sie Spaß und Freude bei der Arbeit hat. Fehlt die Begeisterung, wird alles anstrengender. Ein Basketballspieler muss im Training schuften, Seile hochklettern, Medizinbälle schleppen. Von außen sieht das sicherlich aus wie Quälerei. Da wir mit Leidenschaft dabei waren, war es wesentlich leichter. Manchmal tat es weh, aber ich wusste, es bringt mich weiter. Wenn es Spaß macht, mit den Kollegen in der Halle zu sein, quält man sich, ohne Qual zu empfinden. Es überwiegt die Freude es zu tun, weil man ein Ziel erreichen will.
Wer sich lustlos zum Training schleppt, muss die Anforderungen als Qual empfinden. Der wird schwerlich weiterkommen, denn es fehlt offensichtlich die Fokussierung. Das ist Verschwendung von Energie, denn man kappt seine Leistungsfähigkeit. Gerade für Spieler, die oft auf der Bank sitzen, gilt es, die eigenen Stärken zu erkennen und zu überlegen, wann und wo man die ins Spiel bringen kann. Nur wenn man die persönlichen Defizite erkennt und daran arbeitet, wird man seine Position in der Mannschaft finden. Wer auf der Bank sitzt und über Trainer und Mitstreiter meckert, grenzt sich aus dem Team aus.
In der Zeitung liest man von Spielern, die sagen, der Trainer habe seit Wochen nicht mehr mit ihnen gesprochen. Ich würde diese Spieler fragen, wo ihre Verantwortung liegt. Wenn der Spieler ein Gespräch braucht, ist es seine Verantwortung, dieses Gespräch zu suchen. Warum auf den Trainer warten, wenn man selbst aktiv werden kann? Hat ein Spieler Befürchtungen, das Gespräch mit dem Trainer zu suchen, würde ich sagen: Ach so, es ist Dir unangenehm! Dann hör auf zu meckern. Du hast Dich entschieden, nicht aktiv zu werden, obwohl Du meinst, dass Du das Gespräch brauchst. Verschiebe nicht die Verantwortung auf den Trainer.
Als Spieler war mir wichtig, dass wir im Spiel Strukturen hatten. Ich wollte in bestimmten Situationen einschätzen können, wie meine Mitspieler reagieren. Spielte ich in der Freizeit, wo es weniger Strukturen gab, dauerte es immer eine Zeit lang, bis ich mich zurecht gefunden habe. Andere Spieler fühlten sich total eingeschränkt, wenn Strukturen abgesprochen waren. Die wollten frei sein, sich frei bewegen. Als Trainer hat man dann die Aufgabe zu schauen, wie man die unterschiedlichen Ansichten zusammenbekommt, damit das Spiel funktioniert: Den einen Struktur geben, den anderen ihren Freiraum. In Unternehmen scheint mir diese Problematik wenig berücksichtigt.
Einige Trainer sind der Ansicht, sie müssten die Spieler fertig machen, um sie zu motivieren. Ich denke, dass ein Trainer feinfühlig sein muss, zu unterscheiden, welcher Spieler welche Ansprache braucht. Der eine kann heftig angeraunzt werden und steigert seine Anstrengungen, der andere macht in diesem Fall dicht. Manch ein Spieler muss im Training hart rangenommen werden, im Spiel kann man ihn dann frei laufen lassen. Andere sind möglicherweise zu Beginn des Spiels noch nicht wach, die müssen angeschrien werden, damit sie den richtigen Fokus bekommen. Der nächste muss für ein kurzes Gespräch zur Seite genommen werden, weil der nicht vor der Gruppe bloßgestellt werden will. Ist ein Spieler ehrgeizig und hart mit sich selbst, hat im Spiel aber eine schwache Phase, lasse ich ihn auf dem Spielfeld, weil der sich durch diese Situation durchkämpfen muss. Den anderen muss ich zwei Minuten auf die Bank holen. Man kann eben nicht alle Spieler über einen Kamm scheren. Die Kunst eines Trainers ist zu wissen, was er von den einzelnen Spielern braucht und mit welchen Methoden er diese Leistung bekommt. Augenfällig wird das bei der Arbeit mit Kindern: Eltern sind oft schockiert, wenn sie den Trainer mit ihren Kindern schreien und schimpfen hören. Fragt man die Kinder, finden die das vollkommen in Ordnung. Allerdings ist es durchaus möglich, dass der gleiche Trainer in einer anderen Gruppe scheitert, weil dort die Kinder auf diesen Stil nicht ansprechen.
Erfolg muss man zu seinen Fähigkeiten in Beziehung setzen. Seitdem ich als Consultant in Unternehmen arbeite, habe ich viele erfolgreiche Unternehmen erlebt. Schaute ich mir aber das Potenzial dieser Unternehmen an und malte mir aus, was diese Unternehmen hätten erreichen können, waren die Ergebnisse wesentlich enttäuschender.
1 Grundlagen
Entwicklung des Modells. Darstellung der verwandten Funktionsweise von Basketball und Wirtschaft sowie der unterschiedlichen Organisationsprinzipien im ökonomischen Alltag beider.
Erfolg – ohne Spaß und Sinn?
Finanz- und Wirtschaftskrisen destabilisieren unser Leben. Die Menschen haben Angst. Sie verteidigen ihre Unabhängigkeit. Durch Vereinzelung nehmen sie sich allerdings die einzige Chance, etwas für Veränderungen zu tun. Das geht nur in der Gruppe. Professionelle Sportvereine sind Unternehmen, in denen Menschen freudiger und engagierter arbeiten. Als Modell bieten sie einen anderen Blickwinkel auf die Wirtschaft.
Wir werden mit Schreckensszenarien der Globalisierung überhäuft. Die Finanzkrise und die Euroschwäche geben uns eine konkrete Vorstellung von den Schwierigkeiten, vor die eine vernetzte Welt uns stellt. Die weltweiten Ungleichgewichte lassen wenig Hoffnung auf dauerhafte Stabilität. Einige Länder stehen vor dem finanziellen Kollaps, nicht nur Griechenland, Portugal, Spanien oder Irland, auch die USA, Frankreich und Deutschland sind bis über beide Ohren verschuldet. Die Auswirkungen sind kaum abzuschätzen, vor allem jedoch nicht zu unterschätzen. Denn Insolvenzen treffen Kreditnehmer und -geber.
Die Katastrophe von Fukushima steht sinnbildlich für die Gesamtsituation. Vermeintlich beherrschbare Risiken stellen sich als unbeherrschbar heraus. Fachleute sind überfordert und flüchten sich in Verschleierungen und Fehlinformationen, um den Wirtschaftskreislauf so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Während sich die geschmolzenen Kernbrennstäbe weiter durch den Stahlbetonmantel fressen, hat sich der Großteil der Menschheit wieder anderen Themen zugewandt. Die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen, etwa als Lieferausfälle oder Versicherungsleistungen, werden weltweit zu spüren sein.
Deutschland gehört zu den Top-Ländern, die die weltweite Vernetzung betrieben haben: Zusammen mit USA und Japan stellten wir 2006 acht Prozent der Weltbevölkerung, aber vereinnahmten 49 Prozent des Brutto-Nationaleinkommens der Welt. Der Erfolg weckt keine Euphorie. Im Land des langjährigen Exportweltmeisters bekennt sich eine wachsende Gruppe von Menschen als Globalisierungsgegner.
Die Finanzkrise zeigt uns, dass wir nicht mehr Herr der Spielregeln sind. Eine Regeländerung im Wirtschaftssystem bedarf des weltweiten Konsenses. Anstatt sich plötzlich gegen etwas zu stellen, was man an vorderer Front mit herbeigeführt hat, sind Überlegungen geboten, wie wir in Vorbildfunktion helfen können, faire Regeln zu etablieren.
Wir werden uns kaum gegen die Globalisierung stemmen können. Sie ist längst gegenwärtig, und wir Deutschen spielen vorne mit: als Konsumenten, als Anleger, als Touristen und Produzenten. Als Exportweltmeister müssen wir uns der stärker werdenden Konkurrenz stellen und uns bemühen, auch in den kommenden Jahren um den Titel mitzuspielen.
Von der Spitze aus können wir alles tun, die Gefahren zu umlenken. Doch aktives Gestalten kann niemand alleine. Wir müssen näher zusammenrücken, unser Know-How, unsere Kraft und unser strategisches und taktisches Geschick zusammenlegen. Es ist wichtig, dass wir unseren kritischen Diskurs weiter pflegen. Noch wichtiger ist es, wieder zu lernen, Konsens zu finden.
Gemeinsam schaffen wir es.
Seit Jahren erlebe ich in meinen Trainings in zahlreichen Unternehmen Menschen zwischen Macht und Ohnmacht. Da gibt es Führungskräfte, die sich, randvoll mit Orga- und Berichterstattungsaufgaben, im Widerstreit zu ihrem Team erleben. Ich habe mit Teams gearbeitet, die sich gegenseitig hinter einem Wall aus Misstrauen abschotten oder in anderen Fällen im innigen Schulterschluss die Bezichtigung „derer da oben" pflegen. Verkäufern begegnete ich, die gesättigte Märkte mit Metoo-Produkten1 überschwemmen, oder als „Berater“ die Standardlösung ihres Unternehmens an den Mann bringen sollen. Ganz zu schweigen von Servicetechnikern, die in immer kürzerer Zeit immer mehr Geräte instand halten oder setzen sollen, ohne zu vergessen, die Kunden zu begeistern. Theoretisch scheinen alle Aufgaben lösbar. Doch der Umgang mit Mitarbeitern, Kollegen, Behörden oder Kunden bringt Konflikte und Frustrationen. Was leicht aussieht, wird elend schwer, da es aber leicht aussieht hat niemand Verständnis.
Jeder ist weitgehend auf sich alleine gestellt.
Für immer mehr Menschen wird die persönliche Krisenbewältigung Alltag. Die Kommunikationstechnologie hat einen enormen Umwälzungsprozess in Gang gebracht. Durch effiziente Vernetzung fallen Arbeitsplätze weg. Vor allem die eintönigen mühseligen Arbeiten können durch die IT ersetzt werden. Das Ende dieses Prozesses ist nicht absehbar. Schon heute holen wir Geld oder Fahrkarte am Automaten und bestellen Bücher und Kühlschränke im Internet. Gunter Dueck beschreibt einleuchtend die nächsten Entwicklungsschritte2: Lastwagenfahrer steuern die Ladungen per Laptop aus dem Garten und der einfache Blutscan wird per Zusatzgerät vom Wohnzimmer direkt an riesige Rechenzentren übertragen, die innerhalb weniger Sekunden vergleichen und auswerten. Dadurch werden viele Ärzte beschäftigungslos. Das Wissen der Welt wird im Internet gesammelt und strukturiert. Hochschullehrer werden überflüssig, da Studenten ihre Zeit nicht in langweiligen Vorlesungen absitzen, sondern per Internet nach eigenem Tempo und eigenen Interessen lernen können. Wir nähern uns dem Ende der Dienstleistungsgesellschaft.
Wir können nicht weitermachen wie bisher. Die Finanzmärkte dehnen sich aus, ihr unstillbarer Hunger nach Wachstum saugt die produktive Welt aus. Die Renditejagd der Anleger verteuert Nahrungsmittel und Rohstoffe. Sie setzt die produzierenden Unternehmen unter ständigen Kostendruck. Die Qualität der Produkte leidet unter dem Zwang, billiger zu werden. Innovationen kommen nur, wenn der Return on Investment kurzfristig zu realisieren ist. Die sinkenden Produktivitätsgewinne teilen sich wenige Aktionäre, die Löhne sinken kontinuierlich. Eingesparte Mitarbeiter werden ihrem Schicksal überlassen bzw. der Solidarität einer ärmer werdenden Masse. Auf diesem Weg werden wir in Kürze Zustände wie nach der Weltwirtschaftskrise 1927 haben. In Griechenland ist es schon beinahe Realität. Ein Heer von Mittellosen ohne Hoffnung, in der Folge Unternehmen ohne Kunden.
Die Erfolgsgeschichte des homo sapiens beruht auf dem Prinzip der Gemeinschaft. In der organisierten Verteidigung der Gruppe fand der einzelne Schutz. Nur mit vereinten Kräften konnte er jagen. Kein einzelner hätte den Ackerbau entwickeln und perfektionieren können, noch hätte er sich alleine den Herausforderungen wie Besiedlung neuer Territorien, Entwicklung von Produktionsmitteln, Forschung und Sinnsuche widmen können. Fortschritt wird aus der Gruppe geboren und mit der Gruppe umgesetzt.
Not war und ist gewiss eine treibende Kraft. Aber der Erfindungsreichtum der Gattung Mensch wird in besonderem Maße auch von Neugierde getrieben. Wer seiner Neugier nachgeht, braucht Mut, denn er betritt unbekanntes Terrain. Mit einer Gruppe im Rücken fällt das Kundschaften leichter.
Allerdings hat das Gruppenleben Schattenseiten. Jede Gruppe bildet ihre eigene Kultur, sie organisiert und strukturiert sich, entwickelt offizielle und inoffizielle Regeln und schafft sich ihr Wertesystem. Gleichzeitig ist jede Gruppe ein emotionales Treibhaus mit Zank und Streit. Will man dabei sein, muss man einige Freiheiten aufgeben und Konflikte austragen. Wir als aufgeklärte Bürger halten Abstand, entziehen uns damit gleichzeitig dem Gruppenschutz. Und plötzlich kommt die Angst.
Wir haben uns vereinzeln lassen. Wir sind sogar stolz auf unsere Unabhängigkeit. Doch inmitten materieller Saturiertheit ist die Lebensqualität nicht mit gewachsen. Angst vor der Zukunft, vor Arbeitslosigkeit und Terrorismus prägen unseren Alltag ebenso wie Misstrauen gegenüber dem Staat, den Mächtigen, dem Gesundheitssystem und jeder Person, die wir nicht kennen. Daher können wir auch nicht gemeinsam unsere Ängste verjagen, wie Urvölker es schafften. Wir stehen mit unseren Ängsten alleine da.
Mit Hilfe von Therapien, Wellnessprogrammen, Sport oder Drogen versuchen wir uns zu stärken. Und doch verlassen uns angesichts der Zumutungen durch die Realität schnell wieder die Kräfte. Um uns herum drohen Krisen. Neben der Finanzkrise gibt es die Umwelt- und Klimakrise, die Energiekrise, einige Staaten erleben Hungerkrisen und Währungskrisen. Bürgerkriege, als deren Folge, schaffen Krisenstaaten. Die reichen Länder und großen Unternehmen erleben Absatzkrisen, Liquiditätskrisen, Beschäftigungskrisen. Wir durchschauen sie nicht und rätseln ob der Ursachen. Sorgenvoll blicken wir in eine ungewisse Zukunft.
Viele Menschen reagieren mittels Eichhörnchen-Taktik, sie vergraben ihr Erspartes auf Banken und hoffen, in der Not ein wenig Reserve zu haben. Sie haben nie erlebt oder vergessen, dass in Notzeiten Geld entwertet ist und das gesellschaftliche Leben durch die Grundfunktion des Warentausches zusammengehalten wird.
Nach Feierabend ziehen sich die Menschen zurück in ihre vier Wände. Ihren Dienst an der Gemeinschaft fühlen sie durch das Zahlen von Steuern und das Ausfüllen der Wahlzettel abgegolten. Die Organisation des Staates wird Stellvertretern überlassen. Den gewählten Politikern wird zwar misstraut, aber alleine kann man ja nichts ausrichten. Die Politiker ihrerseits trachten danach, Wünsche und Hoffnungen der Allgemeinheit nicht zu frustrieren, den Laden komplikationslos weiterzuführen und den Einzelhaushalt vor Veränderungen zu bewahren.
Eine schwere Aufgabe angesichts internationaler Verpflichtungen durch EU, Weltbank oder NATO und den kaum zu bändigenden internationalen Kapitalkräften. Keine Partei kann es sich mehr leisten, Parteiprogramme aufzustellen, deren Umsetzung aufgrund übergeordneter Interessenlagen unmöglich ist. In mühseliger Netzwerk-Arbeit spinnen Politiker Fäden und flicken Löcher. Gleichzeitig müssen sie ihre Wähler beruhigen.
Die Schuldenpolitik der letzten Jahrzehnte hat dazu geführt, dass schon heute der größte Haushaltsposten die Zinszahlungen an die Kreditgeber sind. Der Bewegungsspielraum der Politiker wird zunehmend stärker eingeschränkt, die Neuverschuldung übersteigt die Zusatzeinnahmen durch wirtschaftliches Wachstum. Finanzminister legen den Zeitpunkt des ausgeglichenen Haushalts regelmäßig in die nächste Legislaturperiode. Die Regierungen brauchen ständig neues Bargeld und richten ihre Politik nach denen aus, die es liefern. Also durfte der Ex-Chef der Deutschen Bank Ackermann seinen Geburtstag im Kanzleramt feiern, während eine Anhebung des Hartz-IV-Satzes um fünf Euro monatelang debattiert wurde.
Vor allem wird aber kaum etwas in die Bereiche investiert, die die Zukunft sichern: Kindergärten, Schulen, Universitäten, Innovationszentren und in die Infrastruktur des Internets.
Politiker propagieren die Vollbeschäftigung, wissend, dass es sie nach den bisherigen Maßstäben nie wieder geben wird. Denn unser gemeinschaftlicher Erfindungsreichtum hat Technologien entwickelt, die vor allem eins tun: menschliche Arbeit durch Maschinen zu ersetzen. In den kommenden Jahren wird es darum gehen, Technik weiter zu entwickeln und kreative Ideen für ressourcenschonende Produkte zu entwickeln.
Es ist unser aller Aufgabe, diese neue zukünftige Gesellschaft zu gestalten. Das bedeutet auch, dass wir den Arbeitsbegriff neu definieren. Heute verstehen wir Arbeit vulgär und eng als etwas, für das jemand Geld bezahlt, weil es sich schnell refinanziert. Zukünftig müssen wir persönliche Weiterbildung und Forschung als Arbeit für die Gemeinschaft anerkennen. In der Bildung aller liegt die wesentliche Ressource für den Erfolg morgen. Dabei wird es allerdings nicht mehr um das Speichern von Fakten gehen, die liefert das Internet. Das Schwergewicht wird auf Kreativität und Methoden liegen. Es ist absehbar, dass in wenigen Jahren ein Teil der Gesellschaft hochwertige Arbeiten verrichtet, während ein anderer nach weiteren Entwicklungsmöglichkeiten forscht. Eine dritte Gruppe wird sich um Erziehung und Pflege kümmern. Arbeit wird nicht länger fremdbestimmt und kurzfristig sein. Arbeit muss nicht wie Medizin bitter schmecken, um belohnt zu werden.
Wer mit Freude arbeitet, macht sich verdächtig. Wer keine Arbeit hat, ebenfalls. Obwohl es nicht genügend Arbeit gibt, wird dem Arbeitslosen die persönliche Schuld an seiner Misere in die Schuhe geschoben. Götz Werner, Gründer der Drogeriemarkt-Kette dm, sagt treffend: „Hartz IV ist in meinen Augen fast schon offener Strafvollzug in gesellschaftlicher Isolation.“3
Schon in der Schule wird uns der Spaß ausgetrieben. Zwar verdammen wir in Deutschland Kinderarbeit, doch packen wir unseren Kindern immer mehr zweifelhaften Stoff ins Programm und verplanen ihren Tag. Von all dem Stoff, den ich in der Schule pauken musste, waren 40 Prozent nutzlos und weitere 40 Prozent aus heutiger Sicht falsch. Wir mussten ihn lernen, weil irgendwer meinte, er sei wichtig für die Zukunft. Doch kaum jemand von uns hat eine Ahnung, wie die Welt in drei Jahren aussieht. Wir bringen den Kindern unsere Resultate bei, statt sie nach ihren Lösungswegen suchen zu lassen. Schon Seneca sagte, „non vitae, sed scholae discimus“4, und daran hat sich bis heute nichts geändert.
Wenn wir wollen, dass unsere Kinder all das lernen, was wir wissen, vergeben wir die Chance, dass der Nachwuchs die Welt mit neuen Augen betrachtet und neue Ideen generiert. Wir brauchen Bildungsmoderatoren und -motivatoren statt Lehrer. Statt mit Begeisterung zu lernen und die Welt um sich herum zu ergründen, erleben viele bereits die Schule angsterfüllt. Wer von Versagensängsten geplagt ist, wird schwerlich seine Berufung finden, höchstens einen Beruf. Einen Arbeitsplatz. Schon das Wort klingt eng und verschlossen. Die Welt schreitet fort, der Arbeitsplatzinhaber verrichtet seine Arbeit. Bis er freigesetzt wird.
Da der technologische Fortschritt viele Arbeitsplätze maschinell ersetzt, zieht auch in die Berufswelt die Angst.
Wie absurd: Unsere Gesellschaft als Ganzes wird immer produktiver und wohlhabender, in gleichem Maße aber auch unzufriedener und ängstlicher. Denn mit unserem emotionalen und faktischen Rückzug aus der Gemeinschaft wirken dort andere Kräfte, die wir in unserer Vereinzelung weder überschauen noch kontrollieren können.
Gemeinsam können Dinge bewegt werden. Nur so!
Wir werden unsere Lebensumstände und Lebensqualität nur ändern können, wenn wir aktiv am Veränderungsprozess teilnehmen. Um die Herausforderung Zukunft bewältigen zu können, müssen wir stark sein. Stärker als in unserer Vereinzelung, sind wir in Gemeinschaft.
Schauen wir uns an, was eine Gruppe, die zusammen und aktiv an einem Ziel arbeitet, bewirken kann. Wir werden sehen, dass der gemeinsame Einsatz für ein Unternehmensziel die Rahmenbedingungen verändert und den Gruppenmitgliedern das Gefühl wenn nicht der Erfüllung, so doch der Zufriedenheit vermittelt. Daraus erwächst Kraft.
Die Suche nach Unternehmen, in denen das produktive Team Mittelpunkt des Unternehmensinteresses ist, in denen die Fähigkeit zur Zusammenarbeit elementar für den Erfolg ist, und in denen jeder einzelne sich weiterentwickelt für das Ganze, führte mich zu professionellen Sportclubs. Profivereine sind fraglos Wirtschaftsunternehmen und folgen betriebswirtschaftlicher Logik. Die Übereinstimmung von Rahmenbedingungen erleichtert einen vergleichenden Blick auf unser Wirtschaftsgeschehen.
Dann saß ich 2005 im Flieger zufällig neben einem Ex-NBA-Profi, der heute als Consultant arbeitet. Er erzählte mir von Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Leben von Sportprofis und Mitarbeitern in Unternehmen (siehe Vorwort). Plötzlich wurde mir klar, dass sich Basketball vorzüglich als Parabel für die Wirtschaft unserer Zeit eignet.
Basketball ist ein schneller Sport. Anders als in vielen anderen Sportarten gibt es beim Basketball einen Vorteil für die Offensive. Ein guter Angriffsspieler kann den Ball vor dem Verteidiger abschirmen. Wie in der Unternehmensrealität, in der ein ballführender Verkäufer beim Kunden nicht vom Wettbewerb attackiert werden kann. Statt eines Tores gibt es einen Korb, jeder Punkt erfordert Geschicklichkeit. Es sind sehr viele Treffer erforderlich, um ein Spiel zu gewinnen. Es geht dabei weniger um Absicherung eines Terrains, denn um das Ergreifen von Gelegenheiten. Basketball lässt sich weitgehend mit unserem Arbeitsalltag vergleichen. Wenn Sie sich auf diesen Vergleich einlassen, sehen Sie Ihre Arbeit aus einem anderen Blickwinkel. Diese Sicht wirft Fragen auf, fördert Ideen und bietet uns ein Analyse- und Planungsmodell, das komplexe Sachverhalte überschaubar macht und Lösungswege sichtbar.
Was kann Wirtschaft vom Basketball lernen?
Engagement und Enthusiasmus sind Grundlage des Erfolgs. Trotzdem finden gute Leistungen in der Wirtschaft selten Beachtung. Die Umrisse des Basketballmodells werden dargestellt und auf die Wirtschaft übertragen. Ins Auge fällt eine alternative Organisation wirtschaftlicher Abläufe, durch die den produktiven Mitarbeitern andere Bedeutung zukommt.
Für den Fan ist Basketball ein schillernder Kosmos. Darin gibt es Sieg oder Niederlage. Jedes Spiel ist ein Moment der Wahrheit, auf das zwei Mannschaften hingearbeitet haben. Jetzt müssen sie sich messen lassen und zeigen, dass das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist.
Jeder Punkt erfordert Kraft und Einsatz, Zielgenauigkeit und Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Übersicht, und doch ist jeder Punkt nur ein Bruchteil auf dem Weg zum Triumph. Je nach Spiel sind 60 bis 130 Zähler nötig, um die Oberhand zu behalten.
Manche Spiele entscheiden sich erst in letzter Sekunde. Bei den Olympischen Spielen 1972 etwa versenkte Douglas Collins drei Sekunden vor Schluss im Finale gegen die UDSSR zwei Freiwürfe zum 50:49. Das Spiel wurde erneut angepfiffen. Zwei Sekunden später ein neuer Pfiff und die Amerikaner lagen sich in den Armen. Das Spiel war aber noch nicht zu Ende, es war angepfiffen worden, obwohl der russische Coach Auszeit signalisierte. Nach wütenden Protesten und langem Hin und Her wurden die letzten drei Sekunden wiederholt. Und dann erreicht ein langer Pass über das Spielfeld den russischen Center Alexander Below, der seiner Mannschaft mit dem Schlusspfiff das 51:50 und damit die Goldmedaille sicherte.
Basketball hat seine Helden. Doch Helden sind nicht ohne ein starkes Team denkbar. Die NBA (National Basketball Association) ist die wohl beste Liga der Welt. Die Finals, die als „best of seven" ausgetragen werden, sind also Begegnungen der Besten. 1979 standen sich die Los Angeles Lakers und die Philadelphia 76ers gegenüber. Bis zum fünften Spiel hatten beide Mannschaften ihre Heimspiele gewonnen.
Zum sechsten Spiel flogen die Lakers ohne ihren Kapitän Kareem Abdul-Jabbar, der eine Knöchelverletzung hatte. Doch es gab einen Rookie5 im Team: Earvin Johnson, der aus Highschool-Zeiten den Kosenamen „Magic" mitbrachte, vom Stadionsprecher der Lakers damals aber noch zärtlich „the Buck" gerufen wurde. Er hatte schon die ganze Saison durch Leistung geglänzt.
Auf dem Flug nach Philadelphia setzte er sich auf den leeren Platz von Abdul-Jabbar und sagte seinen Mannschaftskollegen, „A.J. is here!" Das Spiel sah dann einen wahren „Magic" Johnson, der auf allen Positionen spielte und 41 Punkte, 15 Rebounds und sieben Assists zum Sieg seines Teams beitrug.
Außergewöhnliche Leistungen, Spannung, Kampf, Sieg oder Niederlage: Die Spiele sind ein komprimiertes Bild des Lebens. Basketball-Endspiele laufen vor Millionen von Zuschauern und finden daher große Beachtung. Doch großartige Teamleistungen gibt es in vielen Bereichen, es gibt eine Menge Helden ohne großes Publikum.
Großartige Leistungen werden tagtäglich in unseren Unternehmen erbracht. Sie werden kaum beachtet, geschweige denn beschrieben. In Film, Fernsehen und Illustrierten spielt Arbeit eine Randrolle. Taucht sie zwischen Glanz und Glamour, Reise und Auto irgendwann auf, werden Eintönigkeit, Ungerechtigkeit oder Gesundheitsschädigung thematisiert. Wer begeistert mit Elan arbeitet, macht sich bei Kollegen verdächtig und wird von Vorgesetzten geflissentlich übersehen. Von Berufsanfängern abgesehen, versucht kaum jemand seine Arbeit interessant zu beschreiben. Wir nehmen ihr kollektiv die Bedeutung, während wir gleichzeitig an unserer empfundenen Bedeutungslosigkeit leiden und verzweifeln.
Statt von Arbeitsergebnissen, Erfindungen und Entwicklungen zu berichten, setzen uns die Medien die Zahlen des Dax und Dow Jones alltäglich vor, als wäre das die Wirtschaft. Tote Zahlen, die nicht auf nachhaltige Entwicklung sondern kurzfristiges Honigsaugen reflektieren. Sicherlich brauchen Unternehmen Kapital, doch an der Börse wird nur mit emittierten Anteilsscheinen gehandelt. Da die Anleger allerdings legalen Einfluss auf die Unternehmen haben, zwingen sie diese zu Aktionen, die Kurse oder Dividenden zeitnah anfeuern. Kontinuierliche nachhaltige Entwicklung ist ihnen nebensächlich.
Erfolge entstehen auf der Basis von Engagement und Enthusiasmus. Wenn Spieler das Beste aus sich herausholen, geschieht es nicht, weil sie gut bezahlt werden. Sie werden gut bezahlt, weil sie einige Jahre in Highschool- und College-Mannschaften für bestenfalls ein Taschengeld alles aus sich herausgeholt haben und jetzt zu den Besten gehören.
Die Motivation, in der Arbeitswelt an seine Reserven zu gehen, ist aufgrund der mangelnden Beachtung gedämpft. Trotzdem gibt es öfter als wir glauben Momente, in denen Menschen scheinbar Unmögliches möglich machen. Doch das wird nicht systematisch gefördert, es wird eher beiläufig als „doch selbstverständlich" notiert. Gute Leistungen der Mitarbeiter scheinen in vielen Führungskräften Unbehaglichkeit zu erzeugen, da sofort Folgeansprüche vermutet werden.
Bei der Expo 2000 in Hannover war das Global House einer der wenigen Orte, an denen das für die Vergabe der Ausstellung ausschlaggebende Konzept der Nachhaltigkeit noch deutlich wurde. 22 beispielhafte Projekte zeigten die Arbeit von NGOs6. Ich war dort für das front-of-the-house zuständig, dafür also, dass alle Besucher sicher und gut betreut und informiert wurden. Beim Bau des Hauses kam es zu Verzögerungen. Am Vorabend des Eröffnungstages sah es nicht danach aus, als könne das Haus pünktlich öffnen. Der Bodenbelag der unteren Ebene war erst halb fertig, 500 qm Teppich nicht verlegt, das Geländer einer Wendeltreppe fehlte und die Bühne stand noch nicht. Das war um 22 Uhr.
Die rund 25 Messebauer waren schon deutlich angeschlagen, Verstärkung war nicht mehr zu bekommen. Aber sie haben es geschafft. Am 1. Juni 2000, morgens um 9 Uhr wurde das Haus für Besucher freigegeben. Die herausragende Leistung des Messeteams wurde von den wenigen Anwesenden bestaunt und beklatscht. Es war deutlich zu sehen, dass die Leute stolz waren auf ihre Leistung.
Für einen Basketball-Profi ist ein Spiel das, was der Standaufbau für einen Messebauer bedeutet: Es ist seine Arbeit. Eine Arbeit, die er hoffentlich nicht nur aus Ernährungsgründen, sondern auch mit dem Herzen gewählt hat. In diese Arbeit bringt er seine besten Fähigkeiten und Fertigkeiten ein, um herausragende Leistungen zu bringen. Darüber hinaus ist er laufend gezwungen, besser zu werden.
Wer Arbeit als eine Form der Prostitution definiert, wird Schwierigkeiten haben, das Gegenteil, nämlich selbstbestimmtes Leben auszumalen. Geld in Hülle und Fülle, dickes Auto, Party – und sonst? Selbstbestimmtes Rumhängen? Dreieinhalb Stunden sitzt statistisch jeder Bundesbürger täglich vor dem Fernseher. Das ist nicht selbstbestimmt. Es füllt die Zeit, dient jedoch nicht der Erfüllung. Die eigene Ziellosigkeit lässt Menschen vermehrt nach dem Lebenssinn fragen.
Der Begriff Lebenssinn ist nebulös und unfassbar. Die einen träumen vom Schlaraffenland der Zuwendung, andere forschen nach der Weltformel. Kitschige Traumbilder, die nur der Träumer selbst versteht. Nur ein wenig mehr Zeit für sich selbst, dann käme man der Lösung schon näher, sagen sich diese Menschen, und haben mit dieser Analyse auch gleich den Schuldigen für ihre seelische Schieflage gefunden: die stressige Arbeit!
Eine deutlich kleinere Gruppe von Menschen stellt sich die Frage nach dem Sinn nicht. Sie machen etwas. Die einen modellieren Zukunftsvisionen, andere definieren ein Ziel und laufen los. Die meisten Unternehmer gehören letzterer Gruppe an. Einem, der mutig losläuft, schließen sich orientierungslose Sinnsucher an, allerdings von Anfang an misstrauisch. Sobald der Nebel hinter ihnen schließt, bereuen sie ihren Schritt und trotten lustlos hinterher.
Den Voranschreitenden geht es nicht schnell genug, die Zurückhängenden müssen jeden Schritt erst debattieren. Das Miteinander von Gruppen ist auf latenten Konfliktherden gebaut. Die Konflikte halten die Gruppe aktiv und vermeiden doch unbedachte Schritte. Sie sind eine wesentliche Energiezelle im Erfolgsmodell Gruppe.
Unternehmen, wie auch Basketball Clubs, kann man als Organismen sehen, die Sinn suchenden Menschen Lösungen bieten. Den Mitarbeitern eröffnen sich Wege einer zielgerichteten Tätigkeit, den Mitmenschen Erleichterung oder Erweiterung ihrer Lebenswelt zu ermöglichen. Da diese Lösungen weitestgehend für und nur in geringem Maß mit den anderen Menschen erdacht und erstellt wurden, bieten sie Hilfe und fremdbestimmte Gängelung zugleich. Die Standpunkte sind nur einen Blickwinkel voneinander entfernt.
Ganze Erlebniswelten werden unternehmerisch geschaffen, um die Freizeitgestaltung der rat- und ideenlosen Masse zu übernehmen. Partys, Theater, Kino, Ausstellungen etc. und auch Sportveranstaltungen. Geboten wird inklusiv auch das Bad in der Menge. Erlebnisse sind erst welche, wenn sie mit anderen genossen, zumindest anderen erzählt werden können.
In der Menge fühlen wir uns sicher und stärker. Wer das gleiche Angebot wahrnimmt, ist offensichtlich gleich gesinnt.
Wenn wir als Kunde ein Basketballspiel besuchen, möchten wir, dass sich unser Team den Hintern aufreißt! Wir erwarten totale Hingabe, die Mannschaft muss spielen wie aus einem Guss.
In den meisten Spielen haben wir tatsächlich auch das Gefühl, dass die Spieler ihr jeweils Bestes geben, selbst an den Tagen, an denen es für den Sieg nicht reicht. Sie geben ihr Bestes, obwohl sie nur Angestellte eines Unternehmens sind, mit dem sie einen Vertrag abgeschlossen haben. Sicherlich ist das Spiel nur ein kleiner Ausschnitt ihres Berufslebens. Doch auch im Training müssen sich die Profis durchsetzen, um in die Starting Five7 zu gelangen. Selbst in ihrer Freizeit achten sie auf Ernährung und gesunden Lebenswandel, da jede Unmäßigkeit beim täglichen Bluttest auffliegt.
Stellen wir uns vor, der Ball ist Produkt oder Dienstleistung. Wir und unsere Kollegen sind die Mannschaft. Unser Unternehmen tritt gegen die Konkurrenz an. Der Kunde ist Zuschauer. Je mehr Spiele wir gewinnen, desto mehr Zuschauer ziehen wir auf unsere Ränge. Der Grad unseres Erfolges kann am Tabellenplatz abgelesen werden. Der Finalsieger darf für das abgelaufene Jahr die Marktführerschaft feiern, um sich gleich darauf wieder mit dem Ziel ins Kampfgetümmel zu werfen, die Krone zu verteidigen.
Jede Mannschaft muss verteidigen und angreifen. Im schnellen Spiel kommt es auf das Umschalten von Defensive auf Offensive an. Die Prozesse müssen eingespielt sein. Von der Leistungserstellung, dem Spielaufbau, bis zur Leistungsverwertung, müssen wir unser Produkt nach vorne bringen und so gut behandeln, dass es durch den engen Korb passt. Es kommt auf jeden einzelnen an, seinen Beitrag für das Ganze zu erbringen.
Wir haben 12 Spieler in unserer Mannschaft, von denen jeweils 5 direkt ins Spielgeschehen eingreifen. Die Führungskraft, Manager oder Coach, stellt die Mannschaft auf.
Ein Beispiel: Zur Spieleröffnung spielt die Produktion auf der Center-Position. Je größer und wendiger sie ist, desto besser kann der eigene Korb vor Angriffen der Konkurrenz geschützt werden. Stürmen wir vor, steht sie in der Nähe des gegnerischen Korbes, zum Punkten bereit.
Die Grundaufstellung im Überblick: Die Forwards Service und Verkauf kommen in der Defensive zurück an die Grundlinie, denn sie müssen die Kundenwünsche dem Team vermitteln.
Marketing ist der Point Guard. In der Abwehr steht er vor dem Freiwurfraum, um frühzeitig die Angriffsbemühungen des Gegners zu durchschauen. Gleichzeitig ist er für den Spielaufbau zuständig, leitet die abgesprochenen Prozesse ein. Der Point Guard sollte auch im heftigen Fight einen guten Überblick über das Spiel haben und, wenn es der Verlauf erfordert, kreative Ideen einbringen. Der Marketing-Profi weiß mit Distanzwürfen zu punkten.
Distanzwürfe beherrscht auch der Entwickler als Shooting Guard. Innovationen mit hohem Kundennutzen sind weite präzise Pässe auf die vorstürmenden Angriffsspieler.
Prinzipiell erwartet die Spieler im Angriff eine Manndeckung: Der Kunde vergleicht bewusst oder unbewusst Verkäufer mit Verkäufer des Wettbewerbs etc. Eine Mannschaft muss beweglich sein. Sie muss versuchen, durch intelligente Kombinationen den Gegner auszuspielen.
Der Außendienst-Mitarbeiter ist der typische Power Forward, dessen primäre Aufgabe das Punkten ist. Ein guter Power Forward kann die Kunden mit atemberaubenden Dunkins (den Ball im Sprung mit der Hand durch die Korböffnung drücken), artistischen Sprungwürfen, kraftvollen Rebounds (Abpraller vom Brett vor der Konkurrenz sichern) in Begeisterung versetzen.
Der Small Forward ist der fünfte Spieler, mit dem wir an den Start gehen. Er sorgt vorne durch ständigen Stellungswechsel für Gefahr und bringt die Abwehrbemühungen der Konkurrenz durcheinander. Durch Blocken oder Doppelpass macht er die Wurfbahn für seinen Sturmpartner frei. Hat er den Ball in aussichtsreicher Position, wirft er auch selbst. In der Unternehmenspraxis spielt der Servicetechniker auf dieser Position.
Auf der Bank sitzen zunächst
Einkauf, spielt auf der Position des Shooting Guard, wenn sich der Gegner auf den innovativen Spielzug eingestellt hat. Muss in der Verteidigung Lücken schließen können. In Handelsunternehmen spielt er als Center.
Lager, ersetzt in bestimmten Spielsituationen die Produktion als Center. Hat eher defensive Qualitäten.
Logistik, kann als Point oder Shooting Guard eingewechselt werden, wenn das Spiel zu langsam wird.
Prozessmanagement, kommt als Guard, um das Spiel zu ordnen.
Pre- und Aftersales, kann als Guard Angriffsbemühungen der Gegner verhindern, gleichzeitig im mittleren Spielabschnitt die Rolle des Power Forward übernehmen.
Innendienst, setzt als Shooting Guard passgenau den Verkauf ein.
Telefon-Hotline, ersetzt je nach Spielphilosophie Verkauf oder Service.
Sie werden, je nach Spielgeschehen, ein- oder ausgewechselt.
Vor der Bank steht der Coach. Er ist der einzige, der während des Spiels am Spielfeldrand stehen darf. Er ist zuständig für die Zusammenstellung der Mannschaft. Er entwickelt einen strategischen Plan, den er für jedes neue Spiel den Gegebenheiten anpasst. Er sorgt für individuell angepasste Trainingspläne und dafür, dass jeder einzelne Spieler mit der richtigen Einstellung auf den Platz geht, und weiß, was von ihm verlangt wird. Er nimmt Auswechslungen vor, wie es das Spiel verlangt.
Auf dem Spielfeld nicht zu sehen sind Teammitglieder, die die Spieler darin unterstützen, fit und sicher ins Spiel zu gehen. In Zeitungen und Fernsehen erleben wir auch den General Manager, dessen Aufgabe es ist, sein Unternehmen, den Verein, finanziell zu sichern.
Aus dieser Vogelperspektive ähneln sich also die Umrisse von Basketball und Arbeitswelt. Zoomen wir unser Basketballmodell näher, erkennen wir eine Menge weiterer Parallelen, aber auch interessante Unterschiede.
So fällt schon bei der Mannschaftsaufstellung auf, dass ein Basketballteam horizontal organisiert ist. Die großen Unternehmen hingegen sind vertikal gegliedert. Dort hätte zum Beispiel der Center seinen eigenen Coach. Es stünden also nahezu genauso viele Coachs am Spielfeldrand, wie es Spieler auf Feld und Bank gäbe. Und die können sich während des Spiels auch nur bedingt abstimmen, weil sie unterschiedlichen Mitgliedern der Geschäftsleitung weisungsgebunden sind.
Bemerkenswert: Bis in die zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts hatten die Basketballteams den gleichen organisatorischen Ansatz, wie Unternehmen heute noch: Damals spielten noch bis zu neun Spieler pro Team, drei Guards, drei Center, drei Forwards, die jeweils ihren festgelegten Aktionsradius hatten. Geändert wurde das System aufgrund des Kundendrucks: Die Zuschauer mochten das Spiel so nicht. Die Faszination fehlte, das Geschehen war langsamer, weniger dynamisch und überraschungsarm.
Da der überwiegende Teil der Unternehmen stark die Macht der Kunden spürt, die gerade bei Reklamationen an der fehlenden Dynamik ihrer Lieferanten verzweifeln, liegt es nahe, die Basketballprinzipien auf ihre Anwendbarkeit in den Firmen zu untersuchen.
In diesem Zusammenhang darf allerdings nicht vergessen werden, dass das vertikale Organisationssystem der Unternehmensleitung die Arbeit erleichtert. Die hat immerhin zwei vollkommen unterschiedliche Kundengruppen zu befriedigen: die Kapitalgeber und die Käufer der Produkte. Fordern letztere Verlässlichkeit und Ehrlichkeit des Produktes oder der Leistung, interessiert die Kapitalgeber das Geschäftsergebnis des Unternehmens.
Die Wünsche beider Kundengruppen stehen in einem Spannungsverhältnis. Augenblicklich haben die Shareholder, besonders in börsennotierten Unternehmen, mehr Macht als Kunden. Ihr Wunsch nach attraktiver Verzinsung wiegt stärker als die Erwartung der Kunden, ein hochwertiges Produkt zu erwerben. Die Leitung eines Unternehmens wird tendenziell danach streben, ihren Anlegern Services zur wohlwollenden Prüfung der Geschäftssituation zu bieten und gleichzeitig an den Erzeugnissen zu sparen. Ein vertikaler Abteilungsaufbau erleichtert Vergleich und Planung nach Kennzahlen.
Doch ist diese Organisationsform zukunftsfähig? Ist sie wendig genug, wachsenden Kundenforderungen nach niedrigerem Preis und besserer Leistung zu entsprechen? Wie lange kann dem Druck standgehalten werden angesichts hoher Verzinsungserwartungen der Anleger?
Gehen wir davon aus, dass sich der Wert eines Unternehmens berechnet nach dem Geld, das die Kunden für seine Produkte und Dienstleistungen auf den Tisch legen. Legen wir den fairen Tauschhandel zugrunde, in dem Leistung und Gegenleistung ehrlich ausgehandelt werden.





























