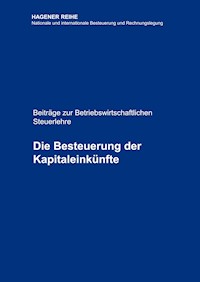
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008 wurde die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen mit der Einführung der Abgeltungsteuer grundlegend reformiert. Seither sind die Regelungen in der Praxis, der Wissenschaft und der Politik umstritten. Die Autoren untersuchen, ob und wenn ja welche Aspekte des aktuellen Steuerregimes für Steuerpflichtige in einem "gerechtigkeitswidrigen" Sinne problematisch sein können. Weiterhin unterziehen sie die aktuelle Rechtslage unter Einbeziehung der Rechtsprechung sowie der Verwaltungsauffassung einer gründlichen Würdigung und leiten Handlungsempfehlungen ab. Dies erfolgt zum einen aus einer grundsätzlichen Perspektive und zum anderen unternehmens- bzw. unternehmer¬bezogen aus der Sicht der GmbH-Gesellschafter.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 70
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Im Zuge der Unternehmensteuerreform 2008 wurde die Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen mit der Einführung der Abgeltungsteuer grundlegend reformiert.
Seither wurden die relevanten Normen durch den Gesetzgeber mehrfach modifiziert, ihre Anwendung wurde durch die Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen konkretisiert.
Dennoch ist die Besteuerung der Kapitalerträge in der Praxis, der Wissenschaft und der Politik umstritten. Dies zeigte sich insbesondere im Vorfeld der Bundestagswahl im Jahre 2017: Vertreter aller Parteien kündigten entsprechende Reformabsichten an. Vor diesem Hintergrund sichteten die Autoren die Wahlprogramme der Parteien. Kritisch angeführt wurden vor allem Gerechtigkeitsaspekte, ohne dass eine Konkretisierung erfolgte. Das Gleiche gilt, abgesehen von einer Ausnahme, für konkrete Reformansätze.
Dies nahmen die Autoren zum Anlass, zu untersuchen, ob und wenn ja welche Aspekte des aktuellen Steuerregimes für Steuerpflichtige in einem „gerechtigkeitswidrigen“ Sinne problematisch sein können.
Im Verlauf des Jahres 2018 zeichnete sich ab, dass, entgegen der im Koalitionsvertrag von den Regierungsparteien verlautbarten Absicht, auf Sicht keine gesetzgeberischen Aktivitäten zur Reform der Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen zu erwarten sind. Aus diesem Grund unterzogen die Autoren die aktuelle Rechtslage unter Einbeziehung der Rechtsprechung sowie der Verwaltungsauffassung einer gründlichen Würdigung und leiteten Handlungsempfehlungen ab. Dies erfolgte zum einen aus einer grundsätzlichen Perspektive und zum anderen unternehmens- bzw. unternehmerbezogen aus der Sicht der GmbH-Gesellschafter.
Für die vielen Diskussionen in ihrem wissenschaftlichen und politischen Umfeld bedanken sich die Autoren herzlich.
Unser Dank für die Durchsicht des Manuskriptes gilt Herrn Benjamin Alexander Schröder, B. Sc.
Solingen, im November 2018
Selden Peter Schröder
Kathrin Krüger
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Selden Peter Schröder / Kathrin Krüger
Die Abgeltungsteuer des § 32d EStG: Gerechtigkeitslücke - ubi es?
Kathrin Krüger / Selden Peter Schröder
Grundsätzliches zur Besteuerung der Einkünfte aus Kapitalvermögen - Aktuelle Rechtslage, anhängige Verfahren und Handlungsempfehlungen
Selden Peter Schröder / Kathrin Krüger
Besonderheiten der Besteuerung des GmbH-Gesellschafters unter Berücksichtigung von Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung
Selden Peter Schröder Kathrin Krüger
Die Abgeltungsteuer des § 32d EStG: Gerechtigkeitslücke - ubi es?
Prof. Dr. Selden Peter Schröder, Dipl.-Kfm. Dipl.-Ing., Professor für Steuern und Rechnungswesen Prof. Dr. Kathrin Krüger, Dipl.-Kff., Professorin für Steuern und Rechnungswesen
Die Abgeltungsteuer des § 32d EStG: Gerechtigkeitslücke - ubi es?
Die Abgeltungsteuer wurde im Rahmen der Unternehmensteuerreform 20081 zum 1.1.2009 eingeführt. § 32d EStG regelt seither die Besteuerung der Kapitaleinkünfte – und zwar mit einem einheitlichen Steuersatz von 25 %2. Die Steuerschuld ist damit abgegolten, eine Einbeziehung in die Veranlagung ist regelmäßig nicht erforderlich. In den vergangenen Jahren wurde vielfach die Abschaffung dieses gesonderten Tarifs gefordert. Begründet wird diese Forderung mit der (ungerechtfertigten) Vorteilhaftigkeit der Besteuerung von Kapitaleinkünften gegenüber den Einkünften aus anderen Einkunftsarten, insbesondere denen aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 EStG. Das Ziel dieses Beitrags ist es, zu untersuchen, inwieweit tatsächlich eine Grundlage für die Diagnose einer Gerechtigkeitslücke durch die Anwendung des Abgeltungsteuertarifs auf die Einkünfte aus Kapitalvermögen gegeben ist. Dazu wird ein Vergleich der Steuerbelastung durch die Abgeltungsteuer und der Besteuerung mit dem Regelsteuersatz des § 32a EStG durchgeführt. Hierbei wird der gesamte Bereich der relevanten Einkommensteuersätze berücksichtigt. Dadurch wird eine differenzierte Bewertung der Thematik ermöglicht. Die Frage, ob eine ungleiche Besteuerung tatsächlich eine Gerechtigkeitslücke darstellt, soll nicht thematisiert werden.
Einleitung
Methodik
Einführung der Abgeltungsteuer
Funktionsweise der Abgeltungsteuer
Die Suche nach der Gerechtigkeitslücke
Fazit und Ausblick
1 Einleitung
Anders als andere Einkunftsarten werden Einkünfte aus Kapitalvermögen derzeit regelmäßig nicht mit dem Einkommensteuertarif des § 32a EStG, im weiteren Verlauf der Untersuchung auch als Regelbesteuerung bezeichnet, sondern mit dem in § 32d EStG verankerten Abgeltungsteuersatz in Höhe von 25 % besteuert. Dies führt immer wieder zu der Kritik, Einkünfte aus Kapitalvermögen seien hinsichtlich ihrer Besteuerung privilegiert, würden doch insbesondere Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit mit einem Steuersatz von bis zu 45 % besteuert.
In welchen Fällen tatsächlich eine Besserstellung der Kapitaleinkünfte gegenüber anderen Einkunftsarten gegeben ist, wird im Folgenden untersucht. Hierzu werden unter der Berücksichtigung der jeweils relevanten Steuersätze Steuerbelastungsvergleiche durchgeführt. In die Untersuchung einbezogen werden laufende Einkünfte aus Kapitalvermögen. Hierzu zählen zum einen Zinsen, zum anderen Dividenden und Gewinnanteile aus GmbH-Beteiligungen, d. h. Ausschüttungen von Kapitalgesellschaften an ihre Gesellschafter. Die Besteuerung anderer Einkünfte, wie beispielsweise die der Veräußerungsgewinne, ist nicht Gegenstand dieses Beitrags.
2 Methodik
Für die Durchführung von Steuerbelastungsvergleichen ist in Abhängigkeit von den Fragestellungen auf unterschiedliche Steuersätze zurückzugreifen. In der Literatur werden regelmäßig der Durchschnittssteuersatz, der Differenzsteuersatz sowie der Grenzsteuersatz unterschieden3.
Der Durchschnittssteuersatz als Quotient aus Steuerschuld und Steuerbemessungsgrundlage gibt an, mit welchem Steuersatz das gesamte zu versteuernde Einkommen eines Steuerpflichtigen belastet ist4.
Anhand des Differenzsteuersatzes ist eine Beurteilung der steuerlichen Belastung einer bestimmten Einkommenserhöhung möglich. Definiert ist der Differenzsteuersatz als das Verhältnis von Steuerdifferenz und Bemessungsgrundlagenerhöhung5. Er ist im Rahmen des vorliegenden Beitrags beispielsweise dann anzuwenden, wenn die einkommensteuerliche Belastung ausschließlich der zusätzlich zum übrigen zu versteuernden Einkommen erzielten Einkünfte aus Kapitalvermögen zu untersuchen und unter den formulierten Zielsetzungen zu beurteilen ist.
Der Grenzsteuersatz zeigt die steuerliche Belastung einer marginalen Einkommenserhöhung auf. Mathematisch entspricht er der ersten Ableitung der jeweiligen Tariffunktion des § 32a EStG nach der Bemessungsgrundlage6. Im Rahmen dieser Untersuchung ist der Grenzsteuersatz als Untergrenze des entscheidungsrelevanten Differenzsteuersatzes von Bedeutung.
3 Einführung der Abgeltungsteuer
Bis zum Zeitpunkt der Einführung der Abgeltungsteuer für Kapitalerträge wurden diese steuerlich unterschiedlich behandelt. Zinsen unterlagen der Regelbesteuerung des § 32a EStG, mithin einem maximalen Einkommensteuersatz von 45 %. Für Dividenden und GmbH-Gewinnanteile war das Halbeinkünfteverfahren anzuwenden, nach dem diese Kapitaleinkünfte zur Hälfte mit dem einkommensteuerlichen Regelsteuersatz, d. h. mit maximal 22,5 %, belastet wurden7. Unter der Berücksichtigung der Vorbelastung dieser Einkünfte auf der Ebene der Gesellschaft durch Körperschaftsteuer i. H. v. damals 25 % und Gewerbesteuer lag die maximale Steuerbelastung für Dividenden und GmbH-Gewinnanteile im Jahr 2007 deutlich über 50 %8.
Die Abgeltungssteuer in ihrer heutigen Form entstand im Rahmen des Unternehmensteuerreformgesetzes 2008. Ziele dieser Steuerreform waren „(…) die längerfristige Sicherung des deutschen Steuersubstrats“9 sowie eine rechtsformneutrale Besteuerung10. Unternehmen und private Haushalte sollten durch gezielte Maßnahmen davon abgehalten werden, „(…) ihre in Deutschland erwirtschafteten Erträge (…) ins niedriger besteuerte Ausland zu verlagern [… bzw. …] Kapital ins Ausland [zu transferieren], um der Besteuerung in Deutschland auszuweichen.“11 Zur Umsetzung dieser Ziele wurden neben der Einführung der Abgeltungsteuer auch die Senkung des Körperschaftsteuersatzes von 25 % auf 15 % beschlossen12.
4 Funktionsweise der Abgeltungsteuer
Die Abgeltungsteuer ist für die in § 20 Absätze 1, 2 und 3 EStG genannten Einkünfte aus Kapitalvermögen anzuwenden. Hierzu zählen insbesondere die Gewinnanteile aus Aktien (Dividenden) und Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie Zinsen.
Die Abgeltungsteuer in der Form einer Quellensteuer beträgt nach § 32d Abs. 1 Satz 1 EStG einheitlich 25 %. Die Besteuerung der Einkünfte ist damit abgegolten. Eine Einbeziehung in die einkommensteuerliche Veranlagung und damit eine Besteuerung mit dem persönlichen Steuersatz des § 32a EStG erfolgt gem. § 32d Abs. 6 EStG nur dann, wenn der Steuerpflichtige dies beantragt. Das Finanzamt hat sodann eine Günstigerprüfung durchzuführen, indem die nach § 20 EStG ermittelten Kapitaleinkünfte in die Veranlagung einbezogen und - soweit dies zu einer niedrigeren Einkommensteuer führt - der tariflichen Einkommensteuer unterworfen werden.
Für Einkünfte aus Kapitalvermögen werden der Verlustausgleich und der Verlustabzug durch § 20 Abs. 6 EStG eingeschränkt. So können Verluste aus Kapitalvermögen nicht mit Einkünften aus anderen Einkunftsarten ausgeglichen werden. Sie dürfen auch nicht nach § 10d EStG in vorhergehende Veranlagungszeiträume zurückgetragen, sondern lediglich vorgetragen und mit zukünftigen Einkünften ihrer Einkunftsart verrechnet werden.
Der Abzug von Werbungskosten von den Einkünften aus Kapitalvermögen beschränkt sich gem. § 20 Abs. 9 EStG auf den Sparer-Pauschbetrag in Höhe von 801 . bzw. 1.602 . bei zusammenveranlagten Ehegatten. Der Abzug tatsächlich angefallener, über diese Beträge hinausgehender Werbungskosten ist ausgeschlossen.
Soweit Einkünfte nach § 20 Absätze 1, 2, und 3 EStG zu Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbständiger Arbeit oder Vermietung und Verpachtung gehören, sind sie nach § 20 Abs. 8 EStG diesen zuzuordnen. Der Tarif des § 32d EStG ist in diesem Fall nicht anzuwenden.
Auch wird der Abgeltungsteuertarif durch § 32d Abs. 2 Nr. 1 EStG u. a. für Zinsen im Sinne des § 20 Abs. 1 Nummer 7 EStG insbesondere dann ausgeschlossen,
wenn Gläubiger und Schuldner der Zinsen einander nahestehende Personen sind und die den Kapitalerträgen entsprechenden Aufwendungen beim Schuldner Betriebsausgaben oder Werbungskosten im Zusammenhang mit Einkünften sind, die der inländischen Besteuerung unterliegen,
wenn die Zinsen von einer Kapitalgesellschaft an einen Anteilseigner oder an eine diesem nahestehende Person gezahlt werden, die zu mindestens 10 % an der Gesellschaft beteiligt sind oder





























