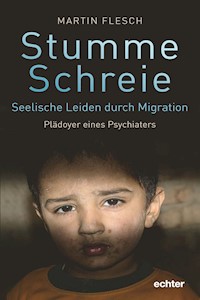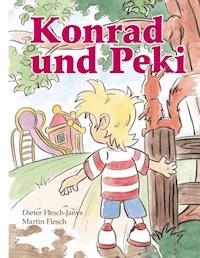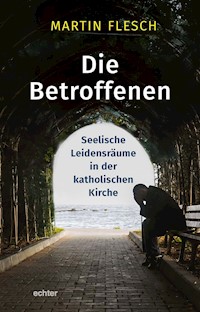
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Echter
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Analyse der missbräuchlichen Strukturen in der Katholischen Kirche lenkt derzeit den Fokus hauptsächlich auf sexuellen Missbrauch, der durch Mitglieder der Institution verschuldet wurde. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch in erschreckendem Ausmaß, dass ein ganzes Spektrum von Leidensräumen existiert, die sich auf vielfältigen Ebenen ausdrücken und nahezu alle kirchlichen Bereiche betreffen. Es ist deshalb Zeit, dass die Betroffenen zu Wort kommen. In diesem Buch beschreiben Missbrauchsopfer ihre Schamverletzung, ihr oft bodenloses Leiden und die Auslöschung ihrer seelischen Strukturen. Es nimmt die Täterpersönlichkeiten aber analytisch ebenso in den Blick wie die Betroffenen selbst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Flesch
Die BETROFFENEN
Martin Flesch
Die BETROFFENEN
Seelische Leidensräumein der katholischen Kirche
Gewidmet
Johannes
David
Elias
Mirijam
– meinen Kindern, die mich einenHumanismusjenseits der Kirche lehren –
– und denen ich selbstdie allgegenwärtigen Spurendes Universalen Christus vermittele –
Der Umwelt zuliebe verzichten wir bei diesem Buch auf Folienverpackung.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
1. Auflage 2022
© 2022 Echter Verlag GmbH, Würzburg
www.echter.de
Umschlag: wunderlichundweigand.de
Umschlagbild: © hikrcn / shutterstock.com
Innengestaltung: Crossmediabureau, Gerolzhofen
E-Book-Herstellung und Auslieferung: Brockhaus Commission, Kornwestheim, www.brocom.de
ISBN
978-3-429-05791-6
978-3-429-05230-0 (PDF)
978-3-429-06583-6 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Unverfügbar:
PROLOG
Ein Mann ging nach Jericho …
I. ERSTER TEIL
Zum Raum wird hier die Zeit –die narzisstische Urkonstellation
II. Zweiter TEIL
LeidensRÄUME –eine Chronik
GEORG (39 Jahre)
DIE EINSAMEN –Austritt als Prävention?
Fluchträume I –Depression und Zwang
REBEKKA (49 Jahre)
DIE ÜBERSEHENEN –verhinderte Berufung …
Fluchträume II –der Weg in die Erschöpfungsdepression
JONAS (35 Jahre)
DIE ENTRECHTETEN –Arbeit contra Leben?
Fluchträume III –die Angst vor der Angst
RUTH (33 Jahre)
DIE INDOKTRINIERTEN –Statuten als Machtoption?
Fluchträume IV –der geistliche Missbrauch
STEPHAN (63 Jahre)
DIE BESCHULDIGTEN –Instrumentalisierte Sündenböcke?
Fluchträume V –„ist der Ruf erst ruiniert ….“
KERSTIN (38 Jahre)
DIE ELENDEN –eine Chronik des Leidens
Fluchträume VI –bis hin zum Seelenmord
FRANZ-LUDWIG (29 Jahre)
DIE „ANDERS“-ORIENTIERTEN –Dämonisierung sexueller Präferenz?
Fluchträume VII –„anders“ ist nicht krank!
Judith (54 Jahre)
DIE UNSICHTBAREN –Krankheit als Makel?
Fluchträume VIII –Isolation …
Michael (40 Jahre)
DIE VERRATENEN –die Hölle nach dem Sturm
Fluchträume IX –die Enteignung vom ICH
KATHARINA (51 Jahre)
DIE GETRENNTEN –Manipulation eines Versprechens?
Fluchträume X –Pathologisierung der Ehe?
GERHARD (34 Jahre)
DIE BEGLEITETEN –indoktrinierte Orientierungssuche?
Fluchträume XI –in Abhängigkeitsverhältnissen
Marie-Luise (66 Jahre)
DIE UNGEHORSAMEN –Barmherzigkeit … Sanktionierungsanlass?
Fluchträume XII –Rückzug als Ausweg …
III. Dritter TEIL
SpielRÄUME –die Wahrheit wird Euch freimachen!
IV. EPILOG
Ein Mann kam aus Jericho …
LITERATUR & ANMERKUNGEN
Vorwort
WIR
Menschen jeglicher Herkunft, jeden Alters und Geschlechts kommunizieren stetig miteinander. Unsere Kommunikationsmuster bilden einen Teil unseres Persönlichkeitsprofils ab, wir wollen beachtet, angenommen und wertgeschätzt werden. Unsere narzisstischen Grundbedürfnisse sind Ausdruck unseres Sprechens und Handelns, oftmals unbewusst. In den verschiedensten Begegnungen leben wir unsere narzisstischen Grundmuster aus, das schafft Abhängigkeiten vielfältiger und komplexer Art. Aus den Abhängigkeiten entstehen wiederum Machtgefälle, ob wir dem zustimmen oder nicht.
Machtgefälle können zielführend, heilsam und stabilisierend wirken, insofern sie sich im Rahmen unserer Kommunikationsstile für alle Beteiligten in Akzeptanz auflösen. Im Falle der Entstehung narzisstischer Ungleichgewichte kann ein manipulativer und missbräuchlicher Einsatz von Machtinstrumentarien wirksam werden – insbesondere dann, wenn die freie Selbstentfaltung und Selbstbestimmung des Gegenübers eingeschränkt, erdrückt oder eliminiert wird. Die hier ablaufenden dynamischen Prozesse sind subtil, sensibel, sehr vielschichtig und oftmals unbewusst – jedoch äußerst wirkmächtig. Diese können auf der emotionalen, verbalen oder auf der körperlichen Ebene zum Einsatz kommen – dann sprechen wir von emotionalem, geistigem oder körperlichem Missbrauch.
Missbräuchlich instrumentalisierte Abhängigkeiten in Beziehungsgefügen überschreiten in der Regel auch Schamgrenzen und führen zu Leidensstrukturen, die die Integrität unserer Seele bedrohen. Im Extremfall folgt daraus eine Traumatisierung, eine Abtötung seelischer Strukturen, manchmal auch ein Suizid.
Die Analyse der missbräuchlichen Strukturen in der katholischen Kirche aus mindestens 70 zurückliegenden Jahren lenkt derzeit den Fokus hauptsächlich auf durch Mitglieder der Kirche verschuldeten sexuellen Missbrauch. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch bedauerlicherweise in einem erschreckenden Ausmaß, dass wir es mit einem ganzen Spektrum von Leidensräumen zu tun haben, die sich auf vielfältigen Ebenen ausdrücken und auch nahezu alle Bereiche kirchlicher Bewegungszweige und Einflussbereiche betreffen.
Eingeschliffene narzisstische Strukturen in der Kirche führen zu Ungleichgewichten und Machtgefällen in Kommunikationsund Handlungsstrukturen. Oft mangelt es an Empathiefähigkeit, Barmherzigkeit, Achtung, Wertschätzung – und insbesondere der Fähigkeit zum Perspektivenwechsel.
Wir neigen im Rahmen der Identifizierung und Analyse von widrigen Strukturen stets zunächst zur Benennung von systemischen Fehlern und Ursachen sowie von dysfunktionalen Mustern und geschlossenen Einheiten. Das ist zwar immer auch hilfreich im Rahmen der Benennung von größer ausgespannten Handlungsbögen und präventiver Erörterungen.
JEDOCH:
Konkreter Missbrauch entsteht in der Regel nahezu ausschließlich auf der konkreten Handlungsebene von kommunizierenden oder agierenden Partnern, jeweils eingebettet in ganz spezifische und die missbräuchlichen Strukturen fördernde oder fixierende Situationskonstellationen. Die ganz persönliche Erfahrung von missbräuchlichen Kommunikations- und Handlungsstilen auf der emotionalen Ebene führt zu ganz persönlichen Schamverletzungen, Traumatisierungen und seelischen und psychischen Leiden. Im Extremfall stirbt das seelische Gefüge, dann sprechen wir von Seelenmord.
Nur die BETROFFENEN selbst können das Ausmaß der ihnen zugefügten seelischen Schmerzen, Traumata und Langzeitfolgewirkungen erfahren, spüren, erleiden und durch Erfahrungsberichte qualifizieren und quantifizieren. Noch immer wird ihnen im Rahmen der sogenannten Aufarbeitungsprozesse der Katholischen Kirche nicht ausreichend zugehört, obwohl sie doch eine eindeutige Botschaft an die konkreten Adressaten aussenden – pausenlos, mittlerweile desillusioniert und erschöpft.
Es ist mehr als Zeit, dass wir den so BETROFFENEN und Leidenden endlich unsere volle Aufmerksamkeit zuwenden, und tatsächlich auch hören wollen, was sie uns, mit ihrer direkten und auch indirekten Botschaft, tatsächlich zu sagen haben und vermitteln wollen. Auf die Fähigkeit, das Gehörte erfassen zu können und auch auf die Motivation, tatsächlich und intensiv zuhören zu wollen, kommt es letztlich an, wenn wir die Botschaften in ihrem Bedeutungsgehalt verstehen möchten.
In diesem Buch kommen daher BETROFFENE zu Wort, im Zentrum steht ihre Schamverletzung, ihr oft bodenloses seelisches Leiden, die Auslöschung ihrer seelischen Strukturen.
Das Buch widmet sich aber auch den komplexen Beziehungsstrukturen von Missbrauchskonstellationen, es nimmt die sogenannten Beschuldigten oder Täterpersönlichkeiten ebenso in den Blick wie die Betroffenen selbst. Denn auch Handelnde und seelisches Leid Verursachende sind oftmals selbst auch BETROFFENE. Dieser Komplexität kann nicht genug Aufmerksamkeit gewidmet werden, insofern man Missbrauch nicht nur makroskopisch, sondern eben gerade im mikroskopischen Bereich beleuchten will und muss. Ein langfristiger Opferschutz kann nur dann zielführend gelingen, wenn wir uns der Hinwendung zu tätlich werdenden Persönlichkeiten im Sinne einer analysierenden und fallbezogenen Täterarbeit nicht verschließen.
Der Autor dieses Buches berührte nun in den zurückliegenden 20 Jahren seiner beruflichen Praxis – sowohl auf Basis seiner leitenden Verantwortung einer forensisch psychiatrischen Klinik als auch im Rahmen seiner gutachterlichen Erfahrung in eigener Praxis – eine Vielzahl von Schnitt- und Handlungsfeldern der katholischen Kirche, aus welcher sowohl zahlreiche Begutachtungen von Priestern, Ordensmitgliedern, Beschuldigten, Verdächtigten, rechtlich bereits Verurteilten und auch Betroffenen hervorgingen wie auch deren längere psychotherapeutische Begleitung in indizierten Fällen.
Die in diesem Buch zum Ausdruck kommenden anonymisierten Leidensgeschichten der Betroffenen beziehen sich somit auf vielfältige Ebenen kirchlicher Strukturen, identifizieren deren missbräuchlichen Charakter und verleihen vor allem den einzelnen Betroffenen eine ganz konkrete Stimme.
Vor allem ihnen, den BETROFFENEN selbst, gilt mein ganz besonderer Dank, für ihre Öffnung, ihre uneingeschränkte Bereitschaft, ihre Geschichte anonymisiert zur Verfügung zu stellen, ihren Mut, Wahrheiten zu benennen und tatsächlich Geschehenes aufzuzeigen.
Ich habe in den zurückliegenden Jahren mit zahlreichen BETROFFENEN gutachterliche Gespräche geführt, viele von ihnen auch psychotherapeutisch begleitet und ihre Anliegen und seelischen Wunden aufgenommen und verschriftlicht. Sie vertreten die einzelnen Bereiche und Ebenen, die Kirche prägen und gestalten.
Auf dieser Basis entstanden zwölf Fallgeschichten, die uns durch das Buch begleiten werden. Aus diesen Narrativen sprechen die Situationsentwicklungen und Missbrauchskonstellationen, die zu konkreten Momenten des seelischen Leidens führen, und letztlich auch die Versuche, unter Rückgewinnung eines gewissen Maßes an Heilung, Stabilität und Hoffnung aus diesen zu entkommen.
Es bleibt dennoch eine Chronik des Leidens.
Die Auseinandersetzung mit diesen komplexen und vielschichtigen Strukturen erfordert Energie, Motivation und Kraft – insbesondere jedoch Kontinuität in dem Bestreben, das Ziel dieser Veröffentlichung nicht aus dem Auge zu verlieren und konsequent diesen Weg zu gehen.
Ich verdanke das Gelingen dieses Projektes einer Vielzahl von Menschen und Persönlichkeiten, die mich anhaltend motivierten, berieten und unterstützten, vor allem jedoch ermutigten, mit diesem Wissen anonymisiert an die Öffentlichkeit zu treten. Sie bestärkten in mir das Gefühl, verpflichtet zu sein, den oft unaussprechlichen seelischen Leiden in anonymisierter, jedoch konkretisierter Form eine deutlich hörbare Stimme zu verleihen.
Ohne die fortwährende emotionale, geistige und spirituelle Unterstützung meiner Frau Ines-Constanze wäre dieses Vorhaben nicht umsetzbar gewesen. Ihr gilt meine große Dankbarkeit, ebenso wie auch meinen Kindern, welche der hier aufgeworfenen Thematik durch kontrovers geführte Diskussionen und Statements eine besondere Färbung verliehen.
Würzburg, den 24. April 2022am Fest der Barmherzigkeit
Dr. med. Martin Flesch
Facharzt für Psychiatrie und PsychotherapieSchwerpunkt Forensische Psychiatrie
Gutachterliche Praxis für Begutachtungenim Straf-, Zivil-, Sozial-, Asyl- und Kirchenrecht
Unverfügbar:
Die christliche Identitätspeist sich aus der Verknüpfungvon Selbst-, Nächsten- und Gottesliebe,von heilsamer Gottesbeziehungund solidarischer Menschenbeziehung.
Ottmar Fuchs1
PROLOG
Ein Mann ging nach Jericho …
Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinabund wurde von Räubern überfallen.Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder;dann gingen sie weg undließen ihn halbtot liegen.
Zufällig kam ein Priesterdenselben Weg hinab;er sah ihn –und ging weiter.
Auch ein Levit kam zu der Stelle;er sah ihn –und ging weiter.
Dann kamein Mann aus Samarien,der auf der Reise war.
Als dieser ihn sah,hatte er Mitleid,ging zu ihm hin,goß Öl und Wein auf seine Wundenund verband sie.
Dann hob er ihnauf sein Reittier,brachte ihn zu einer Herbergeund sorgte für ihn.
Am anderen Morgenholte er zwei Denare hervor,gab sie dem Wirtund sagte:
„Sorge für ihn,und wenn du mehr für ihn brauchst,werde ich es dir bezahlen,wenn ich wiederkomme.“2
I.ERSTER TEIL
Zum Raum wird hier die Zeit –die narzisstische Urkonstellation
Betroffenheit ist relativierbar
In diesem Buch erheben BETROFFENE ihre Stimme – in ihrer vielfältigen Erscheinungsform.
Betroffenheit … Ein oftmals funktionalisierter Begriff. Im Zusammenhang mit den widrigen Entwicklungen in kirchlichen Strukturen bekommt dieser Begriff einen ambivalenten und dualen Charakter. Beleuchtet werden dabei zwei Seiten eines dynamischen Vorgangs.
Funktionsträger in der Kirche bekunden in diesen Zeiten an allen Orten, sie seien von den Vorgängen des Missbrauchs, die gegenwärtig in ihr Bewusstsein dringen, betroffen. Erhebliche Schattierungen werden hier geäußert: Von „betroffen“, bis „erheblich betroffen“, bis „erschüttert“ ist zu lesen und zu hören, wobei in der Regel kaum zu erkennen ist, worin diese Betroffenheit eigentlich besteht. Einerseits!
Andererseits geraten auf dieser Wahrnehmungsebene Menschen in den Fokus, die zwar ebenfalls als BETROFFENE attribuiert werden, doch geht es bei dieser so gemeinten Äußerung um ungleich mehr, nämlich um existenziell ausgerichtete und die Seele erschütternde Betroffenheit.
Dass dieser zuletzt genannte Status des Betroffenseins weit über die anfangs genannte Ebene hinausgeht, dabei den tatsächlich BETROFFENEN auch einen Opferstatus verleiht, wird in der Regel tendenziell und in konstanter Regelmäßigkeit von beiden Seiten der Wahrnehmenden gerne vermieden und so auch nicht verbalisiert.
Woher rührt dieses Verhalten?
Ist es die Scham, die uns verbietet, Geschehenes beim Namen zu nennen? Sind es Schuldkomplexe, Verdrängungsmechanismen, oder spielen hier gar Negativismen und Verleugnungsaspekte eine Rolle? Dies trifft sicherlich anteilig zu, aber auch diese Mechanismen besitzen einen Ursprung.
Könnte es sich beispielsweise nicht auch derart verhalten, dass narzisstisch intendierte Beweggründe uns nicht gestatten, zum rechten Zeitpunkt das Richtige zur Darstellung zu bringen – nämlich die Wahrheit?
Um die dynamischen Hintergründe dieser Hypothese besser zu verstehen, bedarf es der Beschreitung einiger Bahnen in das Zentrum des Narzissmus, sich auf den Brennpunkt narzisstischer Urkonstellationen zuzubewegen:
Im Zentrum des Brennglases
Meine therapeutische und gutachterliche Tätigkeit mit den sogenannten BETROFFENEN innerhalb kirchlicher Strukturen in den zurückliegenden 25 Jahren verdeutlicht mir eine vielfältige Problemkonstellationen in der Kirche umspannende, wegweisende Erkenntnis: Missbräuchliche Strukturen erwachsen aus narzisstischen Urkonstellationen und -konflikten.
Bevor wir uns den Fallgeschichten der so BETROFFENEN zuwenden, bedarf es zunächst eines Exkurses, in das Innere gesellschaftlicher Strukturen, aber auch in das Innere von uns selbst. In diesem Zusammenhang ist es nicht unbedeutend, dass gerade das Oberhaupt der Katholischen Kirche, Papst Franziskus, wieder und wieder sowohl auf die narzisstischen Strukturen unserer Systeme, aber eben auch auf unseren eigenen Narzissmus hinweist, als Impulsgeber, als Motor und Basis krisenhafter Entwicklungen in Kirche und Religionsgemeinschaften.3
Aus fachpsychiatrischer, aber auch aus soziologischer Sicht ist mittlerweile unbestritten, dass die an zahlreichen Faktoren zu beobachtende Zunahme des Narzissmus in den zurückliegenden Jahrzehnten mitverantwortlich ist für die steigende Kränkbarkeit moderner gesellschaftlicher Strukturen. Die Analyse zahlreicher Studien belegt ein rasantes und quantitatives Ansteigen der sogenannten Narzissmusparameter.4 Um hier nur einige zu nennen, dürfte es sicherlich hinreichend bekannt sein, dass der ausufernde Kapitalismus, die darauf folgenden Finanzcrashs (auf Basis narzisstischer brüchiger und nicht immer tatsächlich existenter Strukturen), die stetige Vergrößerung der Armutsschere und die unaufhaltsame Zerstörung des globalisierten Lebensraumes der kommenden Generationen zunehmend mehr salonfähig werden. Fatal ist in jedem Falle, dass sich der Narzissmus gesellschaftlich zunächst etabliert hat, dann idealisiert wurde und gegenwärtig als demokratisiertes Phänomen zu betrachten ist. Dagegen traten die für die gesellschaftliche Stabilität unerlässlichen „Tugenden“, wie Demut und Bescheidenheit, Barmherzigkeit und Empathiefähigkeit zunehmend zugunsten eines rasant anwachsenden Bestrebens, sich selbst zu verwirklichen in den Hintergrund.
Das Maß der narzisstischen Durchdringung kann an dem Anstieg kollektiver Kränkung gemessen werden, auf Basis einer stetig zunehmenden Verletzlichkeit bei gleichzeitiger Abwertung anderer Individuen.
Narzissmus in seiner ureigensten Form
Eine der eingängigsten Definitionen von Narzissmus kann von Alexander Lowen (dem Begründer der Bioenergetischen Analyse) abgeleitet werden, welcher in einem seiner Hauptwerke „Narzissmus – die Verleugnung des wahren Selbst“ zu dem Schluss kommt: „Als Narzissmus bezeichnen wir sowohl einen psychischen als auch einen kulturellen Zustand. Auf der individuellen Ebene bezeichnet er eine Persönlichkeitsstörung, die durch eine übertriebene Pflege des eigenen Images auf Kosten des Selbst gekennzeichnet ist. Auf der kulturellen Ebene kann man den Narzissmus an einem Verlust menschlicher Werte erkennen, an einem Fehlen des Interesses an der Umwelt, den Mitmenschen, an der Lebensqualität.“5
Papst Franziskus hat kurz vor seiner Wahl im Konklave den Narzissmus für die anhaltende Krise der Kirche und der Religionsgemeinschaften verantwortlich gemacht – als Priester und Kardinal, nicht als Psychologe, Psychopathologe oder Psychiater.
Die wichtigsten Elemente, welche die Strukturen des Narzissmus charakterisieren, sind Egozentrik, Empfindlichkeit, Entwertung anderer, Empathiemangel, Eigensucht und die oft ausbleibende Fähigkeit zum Perspektivenwechsel. Beherrscht der Narzissmus die gesamte Persönlichkeitsstruktur, aus welcher sich sodann die ins Krankhafte verschobenen Denk- und Handlungsmuster ableiten, sprechen wir von pathologischem Narzissmus.
Aber auch im Rahmen gemäßigterer Ausprägungen wirkt der narzisstisch denkende und handelnde Mensch auf seine unmittelbare Umwelt – andere Personen haben für ihn kaum einen Wert, es sei denn, sie dienen seinen eigenen Interessen, nur für seine eigene Persönlichkeit kann er sich begeistern – er ist letztlich im Denken, Fühlen und Wahrnehmen auf sich konzentriert und ausgerichtet.
Der Theologe Karl Rahner beschrieb „den Narzissten“ als „Ofen, der nur sich selbst wärmt“. Dabei steht häufig jedoch weniger das „In-sich-selbst-Verliebtsein“ im Vordergrund (wie der Volksmund meist argumentiert), sondern das gewaltige Defizit an Liebes- und Empathiemangel überhaupt. Tatsächlich liebt der Narzisst auch sich selbst in keinster Weise. Sind ihm doch die authentischen Gefühle von Freude, Trauer, echtem Mitleid und Liebe in Wirklichkeit fremd. Besonders folgenreich wirkt sich dabei die unzureichend ausgebildete Fähigkeit aus, sich in die Bedürfnisse und Belange anderer hineinversetzen zu können. Seine Aufmerksamkeit bleibt durch sein Bestreben nach Anerkennung und Wertschätzung gebunden. Daraus resultiert eine von Fassade und Oberflächlichkeit geprägte Seinsstruktur, oder eben ein „Doppelleben“, wobei die eigentliche Not und Bedürftigkeit des Narzissten in der Regel im Tieferen verborgen bleiben.
Narzisstisches Denken und Fühlen fürchtet nichts so sehr wie die subjektiv gefühlte Kränkung. Die Kränkung stellt auf dieser Grundlage eine persönliche Niederlage dar. Infolgedessen gilt es, dem eigenen, von Geltungsbestreben getriebenen Ego, wieder Überlegenheit zu verschaffen, um derart die vormaligen Verhältnisse der Selbstbehauptung wieder herzustellen.
Für nahezu sämtliche Beziehungskonstellationen bedeutet ein narzisstisch geleitetes Kränkungsbewusstsein, dass sie in der Regel von einem zerstörerisch wirkenden Machtgefälle heimgesucht werden. Echte und kongruente Beziehungen können auf dieser Ebene nicht gelebt und gestaltet werden.
Im ungünstigen Fall vermischen sich auf dieser Basis Emotionsmangel, Kränkungspotenzial und erheblicher Empathiemangel zu einer gefährlichen Ansammlung von Persönlichkeitsfaktoren, die im Falle ihres Ausagierens im Sinne einer narzisstisch ausgerichteten Situationsklärung ihr Gegenüber emotional und psychisch schwer schädigen können.
Sind diese persönlichkeitsgebundenen Parameter sodann noch darüber hinaus an dissoziale Denkstile und Handlungsmuster gebunden, die auch unausgereifte und pathologische sexuelle Impulse miteinschließen, ist auch bereits der inhaltliche Bogen in Richtung einer fremdaggressiven und übergriffigen Handlungsbereitschaft gespannt, welche die emotionale und körperliche Grenzverletzung des Kommunikationspartners miteinkalkuliert.
Am Anfang von machtgeprägten Beziehungskonstellationen sowie der daraus folgenden Wahrnehmungs-, Gefühls- und Handlungsketten steht jedoch in der Regel das wirkmächtige Potenzial der narzisstisch intendierten Kränkungsbereitschaft.
Die Kränkung – das Kind des Narzissmus
Es existieren sozusagen kein Streit, kaum irgendein Konflikt und auch keine Krisen, die nicht auf konkret zu benennende Kränkungen zurückzuführen wären. Kränkungen verletzen uns Menschen zutiefst in unserem Selbstverständnis, lösen vielfältiges Leid aus, können den Menschen in Verbitterung und Unversöhnlichkeit zurücklassen und bestimmen nicht selten das Schicksal von Familien, Völkern und politischen Entwicklungen.6
Der Schatten einer Kränkung legt sich auf die Leichtigkeit des Seinszustandes und führt zu schwermütigen Existenzformen, aber auch zu Wut und Hassgefühlen sowie auch zu Rachegedanken. Kränkungen verletzen den Menschen in seinem Innersten, im Kern seiner Persönlichkeit. Wir erleben sie als „Generalangriff“ auf unser gesamtes Ich. Dann führen sie auch zu Erschütterungen, insbesondere unseres Selbst und seiner vielfältigen Werte. Auf diese Weise entsteht ein immerwährender Kreislauf, ein Circulus vitiosus, aufrechterhalten durch eine zermürbende Spirale.
Somit stehen Kränkungen fast immer am Anfang von Demütigung und Rache, von Auseinandersetzungen und daraus folgender Feindschaft, aber oft auch am Beginn von anhaltendem seelischem Leid und psychischer Krankheit. Bekanntlich ziehen sich insbesondere kollektive Kränkungen durch die gesamte menschliche Geschichte, ihre jeweilige Destruktivität bestimmte durch mannigfaltige kriegerische Auseinandersetzungen das Schicksal von Völkern und Kulturen.7 Ihre Botschaft drückt sich auch in zahlreichen künstlerischen Darstellungen aus, ohne diesen „Kränkungsstoff“ wären sicherlich auch nicht wenige Meisterwerke der Welt- und Theaterliteratur nicht denkbar.
Nur der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle vermerkt, dass das erste, am Anfang der biblischen Menschheitsgeschichte stehende Verbrechen im Alten Testament einen Brudermord darstellt, der Mord von Kain an Abel, auf dem Boden einer tiefen persönlichen Gekränktheit. In diesem Zusammenhang könnte man die Kränkung auch als das Urmotiv des Urverbrechens bezeichnen, wie der österreichische Psychiater Reinhard Haller treffend bemerkt.
Kränkungen sind jedoch in unser aller Leben universell existent und repräsentieren ein eklatantes zwischenmenschliches Problem. Sie lassen sich weder zielführend verdrängen, noch auf Dauer tabuisieren und verschonen. Auch der Tod des Menschen selbst wird von nicht wenigen als unfassbare Kränkung empfunden.
Unser alltägliches Leben bleibt häufig durchdrungen von mangelnder Wertschätzung, von psychischen Verletzungen und vielfältigen Enttäuschungen. Wenn wir uns den eigentlichen Prozess der Kränkung näher vergegenwärtigen, so bleibt es unabdingbar zu betonen, dass die Kränkung wesentlich mehr ist als nur ein negativ gefärbtes Gefühl oder ein ebensolcher Affekt. Sie besteht stets aus einer Interaktion zwischen einer kränkenden und einer gekränkten Person und dem jeweiligen Inhalt der Kränkung. Daher besitzt sie in unserer zwischenmenschlichen Kommunikation als einer der wichtigsten sozialen Mechanismen die Bedeutung einer sogenannten „psychologischen Großmacht“, welche sich weitaus stärker auswirkt als andere Affekte, wie beispielsweise Ärger oder Unzufriedenheit, und stets nachhaltiger als Zorn und Wut – aber auch folgenschwerer als Frustration und Trauer.8
Kränkungen quälen neurotisch veranlagte Menschen, sie hetzen Querulanten, ja, sie motivieren Amokläufer und Terroristen und stabilisieren die Kriegstreiber und Diktatoren.
Kränkungen haben eben aber auch ein süchtiges Potenzial, nämlich nach Macht und Machterhalt, und nach dem Verteidigungsund Besitzstreben einmal angeeigneter und überkommener Machtstrukturen. In diesem Zusammenhang zementieren sie bereits eingetretene Machtgefälle auf vielfältige Weise.
Innerhalb kirchlicher Strukturen lassen sich derart wirksame und machtbetonte Muster unter ganz verschiedenen Gewändern wiederfinden. Die dabei ins Auge fallenden Strukturen mögen wir als patriarchalisch, klerikal oder geschlechterbetont und dualistisch identifizieren, sie stehen in jedem Falle als Platzhalter für mächtig wirksame Kränkungspotenziale, die sich sicherlich nicht mehr nur anhand historisch gewachsener Strukturen ausreichend erklären lassen.
Das Bindeglied zwischen Kränkungen und Machtsuche (oder Machtsucht) ist u. a. auch darin zu suchen, dass gerade kollektive Gefühle der Kränkung, der Erniedrigung und der Scham nicht zu unterschätzende und gewaltige soziale Energien darstellen, die nicht nur zu generationsübergreifenden Feindschaften zwischen Völkern, sondern auch – was die Geschichte eindrücklich belegt – innerhalb und außerhalb geschlossener Systeme von Religionsgemeinschaften führen.
Solche Erkenntnisse sind natürlich nicht neu, wir finden sie auch bei Kirchenlehrern und anderen weitblickenden Persönlichkeiten der Kirchengeschichte. Hier wäre, um nur ein Beispiel zu nennen, auf die Mystikerin und Universalgelehrte Hildegard von Bingen hinzuweisen, insbesondere auf deren Weisheit über die krankmachende Wirkung der Kränkungen und den leidbringenden Effekt von Beleidigungen.
Neu ist auch nicht die Feststellung, dass zahlreiche psychische Störungen aus nicht überwundenen, verdrängten oder gar unbewusst gebliebenen Kränkungen resultieren, ein Umstand, der sich oft auf der Basis der sogenannten narzisstischen Wut erklären lässt.9
Unverarbeitete narzisstische Kränkungen führen oftmals zu heftigen Gefühlsreaktionen. Die Ansammlung wiederholter Kränkungsgefühle kann zu einem Aufstau von Wut- und Ärgergefühlen führen, die sich schließlich auch in das Gewand des Hasses kleiden können. Kleinigkeiten und nichtige Anlässe bringen dann Wutausbrüche, sogar auch Hasstiraden hervor. Vielen, von Kränkungserlebnissen Betroffenen, ist dann der eigentliche Bezug zu tief verwurzelten, aber dann wieder aufbrechenden Kränkungsängsten überhaupt nicht bewusst.
Der österreichische Psychiater Haller führt in seinem Band „Die Macht der Kränkung“ ganz zurecht aus, dass der Narzissmus in der Kränkungsproblematik eine absolute Sonderstellung einnehme. Keine andere psychische Störung sei derart eng mit Kränken und Gekränktsein, mit Selbsterhöhung und Entwertung anderer verbunden wie der Narzissmus.10
Die unweigerlichen Folgen sehen wir anhand anhaltender Destabilisierungen unserer Gefühlswelt, die dorthin führenden „Taten“ manifestieren sich in Beleidigungen, Scham und Beschämung, Neid, Eifersucht und schließlich auf der Ebene der tiefsten Kränkungsform, der Demütigung.
Auch ein narzisstischer Fußabdruck: der Kampf um die Legitimität von „Heilswahrheiten“
Der Soziologe Michael Ebertz führt in seinem jüngst erschienenen Werk „Entmachtung“ im Rahmen seines abschließenden und ausblickenden Schlussplädoyers an, dass kaum etwas derzeit aktive Kirchenmitglieder so ratlos und bestürzt machen dürfte wie die momentanen Konflikte im Innern und auf allen Ebenen der Kirche. Dabei seien diese Gegensätze basal und nicht banal. Sie wirkten desintegrativ, beförderten Austritts- und Distanzierungsneigungen und seien auch destruktiv, sie zerstörten zudem noch die ehedem fraglos geglaubten christlichen Wertbindungen.11
In dem Versuch, diese an vielen Orten aufleuchtende Phänomenologie soziologisch zu analysieren, fällt dabei auf, dass diese basalen Konflikte gegenwärtig öffentlich, das heißt, allgemein sichtbar und auch amtlich – sofern sich höchste kirchliche Amtsträger daran beteiligen – geführt werden. Ebertz behauptet, die Diskussionsführer könnten sich dabei unumwunden „vor aller Augen zerfleischen“.
Er spricht des Weiteren von Kirchenspaltung angesichts des permanenten Kleinkrieges kirchlicher Organisationen gegen sich selbst, der vielbeschworene Einheitskonsens sei nurmehr Fiktion. Dabei sei „Gott“ gegen „Gott“ in Stellung gebracht worden. Hierin sieht der Soziologe eine bestimmte Spielart von „Vielgötterei“, und zwar nicht nur unter den Laien mit ihrer Lebenspraxis, sondern auch in der religiösen Arbeit der kirchlichen Repräsentanten – und kommt zu dem Schluss, „Gott“ könne jedenfalls selbst unter dieser nicht mehr als gleich verstandenen Vorstellungsgröße vorausgesetzt werden. So stelle sich also die Frage, ob die offiziellen Akteure der Kirche jenseits von Glaubensformeln überhaupt noch zu einer Verständigung über den „Allerhöchsten“ und das mit ihm assoziierte Heil fähig seien. So werde immer kontroverser diskutiert, was „Gottes heiliger Wille“ sei und welche Intimbeziehungen „mit Gottes Segen“ und Heilszusage bedacht werden dürften, wie also „richtige“ katholische Religion bezüglich der unterschiedlichen Lebensgemeinschaften und Lebensformen zu praktizieren sei.
Wenn also die so skizzierten Konfliktszenarien bereits dahin führen, dass sich die Akteure im innerkirchlichen Feld wechselseitig die religiöse Legitimität absprechen, scheint der eigentliche Heilsauftrag, nämlich die Ausrichtung der an den Kasualien und deren Ausbau orientierten sowie an den Einzelpersonen und ihren Sinnfragen ausgerichteten Kirche, deutlich aus dem Fokus geraten zu sein.
Der soziologische Exkurs fügt im Rahmen seiner Deutungsanalyse dem ohnehin bereits auf dieser Basis destruktiv und desintegrativ einwirkenden Grundansatz noch einen weiteren schweren Hieb auf systemischer Ebene zu, indem kirchlich eingeforderte Machtstrukturen und Deutungshoheiten mit einem „überkommenen staatsanalogen Raumverständnis“ sowie mit „flächendeckenden Präsenzansprüchen nach Art geistlicher Polizeireviere“ gleichgesetzt werden, in denen Glaube „kontrolliert und diszipliniert“ werde, anstatt diesen „wahrhaftig“ zu ermöglichen und exemplarisch zu entfalten.
Angesprochen seien hier die sog. traditionellen Normhüter und Normsetzer im Feld der Kirche, die das Christentum als Regelwerk sähen, das zeigen solle, wo es jetzt gerade langgehen solle.
Papst Franziskus hat in seiner Predigt am 15.02.2015 im Rahmen einer Eucharistiefeier mit neu ernannten Kardinälen versucht, diese Konfliktlage symbolisch zu versprachlichen und dabei u. a. dargelegt12: „Es sind zwei Arten von Logik des Denkens und des Glaubens: die Angst, die Geretteten zu verlieren, und der Wunsch, die Verlorenen zu retten. Auch heute geschieht es manchmal, dass wir uns am Kreuzungspunkt dieser beiden Arten der Logik befinden: der Logik der Gesetzeslehrer, d. h. die Gefahr zu bannen durch Entfernen der angesteckten Personen, und der Logik Gottes, der mit seiner Barmherzigkeit den Menschen umarmt und aufnimmt, ihn wieder eingliedert und so das Böse in Gutes, die Verurteilung in Rettung und die Ausgrenzung in Verkündigung verwandelt. Diese beiden Arten der Logik durchziehen die gesamte Kette der Geschichte der Kirche: ausgrenzen und wieder eingliedern.“
Gerade die letzten Worte der hier anklingenden Botschaft zeigen deutlich auf, dass dem „Wiedereingliedern“ jedoch die „Ausgrenzung“ vorausging, und selbstredend auch die Frage, worin eben „das Böse“ im Gegensatz zum „Guten“ bestanden hatte, somit also die Frage nach der tatsächlichen Berechtigung des Ausschlusses.
Man benötigt in der gegenwärtigen krisengeschüttelten Zeit nicht viel Fantasie, um in der Legitimierungsermächtigung bestimmter Funktionsträger über die Entscheidungen von „Einschluss und Ausschluss“ oder von „Ausgrenzung und Eingrenzung“ eben jene narzisstischen Grundstrukturen zu erkennen, welche auf Basis ihrer Schieflage von durch Legitimation abgeleitetem Machtpotenzial und daraus folgender narzisstischer Kränkung die exkludierende Grenzziehung überhaupt erst ermöglichte.
„Angst essen Seele auf“ – der Sündenbockmechanismus
Damit ist der Exkurs durch narzisstisch konfigurierte Dimensionen auf einer Ebene angelangt, welche einen weiteren Parameter identifiziert, der für die anhaltende dualistische Grenzsetzung und die daraus folgende „Ausschließeritis“ einen entscheidenden ursächlichen Wirkfaktor repräsentiert – nämlich die Angst.
Die sich aus narzisstischer Wut speisende Angst ist nur die Kehrseite der narzisstisch geleiteten Tendenz, eigene Positionen machtorientiert abzusichern. Damit aber erschafft auch sie missbräuchliche Strukturen – den sog. Sündenbock-Mechanismus.
Der deutschstämmige Franziskanerpater und Gründer des „Zentrums für Aktion und Kontemplation“ Richard Rohr stellte die in seinem Buch „Entscheidend ist das UND“ zunächst banal anmutende Frage, woran es liege, dass Menschen anhaltend lieblos miteinander umgingen, und was diese so werden ließe, dass sie andere auf oft recht subtile Weise verletzen wollten?13
Selbst in dem, was Menschen am dringendsten wollten, machten sie es sich schwer oder verstellten sich völlig den Weg. Rohr führt weiter aus, WIR selbst seien uns die schlimmsten Feinde, nicht nur, dass wir mit unseren Schmerzen und unverarbeiteten Ängsten auf andere losgingen, nein, WIR fräßen sie auch in uns selbst hinein. Damit sperrten WIR uns regelmäßig gegen die Auferstehung und fragten uns dann auch noch, warum wir so unglücklich seien.
Die entscheidende Schlussfolgerung des Franziskanerpaters liegt nun auch darin, dass die – sich aus narzisstischen Grundeinstellungen ableitenden – bösartigen Einstellungen und Hassgefühle in mancher Hinsicht geradezu hilfreich erschienen. Jede negative Haltung wirke sich vielfältig auf scheinbar positive Weise aus, in dem Sinne, dass sie einzelne Gruppen und Gruppierungen auf der Grundlage der Angst zusammenschweiße – viel mehr als die Liebe –, und vor allem dann, wenn WIR unsere eigenen Ängste nicht erkennen würden oder zugäben. Rohr identifiziert die so klassifizierte Angst als Dämon, in versteckter, verdrängter und verkleideter Version.
Damit spricht Rohr einen systemimmanenten Mechanismus und eine sich daraus ableitende Dynamik an, die missbräuchlichen Strukturen in aller Regel großen Vorschub leistet, und nicht selten deren Voraussetzung und dynamische Grundlage abbildet: nämlich die Abwehr oder Vermeidung der „Arbeit am eigenen Schatten“. Denn Angst vereint auch sehr schnell die verstreuten Einzelteile des eigenen falschen Selbst. Das Ego bewegt sich immer auch mittels Widerspruch, Selbstschutz und Verweigerung vorwärts. Dieser Widerspruch schenkt dabei in vielen Situationen vermeintlich Zweck, Richtung und Überlegenheit – somit auch eine fragwürdige Art von Sicherheit. Er nimmt die ziellose Angst, deckt sie zu und versucht sie in Zielgerichtetheit und Dringlichkeit umzuformen. Die daraus resultierende Antriebskraft ist jedoch nicht friedvoll und sie macht auch nicht glücklich, denn sie bleibt gesättigt von Ich-Sucht – wobei wir wiederum bei dem narzisstischen Urkonflikt angekommen wären.
Diese Antriebskraft besitzt zahlreiche Programme, und stets befinden sich die Probleme „da draußen“, jedoch niemals „hier drinnen“.
Die Seelenentwicklung kommt jedoch nicht mittels Widerspruch voran, sondern erst durch ihre Ausweitung. Sie bewegt sich nicht voran durch Ausschluss, sondern lediglich durch Einschließen. Die Seele sieht letztlich alles mit Tiefe und Weite, sagt zu allem, was ihr begegnet, statt „Nein“ eher „Ja“. Dieses „Ja“ kommt uns aber dabei nicht leicht über die Lippen – denn es setzt stets voraus, dass wir unsere EGO-Schranken fallen lassen – das wiederum widerspricht dem narzisstischen Grundprinzip.
Erst wenn wir selbst lernen, unsere eigenen Muster und die genaue Struktur unserer Angst zu durchschauen, erst dann gelingt es uns, den „Dämon“ auszutreiben – indem wir seinen eigentlichen „Namen“ kennen und er sich demzufolge dann zeigen kann.
Bei Lukas 8,30 fragt auch Jesus den Dämon von Gerasa: „Wie heißt du?“
Erst dann, wenn die dämonischen Strukturen ihr Versteck im Unbewussten verlassen haben und wir sie in aller Bewußtheit – ohne Abwehrhaltung – ansehen können, verlieren sie endgültig ihre Macht. Das wäre die uns auferlegte „Arbeit am Schatten“.
Vorerst aber verharren wir lieber in widersprüchlichen Strukturen, die es uns dann – wie aufgezeigt – ermöglichen, unser Gegenüber abzuwerten, abzuschreiben, auszuschließen, ja auch auszuschalten und subtil und missbräuchlich geradezu zu quälen. Diese Dynamik bestärkt geradezu das Gefühl, die Lage vermeintlich im Griff zu behalten und über eine ganze Reihe sicherer Grenzen zu verfügen. Die narzisstische Wut, der daraus resultierende Hass und die ihm folgende Empathielosigkeit verleihen dann ein Gefühl der Überlegenheit, eine Machtposition. Auch wenn diese Strukturen in der Realität überhaupt nicht bestehen, dynamisch werden sie jedoch stets wirksam. Insofern ist auch an dieser Stelle wiederum Richard Rohr beizupflichten, welcher die Ansicht vertritt, dass wir rascher eine negative Identität finden, als gänzlich ohne Identität auszukommen.14 Ohne die notwendige Arbeit am Schatten, unserem falschen Selbst, bleiben wir jedoch langfristig an der Oberfläche des Lebens haften, wo Engherzigkeit die sicherste Grenze darstellt und dem Narzissmus gegenläufige Beeinträchtigungen durch unsere Mitmenschen abwehrt.
Der sich auf dieser dynamischen Basis legitimierende Hass ist jedoch sicherlich ein inadäquates Mittel gegen unsere Zweifel und unsere diffusen Ängste, die sich zwangsläufig aus Hinfälligkeiten des menschlichen Daseins ergeben. Aus der Perspektive unserer dynamischen Handlungsebenen ist der Hass eindeutig, er verhindert die Zwiespältigkeit, die der Mensch grundsätzlich ablehnt, und ist somit oftmals verbreiteter als die Liebe selbst und wirkt bisweilen auch, als scheine er deutlich effizienter.
Wir könnten uns nur von uns selbst und voneinander erlösen, so Richard Rohr, indem wir uns zunächst von unserem Bedürfnis nach Hass und Angst erlösen – verstanden im Sinne einer so erlangten vermeintlichen und trügerischen Sicherheit. In der Regel jedoch dominierten die negativen, narzisstisch bestimmten Grundmuster in uns, die derart tief in unserer Persönlichkeitsstruktur integriert seien, dass wir deren heraufbeschworenes Gewand nicht mehr erkennen würden, welches bedauerlicherweise auch daherkomme in Form von religiösen Strukturen. Wir verwendeten auch Religion dazu, unsere Bedürfnisse nach Angst und Hass zu kaschieren.