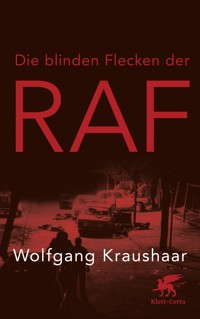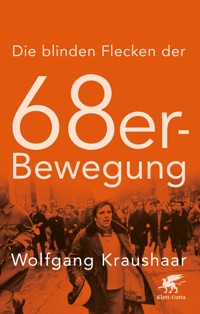
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Vor 50 Jahren begehrten die 68er überall gegen die Autoritäten auf und verlangten mehr individuelle Freiheit. Die Mythen, die aus ihrer Rebellion entstanden, sind noch heute vielfach ungebrochen. Wolfgang Kraushaar problematisiert die vorherrschenden Deutungsmuster der 68er-Bewegung und betont zugleich, dass unsere Zivilgesellschaft kaum ohne ihre Impulse vorstellbar wäre. Auch nach einem halben Jahrhundert gibt es noch immer viele offene Fragen, die einer klaren Deutung der 68er-Bewegung entgegenstehen. Unter ihnen stechen einige besonders hervor: Welche Rolle spielten Pop- und Rockmusik als Multiplikatoren des Protests? Welchen Stellenwert besaßen neue Aktionsformen wie Happenings, Sit-Ins sowie Teach- Ins? Und welche Bedeutung kamen Militanz und Gewalt zu, die einerseits die Ziele der Protestierenden zu beschädigen drohten, andererseits aber auch zur Publicity ihrer Forderungen nicht unerheblich beigetragen haben? Das alles wird von Wolfgang Kraushaar jenseits der üblichen Muster von Verdammung oder Idealisierung in einem Licht betrachtet, deren Scheinwerfer nicht in der Vergangenheit, sondern in der Gegenwart stehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 740
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Wolfgang Kraushaar
Die blinden Flecken der 68er-Bewegung
Klett-Cotta
Impressum
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
© 2018 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung
Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler
unter Verwendung eines Fotos von © ullstein bild – Wolfgang Kunz
Datenkonvertierung: Dörlemann Satz, Lemförde
Printausgabe: ISBN 978-3-608-98141-4
E-Book: ISBN 978-3-608-11016-6
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Einleitung
Die romantische Revolte
Rousseau als insgeheime Zentralfigur der 68er
Rousseau, Agnoli und die Basisgruppen
Romantik und Rebellion
Die Romantisierung der Welt
Novalis und der Pariser Mai
Romantischer Rückfall? Löwenthal contra Marcuse
Die Grünen als die Romantik-Erben der 68er
1. Anfänge
Die Entdeckung der Dritten Welt
Die Anti-Tschombé-Demonstration
Dutschkes Demonstrationsnotiz
Das Modell der direkten Aktion
Lumumbas Ermordung
Lumumbas Biographie
Die Hinwendung zur Dritten Welt
Die Dritte Welt als Projektionsbühne
Arendts Kritik an der Begeisterung für die Dritte Welt
Ein Resümee
Der 3. Juni 1967
Der Tag danach
Sicherheitsvorkehrungen
Fragwürdigkeiten in der Moabiter Klinik
Attentatspläne
Merkwürdigkeiten eines Gerichtsverfahrens
Der 5. bis 10. Juni 1967
Dutschkes Desinteresse
Israel als Vorposten des US-Imperialismus
Solidarität mit Israel
Die Psychologie der Abwehrmechanismen
Die verhängnisvollen Folgen des Kurswechsels
2. Vergangenheiten
Hitlers Kinder?
Historische und geopolitische Besonderheiten der 68er-Bewegung
Jillian Beckers Formel »Hitlers Kinder«
Götz Alys »Unser Kampf«
Methodische und andere Probleme
APO und 68er-Bewegung als Konglomerat heterogener Strömungen
Das Gespenst von einem »neuen 33«
Agnoli, die APO und der konstitutive Illiberalismus seiner Parlamentarismuskritik
Die Politik des »trasformismo« und die Lehre von der »trasformazione della democrazia«
Das Symposium über die SDS-Geschichte
Agnolis Biographie
Die negative »Vollendung« der »Transformation der Demokratie«
Vom tendenziellen Verschwinden der Antisemitismuskritik
Die Vorreiterfunktion des SDS in den fünfziger Jahren
Die Reaktionen auf die antisemitische Welle von 1959/60
Rudi Dutschke und das Auschwitz-Tabu
Adorno als Seismograph
Krahl und die Kontingenz von Auschwitz
Eruptionen 1969
Das Fanal vom 9. November 1969
Die mutmaßlichen Gründe
3. Kritiken
Die Ordinarienuniversität im Zeichen der Gesellschaftskritik von 1968
Medizinische Diagnoseklischees
Der Einfluss der Französischen Revolution
Demokratisierung der Hochschulen
Der universitäre Schatten der NS-Vergangenheit
Reform und Revolten
Vexierbild eines Mentors
Schlaglichter um 1968
Erstes Schlaglicht: Die Bewegung »Kampf dem Atomtod«
Zweites Schlaglicht: Die Verbindungen zur Kommune I
Drittes Schlaglicht: Der Kuba-Aufenthalt
Viertes Schlaglicht: Die Kampagne »1 Stunde Sendezeit für die APO«
Fünftes Schlaglicht: Die Anti-Notstandsbewegung
Sechstes Schlaglicht: Die Habermas-Schelte
Siebtes Schlaglicht: Die Suhrkamp-Revolte
Die Frage nach der Rolle
Das Erwachen
Der zornige junge Mann im Alter
Das Echo
Abrechnungen und Würdigungen
Biographische Sattelzeit
4. Die Revolte …
»Phantasie an die Macht«
Die Vorleistungen der Avantgarde
Unterbrechungen des internationalen Kulturbetriebes
Die Inkorporierung der Avantgarde in Gegenkultur und Revolte
Haight Ashbury als Szene
Die Subversive Aktion als Avantgarde
Die ästhetische Revolte: Der Pariser Mai
Kunst, Künstler und Intellektuelle scheinen am Ende zu sein
Die Folgen
Und eine Adaption von rechts
1968 und die Gewaltfrage
Die Thematisierung der Gewaltfrage als Tabubruch
Das Ende der begrenzten Regelverletzungen
Die stufenweise Entgrenzung der Gewalt
Das Paralleluniversum: Das Zeitalter der Entkolonialisierung und die Offensive der Befreiungsbewegungen
Die Trennung zwischen Militanten und Gewaltfreien
Die Schlüsselfigur: Opfer und Protagonist zugleich
Wie subversiv war der Sound der Sixties?
Der Cavern Club
Der Star-Club
Der Beat-Club
Die Konkurrenz zwischen den beiden Super-Bands
Die Protest-Songs
Dylans Protest gegen die Zensur
Die Festivals auf der Burg Waldeck
Die Internationalen Essener Song-Tage
Protest und Politik wurden 1968 zum integralen Bestandteil der Popmusik
Andy Warhol, Velvet Underground und Peter Zadeks »Ich bin ein Elefant, Madame«
5. … und einige Probleme
»Unsere Aufgabe die Herbeiführung des wirklichen Ausnahmezustands«
Benjamin und der Ausnahmezustand
Benjamin und die Studentenbewegung
Der als möglich erachtete und der tatsächliche Ausnahmezustand
Die Inanspruchnahme von Benjamins VIII. These durch die RAF
Der Zusammenbruch des Benjamin und der Kritischen Theorie entliehenen Staats- und Weltbildes
Die Antinomien einer Universalisierung des Ausnahmezustands
Die geschichtsphilosophischen und historischen Prämissen des Ausnahmezustands
Cohn-Bendit, die 68er und die Grünen
Die Propagierung frühkindlicher Sexualität in Kommunen und Kinderläden
Wilhelm Reich und die sexuelle Revolution
Der Tabubruch des Kindererziehers Daniel Cohn-Bendit
Die Pädophilie-Debatte in der Sponti-Bewegung
Einspruch: Erwachsene haben kein Recht auf die Sexualität von Kindern
Die Kontroverse um Cohn-Bendits Auszeichnung mit dem Theodor-Heuss-Preis
6. Das Echo
1968 und die Massenmedien
Um welche Massenmedien geht es?
Strukturprobleme der Öffentlichkeit und die These von der Bewusstseinsmanipulation
Der politische Konflikt um die Massenmedien
Die Rolle der SED bei der Anti-Springer-Kampagne
Das Dutschke-Attentat und die Springer-Blockade
Die Presseorgane
Das Fernsehen
Die Gegenöffentlichkeit
Die massenmedial produzierten Ikonen der APO
Die Medienrevolte
Die Folgen
Rudi Dutschke und die Wiedervereinigung
Dutschkes Bekenntnisse zur Wiedervereinigung
Warnungen vor einem linken Nationalismus
Linker Nationalismus in Dutschkes politischer Biographie
Eine kritische Bilanz
Was die Kommune-Bewegung war
Das Projekt revolutionärer Kommunen in den Metropolen
Die Nach-68er-Kommunen
Der Tunix-Kongress und das Netzwerk Selbsthilfe
Ein Resümee
Anhang
Anmerkungen
Drucknachweise
Einleitung
Flecken begleiten uns im Alltagsleben; genauer gesagt, sie verfolgen uns seit Kindesbeinen auf Schritt und Tritt und geben uns auch als Erwachsene nicht unbedingt Ruhe. Mal geht im Restaurant etwas daneben und verunreinigt das Tischtuch, mal ist ein Behälter undicht und hinterlässt hässliche Stellen, mal ist es ein Schreibutensil, das kleckst. Früher war es der Füllfederhalter, der regelrechte Katastrophen im Kleinformat herbeizuführen in der Lage gewesen ist, heute ist es eher – obwohl auch dieses Gerät im digitalen Zeitalter zu einer vom Aussterben bedrohten Spezies gehört – der Kugelschreiber, der manch unschöne Überraschung bereitzuhalten vermag.
Flecken sind abstoßend, unansehnlich, hässlich, ja zuweilen abscheulich. Nicht umsonst gelten sie als Störquellen, die es möglichst rasch wieder zu entfernen gilt. Jedenfalls war die Kindheit früher so organisiert, dass die Kleinen geradezu dressiert wurden, dem Fleck möglichst keine Überlebenschance zu bieten. Überall, wo das Malheur passiert war, galt es mit Unterstützung der unterschiedlichsten Hilfsmittel einzugreifen. Für diese Aufgabe sind Fleckenentferner zuständig. Wer etwa in der Abteilung Haushaltsmittel eines Supermarkts danach Ausschau hält, der wird mit einem kaum zu überschauenden Angebot konfrontiert. Obwohl es sich bei Fleckenentfernern um traditionelle, wenn nicht gar konventionelle Mittel handelt, so sind sie doch zu keiner Zeit wirklich aus der Mode gekommen.
Es gibt verschiedene Typen von Flecken: es gibt weiße, es gibt schwarze, es gibt dunkle und es gibt blinde Flecken. Am geläufigsten sind vielleicht jene, die auf die Redewendung vom »weißen Fleck auf der Landkarte« zurückzuführen sind. Wer Landkarten vergangener Jahrhunderte zur Hand nimmt, dem wird rasch klar, wie groß in manchen Erdteilen wie Afrika oder Australien etwa Gebiete waren, die als »weiße Flecken« und damit als unerschlossen galten. Von ihrer Tendenz her waren die Küstengebiete am ehesten mit Zeichen versehen, die auf Bewohnt- oder Belebtheit zu schließen schienen, und je mehr man sich ins Zentrum vorwagte, umso stärker dünnten sich die Angaben aus, bis sie schließlich in völlig unbestimmte, im Urzustand der Kartographie als »weiß« verbliebene Zonen erschienen. Dass dies nicht gleichbedeutend mit der Nichtexistenz von Menschen, Tieren, Pflanzen und der Natur insgesamt war, wusste man natürlich schon in der Vergangenheit. Nicht umsonst war deshalb häufiger die Rede von einer »terra incognita«. Es bedeutete, dass dieses Gebiet, diese Region oder dieses Land durchaus etwas aufweisen konnte, etwa unbekannte, früher zumeist noch als Volksstämme bezeichnete Ethnien, eine reichhaltige Fauna oder nur eine blühende Vegetation. Dass es auf der Landkarte weiß markiert war, bedeutete lediglich, dass es für eine derartige Zone im Auge des Betrachters nichts zu verzeichnen gab. Das konnte sogar ihren Reiz ausmachen. Nicht umsonst galt etwa Zentralafrika, insbesondere der Kongo, in früheren Jahrhunderten als geheimnisvoll. Heute jedoch, wo es in den Zeiten von Google Earth so gut wie keine unerschlossenen Gebiete auf der Erdkugel gibt, wird die Rede von dem oder den weißen Flecken fast nur noch in einem übertragenen Sinne verwendet. Sie figuriert durchweg als eine Metapher für unbekannte Wissensgebiete.
Wer hingegen von dunklen Flecken in einem physiologischen Sinne spricht, dem geht es nur allzu häufig um Alarmsignale für bestimmte Erkrankungen. So können in der Dermatologie etwa dunkel bis schwarz eingefärbte Hautpartien als mögliche Hinweise für die Entstehung eines Melanoms angesehen werden, also für eine bösartige Veränderung der Zellstruktur, die zu einer Krebserkrankung führen kann. In einem übertragenen Sinne stehen dunkle Flecken für etwas Negatives oder aber zumindest Bedrohliches. Sie gelten zumeist als Warnhinweis für irgendein Unheil. Insofern stellen sie den Vorboten eines drohenden Unglücks dar. Ganz ähnlich ist es um die Rede von den braunen Flecken bestellt. Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte geht es hier nur noch selten etwa um Obst, dessen Verfallszeit überschritten ist. Seit dem Ende des Nationalsozialismus ist damit in erster Linie eine politische Symptomatik gemeint – die Gefahr einer als Bedrohung der Demokratie wahrgenommenen Renazifizierung.
Am interessantesten aber ist vielleicht die Rede von dem oder den »blinden Flecken«. Auch hier lässt sie sich in ihrer Verwendung zunächst zwischen verschiedenen Gebieten unterscheiden. Die Rede ist von der Augenheilkunde und von der Psychologie oder Sozialpsychologie. In der Ophthalmologie, wie die das Auge betreffende Heilkunde unter Medizinern genannt wird, existiert ein blinder Fleck in einem wortwörtlichen Sinne. Damit wird jene Stelle des Gesichtsfeldes bezeichnet, auf die sich die Austrittsstelle des Sehnervs im Außenraum projiziert. Da sich an dieser Stelle keine für die Erkennbarkeit nötigen Lichtrezeptoren der Netzhaut befinden, entsteht ein sogenannter blinder Fleck. Das bedeutet, dass es in dieser Region zu einem Ausfall des Gesichtsfeldes kommt. Das Tückische an diesem Phänomen besteht aber darin, dass der blinde Fleck überhaupt nicht als Mangel zur Kenntnis genommen wird. Denn das Gehirn überdeckt den Ausfall, indem es ein vollständiges Blickfeld liefert. Diese Merkwürdigkeit vom blinden Fleck war von dem französischen Physiker Edme Mariotte de Chazeuil bereits im Jahre 1660 entdeckt worden. Das Gründungsmitglied der Akademie der Wissenschaften hatte sich eingehend mit der Funktion der Netzhaut für das Sehvermögen beschäftigt. Seine Entdeckung vom blinden Fleck des Gesichtsfeldes präsentierte er bald voller Stolz dem Hofe von König Ludwig XIV.Mühelos ließ er eine Münze aus dem Gesichtsfeld des Sonnenkönigs »verschwinden«.
Ganz anders verläuft dagegen das Verständnis vom blinden Fleck in psychologischer Hinsicht. Hier geht es um Ausfallerscheinungen des Selbsts oder Ichs, das nicht mehr dazu in der Lage ist, alle Teile seiner Persönlichkeit unbeeinträchtigt wahrzunehmen. In der Psychoanalyse etwa ist in diesem Zusammenhang die Rede von einem Abwehrmechanismus, mit dem sich das Subjekt vor der Einsicht in für dieses schmerzhafte Eigenheiten oder Erlebnisse bewahren will. Die beiden US-amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham sind Mitte der fünfziger Jahre auf die Idee gekommen, den blinden Fleck im Selbstbild eines Menschen durch das sogenannte Johari-Fenster zu illustrieren, in dem bewusste und unbewusste Persönlichkeits- und Verhaltensmerkmale im Verhältnis zwischen einem Einzelnen und anderen beziehungsweise einer Gruppe dargestellt werden. Damit soll vor allem der Unterschied zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung aufgezeigt werden. Die Differenz macht den blinden Fleck im Auge des Selbst aus. Verstanden werden soll darunter all das, was vom Betroffenen aus gesendet und vom Empfänger wahrgenommen wird, ohne dass sich der »Sender« dessen bewusst ist. So viel zur Typenlehre der Flecken und zu den Besonderheiten im Zusammenhang mit der Rede von den blinden Flecken.
Heutzutage von »blinden Flecken« zu sprechen, ist längst zu einem Gemeinplatz geworden. Das gilt in objektiver wie in subjektiver Hinsicht. In beiderlei Hinsicht bedeutet es zunächst nicht sehr viel mehr, als auf Erkenntnislücken zu verweisen und auf diesem Wege zugleich neue Erkenntnisziele zu markieren. Wer in einer Angelegenheit nach »blinden Flecken« sucht, der erweckt jedoch nur zu rasch den Eindruck, als ginge es ihm in Wirklichkeit darum, »dunkle Flecken« ausfindig zu machen, um die es immer dann geht, wenn das Ziel darin besteht, etwas Belastendes und insofern etwas Negatives herauszufinden. Doch das muss keineswegs so sein. Zwar ist nicht auszuschließen, dass bei der Untersuchung derartiger Flecken gewissermaßen dunkle Stellen zum Vorschein kommen, grundsätzlich aber gilt, dass der Erkenntnisprozess ergebnisoffen verlaufen sollte. Das gilt selbstverständlich auch für einen vielschichtigen, nur schwer eingrenzbaren und mit Deutungsangeboten geradezu überladenen zeithistorischen Komplex wie den der 68er-Bewegung.
Zum 50. Jahrestag eines so bedeutenden wie bis auf den heutigen Tag nachhaltig wirksamen Ereigniszusammenhanges nicht etwas zu schreiben, um ihm im übertragenen Sinne eine weitere Girlande zu flechten, bedarf keiner näheren Begründung. Insbesondere deshalb nicht, weil in Teilen der Öffentlichkeit bereits seit Langem ein gewisser Überdruss existiert, mit diesem Thema ein weiteres Mal behelligt zu werden. Die Episoden, so heißt es nur allzu häufig, seien bis zum Überdruss erzählt, die dabei verwendeten Narrative längst erstarrt und die Geschichten hingen einem mehr oder weniger zum Hals heraus.
Diese Wahrnehmung mag in mancher Hinsicht vielleicht sogar zutreffen und keineswegs bloß einem Abwehreffekt geschuldet sein, der die zur Polarisierung geradezu einladende 68er-Bewegung freilich von Anfang an begleitet hat. Jedoch wird damit verdeckt, dass die Erforschung immer wieder zu Neuigkeiten und zuweilen sogar – wie die 2009 gelungene Enttarnung von Benno Ohnesorgs Todesschützen Karl-Heinz Kurras als einem ehemaligen Stasi-Spitzel in der Westberliner Kriminalpolizei eindrucksvoll unterstrichen hat1 – zu spektakulären Überraschungen geführt hat. Natürlich kann das allgemein Aufsehenerregende nun kein Kriterium sein, um zu klären, welche Forschungsfragen in einem bestimmten Gebiet überhaupt zu erörtern sind, jedoch zeigt es auf, wieviel Ungeklärtes in den Untiefen der damaligen Zeit vielleicht noch immer schlummert.
Als ich mich vor inzwischen vierzig Jahren zum ersten Mal näher mit dem Thema Studentenbewegung/68er-Bewegung befasste, verfolgte ich damit eher politische als etwa – wie man einem auf Grund der lebensgeschichtlichen Überschneidungen nur zu rasch meint unterstellen zu können – historische oder gar autobiographische Gründe. Mir war aufgefallen, wie restringiert seinerzeit das Verständnis von der Entstehung, vom Verlauf und den Folgen einer sich ursprünglich radikaldemokratisch begreifenden, aber nur zu bald in totalitarismusverdächtigen ML-Organisationen erstarrten Bewegung geworden war. Dagegen wollte ich etwas ganz Elementares und nur wenig Deutungsbedürftiges setzen – eine Chronologie. Das Resultat war der Anhang zu einem seinerzeit außerordentlich erfolgreichen, von Peter Mosler verfassten Taschenbuch, das unter dem Titel »Was wir wollten, was wir wurden – Studentenrevolte zehn Jahre danach« erschien.2 Damals galt als Schlüsseljahr ja nicht etwa 1968, sondern mit 1967 das Jahr zuvor und die Redeweise von den 68ern und der 68er-Bewegung befand sich noch in den Kinderschuhen.
Hätte mir damals jemand zu prophezeien gewagt, in wie vielen Punkten die Geschichte dieser Studentenbewegung, die ja schon rasch über die im Titel des Bandes so herausgestellte Trägerkohorte hinausgegangen war und sich nicht umsonst als eine außerparlamentarische Opposition manifestiert hatte, zu korrigieren und zu ergänzen gewesen wäre, hätte ich ihm sicher widersprochen und ihn insgeheim wohl für einen Spinner gehalten. Doch genau das geschah und ich selbst wurde noch bevor ich für drei Jahrzehnte am Hamburger Institut für Sozialforschung arbeitete und zusammen mit Reinhart Schwarz dafür sorgte, dass mit dem Aufbau eines Archivs auch für besonders wichtige empirische Grundlagen einer solchen Forschungsarbeit gesorgt wurde, zu jemanden, der den Dingen nun unbedingt auf den Grund gehen wollte. Was dabei u.a. herausgekommen ist, möchte ich an einigen wenigen Fällen, die freilich von weitreichender Bedeutung waren, illustrieren.
Als mit Rudi Dutschke der unbestrittene Wortführer der 68er-Bewegung völlig überraschend am Heiligabend 1979 an den Spätfolgen des Attentats starb, war der Schock groß. Nachdem die Nachrufe gedruckt, die Reden bei der Beerdigung auf dem Dahlemer Friedhof gehalten und die Szenen der Trauerfeier im Auditorium Maximum der Freien Universität, von peinlichen Auftritten esoterisch anmutender Öko-Fundamentalistinnen unterbrochen, vorüber waren, schien sich ein Bild von der Ikone der 68er-Bewegung herauszukristallisieren, das sich mehr und mehr den vier Grundprinzipien der nur wenige Tage später in Karlsruhe gegründeten Partei der Grünen fügte – ökologisch, basisdemokratisch, sozial und gewaltfrei.3
Gegen dieses Bild eines grün angehauchten, christlichen Pazifisten regte sich jedoch schon bald darauf erheblicher Unmut.4 Einer der markantesten Einwürfe stammte von dem seinerzeit in der JVA Moabit einsitzenden Ex-Kommunarden Fritz Teufel. Die tageszeitung publiziert am 15. Januar 1980 einen von Teufel verfassten Nachruf. Darin griff er Dutschkes Ausspruch am Grab von Holger Meins noch einmal auf und schrieb: »Ohne das Attentat, meint Erich Fried, hätte Rudi Ulrike Meinhof vom bewaffneten Kampf abgehalten. Ohne das Attentat, meine ich, wäre Rudi vielleicht selbst diesen Weg gegangen und hätte dem bewaffneten Kampf in den Metropolen, ebenso wie Ulrike, entscheidende Impulse geben können.«5 Das kam bei einem Mann, der schon 1970 seine Rolle als »Polit-Clown« öffentlich aufgegeben hatte und fünf Jahre später mit einer Pumpgun bewaffnet festgenommen worden war, aus berufenem Munde und war mehr als deutlich.
Nach Teufels Einspruch dauerte es nur zwei Wochen, bis ein Dokument auftauchte, das Dutschkes Verhältnis zum bewaffneten Kampf nicht nur in einem anderen Licht, sondern auch auf einer anderen Grundlage darstellen sollte. Es ging um das geheimnisumwitterte »Organisationsreferat«, das Dutschke, der den Text zusammen mit Hans-Jürgen Krahl, dem intellektuellen Kopf des Frankfurter Sozialistischen Deutschen Studentenbunds (SDS), verfasst und auf der SDS-Delegiertenkonferenz im September 1967 im Studentenhaus der Frankfurter Universität gehalten hatte. Es hatte bis dahin als verschollen gegolten.6 Es ist sogar behauptet worden, dass die beiden Verfasser jedem, der den Versuch unternehmen würde, es abzudrucken, mit einer einstweiligen Verfügung gedroht und sich sogar die letzten noch in der Schweiz verfügbaren Tonbandaufnahmen besorgt und möglicherweise vernichtet hätten.7 Offenbar gab es im SDS ganz allgemein, vielleicht aber auch seitens der beiden Urheber selbst massive Bedenken, ihre Überlegungen weiter zu verbreiten. Mir selbst waren diese Vorbehalte zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt. Ich hatte es in dem seinerzeit vom SDS-Bundesvorstand gegründeten Verlag, in dem ich zuvor zwei Jahre gearbeitet hatte, entdeckt und dafür gesorgt, dass es im Februar 1980 in der Frankfurter Studentenzeitung diskus, zu deren Herausgebern ich einige Zeit gehört hatte, abgedruckt und dort auch ausführlich kommentiert wurde.8
Aus verschiedenen Gründen gilt das »Organisationsreferat« auch heute noch als ein, wenn nicht gar als das Schlüsseldokument aus der Geschichte des SDS, jener 1946 von der SPD gegründeten und 1961 aus ihrer Mutterpartei herausgeworfenen Organisation, die in der außerparlamentarischen Bewegung als ihr entscheidender Motor fungierte. Weder zuvor noch danach hatte es einen Redebeitrag gegeben, mit dem in einer vergleichbaren Weise ein theoretisch hochelaboriertes Konzept für eine strukturelle Neuorganisierung offeriert worden wäre. Allerdings war dies mit einer Konkretisierung verknüpft gewesen, wie sie eher zu der zweieinhalb Jahre später gegründeten RAF als zu einem Hochschulbund gepasst hätte, der ja ursprünglich über sozialdemokratische Wurzeln verfügt hatte. Angesichts dieser Brisanz war es alles andere als Zufall, dass sich beim ersten großen Symposium über die Geschichte des SDS, das im Sommer 1985 an der Freien Universität stattfand und durch Porträts von Dutschke und Krahl eingeleitet wurde, die heftigsten Debatten gerade um jenes so lange verschollene Dokument drehten.9
Erst im September 1967 hatte es Dutschke also gewagt, mit seinem Konzept des bewaffneten Kampfes an eine größere Öffentlichkeit heranzutreten. Auf der unter der Fahne des Vietcong im Frankfurter Studentenhaus einberufenen SDS-Delegiertenkonferenz legte er das »Organisationsreferat« vor. Die entscheidende Aufforderung an die SDS-Delegierten lautete: »Die ›Propaganda der Schüsse‹ (Che) in der ›Dritten Welt‹ muss durch die ›Propaganda der Tat‹ in den Metropolen vervollständigt werden, welche eine Urbanisierung ruraler Guerilla-Tätigkeit geschichtlich möglich macht. Der städtische Guerillero ist der Organisator schlechthinniger Irregularität als Destruktion des Systems der repressiven Institutionen.«10 Das mochte zwar schlechtes Soziologendeutsch und mit bedeutungsschweren Vokabeln völlig überfrachtet gewesen sein, die mit ihm verbundene Absicht wurde dennoch verstanden und traf einen Nerv.
Es konnte nicht verwundern, dass das Referat überaus gespalten aufgenommen wurde. Ein Teil der Delegierten feierte es mit frenetischem Applaus, ein anderer Teil reagierte mit strikter Ablehnung. Der Vertreter der als »traditionalistisch« geltenden und der illegalen KPD nahestehenden Bonner SDS-Gruppe, Hannes Heer, etwa scheute sich nicht einmal, den berüchtigten, drei Monate zuvor von Habermas in Hannover erhobenen Vorwurf aufzugreifen und Dutschke als einen »Linksfaschisten« abzukanzeln. Dies änderte jedoch nichts daran, dass es dem von Dutschke und Krahl repräsentierten antiautoritären Flügel auf dieser Delegiertenkonferenz erstmals gelang, die Mehrheit zu stellen und sich mit eigenen Kandidaten bei den Wahlen zum Bundesvorstand durchzusetzen.
Mit der posthumen Veröffentlichung des »Organisationsreferates« war, wie sich 1980 nur zu bald zeigen sollte, ein regelrechter Knoten geplatzt. Es war einer der ersten blinden Flecken, der benannt und zumindest ansatzweise aufgehellt worden war. Dutschke schien nun auf einmal derjenige gewesen zu sein, der erstmals und in aller Öffentlichkeit zur Bildung einer »Sabotage- und Verweigerungsguerilla« und damit vielleicht sogar zu einer Art Stadtguerilla, zumindest aber zu einer Vorform derselben aufgerufen hatte.11 Wer von nun an behauptete, dass die RAF nichts mit der 68er-Bewegung zu tun gehabt hätte, lief Gefahr, sich lächerlich zu machen. Die Details dieser Verbindung mochten vielleicht noch ungeklärt sein und möglicherweise immer noch ganz überwiegend im Dunkeln liegen, das Faktum selbst ließ sich nun aber nicht mehr bestreiten.
Mir war später klar geworden, dass es im Zusammenhang mit Dutschke zumindest noch einen weiteren gravierenden blinden Fleck geben musste. Neben dem Thema »Guerilla und Gewalt« war das der »Nation« eine derartige Blindstelle. Dieser Eindruck verstärkte sich maßgeblich während einer Gedenkveranstaltung.
Als zu Dutschkes 10. Todestag im Frankfurter Club Voltaire einige seiner früheren Weggefährten wie die beiden ehemaligen SDS-Mitgliedern und nun schon seit Längerem in Hannover lehrenden Soziologen Klaus Meschkat und Detlev Claussen mit Dutschkes Witwe Gretchen und ihren drei Kindern im Dezember 1989 zusammentrafen, war es naheliegend, warum dieses Thema auf einmal eine solche Rolle spielte. Schließlich war nur wenige Wochen zuvor die Berliner Mauer gefallen. Die DDR befand sich seitdem in Auflösung und ihre einstige Staatspartei SED nannte sich bald in PDS um. Es gab also gute Gründe, darüber zu spekulieren, wie der selbst aus der DDR stammende Rudi Dutschke wohl auf die Implosion des poststalinistischen Regimes, den Zusammenbruch der Staatssicherheit, die Transformation einer totalitären Staatspartei und die sich abzeichnende deutsche Einigung reagiert hätte. Und nicht weniger abwegig war es, sich an die deutschlandpolitischen Initiativen zu erinnern, die Dutschke in den siebziger Jahren gestartet hatte und die bei fast allen seinen Mitstreitern auf Kopfschütteln und Unverständnis gestoßen waren.
Wenn ich mich recht erinnere, dann hat Klaus Meschkat, der ja ebenfalls aus der DDR stammt, als Erster einen Text über diesen Komplex verfasst. Mich beschäftigte das Thema vor allem deshalb, weil sich innerhalb weniger Monate eine der folgenreichsten Niederlagen der Linken abzeichnete. Nur zu konsequent schien es zu sein, dass die Grünen nach den ersten gesamtdeutschen Wahlen die Quittung für ihr deutschlandpolitisches Versagen erhalten hatten und aus dem Bundestag geflogen waren. Mich interessierte vor allem die Frage, ob es bei Rudi Dutschke, der ja eine nur schwer zu überschätzende Rolle bei der Gründung der grünen Partei gespielt hatte, Ansätze gab, die ein solches Versagen hätten verhindern oder zumindest schmälern können.
Da Gretchen Dutschke im August 1990 nach Deutschland kam, um im Hamburger Institut für Sozialforschung über eben jene Rolle zu forschen, die ihr verstorbener Mann in dem Prozess spielte, der die Grünen in die Parlamente geführt hatte, bekam ich Gelegenheit, auch den handschriftlichen Teil des Dutschke-Nachlasses nach Hinweisen zum Komplex deutsche Einigung genauer durchzusehen. Dabei erlebte ich eine Überraschung nach der anderen. Insbesondere wurde mir bewusst, dass die sogenannte nationale Frage nicht erst nach Dutschkes Genesung in den siebziger Jahren für ihn eine Rolle gespielt hatte, sondern bereits sehr viel früher. Selbst auf dem Höhepunkt der Studentenrevolte im Sommer 1967 hatte er eine maßgebliche Initiative gestartet, die Wiedervereinigung Deutschlands in strategische Überlegungen zur revolutionären Umwälzung Westberlins einzubetten.
Als ich Gretchen Dutschke im Herbst 1990 mit meinen Ergebnissen konfrontierte, reagierte sie zunächst mit Abwehr und Misstrauen. Insbesondere kreiste unsere interne Debatte um die Frage, ob ihr Mann der Autor eines im Juli 1967 im Oberbaumblatt veröffentlichten Aufsatzes sein könnte, in dem ein »R. S.« unter der Überschrift »Zum Verhältnis von Organisation und Emanzipationsbewegung« gefordert hatte, dass ein rätedemokratisch organisiertes West-Berlin »ein strategischer Transmissionsriemen für eine zukünftige Wiedervereinigung Deutschlands« werden müsse.12 Ich war der Meinung, dass bereits der sprachliche Duktus für Dutschkes Autorenschaft spräche. Nun, es dauerte nicht lange, bis ein letzter Rest an Unklarheit beseitigt werden konnte. Gretchen Dutschke war im Nachlass auf eine von ihrem Mann selbst verfasste Gliederung zu einer Publikation jener Schriften gestoßen, die am besten seinen eigenen politischen Werdegang hätten dokumentieren können. Der Titel lautete »Gegen den Strom«. Und einer der ersten Texte, die dort aufgeführt wurden, war eben jener 1967 unter Pseudonym verfasste Text aus dem Oberbaumblatt. Damit war die Sache entschieden. Kurz darauf hielt ich in Essen einen Vortrag über »Die heimliche Dialektik von Internationalismus und Nationalismus« und 1992 erschien der Text dann unter dem Titel »Rudi Dutschke und die Wiedervereinigung« in gekürzter Form in der Institutszeitschrift Mittelweg 36. Er ist in dieser Fassung im vorliegenden Band noch einmal nachzulesen.
Als sich dann zum Ende der neunziger Jahre hin die Anzeichen verdichteten, dass sich eine ganze Reihe ehemalige 68er als Nationalisten und gar als Neonazis entpuppten, mangelte es auch nicht an Versuchen, Dutschke für diese Revision einzugemeinden und als Vorläufer ihres eigenen Kursschwenks auszugeben. Wie weit manche dabei zu gehen bereit waren, zeigte eine zum Jahreswechsel 1998/99 von den drei ehemaligen SDS-Mitgliedern Horst Mahler, Günther Maschke und Reinhold Oberlercher herausgegebene »Kanonische Erklärung zur Bewegung von 1968«,13 in der die Rebellion mit dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953 in der DDR verglichen und zum »zweiten deutschen Aufstand gegen eine Besatzungsmacht« umgedeutet sowie die RAF in die Tradition der Urburschenschaft eingebettet und in »Waffen-SDS« umbenannt worden war. Ihre wichtigsten Punkte bestanden darin, dass sie die Rolle von DDR-Flüchtlingen in der Revolte über die Maßen hervorhoben; der politischen Ausrichtung, insbesondere eines Teils des Westberliner SDS, eine nationalrevolutionäre Option unterlegten; den Protest gegen den Vietnamkrieg einseitig in eine antiamerikanische Willensäußerung umdeuteten; die außerparlamentarische Opposition unter antiwestlichen Vorzeichen als eine quasi-nationale Widerstandsbewegung interpretierten und auch nicht davor zurückschreckten, aus Rudi Dutschke einen Protagonisten des Nationalen zu machen, d.h. ihn posthum zum Nationalrevolutionär zu ideologisieren versuchten.
Gegen diese Usurpation des einstigen Wortführers der Revolte und die damit einhergehende folgenreiche Umdeutung der 68er-Bewegung war 1999 von verschiedenster Seite mit Vehemenz Einspruch erhoben worden. Insbesondere ein Kreis ehemaliger SDS-Mitglieder in Berlin hatte sich gegen diesen Vereinnahmungsversuch zu wehren versucht und unter dem Titel »Nationalisten waren wir nie!« eine gemeinsame Erklärung herausgegeben.14 Dabei hatte man sich allerdings in ihrer nur allzu verständlichen Abwehrhaltung auch zur Einnahme von Positionen verleiten lassen, die einer genaueren Überprüfung nicht standhielten. So wurde etwa behauptet, Dutschke sei »entschiedener Internationalist« gewesen. Das war er sicher. Mit der gleichen Berechtigung ließ sich allerdings hinzufügen, dass er auch ein nicht weniger entschiedener Verfechter der deutschen Frage gewesen sei. Genau das aber war ausgelassen worden, um offenbar eine besonders eindeutige Position in der Verteidigungshaltung zu erzielen. Insofern war ihre Feststellung, »[e]ine nationale Frage stellte sich für uns nicht«, nur solange zutreffend, solange sie Dutschke von dieser Behauptung ausnahmen.
Der in den neunziger Jahren ausgebrochene Streit um die innerhalb der 68er-Bewegung über Jahrzehnte hinweg verdeckte beziehungsweise tabuisierte Rolle der nationalen Frage zeigte ein weiteres Mal, welche blinden Flecken es in diesem Zusammenhang gab und wie wichtig es gewesen wäre, sich ihr genauer zu widmen.
Da es am Hamburger Institut für Sozialforschung unser Bestreben war, insbesondere solche Dokumente ausfindig zu machen und sichern zu wollen, die nur zu leicht hätten verschwinden können, weil sie sich in privater Hand befanden, keinen Gruppierungen, Parteien oder sonstigen Organisationen zugeordnet werden konnten, hatten wir uns als erstes um den Nachlass von Rudi Dutschke bemüht, der schon längst nicht mehr in Berlin oder sonstwo in der Bundesrepublik lagerte, sondern in Boston, der Hauptstadt des an der Ostküste gelegenen US-Bundesstaats Massachusetts, und als zweites um die Hinterlassenschaft der legendären Kommune I. Von dem letzteren Bestand wussten wir zwar, dass er in den Räumen der Anwaltskanzlei von Hans-Christian Ströbele untergebracht war, der zusammen mit seinem Kollegen Klaus Eschen zu Beginn der siebziger Jahre einige der Kommunarden vor Gericht vertreten hatte. Den Auftrag, den Aktenbestand zur Übergabe an unser Archiv vorzubereiten, hatte dann – ohne dass ich davon informiert gewesen wäre – ihr einstiger Kopf Dieter Kunzelmann erhalten. Das war, wie sich später herausstellte, eine ziemlich blauäugige Entscheidung gewesen; denn damit hatte man, indem man ihm die Kontrolle über hochbrisantes Aktenmaterial überließ, das ihn möglicherweise auch selbst hätte belasten können, in gewisser Weise den Bock zum Gärtner gemacht. Das ließ sich jedoch, als ich davon erfuhr und diese Arbeit fast abgeschlossen war, nicht mehr ändern.
Eine weitere wichtige Quelle waren Dokumente aus dem Bestand des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit des mittlerweile untergegangenen SED-Staats DDR. Im Jahr 1994 hatte dazu ein denkwürdiges Treffen in der Berliner Wohnung der einstigen Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley stattgefunden. Die Kollegin, die den Auftrag hatte, in unserem Archiv den RAF-Bestand aufzubauen, war mit Christiane Ensslin die ältere Schwester der RAF-Mitbegründerin Gudrun Ensslin. Sie hatte Bohley kennengelernt und sich mit ihr angefreundet. Für einen Abend war dann von ihnen ein Gespräch über die 68er-Bewegung und die RAF verabredet worden. Von Ensslins Seite bin ich mit dazu gestoßen und von Bohleys Seite der Beauftragte der Stasi-Unterlagen und spätere Bundespräsident Joachim Gauck. Nachdem wir uns bis tief in die Nacht darüber unterhalten hatten, wie weit die Arme der Stasi-Krake wohl gereicht haben könnten, war klar, dass wir seitens des Instituts wohl zwei verschiedene Forschungsaufträge bei der »Gauck-Behörde« stellen würden: einen zur Frage, ob und inwieweit der SDS und andere Organisationen der 68er-Bewegung vom MfS unterwandert worden sein könnten, und einen anderen dementsprechenden hinsichtlich verschiedener linksterroristischer Gruppierungen, genauer der RAF, der Bewegung 2. Juni und der Revolutionären Zellen. Nachdem wir die entsprechenden Anträge gestellt hatten, konnte unsere Forschungsarbeit auch auf diesem Sektor beginnen.
Eine ganz besondere Rolle spielte in diesem Zusammenhang dann der Fund eines extrem dichten und umfangreichen Aktenbestands, der durch Vernehmungen des Kommunarden und Terroristen Michael »Bommi« Baumann zustandegekommen war. Dieser war am 9. November 1973 beim Versuch, von der Tschechoslowakei aus mit dem Zug in die DDR einzureisen, am Grenzort Bad Schandau festgenommen worden, weil er den Grenzern gefälschte Ausweispapiere vorgehalten hatte. Er wurde dann in das Zentralgefängnis der Staatssicherheit in Hohenschönhausen transportiert und dort sechs Wochen lang verhört, besser gesagt wie eine Zitrone ausgequetscht. Er fertigte in dieser Zeit u.a. ein über hundert Kurzbiographien umfassendes »Who’s Who des bewaffneten Kampfes« an, das mit brisanten, für einen Geheimdienst in vielfacher Hinsicht verwendbaren Informationen gespickt war. Wer besaß welche Waffe, wer war an welchem Überfall oder Anschlag beteiligt, wer war mit wem liiert und hatte welche sexuellen Präferenzen?
Ein anderes, eher unscheinbares Dokument aus Baumanns Stasi-Akte wussten wir zunächst nicht angemessen zu würdigen. Es bestand aus einer vom MfS vorgefertigten Liste von terroristischen Anschlägen in West-Berlin. Sie begann mit dem 10. November 1969, jenem Tag, an dem frühmorgens eine Reinemachefrau einen in einem Coca-Cola-Automaten des Jüdischen Gemeindehauses in der Charlottenburger Fasanenstraße versteckten Sprengkörper entdeckt hatte. Die Stasi hatte die Namen der Tatverdächtigen dieses und der anderen Anschläge jeweils in Klammern dahinter gesetzt. In diesem Fall waren dort die Namen »Dieter Kunzelmann / Ina Siepmann« zu lesen. Bemerkenswert war jedoch, dass die beiden maschinenschriftlich getippten Namen durchgestrichen und von Baumann handschriftlich durch »A. Fichter« ersetzt worden war. Mir war der Nachname zwar bekannt, nicht jedoch, für wen die Abkürzung des Vornamens in Frage gekommen wäre. Da ich mit Dr. Tilman Fichter den ehemaligen Berliner SDS-Landesvorsitzenden seit 1977 kannte, war es naheliegend, ihn zu fragen, ob es sich bei dem ominösen »A.« vielleicht um seinen Bruder handeln könnte. Als er mir telefonisch bestätigte, dass es sich dabei wohl tatsächlich um seinen Bruder »Albert Fichter« handeln müsse, ging es eigentlich nur noch darum, ob dieser bereit sei, mit mir über den Aktenfund zu reden.
Ich wusste zunächst nicht, ob der Genannte sich noch oder wieder in Berlin beziehungsweise in Deutschland aufhielt. Sein älterer Bruder versprach mir, ohne mir dabei irgendwelche Einzelheiten zu verraten, ihn zu kontaktieren und ihn zu befragen, ob er zu einer Auskunft bereit sei. Es dauerte schließlich drei Wochen bis ich eine Antwort erhielt. Sie lautete: Ja, er wäre. Es dauerte dann noch einmal wesentlich länger, bis es zu dem angestrebten Treffen kam. Im Juli 2004 war es schließlich so weit. Treffpunkt war ein Kurort im Schwarzwald.
Mir war etwas mulmig dabei, als ich mich ihm näherte. Schließlich gab es vor Ort keinen Vermittler und ich besaß keinerlei Informationen über das Vorleben des als verdächtig Genannten. Gegenüber stand mir ein 60-jähriger Mann mit einem blonden, zu einem Pferdeschwanz zusammengebundenen Haarschopf. Sein Gesichtsausdruck schien den Anflug eines Lächelns zu verraten, vielleicht aber war es auch nur Ausdruck einer Verlegenheit. Unmittelbar nach der Begrüßung fragte er mich, ob wir uns nicht duzen könnten. Da ich merkte, dass das eine Art Vertrauensbeweis wäre, willigte ich kurz entschlossen ein. Damit schien – noch bevor das Gespräch überhaupt begonnen hatte – der Damm bereits gebrochen sein. Albert Fichter redete nicht lang drum herum, sondern gab ohne irgendwelche Ausflüchte zu, dass er es tatsächlich gewesen sei, der am Vormittag des 9. November 1969 die von ihm präparierte Bombe während einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Judenpogroms von 1938, der sogenannten Reichskristallnacht, ins Jüdische Gemeindehaus getragen und dort mit einem Zeitzünder versehen deponiert hatte. Allerdings sei ihm zu diesem Zeitpunkt weder das Datum noch der Anlass der Veranstaltung bekannt gewesen. Ihm hätte man lediglich erklärt, dass es sich um ein »Zionistentreffen« handeln würde. Da er sich selbst als »Antizionist« verstanden habe, sei er bereit gewesen, den Bombenanschlag auch durchzuführen.
Damit hatte er zwar sein Motiv benannt, gleichzeitig aber betont, dass die Idee zu diesem Anschlag nicht von ihm selbst, sondern von Dieter Kunzelmann gestammt habe, in dessen Auftrag er schließlich gehandelt hätte. Als sich dann herausstellte, dass die Bombe doch nicht explodiert war, sei dieser wütend geworden und habe ihn wüst beschimpft und ihm auch persönlich gedroht. Die Vermutung, dass Kunzelmann an der Tat beteiligt oder wenn schon nicht der unmittelbare Täter, so doch der Drahtzieher dieses antisemitischen Mordanschlags gewesen sein könnte, hatte es bereits seit Jahren gegeben. Als im Herbst 1998 dessen Autobiographie erschien, waren nicht wenige überrascht, dass er darin den Bombenanschlag ausführlich zur Sprache brachte. Dabei erweckte er ganz den Eindruck, als könne er jeglichen Verdacht an einer Mitverantwortung ausräumen. »Jedem Linken hätte eigentlich klar sein müssen,« hatte es dort geheißen, »dass eine derartige Aktion keinerlei Sympathien für die legitimen Anliegen der Palästinenser zu wecken vermochte; ganz zu schweigen davon, dass sie sich angesichts der deutschen Vergangenheit von selbst verbietet.«15 Damit schien er jedes Verdachtsmoment von sich zu weisen. Durch die abschließende Behauptung, dass es merkwürdig sei, wie wenig die Ermittlungsbehörden zur Aufklärung unternommen hätten, war klar, worauf er eigentlich hinauswollte. Am ehesten müsste es sich am 9. November 1969 um eine »Inszenierung von Geheimdiensten« gehandelt haben. Doch welche Geheimdienste, was für eine Inszenierung, in wessen Auftrag und zu welchem Zweck? Das waren Fragen über Fragen. Doch der Nebel, den er über der ganzen Angelegenheit schon so lange ausgebreitet hatte, schien sich durch Fichters Aussage endlich zu lüften. Ich war nun dazu in der Lage, mit dem Geständnis des unmittelbaren Täters und dessen Hinweisen auf seinen Hintermann ein Buch zu schreiben, mit dem dieser Fall endlich aufgeklärt werden konnte.16 Seitdem war das Phänomen des linken Antisemitismus nicht länger mehr ein blinder Fleck auf der Landkarte der bundesdeutschen Linken und der Bundesrepublik Deutschland insgesamt.
Nun war auch klar: Was sich als Stadtguerilla in der Bundesrepublik Deutschland ausgab, hatte nicht erst, wie lange Zeit behauptet worden war, mit der sogenannten Baader-Befreiung im Mai 1970 begonnen. Vielmehr hatte dieses sich als so folgenreich erweisende Kapitel bereits ein halbes Jahr zuvor eingesetzt, genauer an jenem 9. November 1969, mit dem Bombenanschlag auf die Teilnehmer einer Gedenkfeier, mit der der jüdischen NS-Opfer gedacht werden sollte. Am Anfang des heroisch beschworenen bewaffneten Kampfes stand nicht das Wort, sondern die Tat – die judenfeindliche, die antisemitische Tat.
So viel zu drei besonders markanten Beispielen, in denen ich bereits im Laufe der Jahre mit dem Titelthema zu tun hatte. In dem hier vorliegenden Band, der insofern eine Fortsetzung darstellt, geht es zwar nicht ausschließlich um blinde Flecken, aber doch um eine ganze Reihe nicht weniger markanter. Zu nennen sind:
die maßgebliche Rolle der Romantik für die damaligen Akteure in fast jeder nur denkbaren Hinsicht und das obwohl sich die meisten von ihnen als klassenkämpferisch und damit als völlig unromantisch verstanden haben dürften;
die Frage, warum gerade nach dem Bau der Berliner Mauer und damit auf dem Höhepunkt der deutschen Spaltung von einem DDR-Flüchtling wie Rudi Dutschke die Dritte Welt für die Protestbewegung entdeckt worden ist und die damit geopolitisch betrachtet so etwas wie das eigentliche Herzstück der Revolte werden konnte;
der spektakuläre Plan, während des Schah-Besuchs am 2. Juni 1967 in West-Berlin ein Attentat auf den iranischen Despoten durchzuführen, eine Geschichte, von der kaum jemand etwas wusste, obwohl es einige Zeitungen gegeben hatte, die seinerzeit davon berichteten, und die von denjenigen, die davon eigentlich etwas wissen mussten, gehütet worden ist wie ein Gralsgeheimnis;
die folgenreiche zeitliche Koinzidenz zwischen der nach Ohnesorgs Tod gerade im Entstehen begriffenen Studentenbewegung und dem mit einem israelischen Sieg endenden Sechs-Tage-Krieg, der nicht nur den Nahen Osten geopolitisch verändert hat, sondern auch die ideologische Weltordnung der bundesdeutschen Linken;
die lange Zeit verborgene Tatsache, dass die Parlamentarismuskritik der APO von einem ehemaligen italienischen Faschisten formuliert worden war, der nicht nur die vollständige Ablehnung der repräsentativen Demokratie propagiert hat, sondern sich dabei gleich auch noch auf präfaschistische Theoretiker aus der Mussolini-Ära berief;
die unterschätzte Rolle Hans Magnus Enzensbergers in Bezug auf die studentische Revolte, der nicht einfach nur ein »teilnehmender Beobachter«, wie er das im Nachhinein einmal meinte herunterspielen zu können, sondern auch ein bedeutender Mitakteur, in mancher Hinsicht sogar eine Art Joker war;
die immer wieder heruntergespielte oder vollständig abgestrittene Rolle der Gewaltaffinität bei führenden Exponenten der 68er-Bewegung wie Dutschke, Kunzelmann und Teilen des antiautoritären Flügels im SDS, aus denen sich schon bald die ersten Ansätze zum viel beschworenen bewaffneten Kampf und damit die Protagonisten des linken Terrorismus in Gestalt der RAF entwickelten;
die eigentlich überraschende und deshalb auch klärungsbedürftige Rolle einer so affirmativ wirkenden massenkulturellen Kraft wie der Popmusik für Protest und Rebellion, die in ihrer kommerziellen Ausrichtung zunächst überhaupt nicht zu der von den Akteuren an den Tag gelegten antikapitalistischen Einstellung zu passen schien, dann aber zu deren besonders wirksamen Ausdrucksform wurde;
die späte Einholung des innerhalb der 68er-Bewegung libertär besetzten Sexualitätsdiskurses durch die Debatte über sexuellen Missbrauch von Jugendlichen und Kindern, die im Nachhinein zumindest eine kaum zu entschuldigende Naivität mancher 68er im Umgang mit den schwächsten Gliedern der Gesellschaft verriet, die seinerzeit zugleich als die eigentlichen Hoffnungsträger eines grundlegenden Wandels idealisiert worden waren.
Bei alledem sollte man allerdings nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass die bloße Addition von auf diesem Wege aufgehellten blinden Flecken auch unbedingt ein Gesamtbild der 68er-Bewegung ergibt. Die hier versammelten Aufsätze sind nicht etwa Puzzleteile eines imaginären Ganzen, sondern sehr viel eher historiographische Sonden, mit denen es möglich ist, in bislang verborgene Tiefendimension der damaligen Bewegung vorzustoßen, und dadurch möglicherweise Teile ihres bislang vorherrschenden Verständnisses erschüttern und vielleicht Anstoß zu einer zwingenderen Neuinterpretation bieten zu können.
Die romantische Revolte
Je größer der historische Abstand zur 68er-Bewegung anwächst, umso stärker wird dem Betrachter bewusst, wie sehr sie mit romantischen Motiven gespickt gewesen ist. Wofür die damaligen Akteure, die sich möglichst politisch und klassenkämpferisch interpretieren wollten, nur wenig Sinn hatten, das tritt im Nachhinein umso deutlicher hervor. Und dass die in der Wahrnehmung so unterschlagene Romantik eine enorme Rolle gespielt hat, gilt mit Deutschland keineswegs nur für eines ihrer Stammländer, sondern zugleich auch für eine ganze Reihe anderer Länder, in denen die damaligen Rebellionen und Aufbrüche zumindest soziokulturell und massenmedial eine ganze Ära geprägt haben. Man denke nur etwa an die Hippie-Bewegung in dem geographisch so fernen, zugleich aber in utopischer Hinsicht so nahegelegenen Kalifornien, in der ein deutscher Schriftsteller wie Hermann Hesse mit Prosawerken wie »Siddharta« und »Der Steppenwolf« zum Kultautor hat werden können. Wenn es aber in dieser Zeit eine Bewegung gegeben hat, der eine poetische Signatur einbeschrieben war, dann ist es die gewesen, die nicht weiter klassifiziert werden musste und bereits in ihrer Zeit selbst schlicht als »Pariser Mai« bezeichnet worden ist. In dem Namen waren die »Stadt der Liebe« und der Frühlingsmonat eine Allianz eingegangen, die ihre Energie nicht aus irgendeinem politischen Bündnis bezog, sondern aus ihrem aktivistischen, in jeder nur denkbaren Hinsicht romantisch aufgeladenen Glutkern.
Ein Zitat aus einem Briefwechsel belegt, wie »romantisch« die Zeit in der an der Seine gelegenen Metropole auf ihrem Höhepunkt wohl besetzt gewesen sein muss: »Lieber Herr Professor Adorno, hier ist heute sehr schönes Wetter, und man lebt in einer Art Rauschzustand […] Die alte französische Universität kracht in allen Fugen. Unzählige Fakultäten und Universitäten haben ihre Autonomie proklamiert und sind von Studenten und Professoren besetzt. Man schläft dort, isst, feiert, diskutiert Tag und Nacht, die Studentenrestaurants, Schwimmbäder, Auditorien sind Arbeitern geöffnet. Es ist ein wahrhaft fourieristischer Zustand.«1 Dies schrieb die Doktorandin Elisabeth Lenk ihrem akademischen Lehrer Theodor W. Adorno am 15. Mai 1968 aus Paris. In ihrer Dissertation ging es um André Breton, die führende Figur des Surrealismus, der sich zusammen mit seinen Gefährten an einer Aufhebung der Romantik versucht hatte. Zwei Jahre zuvor hatte Lenk, die sich innerhalb des Frankfurter SDS einen Namen als Theoretikerin gemacht hatte, die Einleitung zu der von Adorno herausgegebenen und von dem Utopiker Charles Fourier geschriebenen »Theorie der vier Bewegungen« verfasst.
Zwei Tage später, am 17. Mai 1968, setzte sie ihren Bericht fort und schrieb an Adorno weiter: »Das Quartier Latin ist eine immense Wandzeitung. In der Sorbonne ist ein grundsätzliches Manifest zu sehen, das unter anderem vorschlägt, die Bildungskrise dadurch zu beseitigen, dass ab sofort jeder lehren kann, der sich dazu berufen fühlt und der der Kritik der Lernenden standhält; Aufhebung aller Titel, aller Prüfungen oder sonstiger Bildungsnachweise […] man diskutiert in der Regel bis Morgens früh, die Nacht ist, im Moment jedenfalls, abgeschafft […] Das Komischste […] ist, dass es selbst Polizisten gibt, die vom Taumel der Anarchie erfasst sind.«2 Rauschzustand, Autonomie, Anarchie, die Verwandlung des Alltagslebens in ein endloses Fest – das alles sind Schlüsselvorstellungen der Romantik.
Rousseau als insgeheime Zentralfigur der 68er
Auf den ersten Blick ist Karl Marx die zentrale theoretische Autorität der 68er gewesen. Von ihm und seiner Kritik der politischen Ökonomie stammten die Fundamente der damaligen System- und Gesellschaftskritik. Die 68er-Bewegung verstand sich zugleich auch als eine Renaissance und Rehabilitierung des Marxismus, nicht zuletzt wegen der zahlreichen deutsch-jüdischen Theoretiker, die sich auf Marx berufen hatten und von den Nazis vertrieben worden waren.
Auf den zweiten Blick könnte es allerdings sein, dass es einen Philosophen gab, dessen Name in den Seminaren, auf den Teach-ins und den Vollversammlungsdebatten kaum gefallen ist, der für sie möglicherweise jedoch kaum weniger wirkungsträchtig gewesen sein könnte. Denn das insgeheime Motto der 68er-Bewegung hätte eher »Zurück zur Natur« lauten und von Jean-Jacques Rousseau als von Karl Marx stammen können. Und dies in zweifacher Hinsicht:
Zum einen im Hinblick auf die Suche nach einer ursprünglichen Subjektivität wie sie in dem gegen die bürgerliche Familie gerichteten Kommunemodell zum Vorschein gekommen ist; zum anderen im Hinblick auf die Suche nach einem in seiner Legitimität nicht mehr weiter hinterfragbaren, also scheinbar selbstevidenten politischen Subjekt, das zunächst als »Basis« und später ganz allgemein als »Volk« bezeichnet wurde. Nicht ohne Grund hatte sich die Emphase für die neuen Vergemeinschaftungsformen mit der für die Basisdemokratie verbunden und eine derartige Wirksamkeit entfaltet.
Die Verknüpfung dieser beiden Rekurse auf vermeintlich Ursprüngliches, stiftete einen Subtext, der als die Suche nach der ersten Natur bezeichnet beziehungsweise charakterisiert werden kann. Bereits der abtrünnige Freud-Schüler Wilhelm Reich, der mit seinen Büchern über »Die Massenpsychologie des Faschismus« und »Die sexuelle Revolution« damals zu den besonders einflussreichen Autoren zählte, war in seiner Begeisterung für die ursprüngliche Triebnatur ohne es zu ahnen ein heimlicher Jünger Rousseaus. Das Gesellschaftliche sollte von seinen als faschistisch, kapitalistisch und imperialistisch unterstellten Prägungen freigemacht werden, um es als etwas restituieren zu können, was in seiner vermeintlich puristischen Totalität nicht mehr weiter in Frage zu stellen war. Auf diesem Wege, der sich für Marx ebenso wie die meisten seiner neomarxistischen Schüler verboten hätte,3 stellte sich jedoch häufig das Gegenteil dessen ein, was ursprünglich intendiert war.
Für den Calvinisten Rousseau existierte ein grundsätzlicher Dualismus: der zwischen Kultur und Natur. Die Natur war für ihn gut und durchweg positiv besetzt, die Kultur dagegen negativ. Seine Philosophie war anthropologisch begründet; sie stellte eine Verehrung des Natürlichen und zugleich eine radikale Kulturkritik dar, in vielerlei Hinsicht die Vorwegnahme des Kulturpessimismus, der erst im 20. Jahrhundert seine finstersten Blüten bot. Die Seelen der Menschen, argumentierte er, seien umso mehr verdorben worden, je mehr die Wissenschaften und die Künste vervollkommnet worden seien. Besonders empörten ihn Anzeichen von Heuchelei und Missgunst unter den Mitmenschen. Die bei Hofe gepflegte Etikette und Höflichkeit hielt er für völligen Schein, den es zu entzaubern gelte. Die höfische Gesellschaft von Versailles war für ihn der Gipfel der Verlogenheit. Die dort gepflegte Hochkultur erschien ihm geradezu als Perversion. Im Gegensatz zu ihr lobte er das einfache Leben und empfahl in jeder nur denkbaren Hinsicht eine Rückbesinnung zur Natur.
Der Mensch war in seinen Augen ein Naturwesen, das sich von seinen Ursprüngen entfernt hat und deshalb alles daran setzen muss, dorthin wieder zurückzukehren. Er schrieb: »Alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut; alles entartet unter den Händen des Menschen. Er zwingt einen Boden, die Erzeugnisse eines anderen zu züchten, einen Baum, die Früchte eines anderen zu tragen. Er vermischt und verwirrt Klima, Elemente und Jahreszeiten. Er verstümmelt seinen Hund, sein Pferd, seinen Sklaven. Er erschüttert alles, entstellt alles – er liebt die Missbildung, die Monstren. Nichts will er so, wie es die Natur gemacht hat, nicht einmal den Menschen. Er muss ihn dressieren wie ein Zirkuspferd. Er muss ihn seiner Methode anpassen und umbiegen wie einen Baum in seinem Garten.«4
Mit diesen Zeilen beginnt Rousseau das Erste Buch seines Erziehungsromans »Emile«, weniger ein übliches Stück Prosa als ein Traktat, mit rund tausend Seiten allerdings auch ein Monstrum von Traktat. Darin beschreibt er die fiktive Erziehung eines Jungen. Sie beginnt im frühen Kindesalter und endet mit 25 Jahren durch die Eheschließung. Um allen äußeren, als künstlich und damit verfälschend betrachteten Einflüssen zu entgehen, wird Emile in seiner Kindheit konsequent von allen kulturellen Determinanten abgeschottet. Da die natürlichen Anlagen gegeben sind, kommt es dem Erzieher lediglich darauf an, die urwüchsige Natur des Kindes möglichst optimal zur Entfaltung zu bringen. Jegliche direkte Einflussnahme auf diesen Prozess gilt es zu vermeiden, im Grunde ist sie verpönt. Ziel aller Erziehung ist seinen Worten nach »die Natur selbst«, genauer die Herausbildung sozialer Instinkte. Rousseaus pädagogisches Ethos verweist im Kern bereits auf eine Anti-Pädagogik.
In einem Streitgespräch mit dem Pädagogen Bernhard Bueb, der vor einigen Jahren mit seinem Pamphlet »Lob der Disziplin« in der Öffentlichkeit großes Aufsehen erregt und sich als ein ehemaliger »romantischer Schüler Rousseaus« bezeichnet hatte,5 wurde der starke Einfluss des Klassikers der Pädagogik auf die 68er-Bewegung von keinem Geringeren als Daniel Cohn-Bendit, der wie kein Zweiter die im Mai 1968 sich in Paris zutragende Revolte repräsentiert und vielleicht sogar personifiziert hat, im Nachhinein bestätigt: »Das Menschenbild der Linken war sehr von Rousseaus Theorie geprägt: Der Mensch ist an und für sich gut, und die Gesellschaft ist böse, und es geht nur darum, die Gesellschaft gut zu machen, die Entfremdung zu beseitigen. Dann wird der gute Mensch automatisch zum Vorschein kommen. Dies aber ist falsch.«6
Und Cohn-Bendit war nicht nur der wichtigste Sprecher der französischen Studentenbewegung, sondern arbeitete auch jahrelang in einem Kinderladen der Frankfurter Universität. Was sich während des Pariser Mai kurzfristig politisch nicht hatte erreichen lassen, das sollte nun auf die nächste Generation übertragen und in der Form antiautoritärer Erziehung langfristig umgesetzt werden.
Rousseau, Agnoli und die Basisgruppen
Doch Rousseau war nicht nur das insgeheime Vorbild für die Kinderladenbewegung, die Kritik der bürgerlichen Erziehung und der aus ihr resultierenden Anti-Pädagogik. An den Idealen des Ahnherren der »klassischen« Demokratie- und Staatstheorie orientierte sich im Kern auch das politische Denken vieler 68er. Parlamentarismus und Parteienstaat standen für die Entfremdung demokratischer Institutionen von den Interessen der Bevölkerung. Das dem Parlamentarismus zugrundeliegende Prinzip der Repräsentation wurde massiv in Frage gestellt. Gesucht wurde nach Alternativlösungen für die Ausübung politischer Herrschaft.
Das Zauberwort jener Tage lautete daher nicht ohne Grund schlicht und einfach »Basis«. An den Universitäten, die ja derselben marxistischen Terminologie nach ein Hort des Überbaus und damit ideologischer Herrschaftsausübung verdächtig waren, schoss 1968/69 eine »Basisgruppe« nach der anderen aus dem Boden – auf die Basisgruppe Soziologie folgte die Basisgruppe Germanistik, auf diese die Basisgruppe Medizin und so weiter. Und von den Universitäten, so war zeitweilig die richtungweisende Vorstellung, sollten die Basisorganisationen auf die Stadtteile, die Betriebe und schließlich von den Städten auf das Land übergreifen und auf diese Weise eine praktische Alternative zum Parteienstaat formieren.
Für diese Veränderung in der politischen Grundorientierung stellte Johannes Agnolis Traktat »Transformation der Demokratie« das theoretische Modell dar. Der Berliner Politikwissenschaftler, im Übrigen ein aus Südtirol stammender ehemaliger Mussolini-Faschist, hatte darin ganz allgemein festgestellt, dass »das Identitätsverhältnis zwischen Regierten und Regierenden« dem demokratischen Gedanken zugrundeliege.7 Hinter seiner Argumentation steckte also, ohne dass dies mit einem einzigen Wort erwähnt worden wäre, unverkennbar ein rousseauistischer Kern.
Wie eng Rousseau seine Vorstellung einer Identität von Regierenden und Regierten fasste, hatte er bereits in seinem aus dem Jahre 1755 stammenden »Diskurs über die Ungleichheit« zum Ausdruck gebracht. In einer Widmung, die dem Werk vorangestellt und an seine Genfer Mitbürger gerichtet war, hieß es: »Ich hätte mir gewünscht, in einem Land geboren zu sein, in dem der Souverän und das Volk einerlei Interesse haben, damit alle Bewegungen der Maschinerie [gemeint war hier der Staatsapparat; W.K.] auf die allgemeine Gültigkeit abzielen. Dieses kann nirgends anders sein, als wo der Souverän und das Volk in einer einzigen Person vereinigt sind. Folglich würde ich nur wünschen, unter einer mit Weisheit gemäßigten demokratischen Regierung geboren zu sein.«8
Indem Agnoli von der von Rousseau propagierten Identität von Regierten und Regierenden ausging, musste er das auf dem Repräsentationsgedanken basierende parlamentarische System verwerfen. Daraus resultierte auf der einen Seite eine prinzipielle Gegnerschaft zum Pluralismus9 und gegenüber den Parteien als ihren konkreten politischen Manifestationen.10 Auf der anderen Seite wohnte dieser Vorstellung die Gefahr inne, totalitarismusverdächtigen Alternativmodellen wie dem Rätesystem, das bekanntlich keine Gewaltenteilung kennt, das Wort zu reden.11 Unter Agnolis Vorannahmen hing die Beurteilung der bundesdeutschen Demokratie nicht von irgendwelchen Problemstellungen ab; sie war keine gradualistisch zu beantwortende Frage nach einem »besseren« oder »schlechteren« Funktionieren demokratischer Institutionen. Die Verurteilung des Parlamentarismus war vielmehr bereits vorab normativ gesetzt.
Seine Fundamentalkritik bereitete den Boden für eine Trivialisierung politischen Denkens. Was die Vermittlungsorgane demokratischer Herrschaft nicht zu schaffen schienen, das sollte nun die Gemeinschaft richten. Eine möglichst unmittelbare Form der Volksherrschaft erschien der 68er-Bewegung und vieler aus ihr entstandener Organisationen als Idealbild. Der Ruf nach Volksentscheiden und Volksabstimmungen wurde in der Folge dann in den siebziger Jahren auch immer lauter.
Romantik und Rebellion
In der ersten Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit im Jahr 1968 erschien auf ihrer Titelseite ein Leitartikel der Herausgeberin Marion Gräfin Dönhoff. Er trug den Titel »Die Rebellion der Romantiker« und verfolgte gegenüber der Bewegung, die immer noch als eine auf die Universitäten beschränkte studentische Rebellion erschien, eine Art Doppelstrategie: Würdigung des bereits Erreichten und scharfe Kritik gegenüber einer weiteren Radikalisierung. Das Stichwort Romantik diente Dönhoff dazu, den Aktivisten vage Visionen, idealistische Utopien und mangelnden Realitätssinn vorzuwerfen. So sehr die Rebellierenden Ziele verfolgt hätten, argumentierte sie, die in ihrer Kritik an der Entfremdung in der modernen Welt durchaus nachvollziehbar gewesen seien, so sehr würde nun das bereits Gewonnene wieder aufs Spiel gesetzt.
Sie verglich die Rebellion der Studenten von 1967/68 mit dem von der Jenaer Burschenschaft initiierten Wartburgfest von 1817, die dort für die Gründung eines Nationalstaates und eine freiheitliche Verfassung eingetreten waren, sowie der Jugendbewegung um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und schloss mit der Warnung: »Politische Romantik, die nach den Sternen greift, um die leider stets und immer unvollkommene Wirklichkeit zu verbessern, und die gar nicht merkt, wie diese Wirklichkeit dabei ganz ruiniert wird – von dieser Therapie haben wir nun wirklich genug gehabt.«12 Das Schlagwort von der romantischen Rebellion gehörte fortan zum Kanon der Kritik, mit der sich eine in die Defensive gedrängte bürgerliche Öffentlichkeit der immer heftiger ausfallenden Attacken ihrer Söhne und Töchter zu erwehren versuchte.
Doch Romantik und Rebellion sind nicht einfach in eins zu setzen. Die 68er-Bewegung war keine romantische Revolte in einem unmittelbaren Sinne. Der von den Romantikern betriebene Ästhetizismus stand dem Wunsch nach möglichst direkter politischer Aktion diametral entgegen. Die blaue Blume, jenes wohl am häufigsten für die Romantik genannte Symbol, das später dann als Kennzeichen auf die Wandervogelbewegung übertragen wurde,13 sollte nicht einfach zitiert, sondern eingefärbt und damit – wie eines der damaligen Modewörter lautete – in gewisser Weise »umfunktioniert« werden. Nicht ohne Grund lautete daher eine der eher gruseligen Parolen: »Schlagt die Germanistik tot, färbt die blaue Blume rot!« Hatte Carl Schmitt nicht bereits 1919 festgestellt, dass jegliche politische Aktivität »der wesentlich ästhetischen Art des Romantischen« widerspräche?14 Und von Walter Benjamin, an dem sich die damalige Kritik an der Germanistik maßgeblich orientierte, stammte der Einwand: »Es träumt sich nicht mehr recht von der blauen Blume. Wer heut’ als Heinrich von Ofterdingen erwacht, muss verschlafen haben.«15 Für einen bloßen Träumer wollte 1968 aber niemand gehalten werden. Es sollte gerade nicht darum gehen, auf irgendeinem Traumpfad der Welt zu entfliehen, sondern eher umgekehrt dem Geträumten zur Wirklichkeit zu verhelfen.
Der Romantizismus auf der Suche nach einer vermeintlich ersten Natur hatte allerdings zunächst einmal verhindert, dass die 68er-Bewegung in der Lage war, ein politisches Realitätsprinzip zu entwickeln. Dagegen ließe sich einwenden, dass sie dies auch nicht unbedingt beabsichtigt hat, schließlich ist es ihr gerade im Gegensatz zur vorgefundenen Realität um das Lustprinzip, die Verwirklichung konkreter Utopien gegangen. Das jedoch ist ein vordergründiges Argument. Denn der 68er-Bewegung war es durchaus darum gegangen, sich machtpolitisch durchzusetzen und entsprechende Erfolge zu erringen. Insofern bleibt der Einwand, dass es ihr an einem politischen Realitätsprinzip gemangelt habe, berechtigt.
Was die konservative Kulturkritik vom ersten Moment an wahrnahm, das traf in einer bestimmten Hinsicht also zweifellos zu. Die damalige Revolte war hochgradig romantisch aufgeladen.16 Über »68« schwebte eine überdimensionale romantische Wolke. Die Phänomene, in denen sie sich zeigte, waren kaum zu übersehen. Sie zeigte sich in den unterschiedlichsten Formen der Begeisterung für ein Gegenbild zur bestehenden Gesellschaft: Für die Anormalität, das Abenteuer, den Rausch und das Fest; für die Aktion, die Diskussion, die Introspektion und das ewig andauernde Gespräch; für den Traum, die Phantasie und die Utopie; für die Ferne, exotische Länder wie Völker, ob in Lateinamerika, Afrika oder in Asien, insbesondere China und Vietnam. Und nicht ganz zufällig waren für eine kurze Zeit die sogenannten Randgruppen, diese jungen gesellschaftlich Marginalisierten, mit denen man nichts anzufangen wusste und die man nur zu häufig in sogenannte Fürsorgeanstalten gesteckt hatte, als das vermeintlich einzig übrig gebliebene revolutionäre Subjekt auserkoren worden.
Als die Bewegung vorüber war, hat sich diese Wolke dann in den 70er Jahren wie bei einem starken Regenguss entladen und eine romantische Blüte nach der anderen ans Tageslicht befördert. Auch diese Phänomene konnten kaum jemandem verborgen bleiben. Sie verrieten sich in der Faszination für die Arbeiter, die Proleten, bis hin zur Renaissance des Zwanziger-Jahre-Proletkults in der Literatur; für die Ausgegrenzten, die Loser, die Kriminellen und die psychisch Gestörten, ja die im klinischen Sinne Geisteskranken; für das Psychische, die neue Subjektivität und die neue Innerlichkeit; für ein ursprünglicheres, alternatives Leben, das Landleben und das Heimatgefühl; für eine vermeintlich erste Natur im Gegensatz zu einer hochgradig vermittelten, differenzierten, von Institutionen und deren Bürokratien durchzogenen Gesellschaft.
Die Romantisierung der Welt
Was nicht nur Konservative, sondern auch Liberale wie die bereits erwähnte Gräfin Dönhoff jedoch übersahen, war die Tatsache, dass es einen entscheidenden Differenzpunkt zu einer bloßen Neuauflage der Romantik gab.17 Die neue Jugendbewegung, als die die 68er-Bewegung mit einem gewissen Recht durchaus bezeichnet werden kann, wollte – wie bereits angedeutet – keineswegs bloß ein Traumgebilde bleiben. Sie war unter politischen Vorzeichen angetreten und wollte die Welt nicht nur verschieden interpretieren, sondern sie – wie das Marx bereits in seiner 11. Feuerbach-These formuliert hatte – grundlegend verändern. Und sie wollte zunächst nicht von der Stadt aufs Land flüchten und sich der modernen Welt einfach entziehen. Stattdessen sollte einer in ihren Augen unglaubwürdigen, von der bloßen Sucht nach Konsum deformierten Gesellschaft Paroli geboten werden. Sie verstand sich politisch, wollte praktisch eingreifen, sagte deshalb dem gesamten politischen System den Kampf an und sah sich damit als Teil eines weltumspannenden antikapitalistischen wie antiimperialistischen Kampfes an. Dass sich später, als der politische Aufbruch in die unterschiedlichsten Sackgassen geführt hatte, dann doch Teile der einstigen Bewegung dafür entschieden, der Stadt den Rücken zu kehren, um in die Provinz zu gehen und ein Hochlied auf das Landleben anzustimmen, stellt keinen Widerspruch dazu dar. Im Gegenteil, es bestätigt eher die Existenz einer romantischen Grundströmung, die in den unterschiedlichsten Ausformungen der 68er-Bewegung bereits im Gange war und erst zeitversetzt vollständig ans Tageslicht gelangt ist.
Ohne ein eigenes Bewusstsein davon zu haben, schloss die 68er-Bewegung gleichwohl an die romantische Bewegung an, die nach 1770 entstanden war, im Anschluss an die Französische Revolution ihre Hochzeit erfuhr und sich in den beiden Jahrhunderten darauf als antimodernistisches Reservoir immer wieder aufs Neue zu aktualisieren vermochte. Auch die deutsche Romantik resultierte ja aus dem Freiheitsimpuls, der sich 1789 in Paris mit dem Sturm auf die Bastille Bahn gebrochen hatte und begann – wie das der Historiker Gordon A. Craig einmal formuliert hat – als »Protest der Jugend gegen die Normen der älteren Generation«, die in Kunst und Literatur vor allem gegen die Vertreter der Klassik aufbegehrte. Die Protagonisten der Frühromantik hatten zu Beginn des 19. Jahrhunderts insofern an einer revolutionären Umwälzung partizipieren wollen, jedoch nicht eingreifend, sondern in gewisser Weise nur sublimiert im Sinne einer auf die geistige Sphäre beschränkten Idealisierung. Für das, was in Paris die Jakobiner in Angriff nahmen, existierten in Preußen und den anderen Teilen Deutschlands keine Voraussetzungen, um die Gesellschaft auch praktisch umkrempeln, vor allem in sozialer Hinsicht revolutionieren zu können. Die Diskrepanz zwischen Frankreich und Deutschland hätte daher kaum größer ausfallen können: Während die einen 1789 das Ancien Regime stürzten und eine Revolution sans phrase durchführten, gaben sich die anderen bei Lichte betrachtet wohl eher einem revolutionären Gefühl hin. Das eine betraf die soziale und politische Wirklichkeit, das andere die Innerlichkeit und damit letztlich einen bloßen Traum von Veränderung. Eine historische Zäsur, eine Epochenschwelle stand einem Traumgebilde gegenüber.
Die ursprüngliche deutsche Romantik von Novalis, Tieck, Arnim, Brentano und den Gebrüdern Schlegel war insofern eine Revolte im Geiste.18 Letztere waren die Söhne eines Theologen, eines Konsistorialrates und Pastors und nach den Worten Karl August Varnhagen von Enses »ein paar ächte Revoluzionsmänner«. Da der Auf- und Umbruch nicht in der gesellschaftlichen Wirklichkeit stattfand, konnte er sich nur kulturell artikulieren lassen, als poetische Figur in einer Welt der Phantasie. Der »Fortschritt« trat zwar in Erscheinung, jedoch nicht als Ausdruck eines faktisch vollzogenen Prozesses, sondern in der Form eines Als-ob. Der Freiheitswunsch ließ sich nur in der geistigen Sphäre ausleben, in der Literatur, im Theater, in der Musik, in der Konversation und der Korrespondenz. Er blieb eine subjektive Figur, ein Wollen, dem es an der politischen Macht mangelte, gesellschaftliche Veränderungen herbeizuführen. Insofern war es zwingend, dass es sich bei der romantischen Revolte nur um ein Phänomen handeln konnte, das sich im Medium der Ästhetik Ausdruck verschaffen konnte.
Weil die Romantisierung der Welt nicht über die Einbildungskraft des Subjekts hinausgelangte, schlug sie letztlich vielleicht auch von einer rebellierenden in eine reaktionäre, staatsverherrlichende Kraft um. Mit Novalis, von dem das Symbol der blauen Blume stammte19 und der ja bekanntlich Friedrich von Hardenberg hieß, polemisierte bereits die schillerndste Figur der Frühromantik gegen Aufklärung und Fortschritt. Stattdessen setzte er, dessen Vater nach dem Tod seiner ersten Frau eine religiöse Erweckungserfahrung gehabt und sich deshalb der Herrenhuter Brüdergemeinde angeschlossen hatte, auf die Erfahrung einer religiösen Erneuerung.
Der politischen Romantik wohnte insofern nicht von ungefähr eine grundsätzliche Ambiguität inne; sie stellte die Gleichzeitigkeit eines Vor und Zurück dar. Sie versuchte die von ihr erlebte Krisenstimmung – die Diskrepanz zwischen subjektiver Potentialität und objektiver Restringenz – durch eine Fluchtbewegung, einen Rückgriff auf die Vergangenheit, zu lösen. Sie war auf eine ganz eigentümliche Weise revolutionär und reaktionär zugleich.
Die romantische Bewegung ist bekanntlich keine deutsche Erfindung gewesen. Es gab sie in England, es gab sie in Frankreich, Italien, Ungarn, Polen, Russland und anderen europäischen Ländern. In Deutschland jedoch ist sie im 19. Jahrhundert zu einer besonderen Blüte gelangt, zunächst in der Frühromantik, danach in der Hoch- und in der Spätromantik. Die Romantik entstand zunächst in Ländern mit einer protestantisch geprägten Kultur, in England und in Norddeutschland. Sie diente dazu, die Sehnsucht nach den seit der Reformation verlorengegangenen Bindungen an einen ursprünglichen Glauben zu stillen.