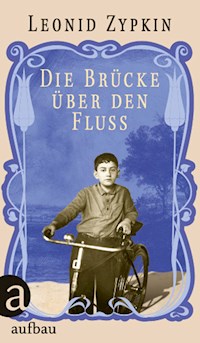
16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die bewegende Familiengeschichte eines Unbeugsamen Zypkins Familie floh 1941 vor den Nazis von Minsk bis zum Ural. Die zurückgebliebenen Verwandten kamen im Ghetto um. Jahre später erkundet er, assoziativ und in Zeitüberblendungen ähnlich wie W. G. Sebald, die verlorenen Territorien und sein früheres Ich. Seine Sätze verweben Vergangenheit und Gegenwart, Erinnerung und Wünsche, Ekel und Zartheit. Sie kommen der Wirklichkeit so schmerzlich nahe, wie es nur dem gelingen kann, der zum Chronisten einer unmöglichen Zeit wird und dem jahrzehntelang nichts anderes bleibt, als für die Schublade zu schreiben – und der doch nicht aufhören kann. Erstmals auf Deutsch – ein Buch gegen das Vergessen der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts »Der Triumph eines Mannes aus dem Untergrund.« New York Review of Books. »Ein einzigartiger Klassiker, der gerade noch rechtzeitig aus dem Kerker der Zensur befreit wurde.« James Wood, The Guardian »Eine der schönsten Entdeckungen der jüngeren Literatur.« Christoph Keller, Die Zeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über Leonid Zypkin
Leonid Zypkin wurde 1926 als Sohn russisch-jüdischer Eltern in Minsk geboren. Nur knapp überlebte er den stalinistischen Terror der dreißiger Jahre und die deutschen Angriffe auf die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Er studierte Medizin und arbeitete als Pathologe in Moskau. Zuletzt war er starken Repressalien ausgesetzt, weil sein einziger Sohn die SU in Richtung Amerika verlassen hatte; seinem eigenen Ausreiseantrag wurde nie stattgegeben. Sein literarisches Werk, das durch die Zensur und die von ihr ausgehende Einschüchterung, bis zu seinem Tod unveröffentlicht blieb, umfasst neben seinem einzigen Roman »Ein Sommer in Baden-Baden« Erzählungen, Novellen und Lyrik. Er starb 1982, als sein Roman, zwei Jahre nach Fertigstellung und außer Landes geschmuggelt, gerade in Fortsetzungen in einer russischsprachigen Exilzeitung in New York zu erscheinen begann.
Ganna-Maria Braungardt, geboren 1956, studierte russische Sprache und Literatur in Woronesh (Russland). Seit 1991 arbeitet sie als freiberufliche Übersetzerin und übertrug u. a. Ljudmila Ulitzkaja, Boris Akunin, Jewgeni Wodolaskin und Leonid Zypkin ins Deutsche. Ganna-Maria Braungardt lebt in Berlin.
Michail Zypkin, geboren 1950 in Moskau, beantragte 1977 gemeinsam mit seiner Ehefrau ein Visum und emigrierte in die USA. Er ist Politikwissenschaftler und lebt in Pacific Grove, Kalifornien.
Informationen zum Buch
Die bewegende Familiengeschichte eines Unbeugsamen
Zypkins Familie floh 1941 vor den Nazis von Minsk bis zum Ural. Die zurückgebliebenen Verwandten kamen im Ghetto um. Jahre später erkundet er, assoziativ und in Zeitüberblendungen ähnlich wie W. G. Sebald, die verlorenen Territorien und sein früheres Ich. Seine Sätze verweben Vergangenheit und Gegenwart, Erinnerung und Wünsche, Ekel und Zartheit. Sie kommen der Wirklichkeit so schmerzlich nahe, wie es nur dem gelingen kann, der zum Chronisten einer unmöglichen Zeit wird und dem jahrzehntelang nichts anderes bleibt, als für die Schublade zu schreiben – und der doch nicht aufhören kann.
Erstmals auf Deutsch – ein Buch gegen das Vergessen der großen Katastrophen des 20. Jahrhunderts
»Der Triumph eines Mannes aus dem Untergrund.« New York Review of Books.
»Ein einzigartiger Klassiker, der gerade noch rechtzeitig aus dem Kerker der Zensur befreit wurde.« James Wood, The Guardian
»Eine der schönsten Entdeckungen der jüngeren Literatur.« Christoph Keller, Die Zeit
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Leonid Zypkin
Die Brücke über den Fluss
Roman
Aus dem Russischen von Ganna-Maria Braungardt
Mit einer Nachbemerkung von Michail Zypkin
Inhaltsübersicht
Über Leonid Zypkin
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4–5–6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Nachbemerkung
Fußnoten
Impressum
1
Die Metro riecht 1972 genauso wie 1936, und einen Augenblick lang empfinde ich die gleiche grundlose, durchdringende Freude wie damals, 1936, und ich denke, wenn ich jetzt aussteige und hinausgehe, stehe ich in der blendenden Julisonne vor der Metrostation Sokol – warum ich damals dort war, weiß ich nicht mehr, ich erinnere mich nur an die blendende Sonne, an die neuen Hochhäuser, die ich noch nie zuvor gesehen hatte, und an den Geschmack von beißend kaltem Eskimo-Eis – Eskimo-Eis gibt es nur in Moskau, es ist beinahe ein Synonym für Moskau –, doch warum erinnere ich mich partout nicht an die Gesichter derer, die mit mir zusammen in der Metro saßen, mit der Rolltreppe hinauffuhren, durch die Straßen liefen? Wie sahen sie aus? Wem ähnelten sie? Den Filmhelden aus »Zirkus« oder »Fröhliche Burschen« mit den unmäßig breiten Krawatten (die wieder zurückgekehrt sind) und den sackartigen Hosen, mit den naiven und gutmütigen Gesichtern voller Glauben an die glückliche Zukunft oder der Schauspielerin und Ehefrau von Lunatscharski Natalja Rosenel – lange Kleider, Bubikopf, staunend aufgerissene Augen? Ich strenge mein Gedächtnis an, aber vergebens: keine Gesichter, keine Kleidung, keine Menschen. Was ist das – meine Vergesslichkeit oder die Vergesslichkeit der Geschichte? Und werden nicht genauso auch ich und meine Waggonnachbarn in der Metro von 1972 aus dem Gedächtnis des Schülers in der Nylonjacke, der mir jetzt gegenübersitzt, verschwinden? – er trägt schon einen fast modischen Haarschnitt, ich erahne in ihm bereits den jungen Studenten, schlank und hochgewachsen, wie diese ganze Generation, der mit einer lässigen Kopfbewegung das ins Gesicht fallende Haar zurückwirft, und den Erwachsenen, keinen Studenten mehr, sondern einen Mann, frisch verheiratet, mit Ehering und einem vollen Einkaufsnetz, der nach Hause eilt – und auch er wird, genau wie ich, aus dem Gedächtnis derer verschwinden, die ihn jetzt wahrnehmen, und einen Augenblick lang sehe ich alle in diesem Waggon – Besorgte und Sorglose, Menschen, die sich gerade von einer Frau getrennt haben oder die zu einem Rendezvous unterwegs sind, solche, die an die morgendliche Plansitzung denken, die technische Zeichnungen dabeihaben, Ordner, Konspekte, vorbereitete Anwaltsplädoyers auf zweiundzwanzig Schreibmaschinenseiten – der Bleistift gleitet die Zeilen entlang und unterstreicht besonders wichtige Stellen, die während der Sitzung betont werden müssen –, einen Augenblick lang sehe ich sie alle in der gleichen Lage vor mir – mit auf der Brust gefalteten Händen, zurückgeworfenem Kopf, mit gelbem, wächsernem Gesicht –, sie alle werden wie auf Kommando – die einen früher, die anderen später – verschwinden und nichts hinterlassen, und genauso werden die Scharen von Menschen verschwinden, die an Feiertagen durch die breiten Straßen flanieren, und manchmal kommen sie alle, die mit mir in einem Waggon sitzen, mir vor wie kostümierte Zweibeiner mit Aktentaschen und Einkaufsbeuteln in der Hand.
2
Die bucklige Straße mit den glänzenden Pflastersteinen führt steil zum Fluss hinunter. Ganz am Rand, dicht am Trottoir, fährt ein dicker, kurzbeiniger Halbwüchsiger mit ungesunden Ringen unter den Augen auf einem Fahrrad. In seinen Ohren hämmert sein Herzschlag, er drückt mit dem Fuß auf die Rücktrittbremse, er wird von rumpelnden Fuhrwerken überholt, doch ihm scheint es, als jagte er in atemberaubendem Tempo dahin, überholte jeden und alles, und so wird es ihm sein Leben lang vorkommen, denn er wird immer zu stolz sein, sich mit dem Bewusstsein seiner Schwäche abzufinden. Glücklich unten angekommen, fährt er mit Siegermiene auf die Holzbrücke – dort fließt der Nerotsch, ein schmales Flüsschen, das auf keiner noch so detaillierten Landkarte verzeichnet ist, was den Jungen ein wenig kränkt, denn ragen am Ende des Sommers auch rostige Konservenbüchsen und mit Schlingpflanzen um
wundene kaputte Flaschen aus dem Wasser, tritt der Fluss doch im Frühjahr weit über die Ufer und überschwemmt den Stadtpark, ja selbst die kleinen Häuser dahinter, seine Strömung wird stark, das dunkle Hochwasser überspült beinahe die Brücke, große Eisschollen schlagen gegen die Pfeiler und bringen die Brücke zum Beben, auf dem Fluss schwimmen entwurzelte Bäume, Balken und Bretter – an solchen Tagen kommt dem Nerotsch nur die Wolga gleich, die der Junge noch nie gesehen hat – hinter der Brücke biegt er nach links ab, legt sich in die Pedale und strampelt die Straße bergauf zum absurden Gebäude des Opernhauses, das an ein altes Schloss erinnert –, einige Tage zuvor hat ihm Tussik, der Cousin seiner Mutter, auf dem Opernvorplatz, wo jetzt die lokalen Halbstarken herumradeln, viele von ihnen freihändig, das Fahrrad nur mit einer kaum merklichen Neigung des Oberkörpers steuernd – hier hat ihm Tussik vor einigen Tagen das Radfahren beigebracht. Er hielt mit einer Hand den Sattel fest, mit der anderen den Lenker und lief neben ihm her, ganz nass geschwitzt, denn es ist gar nicht leicht, ein Fahrrad mit einem dicken Jungen im Gleichgewicht zu halten – mal musste er es abfangen, mal wegstoßen, damit der Junge samt Fahrrad nicht auf ihn kippte, und dabei sagte er immer wieder: »Tritt zu, Gawrila« – der Junge heißt zwar keineswegs Gawrila, doch dieser Zuruf klang für
ihn verwegen, wie etwas, das ihn mit Tussik gleichstellte – zwei Männer, die einander ohne viele Worte verstehen –, er trat eifrig in die Pedale, und sein Rad machte sich immer öfter frei, so dass sein Lehrer das Gefährt nicht mehr steuern musste, sondern es nur noch leicht am Sattel hielt, was der Junge bisweilen sogar als störend empfand, er strampelte noch stärker und riss sich für einen Augenblick ganz von der Stütze los – sein Lehrer lief nur noch neben ihm, und der Junge konnte kaum glauben, dass er allein fuhr, ohne fremde Hilfe, als hätte er plötzlich die Arme geschwungen und sei losgeflogen – sie war beängstigend und zugleich süß, diese brennende, urplötzlich erlangte Selbstständigkeit, die mit einem Sturz zu enden drohte –, er blickte sich um: Tussik rannte nicht mehr, er ging nicht einmal, er stand nur da, seine Gestalt wurde mit jeder Sekunde kleiner, er machte eine Handbewegung, die bedeutete: »Schneller treten!« – der Junge verlor das Gleichgewicht, stürzte auf den Asphalt, schlug sich die Knie blutig, Tussik kam angelaufen, half ihm auf, und alles begann von vorn. Tussik war groß, jedenfalls war er der Größte in ihrer Familie, er hatte glattes dunkles Haar, das leicht in Unordnung geriet und ihm in die Stirn fiel, tiefliegende ruhige graue Augen, in denen bisweilen etwas Draufgängerisches aufblitzte – sein Großvater war Donkosak gewesen, ein Foto von ihm
steckte in dem goldenen Medaillon, das Tussik von seiner Mutter geerbt hatte, der Junge klappte es gern auf und betrachtete das Foto: Der Donkosak hatte breite Wangenknochen, einen langen hellen Schnauzbart wie Taras Bulba1 und helle Augen, die noch tiefer lagen als die von Tussik – der Junge war sehr stolz auf diese Verwandtschaft, obgleich niemand aus der Familie diesen Großvater je gesehen hatte – seine Tochter, Tussiks Mutter, hatte für die Heirat zum Judentum übertreten müssen, und der Donkosak, offenbar nicht erfreut darüber, hatte sich nie blicken lassen; Tussiks Eltern waren gestorben, als er zwei oder drei Jahre alt war, seitdem lebte er bei der Familie seiner Tante, der Großmutter des Jungen – sie liebte Tussik mehr als ihre eigenen Töchter – das sagte sie jedenfalls –, vielleicht wegen seiner ruhigen, fügsamen Art, vielleicht, weil sie sich durch ihn, das Waisenkind, als Wohltäterin fühlen konnte. Der Junge fährt auf den Platz vor der Oper und mischt sich unter die anderen, die um die kleine Grünanlage herumradeln – ein knappes Jahr später wird im Gebäude der Oper der deutsche Stab untergebracht sein, und die Familie des Jungen, die in der Evakuierung lebt, wird an einem ebensolchen klaren Frühherbsttag wie jetzt, der bereits den Winter 1941 ahnen lässt,
eine Postkarte von Tussik erhalten – die einzige Karte mit seiner akkuraten, nach links geneigten Handschrift –, Tussik bittet, sie sollten sich keine Sorgen machen, bei ihm sei alles in Ordnung, aber wie gehe es ihnen, wie gehe es Mama? – so nannte er die Großmutter des Jungen –, und auf der Rückseite der Karte stand in seiner Handschrift die Adresse des Absenders: »247 B.F.W« – Erkundigungen bei Bekannten ergaben, dass »B.F.W« Bataillon des Flugplatzwartungsdienstes bedeutete, und der Junge versuchte sich vorzustellen, was Tussik da tat – er glaubte, Tussik transportiere Munitionskisten oder fege das Flugfeld, dabei war Tussik ein Kommandeur, wenn auch ein niederer – er war während des Polenfeldzuges beim Militär gewesen und hatte sich zum Unterleutnant mit einem Rhombus hochgedient – der Junge erinnerte sich genau an das kleine Foto von Tussik mit diesem Rhombus am Kragen und dem keck schräg aufgesetzten Käppi auf dem Kopf – diese Aufnahme fanden sie später bei entfernten Verwandten wieder und ließen sie vergrößern, es wurde fast ein Porträtfoto – jetzt liegt es bei meiner Mutter auf dem Schreibtisch, unter Glas, neben anderen Fotos und einer Gruppenaufnahme unserer Familie – darauf ist der Junge noch ganz klein und dünn, im Matrosenanzug und mit abstehenden Ohren. Als der knietiefe Schlamm auf den Straßen der Stadt im Ural allmäh
lich gefror, sich an den Wänden des Zimmers, in dem die Familie des Jungen lebte, Raureif bildete und die Ahnung des nahenden Winters zu einem unglaublich frühen Winter wurde – aber vielleicht war das im Ural immer so –, als auf den Straßen und Dächern der eingeschossigen Holzhäuser mit den geschnitzten Fensterrahmen Schnee lag, das auf dem Markt gekaufte Reisig sich mühelos mit einem Kinderschlitten transportieren ließ und die Milch in Form von durchscheinenden gefrorenen Scheiben verkauft wurde, da kam ein ganzes Bündel Briefe und Postkarten mit dem Stempel: »Adressat verzogen«, doch der Gedanke an Tussiks Tod behauptete sich in der Familie nicht gleich, selbst als der Krieg zu Ende war, hofften wir noch immer und fragten nach, bis wir schließlich erfuhren, dass die Unterkünfte von Tussiks Einheit eines Nachts von deutschen Panzern überrollt worden waren. Tussik und seine Kameraden waren in Scheunen am Rande eines Dorfes untergebracht gewesen, und der Junge versuchte, sich Tussiks Gesicht im letzten Augenblick seines Lebens vorzustellen, als ein Panzer in die Scheune fuhr, sich nach rechts und links drehte und mit seinen Ketten alle zermalmte, die sich darin befanden, oder wie er zur Erschießung geführt wurde, denn er war ja Kommandeur, Kommunist und Jude, sie konnten ihn also nicht in Gefangenschaft behalten haben – doch Tus
siks Todesmoment entzog sich der Vorstellung des Jungen, denn Tussik hatte ihn mit einem Finger aufs Kreuz legen können, er war der Größte gewesen, nicht nur in der Familie des Jungen, sondern im ganzen Haus, und wenn Klassenkameraden den Jungen besuchten, hatte er immer die Zimmertür offen gelassen, damit sie Tussik sahen, wenn er im Flur vorbeiging. Tussik konnte nicht von fremder Hand gestorben sein – er war stärker als alle anderen! Der Junge lachte traurig über diese Gedanken, denn als er die Umstände von Tussiks Tod erfuhr, war er kein Junge mehr. Ich träume noch heute oft von ihm, und es ist fast immer der gleiche Traum: Ich weiß, dass Tussik tot ist, und zugleich ist er bei uns – er lebt in unserer Vorkriegswohnung, nein, er lebt nicht dort, er ist anwesend – er erscheint nur nachts, fremd und unnahbar, ich kann nie mit ihm sprechen oder ihn auch nur sehen –, er schläft an seinem gewohnten Platz, auf der durchgelegenen Couch mit den kaputten Sprungfedern – in dem riesigen Zimmer, größer als unsere jetzige Dreizimmerwohnung, das durch einen Wandschirm geteilt ist, hinter dem Großmutter und Großvater leben –, genau auf dieser Couch hat er dem Jungen Kampfsportgriffe gezeigt, ihn mit einer Hand aufs Kreuz gelegt, ihn dann gepufft und geknetet und dabei furchterregende Laute ausgestoßen – ich betrete das Zimmer, doch die Couch ist leer,
nur zerknüllte Laken und kaputte Sprungfedern, und ich ahne, nein, ich weiß genau, dass Tussik bei seiner Freundin ist, dass er dort lebt, dort spricht er auch und ist wieder wie früher – Großmutter war sehr stolz darauf, dass Tussik Gehorsam gezeigt und diese Frau nie geheiratet hat, obwohl er mehrere Jahre mit ihr zusammen war – Großmutter mochte sie nicht, sie glaubte, diese Frau liebe Tussik nicht, sie habe andere, eigennützige Motive –, sie trug einen Bubikopf und eine Brille, doch selbst mit Brille blinzelte sie stets ein wenig – manchmal nahm Tussik den Jungen mit zu ihr – der Junge war heimlich eifersüchtig auf sie, vielleicht verehrte er sie genau deshalb, außerdem, wenn Tussik sie liebte, musste sie ja etwas Besonderes haben – Großmutter brüstete sich immer mit ihren großzügigen Ansichten – auch in der Familie fanden alle, sie sei sehr liberal und habe einen Hang zu philosophischen Verallgemeinerungen – sie sagte gern belehrend-philosophische Sätze wie: »Wer Vater und Mutter nicht ehrt, dem ist das Himmelreich verwehrt«, »C’est la vie« oder dergleichen, und manchmal setzte sie sich ans Klavier und spielte mit ihren gichtkrummen Fingern eine Romanze, die einzige, die noch übrig war aus ihrem, wie sie behauptete, einst reichen Repertoire; in der Romanze ging es um eine Fee, die am Ufer eines Flusses lebt, und um einen gewissen Mark, in dessen Ar
men sie sich glutvoll windet – das verstand der Junge nie: Wieso windet sich die Fee in seinen Armen? –, Großmutters Darbietung war eher eine Art Sprechgesang, und bei den Passagen der Klavierbegleitung, in denen die ganze Tiefe der Gefühle von Mark oder der Fee oder vielleicht von beiden ausgedrückt werden sollte, verspielte sich Großmutter, ihre krummen Finger blieben hinter der Entwicklung des musikalischen Gedankens zurück und schlugen die falschen Tasten an – Großmutters Eltern, die für ihre Zeit als fortschrittlich galten, hatten ihren Kindern Klavierunterricht erteilen lassen und die Tochter als Achtzehnjährige nach Paris geschickt, wo sie Zahnheilkunde studierte und sich das Rauchen angewöhnte – manchmal ließ sie den Jungen nach dem Mittagessen eine Papirossa und Streichhölzer aus ihrem Zimmer holen – um die Streichhölzer nicht mitnehmen zu müssen, kam der Junge mit einer angezündeten Papirossa zurück – meine Frau verzeiht meiner Mutter bis heute nicht, dass sie das zuließ –, Großmutter schätzte die erlangte Selbstständigkeit mehr als alles andere auf der Welt, deshalb übte sie philosophische Nachsicht mit Großvater, der in der Familie als geizig galt, Großmutter Verschwendungssucht vorwarf und Teller nach ihr schleuderte, was er mit saftigen Beschimpfungen auf Jiddisch begleitete, bisweilen jedoch ebenfalls einen Hang zu beleh
renden Aphorismen zeigte, sein liebster lautete: »Kosak, gib acht, dir droht der Tod/wirst wie ein kleines Kind ertrinken«2 – ein Satz, der in unserer Familie bis heute benutzt wird. Großvater trug einen Schnurrbart und war Gynäkologe und Geburtshelfer, er nahm den Jungen häufig mit zu Hausbesuchen – der Junge saß in einer Droschke mit lackiertem Dach und Luftreifen, vor sich den breiten Rücken des Kutschers, und wartete geduldig vor einem Holzhaus in einer ungepflasterten Vorstadtstraße, während der Großvater eine Patientin untersuchte, denn auf der Rückfahrt würden sie sämtliche Fuhrwerke und sogar viele Droschken überholen; abends nahm ihn der Großvater oft mit auf Spaziergänge – sie liefen die Hauptstraße ihrer Stadt entlang, Großvaters unverwüstliche hohe Schuhe knarrten anheimelnd, und fast alle Passanten, besonders die Frauen, grüßten Großvater zuerst, und es schmeichelte dem Jungen, dass die ganze Stadt seinen Großvater kannte; als Großvater beerdigt wurde, rollte sein Kopf mit dem schütteren Haarschopf, der vom Dezemberwind gezaust wurde, von einer Seite zur anderen und schlug dabei mehrfach gegen die Sargwände, denn der Katafalk fuhr über Kopfsteinpflaster, und der Junge
fand es seltsam, dass Großvater keinen Schmerz spürte und nicht fror, nur im Anzug – er lief hinter dem Katafalk mit den gedrechselten schwarzen Säulen, die ein ebensolches Dach stützten, und vor dem Orchester und dem Trauerzug, der sich bestimmt über mehrere Häuserblocks hinzog, und aus den Hauseingängen und Gartenpforten traten Frauen, schlugen die Hände zusammen, riefen Ach und wehklagten: »Mein Gott, das ist doch der Doktor, der mich entbunden hat!« – es gefiel dem Jungen, dass er an der Spitze eines so großen Zuges lief, unter den Klängen eines Orchesters, und dass die ganze Stadt seinen Großvater begleitete – von den wehklagenden Frauen wusste er allerdings eher aus der Familienüberlieferung, denn er selbst erinnerte sich nicht daran, trotzdem sehe ich die trauernden und wehklagenden Frauen, die an der Straße ein Spalier bilden wie zur Begrüßung eines Kosmonauten, noch heute deutlich vor mir – Großvater hatte vor seinem Tod darum gebeten, ihm Morphium zu spritzen, um das Ende zu beschleunigen, und während jemand in die Apotheke ging, rief er seinen Enkel zu sich, um sich von ihm zu verabschieden – der Junge beugte sich zu ihm hinunter, und die Berührung von Großvaters kratzigem Schnurrbart behielt er sein Leben lang in Erinnerung – genau ein Jahr später, am selben Tag, verschwand ihr Hund, ein kleines weißes Tier mit
schwarzen Flecken – er hinterließ manchmal auf dem Linoleum Pfützen, die an eine Acht erinnerten – als sie von der Beerdigung nach Hause zurückkehrten, aßen sie, denn nach dem langen Aufenthalt draußen bei Frost waren alle sehr hungrig – der Junge erinnerte sich, dass es nach der Suppe Fleischklopse gab und er sie mit großem Appetit verspeiste – doch womöglich erfuhr er von dem Essen und den Fleischklopsen erst später, von seiner Tante. Sie war am Tag nach Großvaters Tod mit ihrem Mann aus Moskau angereist, am frühen Morgen, mit dem Zug, der auf seiner Fahrt von einer Grenze zur anderen ihre Stadt passierte – der Junge hatte diesen Transsibirien-Express nie zu Gesicht bekommen, doch ihm schien, er müsse aus gelben Holzwaggons mit Spiegelfenstern bestehen – Großvater war in der Nacht gestorben, als der Junge schon schlief, gleich nach der Morphium-Spritze, und als der Junge aufwachte, war die Tante schon da, als wohnte sie immer hier – bei einem ihrer Besuche hatte sie dem Jungen einen Kanarienvogel im Käfig mitgebracht, als der Kanarienvogel gestorben war, wurde ihm der Bauch aufgeschnitten, und es stellte sich heraus, dass er voller Würmer war – der Junge nötigte die Tante jedes Mal zum Zeichnen, er lauerte auf jede freie Minute von ihr, um sie mit Alben oder Blättern zu belagern – beim Zeichnen schob sie die Zunge in die Wangentasche und kaute
darauf herum, und das sah bei ihr sehr hübsch aus – wenn der Junge Hausaufgaben machte, schob er ebenfalls die Zungenspitze heraus, besonders wenn er sich viel Mühe gab, die Tante sagte, das habe er von ihr, und darauf war er stolz, denn sie konnte sehr genau eine Vase oder ein Glas mit einer Blume darin abzeichnen, manchmal sogar mit Farben, doch wenn der Junge sie bat, mal einfach so etwas zu malen, erwiderte sie, sie könne nur abzeichnen – später erfuhr der Junge, dass sie von Beruf »Kunsthistorikerin« war – als er sie als Erwachsener in Moskau besuchte, nahm sie ihn oft mit zu Vernissagen, Jubiläumsveranstaltungen oder kunstwissenschaftlichen Disputen, denn er glaubte, seine wahre Bestimmung sei die Malerei, und sie bestärkte ihn darin – wenn sie ihn einem ihrer Kollegen vorstellte, bezeichnete sie ihn als ihren geistigen Sohn, wobei sie ihm gönnerhaft auf die Schulter klopfte, obwohl sie viel kleiner war als er, und erzählte, dass er einmal für ihren Chauffeur gehalten worden sei – er trug damals einen in der Evakuierung gekauften Uniformmantel auf –, und wenn sie im Taxi saßen und draußen Menschen vorbeilaufen oder in einer Schlange stehen sahen, dann sprach sie davon, dass jeder dieser Menschen sein eigenes, besonderes Leben habe – einer habe wahrscheinlich gerade seine Mutter begraben, ein anderer eile zu einem Rendezvous – »Weißt du, wie bei





























