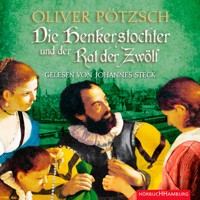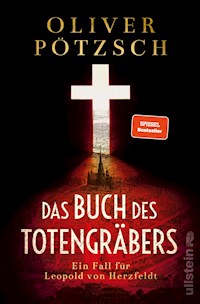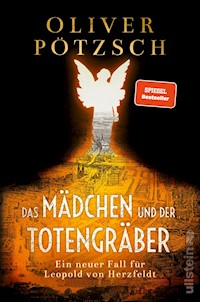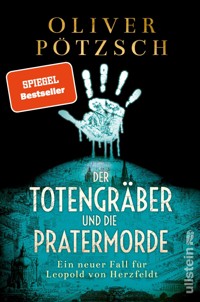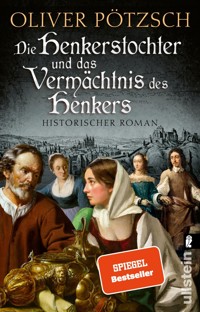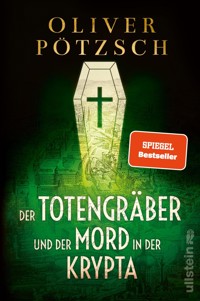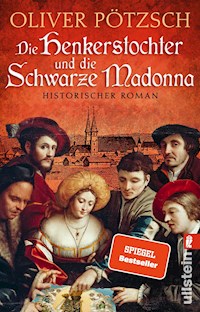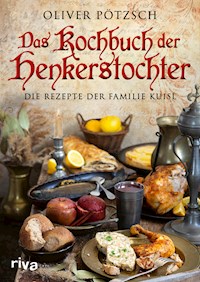9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine mächtige Burg, eine alte Legende und der Kampf um die Krone 1524: Die deutschen Lande werden von den Bauernkriegen zerrissen. Dem Adel droht der Verlust der Macht, dem Volk Hunger und Tod. Die Herrschaft Kaiser Karls V. ist in Gefahr. In den Wirren dieser Zeit stoßen Agnes, die Burgherrin der einst mächtigen Stauferburg Trifels, und Mathis, der Sohn des Burgschmieds, auf ein altes Geheimnis. Schon bald wird ihnen bewusst, dass ihre Entdeckung nicht nur über ihr eigenes Schicksal, sondern auch die Zukunft der Krone entscheiden wird. Bestsellerautor Oliver Pötzsch hat einen großen Roman über die legendäre Burg der Staufer geschrieben. Der Trifels: Hort vieler Legenden und Schlüssel zum Kaiserthron.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-0606-3
© 2013 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Dieses Werk wurde vermittelt von der Agentur Gerd Rumler.
Alle Rechte vorbehalten.
Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung,
Verbreitung, Speicherung oder Übertragung
können zivil- oder strafrechtlich
verfolgt werden.
eBook: LVD GmbH, Berlin
Einmal mehr für Katrin, Niklas und Lily.
Meine Burg.
Was wäre ich ohne euch!
Der alte Barbarossa,
der Kaiser Friederich,
Im unterird’schen Schlosse hält er verzaubert sich
Er ist niemals gestorben, er lebt darin noch jetzt
Er hat im Schloss verborgen zum Schlaf sich hingesetzt
Er hat hinabgenommen
Des Reiches Herrlichkeit
Und wird einst wiederkommen
Mit ihr, zu seiner Zeit
Friedrich Rückert: Barbarossa
Dramatis Personae
Burg Trifels
Philipp Schlüchterer von Erfenstein, Ritter und Burgvogt
Agnes von Erfenstein, seine Tochter
Martin von Heidelsheim, Kämmerer des Burgvogts
Margarethe, Zofe
Mathis, Sohn des Burgschmieds
Hans Wielenbach, Burgschmied
Martha Wielenbach, Frau des Burgschmieds
Marie Wielenbach, ihre kleine Tochter
Hedwig, Köchin
Ulrich Reichhart, Geschützmeister
Die Burgmannen Gunther, Eberhart und Sebastian
Radolph, Stallmeister
Pater Tristan, Burgkaplan
Annweiler
Bernwart Gessler, Stadtvogt von Annweiler
Elisabeth Rechsteiner, Hebamme
Diethelm Seebach, Wirt des Gasthauses zum »Grünen Baum«
Nepomuk Kistler, Gerber
Martin Lebrecht, Seiler
Peter Markschild, Wollweber
Konrad Sperlin, Apotheker
Johannes Lebner, Stadtpfarrer
Schäfer-Jockel, Anführer des hiesigen Bauernhaufens
Burg Scharfenberg
Graf Friedrich von Löwenstein-Scharfeneck, Herr auf Burg Scharfenberg
Ludwig von Löwenstein-Scharfeneck, sein Vater
Melchior von Tanningen, Barde
Andere
Rupprecht von Lohingen, herzoglicher Verwalter auf Burg Neukastell
Hans von Wertingen, Raubritter auf der Ramburg
Weigand Handt, Abt des Klosters Eußerthal
Barnabas, Hurenhändler
Samuel, Marek und Schniefnase, Gaukler und Halsabschneider
Mutter Barbara, Marketenderin und Heilerin
Agathe, Wirtstochter und Gefangene des Hurenhändlers Barnabas
Caspar, Agent in unbekannter Mission
Historische Figuren
Karl V., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation
Mercurino Arborio di Gattinara, Großkanzler Karls V.
Franz I., König von Frankreich
Königin Claude, Gemahlin von Franz I.
Truchsess Georg von Waldburg-Zeil, Heerführer des Schwäbischen Bundes
Götz von Berlichingen, Raubritter und Anführer des Odenwälder Haufens
Florian Geyer, Ritter und Anführer des Schwarzen Haufens
Prolog
Palast von Valladolid, 3. März,
Anno Domini 1524, spätnachts
Der Kaiser hielt die Welt in seinen Händen, doch er war nicht glücklich.
Mit langen manikürten Fingern fuhr Karl V. über die glattpolierte Oberfläche der Erdkugel, die all die Länder zeigte, deren Herrscher er seit einigen Jahren war. Die Finger wanderten von Flandern bis Palermo, vom sturmumtosten Gibraltar bis nach Wien an der Donau, von Lübeck an der Nordsee bis hin zu jenem Land, das man neuerdings Amerika nannte und aus dem Gold in dickbäuchigen Galeeren nach Europa kam. Der Kaiser gebot über ein Reich, in dem die Sonne niemals unterging.
Und nun war dieses Reich in Gefahr.
Karl kniff die Augen zusammen und suchte auf der hölzernen Kugel einen winzigen Ort, der nicht größer als ein Fliegendreck sein konnte. Doch obwohl der Globus von einem der besten Kartographen seiner Zeit stammte und viele Tausend Gulden gekostet hatte, konnte er den Ort nicht finden. Seufzend verpasste der Habsburger Kaiser der Kugel einen Schubs, so dass sie wild zu rotieren begann. In der lackierten Oberfläche spiegelte sich sein Gesicht. Erst vor einigen Tagen war Karl V. vierundzwanzig Jahre alt geworden, er war ein eher schwächlicher junger Mann, dessen ungewöhnliche Blässe in Adelskreisen als besonders vornehm galt. Sein Unterkiefer war leicht nach vorne geschoben, was ihn immer etwas trotzig aussehen ließ; die Augen quollen leicht hervor wie bei allen Mitgliedern seiner Familie. Während sich die Kugel weiterdrehte, wandte er sich wieder den Briefen auf seinem Schreibtisch zu.
Besonders einem Brief.
Es waren nur ein paar hingekritzelte Zeilen, aber sie konnten den Lauf der Welt verändern. Unter dem Text fand sich eine hastige Zeichnung, das Porträt eines bärtigen Mannes. Eingetrocknete Blutspritzer auf dem Rand des Blattes verrieten, dass dieser Brief nicht gewaltlos in die Hände des Kaisers gelangt war.
Ein leises Klopfen ließ Karl aufblicken. Beinahe lautlos öffnete sich eine der hohen Flügeltüren, und sein Erzkanzler, Marchese Mercurino Arborio di Gattinara, trat ein. Mit der schwarzen Schaube und dem ebenso schwarzen Barett glich er wie so oft einem leibhaftigen Dämon.
Es gab nicht wenige Menschen am spanischen Hof, die behaupteten, dass er tatsächlich einer war.
Gattinara verbeugte sich tief, doch Karl wusste, dass diese Demut nur ein Ritual war. Der Kanzler war beinahe sechzig und hatte in anderen Funktionen bereits Karls Vater Philipp und auch seinem Großvater Maximilian gedient. Seit dem Tode Maximilians vor fünf Jahren herrschte nun Karl über das größte deutsche Reich seit seinem Namensvetter Karl dem Großen.
»Eure Exzellenz«, sagte Gattinara, während er den Kopf weiterhin gesenkt hielt, »Ihr habt mich gerufen?«
»Ihr wisst, warum ich Euch trotz der späten Stunde herbestellt habe, Gattinara«, erwiderte der junge Kaiser. Er hielt den blutbefleckten Brief hoch. »Wie konnte das passieren?«
Erst jetzt hob der Kanzler den Blick, seine Augen waren eisgrau. »Nun, wir haben den Mann kurz vor der französischen Grenze abgefangen. Leider lebte er nicht lange genug, um ihn näher zu befragen.«
»Das meine ich nicht. Ich meine, wie konnte er an diese Information gelangen?«
Der Kanzler zuckte mit den Schultern. »Die französischen Agenten sind wie Ratten. Sie verschwinden in einem Loch und tauchen an anderer Stelle wieder auf. Vermutlich gibt es ein Leck in den Archiven.« Er lächelte. »Majestät wird beruhigt sein zu hören, dass wir bereits mit der Befragung möglicher Verdächtiger begonnen haben. Ich leite die Verhöre persönlich, um ihnen die … nun, die nötige Intensität zu verleihen.«
Karl zuckte kurz zusammen. Er hasste es, wenn Gattinara selbst den Inquisitor spielte, aber eins musste man ihm lassen: Er war gründlich. Auch bei der Königswahl nach Maximilians Tod hatte er dafür gesorgt, dass das Geld der Fugger in die richtigen Kanäle geflossen war. Die deutschen Kurfürsten hatten daraufhin Karl und nicht seinen härtesten Konkurrenten, den französischen König Franz, zum deutschen Herrscher gemacht.
»Und was, wenn dieser Mann nicht der Einzige war?«, hakte der junge Kaiser nach. »Vielleicht gibt es Abschriften dieses Briefs. Es könnten mehrere Boten geschickt worden sein.«
»Nun, die Möglichkeit besteht tatsächlich. Ich halte es deshalb für unerlässlich, das zu vollenden, was Euer Großvater bereits begonnen hat. Zum Wohle des Reiches«, fügte Gattinara hinzu und verneigte sich erneut.
»Zum Wohle des Reiches«, murmelte Karl. Schließlich nickte er. »Tut, was zu tun ist, Gattinara. Ich verlasse mich auf Euch.«
Der Kanzler machte eine letzte tiefe Verbeugung, dann schob er sich wie eine dicke schwarze Spinne rückwärts aus der Kammer. Die Türen schlossen sich, und der Kaiser war wieder allein.
Karl dachte eine Weile nach, dann ging er erneut zum Globus und suchte nach jenem winzigen Ort, von dem aus dem Reich so große Gefahr drohte.
Doch alles, was er dort entdeckte, waren die schraffierten Zeichnungen dichter schwarzer Wälder.
Erstes Buch
März bis Juni 1524
KAPITEL 1
Queichhambach bei Annweiler im Wasgau,
21. März, Anno Domini 1524
er Junge, dem der Henker die Schlinge um den Hals legte, war nicht älter als Mathis. Er zitterte am ganzen Körper, und dicke Tränen rannen ihm über das von Rotz und Dreck verschmierte Gesicht. Von Zeit zu Zeit würgte der Knabe ein Schluchzen hervor, ansonsten schien er sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben. Mathis schätzte, dass er vielleicht sechzehn Sommer zählte, ein erster Flaum spross um seine Lippen. Vermutlich hatte der Junge ihn mit Stolz getragen und versucht, die Mädchen damit zu beeindrucken, doch nun würde er ihnen nie wieder hinterherpfeifen. Sein kurzes Leben war vorbei, ehe es richtig begonnen hatte.
Die beiden Männer neben dem Knaben waren um einiges älter. Ihre Hemden und Beinlinge waren schmutzig und zerrissen, das Haar stand ihnen wirr vom Kopf, und sie murmelten lautlose Gebete. Alle drei standen auf schiefen Leitern, die an einem von Sturm und Regen stark verwitterten Holzbalken lehnten. Der Queichhambacher Galgen war fest und massiv gebaut, seit vielen Jahrzehnten fanden hier die Hinrichtungen der Gegend statt. Und in letzter Zeit waren es mehr und mehr geworden. Die vergangenen Jahre hatten zu kalte Winter und zu trockene Sommer gebracht, die Pest und andere Seuchen waren über das Land gezogen. Hunger und die drückenden Abgaben hatten viele der Pfälzer Bauern in die Wälder getrieben, wo sie sich Räuberbanden und Wilderern anschlossen. Auch die drei dort vorne am Galgen waren auf frischer Tat beim Wildern erwischt worden, nun wurde die dafür vorgesehene Strafe an ihnen vollstreckt.
Mathis hielt sich ein wenig abseits der gaffenden Menschenmenge, die sich an diesem verregneten Vormittag zur Hinrichtung versammelt hatte. Der Galgenhügel befand sich gut eine Viertelmeile entfernt vom Ort, jedoch nahe genug an der Straße nach Annweiler, dass Reisende ihn gut sehen konnten. Eigentlich hatte Mathis nur dem Queichhambacher Dorfvogt ein paar Hufeisen gebracht, die dieser bei Mathis’ Vater, dem Trifelser Burgschmied, bestellt hatte, doch auf dem Rückweg war er am Galgenhügel vorbeigekommen. Er wollte schon weitergehen – schließlich war heute sein freier Tag, und er hatte noch etwas Bestimmtes vor –, aber angesichts der vielen Menschen, die mit angespannten, verhärmten Gesichtern im eisigen Regen auf die Hinrichtung warteten, siegte die Neugierde. Also blieb er stehen und beobachtete den Schinderkarren, auf dem die drei Gefangenen der Hinrichtungsstätte entgegenfuhren.
Mittlerweile hatte der Henker die Galgenleitern aufgestellt und die drei armen Sünder wie Schlachtvieh zum Balken hinaufgezerrt, wo er einem nach dem anderen die Schlinge um den Hals legte. Als es schließlich so weit war, senkte sich ein tiefes Schweigen über die Menge, nur unterbrochen durch das gelegentliche Schluchzen des Jungen.
Mit seinen siebzehn Jahren hatte Mathis bereits einige Hinrichtungen erlebt. Meist waren es Räuber oder Diebe gewesen, die gehenkt oder gerädert wurden, und die Leute hatten geklatscht und die zitternden Kreaturen noch am Schafott mit faulem Obst und Gemüse beworfen. Doch diesmal war es anders. Eine beinahe vibrierende Spannung lag in der Luft.
Obwohl es bereits Mitte März war, fanden sich auf den umliegenden Äckern noch zahlreiche Schneefelder. Fröstelnd beobachtete Mathis, wie die Menge sich widerwillig teilte, als nun der Annweiler Stadtvogt Bernwart Gessler gemeinsam mit dem feisten Gemeindepfarrer Pater Johannes auf die Anhöhe zuschritt. Es war offensichtlich, dass die beiden Herren sich Besseres vorstellen konnten, als an einem verregneten, nasskalten Frühlingstag drei Galgenvögeln beim Baumeln zuzusehen. Mathis vermutete, dass sie gerade noch bei ein paar Gläsern Pfälzer Wein in einer warmen Annweiler Wirtsstube gesessen hatten, doch als herzoglicher Stellvertreter war der Stadtvogt nun einmal für die hohe Gerichtsbarkeit in der Gegend zuständig, und nun galt es, Recht zu sprechen. Gessler stemmte sich gegen den Regen, der ihm in Böen ins Gesicht wehte, angestrengt hielt er sein schwarzsamtenes Barett fest, dann kletterte er auf den nunmehr leeren Schinderkarren.
»Bürger von Annweiler!«, wandte er sich mit lauter, hochfahrender Stimme an die Umstehenden. »Diese drei Burschen sind der Wilderei überführt! Sie sind nicht mehr als Vagabunden und Räuber und haben das Recht auf Leben verwirkt. Ihr Tod sollte uns allen eine Mahnung sein, dass Gottes Zorn furchtbar, aber auch gerecht ist!«
»Von wegen Räuber«, knurrte ein hagerer Bauer neben Mathis. »Den armen Schlucker ganz rechts kenn ich, das ist der Sammer Josef aus Gossersweiler. Ein ganz anständiger Knecht war das, doch dann konnte ihn sein Herr nicht mehr bezahlen, und er ist in die Wälder.« Er spuckte auf den Boden. »Was soll unsereins denn noch essen nach zwei verhagelten Ernten? Nicht einmal mehr Bucheckern gibt’s im Wald. Der ist so leer wie die Mitgifttruhe meiner Frau!«
»Die Pacht haben sie uns auch schon wieder erhöht«, fiel ein zweiter Bauer brummend ein. »Und die Pfaffen leben in Saus und Braus, die kassieren trotz allem ihren Kirchenzehnten. Schaut nur, wie fett unser Pfarrer mittlerweile ist!«
Soeben ging der wohlbeleibte Pater Johannes mit einem einfachen Holzkreuz hinüber zu den Galgenleitern. Unter jeder von ihnen blieb er stehen und sprach mit hoher, leiernder Stimme ein kurzes lateinisches Gebet. Doch die Verurteilten über ihm schienen bereits in einer anderen Welt, sie starrten ins Leere. Nur der Junge schluchzte noch immer herzerweichend. Es klang, als riefe er nach seiner Mutter, aber niemand in der Menge antwortete.
»Kraft des mir vom Zweibrückener Herzog verliehenen Amtes befehle ich dem Scharfrichter, diese drei Missetäter ihrer gerechten Strafe zuzuführen!«, rief der Stadtvogt hinaus in die Menge. »Ihr Leben ist hiermit verwirkt!«
Er zerbrach einen kleinen Holzstab, und der Queichhambacher Scharfrichter, ein stämmiger Mann mit weiten Landsknechtshosen, Leinenhemd und Augenbinde, zog dem ersten Delinquenten die Leiter unter den Füßen weg. Der Mann zappelte eine Weile, sein ganzer Körper schwang hin und her wie ein außer Kontrolle geratenes Uhrpendel, ein nasser Fleck breitete sich auf seiner Hose aus. Während seine Bewegungen schwächer wurden, zerrte der Henker bereits an der nächsten Leiter. Ein weiterer wilder Tanz setzte ein, als der zweite Mann am Seil baumelte. Als der Scharfrichter sich schließlich dem Knaben zuwandte, ging ein Raunen durch die Menge. Nicht nur Mathis war aufgefallen, wie jung der Bursche war.
»Kinder! Ihr hängt Kinder!«, zeterte jemand. Mathis wandte sich um und sah eine verhärmte Frau, an deren Rockzipfeln zwei kleine rotznasige Mädchen hingen. Ein winziger Säugling schrie unter dem zusammengerollten Leinentuch, das sich die Frau auf den Rücken gebunden hatte. Sie schien nicht die Mutter des Jungen zu sein, trotzdem war ihr Gesicht rot vor Zorn und Entrüstung. »So was kann Gott nicht gewollt haben!«, schrie sie ihre Wut hinaus. »Kein gerechter Gott lässt so etwas zu!«
Der Henker zögerte, als er merkte, wie unruhig die Zuschauer wurden. Mit erhobenen Händen wandte sich der Stadtvogt Bernwart Gessler an die Menge. »Er ist kein Kind mehr!«, schnarrte er mit befehlsgewohnter Stimme. »Er wusste, was er tat. Und nun wird er dafür seine Strafe erhalten, das ist nur gerecht! Oder gibt es hier jemanden, der das anzweifeln will?«
Mathis wusste, dass der Vogt im Recht war. Schon Vierzehnjährige konnten in deutschen Landen gehenkt werden. Wenn sich die Richter über das Alter nicht sicher waren, wandten sie gelegentlich einen Trick an: Sie ließen den Knaben oder das Mädchen zwischen einem Apfel und einer Münze wählen. Nahm das Kind die Münze, galt es als schuldfähig – und wurde hingerichtet.
Trotz der klaren Worte des Vogts ließen sich die Menschen neben Mathis nicht einschüchtern. Murrend scharten sie sich enger um den Galgenhügel. Der zweite Gehenkte zuckte noch ein wenig, während der erste bereits still im Wind hin und her pendelte. Zitternd, noch immer den Strick um den Hals, blickte der Knabe von der Leiter hinab auf den Henker, der wiederum zum Stadtvogt hinüberstarrte. Es war, als würde die Zeit einen Augenblick stillstehen.
»Nieder mit den Ausbeutern! Nieder mit dem Zweibrückener Herzog und seinem Vogt, die uns wie Vieh hungern und verrecken lassen!«, erklang plötzlich ein weiterer Schrei. »Tod allen Herrschern!«
Stadtvogt Bernwart Gessler zuckte zusammen. Die Menschen brüllten und johlten, vereinzelt waren Hochrufe auf die drei Wilderer zu vernehmen. Unsicher sah Gessler sich um und versuchte den Rufer auszumachen, der da so offen zur Rebellion anstachelte.
»Wer war das?«, schrie der Vogt entrüstet gegen den Lärm an. »Wer ist so frech, sich gegen den von Gott eingesetzten Herzog und seine Diener zu stellen?«
Doch der Gesuchte war bereits wieder in der Menge untergetaucht, allerdings hatte Mathis noch einen kurzen Blick auf ihn erhaschen können. Es war der bucklige Schäfer-Jockel, der sich nun hinter eine Reihe Weiber duckte und von dort aus das weitere Geschehen beobachtete. Wieder einmal war seine Stimme eindringlich und auf eine seltsame Art aufrüttelnd gewesen. Mathis glaubte ein leises Lächeln auf Jockels Lippen zu sehen, dann versperrten ihm ein paar schimpfende Bauern die Sicht.
»Weg mit dem verfluchten Zehnten!«, verlangte nun ein anderer Mann in seiner Nähe, ein dürrer Alter, der sich an einen Stock klammerte. »Der Bischof und der Herzog sind fett und feist, und ihr hängt hier Kinder, die nicht wissen, was sie essen sollen! Was ist das nur für eine Welt!«
»Ruhig, bleibt ruhig, Leute!«, befahl der Vogt und hob herrisch die Hand. »Sonst hängen gleich noch ein paar mehr am Galgen. Wer tanzen will, braucht es nur zu sagen.« Er gab den Bütteln, die bislang hinter dem Schinderkarren gewartet hatten, einen Wink, und sie gingen mit Spießen drohend auf die Menge zu. »Wer allerdings brav wieder an seine Arbeit geht, dem wird nichts geschehen. Alles hier ist Gottes Wille!«
Hier und da war noch lautes Schimpfen und Fluchen zu hören, das jedoch nach und nach verebbte. Der Sturm der Entrüstung war vorüber, Angst und Gewohnheit siegten wie so oft über den Zorn. Schließlich rumorte es nur noch leise, wie ein sanfter Wind, der über den Feldern weht. Der Stadtvogt straffte sich, dann gab er dem Henker das Zeichen.
»Nun mach schon, damit es ein Ende hat.«
Mit einer schnellen Handbewegung zog der Scharfrichter die Leiter unter den Beinen des Jungen weg. Der Knabe zuckte und zappelte, die Augen quollen hervor wie große Murmeln, doch sein Todeskampf war nur von kurzer Dauer. Schon nach einer knappen Minute hörten die Zuckungen auf, und der schmächtige Körper erschlaffte. So starr und leblos wirkte er nun noch kleiner und zerbrechlicher als zuvor.
Immer noch murrend löste sich die Menge auf, verstohlen sprachen die Menschen miteinander, dann ging jeder wieder seiner Wege. Auch Mathis wandte sich ab. Er hatte genug gesehen. Traurig schulterte er den leeren Sack und eilte auf den Wald zu.
Es gab etwas, das auf ihn wartete.
***
»Nun mach schon, Parcival! Hol dir den Spitzbuben!«
Agnes blickte hinauf zu ihrem Falken, der wie ein abgeschossener Pfeil auf die Krähe zuraste. Diese, ein alter, schon leicht zerzauster Vogel, hatte sich ein Stück zu weit von ihrem Schwarm entfernt, eine leichte Beute für den Sakerfalken. Die Krähe bemerkte den kleinen Jäger erst im letzten Augenblick und schlug einen Haken in der Luft, so dass der Falke an ihr vorbeischoss. Er flog einen weiten Bogen, gewann wieder an Höhe, um sich erneut auf die Krähe zu stürzen. Diesmal traf er sein Ziel besser. Wie ein Ball aus braunen und schwarzen Federn, Blut und Fleisch trudelten die beiden Vögel dem Feld entgegen; ein letztes Flattern, dann lag die Krähe tot zwischen den frostharten Lehmklumpen. In triumphierender Haltung hockte der Falke auf dem Kadaver und begann, ihn zu rupfen.
»Gut gemacht, Parcival! Hier, dein Lohn!«
Mit einem Hühnerbeinchen in der Hand näherte sich Agnes dem pickenden Falken, während ihr kleiner Dachshund Puck aufgeregt kläffend um die Vögel herumsprang. Parcival würdigte ihn keines Blickes. Nach kurzem Zögern flatterte der Sakerfalke hoch und landete auf dem dicken Lederhandschuh, den Agnes über der linken Hand trug. Zufrieden begann er, kleine Stücke Fleisch aus dem Hühnerschlegel herauszuzuhacken. Doch bereits nach kurzer Zeit steckte Agnes den Schlegel wieder weg, um das Tier nicht allzu sehr zu sättigen. Einmal mehr bewunderte sie Parcivals aufrechte Haltung und den stolzen Blick, der sie immer an die Augen eines alten, weisen Herrschers erinnerte. Seit zwei Jahren war der Falke nun ihr liebster Gefährte, manchmal wünschte sich Agnes, er wäre tatsächlich ein verzauberter Prinz.
Puck hatte inzwischen einen neuen Schwarm Krähen in dem frisch bestellten Feld aufgestöbert, und der Falke schwang sich zu einer weiteren Jagd in die Lüfte. Der Regen hatte nun aufgehört, der Wind die niedrig hängenden Wolken vertrieben, und so konnte Agnes den Flug ihres Vogels in seiner ganzen Pracht bewundern.
»An die Arbeit, Faulpelz!«, rief sie ihm hinterher. »Für jede Krähe bekommst du ein Stück saftiges Fleisch – versprochen!«
Während Agnes dem Falken dabei zusah, wie er sich immer höher in den Himmel schraubte, überlegte sie, wie die Erde von dort oben wohl aussah – die Burg ihres Vaters auf dem gegenüberliegenden Sonnenberg, die sich auf einem Sandsteinfelsen zwischen Buchen, Kastanienbäumen und Eichen erhob, der Wasgau, dieses riesige Pfälzer Waldgebiet mit seinen unzähligen grünen Hügeln, der berühmte Speyerer Dom, der viele Meilen von hier den Mittelpunkt jener Welt markierte, die Agnes kannte. Als Kind hatte der Vater sie einmal in die ferne Stadt mitgenommen, doch die Erinnerung daran war längst verblasst. Seitdem Agnes denken konnte, waren die ehemalige Reichsburg Trifels, das darunterliegende Städtchen Annweiler, die Dörfer Queichhambach und Albersweiler, ja die ganze Wildnis ringsumher ihr Spielplatz. Auch wenn der Burgvogt Philipp Schlüchterer von Erfenstein es nicht gern sah, dass seine sechzehnjährige Tochter in den Wäldern, Auen und Sümpfen umherstromerte, nutzte Agnes doch jede freie Stunde, um mit ihrem Hund Puck und dem Falken fern von der Burg zu sein, die ihr oft zu klamm und zu einsam war. Gerade jetzt, da der Winter zu Ende ging, war es auf dem Trifels noch lausig kalt, während sich unten im Tal bereits die ersten Triebe zeigten.
Der Falke hatte mittlerweile wieder die nötige Höhe von fast dreihundert Fuß erreicht. Wie ein Blitz fuhr er hernieder in den Schwarm Krähen, die laut krächzend auseinanderstoben. Doch diesmal waren sie ihm alle entkommen. Nur wenige Meter über dem Boden fing sich der kleine Raubvogel ab und schraubte sich ein weiteres Mal hinauf, um erneut zuzustoßen. Der Schwarm wogte gleich einer schwarzen Wolke über den gepflügten Äckern.
Agnes hatte den braun-weiß gesprenkelten Sakerfalken als Nestling von ihrem Vater geschenkt bekommen und ohne fremde Hilfe in monatelanger Arbeit abgerichtet. Parcival war ihr ganzer Stolz, und selbst ihr sonst so mürrischer Vater musste zugeben, dass sie ihre Sache gut gemacht hatte. Die Annweiler Bauern hatten ihn, den Burgvogt von Trifels, erst letzte Woche gebeten, Agnes möge doch mit ihrem Falken die Krähen auf den städtischen Feldern jagen. In diesem Jahr waren die schwarzen Rabenvögel, die Agnes mit ihren hinterhältigen Blicken an verzauberte böse Menschen denken ließen, eine echte Plage; sie fraßen das letzte bisschen Saat und vertrieben die Lerchen, Buchfinken und Amseln, die den armen Leuten oft als einzige Fleischmahlzeit dienten.
Eben hatte Parcival eine weitere Krähe geschlagen; ineinander verhakt trudelten sie auf das Feld zu, und Agnes lief ihnen entgegen, um ihren heißgeliebten Falken vor möglichen Angriffen zu schützen. Krähen waren schlaue Tiere, oft gingen sie gemeinsam auf einen Raubvogel los, um ihm den Garaus zu machen. Auch jetzt näherte sich der schwarze Schwarm bedrohlich, und Agnes spürte, wie Zorn in ihr aufstieg, ganz so, als müsste sie ihr eigenes Kind beschützen. Sie warf ein paar Steine, und die Vögel drehten krächzend ab.
Erleichtert lockte Agnes Parcival ein weiteres Mal mit der angenagten Hühnerkeule. Die tote Krähe wollte sie als Abschreckung für die übrigen auf dem Feld liegen lassen; es war bereits die siebte, die der Falke heute erlegt hatte.
»Komm schon, mein Kleiner. Das hier schmeckt viel besser, glaub mir.«
Parcival hielt mit dem Picken inne und schlug aufgeregt mit den Flügeln. Doch gerade als der Falke auf ihrem Handschuh landen wollte, erschütterte plötzlich ein gewaltiger Donner das Tal. Der Vogel machte kehrt und flog auf den nahe gelegenen Wald zu.
»Parcival, verflixt, bleib hier! Was soll das?«
Ahnungsvoll schaute Agnes nach oben, ob sich ein Gewitter ankündigte, doch der Himmel war nirgendwo schwarz, nur grau und verhangen. Überhaupt war es jetzt im März für ein Sommergewitter noch viel zu früh. Was also mochte dieses Donnern zu bedeuten haben? Egal, was es war – es hatte ihren Vogel so verstört, dass Agnes Gefahr lief, ihn für immer zu verlieren.
Gemeinsam mit dem kläffenden Puck rannte sie auf das etwa hundert Schritt entfernte Waldstück zu, in dem der aufgeschreckte Parcival verschwunden war. Dabei blickte sie sich immer wieder um, um den Ursprung des Lärms zu erkunden. Bis hin zum Städtchen Annweiler breiteten sich auf etwa einer halben Meile Felder und Gemüsegärten aus, auf denen noch zahlreiche Schneereste zu sehen waren; dahinter erhob sich im sanften Vormittagslicht der Burgberg, von Weinhängen und weiteren frisch gepflügten Feldern in einem breiten Kranz umgeben.
Agnes überlegte. Hatte etwa der versoffene Trifelser Geschützmeister Ulrich Reichhart einen Schuss aus einem der drei noch verbliebenen Geschütze abgegeben? Doch Pulver war teuer. Außerdem war das Krachen eher aus der Gegenrichtung gekommen.
Aus ebenjener Richtung, in die ihr Vogel geflogen war.
»Parcival! Parcival!«
Mit klopfendem Herzen rannte Agnes auf den dichten, mit Weißdornbüschen umgebenen Waldsaum zu. Erst jetzt fiel ihr noch etwas ein, was die Ursache für den Donner gewesen sein konnte. In letzter Zeit gab es immer wieder Gerüchte über Räuber in der Gegend. Die Ramburg, eines der vielen Raubritternester im Wasgau, lag nur wenige Meilen entfernt. Sollte deren Vogt, Hans von Wertingen, es tatsächlich gewagt haben, so nahe an der Burg ihres Vaters auf Raubzug zu gehen? Bislang hatte der verarmte Adlige nur die großen Mautstraßen unsicher gemacht, und auch das meist im Schutze der Dunkelheit. Doch vielleicht war der Hunger, und damit die Lust auf Raub und Mord, ja nun größer geworden?
Am Waldrand angekommen, blieb Agnes vorsichtig stehen und sah sich erneut zu dem Städtchen um, hinter dem der Burgberg aufragte. Sicherlich wäre es vernünftiger, zum Trifels hinaufzulaufen, um ihren Vater vor einem möglichen Angriff zu warnen. Doch dann würde sie ihren Parcival vermutlich nie wiederfinden. Auch abgerichtete Falken blieben scheue Tiere. Die Gefahr war groß, dass der Vogel für immer in der Wildnis verschwand.
Schließlich gab sie sich einen Ruck und rannte zwischen den borkigen Stämmen hinein in den Eichenwald. Sofort umfing sie dämmriges Licht, die dichten Zweige, an denen bereits die ersten Triebe und Blüten zu sehen waren, ließen die Sonne kaum durch. Im Herbst holten die Annweiler Gerber in diesem Waldabschnitt die Rinde für ihre Gerblohe, doch um diese Jahreszeit war er wie ausgestorben. Holzsammler hatten den vereisten Boden noch vor wenigen Wochen nach Winterreisig und Eicheln abgesucht, und der Wald war wie leergefegt. Agnes war froh, dass wenigstens Puck sie begleitete, auch wenn der kleine Dachshund im Falle eines Überfalls sicher keine große Hilfe war. Das Knacken der wenigen Äste und Zweige, auf die sie trat, klang wie das Brechen morscher Knochen.
Immer tiefer marschierte sie in den dunklen Wald hinein. An schnelles Laufen war nun nicht mehr zu denken, oft versperrten ihr sumpfige Erdwälle und stachliges Weißdorndickicht den Weg. Einmal mehr schätzte sich Agnes glücklich, dass sie für die Falkenbeize ihr braunes Lederwams angezogen hatte und nicht das lange Kleid aus Barchent, das ihr Vater so liebte. Die Dornen hätten das teure Kleidungsstück längst zerrissen. In Agnes’ blonden, immer etwas ungekämmten Haaren hingen Kletten und kleine Zweige; Dornen zerkratzten ihr das sommersprossige Gesicht.
»Parcival?«, rief sie ein weiteres Mal. Doch außer dem zornigen Tschilpen einiger Amseln war nichts zu hören. Die Stille des Waldes, die sie sonst so liebte, kam ihr mit einem Mal bedrückend vor. Wie eine dicke, alles erstickende Decke schien das Schweigen auf ihr zu liegen.
Plötzlich hörte sie von rechts ein vertrautes Krächzen. Agnes atmete erleichtert auf. Es war ganz eindeutig Parcival, der nach ihr lahnte! Junge Greifvögel taten dies oft, wenn sie um Futter bettelten. Manchmal konnte das Lahnen eine echte Plage sein, doch heute klang es für Agnes so wohltönend wie das Spiel einer Laute. Auch die Bell vernahm sie nun, jenes Glöckchen, das am Fuß des jagenden Falken hing und den Falkner zu ihm führte.
Agnes eilte in die Richtung, aus der das Krächzen und Klingeln gekommen waren, und vor ihr tat sich eine Waldlichtung auf. Im schräg einfallenden Sonnenlicht erblickte sie eine mit Efeu überwucherte Ruine aus Sandstein, die wohl einst ein Wachturm gewesen war. Erst jetzt erinnerte sie sich, dass sie die Stelle kannte. Türme dieser Art gab es rund um den Trifels viele, die Gegend war einst das Herz des deutschen Reiches gewesen. Kaiser und Könige hatten hier ihre Burgen erbaut. Nun zeugten nur noch ein paar Lieder und solche von Moos bewachsenen Mauerreste von der einstigen Pracht dieses Landstrichs. Verträumt blieb Agnes stehen, und ein leiser Schauder durchfuhr sie. Nebelschwaden zogen über die Ruine hinweg, in der Luft lag ein merkwürdiger fauliger Geruch. Ihr war, als würde sie in eine längst vergangene Zeit blicken. Eine Zeit, die ihr vertrauter schien als ihre eigene und die doch so tot war wie die Steine ringsumher.
Erneut erklang nicht weit entfernt das Lahnen ihres Falken. Verborgen hinter einem breiten Eichenstamm suchte Agnes mit Blicken die Lichtung ab und entdeckte den kleinen Vogel endlich auf dem Ast einer verkrüppelten Weide, die in den Ritzen der Ruine Wurzeln geschlagen hatte. Sie lachte befreit, und der magische Moment war vorüber.
»Hier bist du also, du …«
Agnes stockte, als plötzlich eine Gestalt auf der Lichtung stand. Offenbar war der Mann hinter einigen größeren Felsbrocken verborgen gewesen, doch nun trat er gebückt hervor. In den Händen hielt er eine Art großes Rohr, das er nun ächzend auf einen Stein legte.
Agnes hielt sich die Hand vor den Mund, um nicht laut aufzuschreien. War das etwa einer der Raubritter und Wegelagerer, von denen sie so viel gehört hatte? Doch dann bemerkte sie, dass ihr die Bewegungen des Mannes seltsam vertraut vorkamen. Als sie genauer hinblickte, erkannte sie nun auch den abgeschabten braunen Lederkittel, die rotblonden Haare und das feingeschnittene Gesicht.
Ein Gesicht, das ihr nur allzu vertraut war.
»Mein Gott, Mathis, wie kannst du mir nur so einen Heidenschreck einjagen!« Bebend vor Wut trat Agnes hinaus auf die Lichtung, während Puck fröhlich kläffend an dem jungen Mann emporsprang und ihm die Hand leckte.
Mathis war nur ein knappes Jahr älter als Agnes. Er war großgewachsen, aber sehnig, mit breitem Kreuz und Muskelpaketen an den Oberarmen, die von der harten Arbeit am Amboss herrührten.
»Hätt’ ich mir ja denken können, dass du hinter diesem teuflischen Knall steckst!«, sagte Agnes kopfschüttelnd. Ihr Zorn wich zunehmend der Erleichterung, dass es nun doch kein Räuber war, der ihr aufgelauert hatte. Schließlich konnte sie sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. »Wenn es nach Pech und Schwefel stinkt, dann ist der Trifelser Schmiedgeselle nicht weit, nicht wahr?« Sie deutete auf das beinahe mannslange Rohr, das neben Mathis auf dem Felsen lag. »Offenbar reicht es dir nicht, dass du deinen und meinen Vater damit zur Weißglut treibst. Jetzt musst du auch noch meinen Falken und sämtliche Tiere des Waldes zu Tode erschrecken. Schäm dich!«
Mathis grinste und hob in einer Geste der Demut die Hände. »Hätte ich vielleicht oben auf der Burg zündeln sollen? Der Trifels mag ein gammliger Haufen Steine sein, aber deshalb muss man ihn ja nicht gleich in die Luft jagen.«
»Die Burg meines Vaters ist kein gammliger Haufen Steine. Nimm dich in Acht, was du sagst, Mathis Wielenbach.«
Agnes’ Stimme war jetzt leise und kühl, doch Mathis ließ sich davon nicht einschüchtern. Er überragte sie um beinahe einen ganzen Kopf, ihre Wut schien an ihm abzuprallen wie an einer Wand.
»O Verzeihung, Exzellenz!« Er machte eine tiefe Verneigung. »Ich vergaß ganz, dass ich mit der Tochter des ehrwürdigen Burgvogts spreche. Darf ich mich überhaupt Euch nähern, Jungfer? Oder ist Euch das Sprechen mit einem einfachen, breimümmelnden Lehnsmann wie mir nicht gestattet?« Mathis zog eine dümmliche Miene, als wäre er so einfältig wie einer der wenigen Bauern, die noch zum Lehen der Erfensteins gehörten. Doch plötzlich wurde sein Blick düster.
»Was hast du?«, fragte Agnes.
Mathis holte tief Luft, bevor er schließlich leise antwortete: »Ich war vorhin drüben in Queichhambach. Da haben sie drei Wilderer gehängt. Einer von denen war nicht älter als ich.« Er schüttelte zornig den Kopf. »Es wird immer schlimmer, Agnes! Die Leute fressen die Frühsaat und die Spelzen, und wenn sie in ihrer Not im Wald jagen, dann landen sie am Galgen. Was sagt eigentlich dein Vater zu alldem?«
»Mein Vater hat die Gesetze nicht gemacht, Mathis.«
»Ja, er geht nur munter jagen, während andere dafür hängen müssen.«
»Du meine Güte, Mathis!« Agnes funkelte ihn an. »Du weißt nur zu gut, dass mein Vater ohnehin schon beide Augen zudrückt, wenn er in seinen Wäldern unterwegs ist. Aber was in den Wäldern des Annweiler Stadtvogts geschieht, dafür kann er nun wirklich nichts! Also lass gefälligst meinen Vater aus dem Spiel und hack nicht immer wieder auf ihm herum.«
»Schon gut, schon gut.« Mathis zuckte mit den Schultern. »Ich sollte solche Gespräche vielleicht nicht mit der Tochter eines Burgvogts führen.«
»Du solltest solche Gespräche überhaupt nicht führen!«
Eine Zeitlang schwiegen beide, und Agnes starrte mit verschränkten Armen trotzig vor sich hin. Doch schon bald verrauchte ihre Wut. Sie kannte Mathis schon zu lange, um ihm wegen solcher Sprüche böse zu sein, auch wenn sie nicht zulassen konnte, dass er über ihren Vater herzog. Noch vor einigen Jahren hatten die beiden in den Kellern der Burg Haschmich und Verstecken gespielt, erst seit letztem Herbst waren ihre Treffen seltener geworden. Agnes hatte sich um ihren Falken gekümmert und die langen Winternächte in der Trifelser Bibliothek verbracht, und Mathis war immer häufiger mit Leuten zusammen, die über Freiheit und Gerechtigkeit predigten. Dabei schoss er gelegentlich übers Ziel hinaus, fand Agnes, auch wenn sie für manche Forderungen der Bauern durchaus Verständnis aufbrachte. Doch es war nicht an ihr oder ihrem Vater, an den gegenwärtigen Verhältnissen etwas zu ändern. So etwas konnten nur die ganz hohen Herren tun, die Fürsten, Bischöfe und natürlich der Kaiser.
»Was … was machst du da eigentlich?«, fragte sie schließlich versöhnlicher.
»Ich habe gerade eine neue Sorte Schießpulver ausprobiert«, begann Mathis feierlich und ganz so, als hätte es den Streit zwischen ihnen nie gegeben. »Sieben statt sechs Teile Salpeter, außerdem fünf Teile Schwefel und dazu Kohle aus jungem Haselholz.« Er griff nach einem Säckchen, das vor ihm auf dem Boden stand, und ließ die schwarzgraue Substanz durch seine Finger rinnen. »Außerdem hab ich das Pulver diesmal besonders körnig gemacht. Dann brennt es schneller ab und verklumpt nicht so stark.«
Agnes verdrehte die Augen. Feuerwaffen waren Mathis’ große Leidenschaft, sie würde nie verstehen, was er an den lärmenden Eisenrohren fand. »Irgendwann wirst du dich mit dem Zeug noch in die Luft jagen!«, sagte sie vorwurfsvoll. »Ich weiß wirklich nicht, was so großartig daran sein soll, wenn es knallt und stinkt. Es … es ist einfach unritterlich! Ja, das ist es!«
Mathis lächelte. »Das hat dir dein Vater gesagt, nicht wahr?«
»Und wenn schon! Er wird es jedenfalls nicht gutheißen, dass du ihm eine seiner Arkebusen aus der Geschützkammer gestohlen hast.« Sie deutete auf das eiserne Rohr auf dem Felsen, das noch schwach vor sich hinqualmte. »Denn von dort stammt das Feuerrohr doch, gib’s ruhig zu!«
Achselzuckend wandte sich Mathis wieder dem Geschütz zu und begann damit, es sorgfältig mit Schießpulver zu füllen. Mit einem hölzernen Stößel schob er die winzigen Körner ganz nach hinten und stopfte das Rohr schließlich mit einer walnussgroßen Bleikugel. An der Seite des Geschützes war ein Haken angebracht, den Mathis nun in einen Spalt zwischen zwei Felsen schob, damit die Arkebuse durch den Rückstoß der Explosion nicht wegrutschen konnte. So etwas hatte Agnes schon bei den Burgmännern ihres Vaters gesehen, nur dass diese den Haken in die vorgesehenen Ösen an den Burgzinnen einhängten. Diese sogenannten Hakenbüchsen oder Arkebusen, wie die Franzosen sagten, waren altertümliche Waffen, aber neuere Techniken kosteten viel Geld und waren auf dem Trifels kaum bekannt. Ein Zustand, über den Mathis gern spottete.
»Der alte Ulrich hat gar nicht gemerkt, dass ich mir die Büchse ausgeliehen habe«, brummte der junge Schmied, während er vorsichtig Pulver in die Zündpfanne schüttete. »War so besoffen, dass ich ihm den Schlüssel zur Geschützkammer einfach aus der Tasche fischen konnte. Ich hab sie vorgestern hier versteckt. Heute war endlich das Schießpulver fertig.«
»Hast du den Verstand verloren?« Agnes schüttelte ungläubig den Kopf. »Das ist Diebstahl, Mathis! Kannst du dir vorstellen, was mein Vater mit dir anstellt, wenn er das merkt?«
»Himmelherrgott, er wird’s schon nicht merken, wenn du’s ihm nicht verrätst! Und außerdem, was will dein Vater schon mit dieser alten verrosteten Arkebuse anfangen? Vielleicht die Türken in die Flucht schlagen?« Mittlerweile war Mathis fertig. Er nestelte eine Lunte aus seiner Kitteltasche und steckte sie in den dafür vorgesehenen Bügel. »Der Vogt sollte froh sein, dass ich mich mit diesen Dingen beschäftige! Wenn nicht bald ein, zwei neue Falkonette auf der Burg stehen, kann er zukünftige Angreifer auch gleich mit faulen Salatköpfen bewerfen.«
Agnes seufzte. »Du weißt ebenso gut wie ich, dass für derlei Kram das nötige Geld fehlt. Und außerdem wüsste ich nicht, wer uns hier angreifen sollte. Die Türken jedenfalls nicht.«
»Vielleicht nicht die Türken, aber …«
Mathis hielt inne, als der kleine Puck plötzlich zu knurren anfing. Der Dachshund fletschte die Zähne und starrte mit aufgestelltem Fell auf die andere Seite der Lichtung. Als Agnes sich umwandte, spürte sie, wie eine Gänsehaut ihre Arme überzog. Geräusche waren zu hören, und sie waren nicht lieblich. Das Schnauben von Pferden, dicht gefolgt von Waffenklirren und den leisen, tiefen Stimmen mehrerer Männer.
Gleich darauf tauchten hinter einem Weißdorndickicht vier Reiter auf. Sie trugen zerschlissene Beinlinge und darüber fleckige Lederwesten, an den Seiten ihrer Pferde baumelten Hirschfänger und unterarmlange Armbrüste. Einer von ihnen, ungewöhnlich groß gewachsen, war zusätzlich mit einem altertümlichen Brustharnisch und einem Rundhelm ausgerüstet, an seinem Gürtel hing ein gewaltiges Breitschwert. An einer langen Leine hielt der Riese eine fast kalbsgroße schwarze Dogge, die die beiden jungen Leute böse anknurrte.
»Schau an, wen haben wir denn da?«, brummte der Mann in der Rüstung, während sein Hund hechelnd und mit vorquellenden Augen an der Leine zog. »Da sucht man einen großen Donner und findet nichts weiter als zwei kleine Fürze.«
Die anderen drei Männer lachten, doch ihr offensichtlicher Anführer befahl ihnen mit einer herrischen Geste zu schweigen. Misstrauisch ließ er seinen Blick über die Lichtung schweifen, schließlich wandte er sich an Agnes.
»Seid ihr zwei alleine?«
Agnes nickte schweigend. Es hatte keinen Sinn, den Mann anzulügen. Sie hatte ihn zwar noch nie zuvor gesehen, aber aus Beschreibungen wusste sie sofort, dass der sechs Fuß große Hüne Hans von Wertingen sein musste. Zweihändige Waffen durften in Friedenszeiten nur Ritter tragen, selbst dann, wenn sie mittlerweile als Räuber und Mörder unterwegs waren. Außerdem war Wertingens riesiger Hund weit über Annweiler hinaus berüchtigt. Es hieß, die Bestie sei auf Menschen abgerichtet und habe auch schon Kinder gerissen. Ob das stimmte, konnte Agnes nicht beurteilen. Auf alle Fälle war das Vieh mehr als furchteinflößend.
»Hat euch der Donner taub gemacht, hä?«, knurrte Hans von Wertingen nun. »Redet schon! Was habt ihr hier in den Wäldern zu suchen?«
»Wir … wir sind einfache Annweiler Gerber und halten Ausschau nach jungen Eichen«, erwiderte Agnes stockend und hielt den Blick gesenkt. »Wir brauchen frische Rinde für unsere Lohgruben. Verzeiht, wenn wir Euch bei der Jagd gestört haben, edle Herren.«
Mathis sah Agnes einen Moment lang verblüfft an, dann tat er es ihr gleich. Offenbar war auch ihm klargeworden, was geschehen würde, wenn Hans von Wertingen begriff, wer da tatsächlich vor ihm stand. Als Tochter eines Adligen war Agnes die ideale Geisel – für verarmte Raubritter ein beliebtes Mittel, sich ihrer Geldsorgen zu entledigen.
»Ach, und dieses Rohr hier?« Von Wertingen deutete spöttisch auf die am Boden liegende Arkebuse. »Das braucht ihr wohl zum Rindenschälen?«
»Hab’n wir hier gefunden, hoher Herr«, erwiderte Mathis und zeigte eine einfältige Miene. »Ist alt und rostig. Wir wissen auch nicht, was das ist. Aber vielleicht kann man es noch irgendwie gebrauchen?«
»So, so, ihr wisst es nicht …« Hans von Wertingen musterte sie beide argwöhnisch. Als sein Blick auf Agnes’ Falknerhandschuh fiel, huschte plötzlich ein Ausdruck des Erkennens über sein Gesicht. Agnes zuckte zusammen. Sie verfluchte sich, dass sie den Handschuh nicht abgestreift hatte. Doch nun war es zu spät.
»Natürlich!«, rief der Ritter und deutete auf Agnes. »Dich kenn ich doch! Hab von dir gehört. Blond, gekleidet wie ein Jüngling, mit Sommersprossen … Du bist das verrückte Mädchen mit dem Falken, die Tochter vom Trifelser Vogt, nicht wahr?« Er wandte sich grinsend an seine Männer. »Ein Weibsbild mit einem Falken! Hat man so was schon erlebt? Nun, ich denke, das werden wir ihr schon austreiben, bis der Herr Vater das nötige Lösegeld zahlt. Wir werden uns gut um das Täubchen kümmern. Nicht wahr, Männer?«
Die anderen drei lachten, und Hans von Wertingen rieb sich selbstzufrieden den struppigen Bart. Sein langes schwarzes Haar war verfilzt, das Gesicht rot und aufgedunsen von billigem Branntwein. Agnes kannte viele Geschichten über berühmte, einst von Barden besungene Ritter, die das Elend der letzten Jahrzehnte zu zerlumpten Kreaturen gemacht hatte. Ihr Vater hatte ihr erzählt, dass auch die von Wertingens einst ein angesehenes Geschlecht gewesen waren. Bis zu Reichsministerialen des Kaisers hatten sie es gebracht, doch dann waren die Pachteinnahmen immer weniger und die Schulden immer mehr geworden.
Agnes sah auf zu dem schmutzigen, verlausten Mann auf seinem klapprigen Gaul und wusste im gleichen Augenblick, dass von ihm keine Gnade zu erwarten war.
»Schnappt euch das Weibsbild!«, befahl von Wertingen mit knarrender Stimme. »Den Burschen schickt meinetwegen zum Teufel.«
Wiehernd setzten sich die Pferde in Bewegung und bildeten einen Halbkreis um die zwei Gefangenen. Sofort rannte Puck auf die johlenden Reiter zu und fing an, sie kläffend zu umkreisen. Dabei achtete der kleine Hund tunlichst darauf, der großen Dogge nicht zu nahe zu kommen, die ihn böse anknurrte und an der Leine zog.
»Hat man so was schon gesehen?« Hans von Wertingen lachte so heftig, dass sein verbeulter Harnisch leise schepperte. »Ein mickriger Kläffer greift meine Saskia an! Die Töle ist ja genauso verrückt wie ihre Herrin. Komm schon, Saskia, hol sie dir!«
Er ließ die Leine los, und das Monstrum stürzte sich wie ein schwarzer Dämon auf Puck. Alles ging so schnell, dass Agnes nicht einmal Zeit hatte zu schreien. Die Fänge der Dogge schnappten zu und wirbelten den Dachshund durch die Luft wie einen nassen Lumpen. Im nächsten Moment lag Puck mit zerbissener Kehle vor seiner Herrin. Ein letztes heiseres Fiepen ertönte, dann erschlaffte das kleine Bündel Fell.
»Du … du Mörder! Du verdammter Mörder!«
Schreiend lief Agnes auf den noch immer lachenden Ritter zu und trommelte mit dem Falknerhandschuh auf seine Beine ein. Hans von Wertingen gab ihr einen Tritt, dass sie ausrutschte und mit dem Hinterkopf auf einen der Felsen prallte. Ein stechender Schmerz durchfuhr sie, einen Moment lang wurde ihr schwarz vor Augen.
»Dummes Weibsstück!«, knurrte von Wertingen. »Vergießt Tränen wegen so einer mickrigen Töle. Sag uns lieber, wo dein Falke ist, der bringt einen hübschen Batzen Geld ein. Red schon, sonst …«
»Keine falsche Bewegung, du Hundsfott!«
In ihrem Schmerz brauchte Agnes einen Moment, um zu begreifen, dass es tatsächlich Mathis war, der da gesprochen hatte. Als sie sich stöhnend vom Boden aufrichtete, sah sie den Sohn des Schmieds neben der Arkebuse stehen, in der rechten Hand eine brennende Lunte, die er nur eine Handbreit über die Zündpfanne hielt. Das Rohr lag noch immer auf dem Felsen und war direkt auf die vier Männer gerichtet.
»Ihr Schweine habt genauso viel Zeit, wie die Lunte brennt, um von hier zu verschwinden«, drohte Mathis. Seine Stimme zitterte leicht, doch der Blick war fest auf Hans von Wertingen gerichtet. »Wenn nicht, werden nicht mal eure Mütter eure stinkenden Kadaver wiedererkennen.«
Einige Sekunden lang war es auf der Lichtung so still, dass man nur das Knistern der Lunte hören konnte. Dann fing Hans von Wertingen erneut dröhnend an zu lachen.
»Ein dummer kleiner Bauer bedroht mich mit einer Donnerbüchse!« Er wischte sich die Tränen aus den Augen. »Verbrenn dir bloß nicht die Finger, Bursche. Mit was hast du das Höllenrohr denn geladen? Mit Eicheln?«
»Mit einer sechs Unzen schweren Bleikugel und gut einem Pfund feinstem gekörntem Schießpulver. Das reicht allemal aus, um mindestens einen von euch zur Hölle zu schicken.«
Hans von Wertingens Lachen verstummte abrupt, auch seine drei Männer wirkten nun merklich verunsichert.
»Dann hast also du vorhin den Schuss abgegeben?«, murmelte der Ritter misstrauisch. »Aber wie ist das möglich? Allein für das Stopfen der Büchse braucht man die Erfahrung eines mit allen Wassern gewaschenen Landsknechts. Und gekörntes Schießpulver ist teuer, das …«
»Die Lunte ist schon zur Hälfte abgebrannt«, unterbrach ihn Mathis. »Euch bleibt nicht mehr viel Zeit.« Er richtete das Rohr erneut aus. Diesmal zeigte es direkt auf von Wertingens verbeulten Harnisch. »Also verschwindet.«
»Du … du windiger …« Hans von Wertingen kostete es sichtlich Mühe, an sich zu halten. Schließlich spuckte er grimmig auf den Waldboden. »Ach was! Mich täuschst du nicht. Das Ding ist nicht geladen, jede Wette. Männer, holt ihn euch!«
Doch die drei Räuber verharrten ängstlich auf ihren Pferden.
»Ich sagte, holt ihn euch, verflucht noch mal! Oder ich schieb euch die Hakenbüchse eigenhändig reihum in eure fetten Ärsche!«
Diese Drohung reichte aus, dass sich die Männer endlich in Bewegung setzten. Bedrohlich langsam trabten sie auf Mathis und Agnes zu, in ihren Augen glomm ein mörderisches Funkeln.
Als sie bis auf wenige Schritte herangekommen waren, erschütterte plötzlich ein gewaltiger Donnerschlag die Lichtung, so laut, als wollte die ganze Welt in Feuer und Rauch untergehen.
Agnes warf sich auf den harten Boden und sah aus dem Augenwinkel, wie einer der Männer unversehens vom Pferd stürzte wie von einem göttlichen Hammer getroffen. Sein Oberkörper war eine einzige rote Masse. Die Vogtstochter spürte etwas Feuchtes im Gesicht, und im gleichen Moment rieselte ein feiner Blutregen auf sie herab.
Aus der Arkebuse quoll dicker schwarzer Rauch.
Agnes schrie vor Entsetzen, während um sie herum Tiere und Menschen in Panik gerieten. Todesangst packte sie. Was hatte Mathis nur getan? Nach diesem Vorfall gab es kein Zurück mehr! Die Männer würden sie nun beide töten, daran bestand kein Zweifel. Verzweifelt versuchte Agnes, in ein Gebüsch am Rande der Lichtung zu krabbeln, doch ihre Beine gehorchten ihr nicht mehr. Seit dem Knall klangen alle Geräusche dumpf und weit entfernt, so als wären ihre Ohren in dicke Wolle gepackt. Die große Dogge war winselnd unter einen Felsvorsprung gekrochen, zwei der Pferde hatten ihre Reiter abgeworfen und galoppierten laut wiehernd davon. Nur Hans von Wertingen saß noch fest im Sattel, das Gesicht rot vor Zorn und Blutspritzern.
»Das … das werdet ihr mir büßen!«, schrie er außer sich und griff nach dem gewaltigen Bihänder an seiner Seite. »Scheiß auf das Lösegeld! Philipp von Erfenstein kann seine Tochter gerne wiederhaben. Den Kopf, die Arme, die Beine, alles einzeln und hübsch der Reihe nach!«
Brüllend vor Wut preschte er mit gezogenem Breitschwert auf Agnes los, die wie erstarrt in der Mitte der Lichtung kauerte. Als liefe die Zeit plötzlich langsamer, sah sie den Ritter Schritt für Schritt auf sich zureiten. Die Luft war erfüllt von Dröhnen und Klirren. Schon fuhr die Klinge herab, da spürte Agnes plötzlich eine Hand auf der Schulter. Es war Mathis, der sie im letzten Moment zur Seite zog.
»Wir müssen weg von hier! Hörst du mich?«, brüllte er ihr ins Ohr. Seine Stimme klang seltsam verhallt.
Agnes nickte wie in Trance, doch dann fiel ihr etwas ein. »Parcival!«, schrie sie außer sich. »Ich darf Parcival nicht im Stich lassen!«
»Vergiss den Falken, es geht um unser Leben! Schau doch, das Schwein kommt zurück!«
Mathis deutete auf Hans von Wertingen, der sein Pferd gewendet hatte und erneut auf sie beide zugaloppierte.
Verzweifelt blickte sich Agnes um, doch nirgendwo auf der verwüsteten Lichtung konnte sie Parcival entdecken. Endlich rappelte sie sich auf und rannte mit Mathis in den Wald hinein. Hinter ihnen ertönte das Schnauben und Wiehern des Pferdes.
»Verdammt, ich krieg euch!«, rief Hans von Wertingen. »Bleibt stehen, dann lass ich vielleicht ritterliche Gnade walten!«
»Ritterliche Gnade, dass ich nicht lache!«, keuchte Mathis, während er Agnes an der Hand weiterzerrte. »Gerade eben noch wollte er uns vierteilen.«
Keuchend vor Angst stolperten sie durch Büsche, Erdkuhlen und über modrige Äste, bis das Wiehern leiser wurde. Schließlich blieb Agnes stehen und lauschte. Bis auf ein leichtes Summen schien ihr Gehör wieder intakt zu sein. Erleichtert stellte sie fest, dass ihnen der Ritter auf seinem Pferd im Dickicht nicht folgen konnte.
»Wir sollten uns verstecken«, flüsterte sie. »Bestimmt reitet er dann an uns vorbei.«
»Du vergisst die Dogge. Die kann uns riechen.« Mathis zog sie weiter, bis sie an einen kleinen Bach gelangten, der sich durch den Wald schlängelte. »Wenn wir darin ein Stück weit waten, wittert uns der Hund vielleicht nicht mehr.«
Noch immer außer Atem ließen sie sich hinab in das kalte Wasser, das ihnen bis zu den Knien ging. Mit der Rechten klammerte sich Agnes an das Wams von Mathis und gab sich alle Mühe, nicht an das erbärmliche Fellbündel zu denken, das vor wenigen Minuten noch ihr lieber, fröhlicher Puck gewesen war.
Da sie mit der Strömung liefen, kamen sie schnell voran. Einmal glaubten sie kurz, Hundebellen zu hören, doch es war zu fern, um ihnen gefährlich zu werden. Agnes taumelte mehr, als dass sie ging, den Falknerhandschuh hatte sie längst verloren. Sie stürzte und fiel ins Bachbett, spürte aber kaum, dass sie sich ein Knie aufgeschlagen hatte. Das schreckliche Ende ihres geliebten Puck, die Flucht des Falken, der ohrenbetäubende Knall, der blutige Torso des Mannes – all diese Bilder spukten gleichzeitig durch ihren Kopf. Sie stolperte hinter Mathis her, bis sie endlich wieder aus dem Bach stiegen. In einem weiten Bogen liefen sie auf den Burgberg zu. Tränen rannen ihr übers Gesicht, und immer wieder unterdrückte sie ein Schluchzen. Der Tag, der so schön begonnen hatte, hatte sich in einen wahren Alptraum verwandelt.
Erst als sie die Schlossäcker erreicht hatten und der Trifels grau und mächtig über ihnen aufragte, wusste Agnes, dass sie in Sicherheit waren.
Von ihrem Falken fehlte jede Spur.
***
Nicht weit entfernt, in einer Hütte im Wald, warf die alte Hebamme Elsbeth Rechsteiner ein Scheit ins Feuer und sah zu, wie blaue Flammen um das Holz züngelten. Auf einem Dreibein darüber brodelte zischend ein Kessel. Der Rauch zog nur schlecht durch eine Öffnung im Reetdach ab, so dass die kleine Kate von Qualm erfüllt war.
Nachdenklich rührte Elsbeth in dem Topf, in dem ein paar blasse Blüten und Birkenblätter schwammen. Bei dem Knall vorhin war sie kurz zusammengezuckt und hatte ein leises Gebet gemurmelt, auch wenn sie nicht wusste, was ihn verursacht hatte. Doch in letzter Zeit kam ihr der Wald, der von Kindheit an ihr Zuhause gewesen war, dunkel und gefährlich vor. Wie ein böses Wesen, das, wenn sie stundenlang auf überwucherten Wildwechseln dahinwanderte und Kräuter sammelte, mit Ästen und Zweigen nach ihr griff. Immer mehr Raubritter und Banditen trieben in der Gegend ihr Unwesen, ausgezehrte Wölfe und Keiler, so groß wie Bären, waren zu einer wahren Plage geworden, und der Hunger verwandelte sogar manchen sonst friedliebenden Dorfbewohner in eine Bestie.
Doch dass Elsbeths Hand jetzt zitterte, während sie das Feuer mit trockenen Zweigen fütterte, lag nicht an den Räubern, den wilden Tieren und dem Knall, sondern an den drei Männern, die hinter ihr an dem kleinen abgewetzten Tisch saßen. Sie kannte sie schon seit vielen Jahren, aber bislang hatten sie sich stets heimlich in einem Keller unter der Annweiler Fortunatakirche getroffen. Ihr plötzlicher Besuch hier in ihrer Hütte machte Elsbeth deutlich, wie ernst die Lage war.
Der Feind war zurückgekommen.
Eine ganze Weile hatten sie alle geschwiegen, so dass nur der warnende Ruf des Eichelhähers von draußen zu hören war. Jetzt erst drehte sich die Hebamme zu den drei Männern um.
»Und die Nachrichten stimmen?«, fragte sie mit einem Rest von Zweifel in der Stimme. Elsbeth war mittlerweile über sechzig, Alter, Arbeit und Sorgen hatten tiefe Falten in ihre Haut gegraben. Nur ihre Augen leuchteten noch so wach wie in jungen Jahren.
Einer der Besucher nickte betreten. Auch ihn hatte das Alter gezeichnet: Die Hände, die einen Becher warmen Kräutersuds umklammerten, waren krumm von Gicht, das Gesicht zerfurcht wie ein frisch gepflügter Acker. »Sie sind wieder unterwegs, Elsbeth«, murmelte er, »kein Zweifel. Mein Vetter Jakob hat sie in Zweibrücken gesehen, dort haben sie das Archiv durchstöbert, aber wohl nichts gefunden. Wer weiß, wohin sie nun reiten. Worms, Speyer, vielleicht Landau … Es kann nicht mehr lange dauern, dann sind sie hier in Annweiler.«
»Nach all den Jahren!« Elsbeth Rechsteiner seufzte und starrte mit trüben Augen in die Flammen. Trotz des Feuers war ihr kalt, der Märzfrost saß ihr in den alten Knochen. »Ich dachte, sie hätten aufgegeben«, fuhr sie schließlich fort. »Es ist doch schon so lange her, und wir haben das Geheimnis so gut gehütet! Beginnt nun der ganze Schrecken wieder von vorn?«
»Sie werden nichts finden, glaub mir«, erwiderte einer der beiden anderen Männer beruhigend. Er war deutlich jünger, die schmutzige Lederschürze zeigte, dass er aus der Werkstatt hierhergeeilt war. »Die Spuren sind gut verwischt, nur die Bruderschaft weiß davon. Und von uns wird keiner reden, kein Einziger! Dafür lege ich meine Hand ins Feuer.«
Elsbeth Rechsteiner lachte leise und schüttelte den Kopf. »Wie kannst du dir da so sicher sein? Diese Männer sind schlau, und sie sind grausam wie Bluthunde! Du weißt doch, was sie das letzte Mal verbrochen haben. Sie kennen keine Gnade. Sie werden überall herumstochern, Leute werden aus Angst reden, und irgendwann werden sie etwas finden! Entweder bei euch oder bei mir.«
»Denk daran, was du versprochen hast, Elsbeth. Denk an deinen Eid.« Der alte Mann stellte seinen Becher ab und erhob sich ächzend. Der lange Weg von Annweiler durch den Wald hatte ihn sichtlich angestrengt. »Wir sind gekommen, um dich zu warnen. Das entbindet dich jedoch nicht von deiner Aufgabe. Wenn das Geheimnis gut versteckt sein soll, dann besser hier und nicht in der Stadt.« Er gab den beiden anderen Männern ein Zeichen, und gemeinsam gingen sie zur Tür. Erst dort drehte der Alte sich noch einmal um. »Wir haben geschworen, das Geheimnis zu wahren, bis der Tag endlich gekommen ist. So viele Generationen, und alle haben geschwiegen. Nichts kann uns von diesem Versprechen entbinden.«
»Und was, wenn der Tag bereits gekommen ist?«, fragte Elsbeth Rechsteiner leise, während sie weiter ins Feuer starrte. »Was, wenn es nun Zeit wird, endlich zu handeln?«
»Es ist nicht unsere Aufgabe, dies zu entscheiden. Das weiß allein Gott.« Der alte Mann zog seinen fleckigen Hut. »Dank dir für den heißen Trank, Elsbeth. Möge der Himmel dich beschützen.«
Die drei wandten sich schweigend ab und verließen die Hütte. Ihre Schritte knirschten auf dem mit Zweigen bedeckten Waldboden und entfernten sich langsam.
Dann herrschte wieder Stille.
Elsbeth Rechsteiner blieb mit ihrer Angst allein zurück.
***
Schweigend stiegen Agnes und Mathis den steilen Weg zur Burg hinauf. Von der Lichtung bis hierher waren sie fast ständig gelaufen. Agnes’ Herz pochte noch immer heftig, Schweiß stand ihr auf der Stirn. Immer wieder sah sie den zerfetzten, blutigen Torso vor sich, hörte sie die Schreie ihres Verfolgers. Sie wusste, dass sie nur mit knapper Not dem Tod entronnen waren. Mittlerweile hatte sie sich wenigstens so weit beruhigt, dass sie sich ausmalen konnte, was ihr Vater zu alldem sagen würde. Nicht nur, dass sie ihren Falken Parcival verloren hatte und der kleine Puck tot war – auch die Arkebuse hatten sie zurücklassen müssen. Wenn Philipp von Erfenstein herausfand, dass Mathis die Hakenbüchse gestohlen hatte, würde er einen seiner berühmten Wutanfälle bekommen. Auch wenn Agnes nicht glaubte, dass ihr Vater Mathis an den Annweiler Stadtvogt ausliefern würde, so drohte ihm doch der Karzer, wenn nicht sogar die Verbannung.
»War vielleicht doch kein so guter Einfall, das mit dem Experiment auf der Lichtung«, murmelte Mathis neben ihr. Auch er war von den Erlebnissen der letzten Stunde sichtlich mitgenommen. Er zitterte leicht und war noch immer leichenblass, was die schwarzen Rußspuren auf seinem Gesicht nur noch mehr hervorhob.
»Kein guter Einfall? Das war die … die dümmste Idee, die du je hattest!«, brach es aus Agnes heraus. Doch sie war zu sehr erschüttert, um wirklich zornig zu sein. »Den Knall hat man bestimmt bis Rom gehört«, fuhr sie ein wenig ruhiger fort. »Wir können von Glück reden, dass nicht noch mehr solcher Lumpen aufgetaucht sind.«
»Nun, wenigstens gibt es jetzt einen Lumpen weniger.« Trotzig schob sich Mathis eine rotblonde Locke aus dem Gesicht und wischte sich den Ruß von der Stirn. Einmal mehr fiel Agnes auf, dass der Schmiedgeselle nicht im eigentlichen Sinne schön war. Vor vielen Jahren hatte er sich beim Raufen die Nase gebrochen, seitdem stand sie ein wenig schief in dem sonst feingeschnittenen Gesicht; die Augen waren dunkel und blickten meist düster drein. Seit seiner frühen Kindheit hatte Mathis etwas Aufbrausendes, Zorniges, was ihn für Agnes immer interessant gemacht hatte.
»Ich glaube, dein Vater wäre stolz auf mich, wenn er’s wüsste«, brummte Mathis.
»Ich glaube eher, mein Vater würde dir den Arsch blutig hauen. Bete zu Gott, dass er es niemals herausfindet. Vielleicht hat ihn der zweifache Knall bereits misstrauisch gemacht. Schließlich weiß er, wie gerne du mit Feuerwaffen spielst.«
Mathis schnaubte verächtlich. »Wenn er nicht so starrköpfig wäre, könnte mein Wissen für die Burg Gold wert sein. Ich … ich müsste bloß einmal mit ihm reden …«
»Der Trifels braucht keine Hilfe, jedenfalls nicht von einem einfachen Schmiedgesellen«, unterbrach ihn Agnes harsch. »Also vergiss es, bevor du meinen Vater damit zur Weißglut treibst.«
In ängstlicher Vorahnung blickte sie hinauf zu der verwitterten Felsenburg, deren Vogt ihr Vater seit vielen Jahren war. Der Trifels thronte auf einem gewaltigen Keil aus Sandstein, der wie ein Schiff aus den umliegenden Wäldern herausragte. Auf drei Seiten erhoben sich bis zu fünfzig Schritt hohe Felsen. Nur im Osten führte eine schräge Ebene an die Burg heran, die auf dieser Seite durch vorgelagerte, mittlerweile jedoch verfallene Wehranlagen geschützt wurde. Einst war der Trifels eine uneinnehmbare Festung gewesen, aber diese Zeiten waren längst vorüber. Die Burg wurde immer mehr zur Ruine, und Agnes wusste, dass Mathis mit seinen kritischen Worten recht hatte. Doch ebenso gut wusste sie, was ihr ritterlich gesinnter Vater von Feuerwaffen hielt – nämlich gar nichts. Außerdem würde er, der Burgvogt, niemals den Rat eines gerade mal siebzehnjährigen Vasallen annehmen. Dafür war Philipp von Erfenstein viel zu stolz und auch zu eigensinnig. Im schlimmsten Fall würde er Mathis quer durch den Rittersaal prügeln. Davon abgesehen war für solche Anschaffungen einfach kein Geld vorhanden.
Nur kurze Zeit später passierten sie die nördliche Burgmauer und den Brunnenturm, der etwas abseits stand und durch eine windschiefe überdachte Brücke mit der Hauptburg verbunden war. Ein ausgetretener Pfad, gerade breit genug für ein Fuhrwerk, führte an der Mauer entlang bis zum vorderen Burgtor. Fast schien es Agnes, als würde der trutzige hohe Bau sie misstrauisch beäugen – wie ein gewaltiges Tier, das müde blinzelte, bevor es wieder in einen jahrhundertelangen Schlaf fiel.
»Und wenn wir deinem Vater einfach die Wahrheit erzählen?«, schlug Mathis zaghaft vor. »Schließlich hatte der Schwarze Hans vor, dich zu entführen. Erfenstein kann froh sein, dass wir bewaffnet waren und einen von Wertingens Halunken getötet haben. Außerdem wollte ich ohnehin wegen der Arkebusen mit ihm reden. Die Geschützkammer ist in einem wirklich schauerlichen Zustand, von den restlichen Wehranlagen ganz zu schweigen!« Er deutete auf einen ehemaligen Turm, von dem nur noch die Fundamente übrig waren. »Wenn nicht bald etwas geschieht, reicht ein einziges großes Unwetter, um hier alles einstürzen zu lassen. Ha, und drüben in Eußerthal machen die Pfaffen ihr Kloster von Tag zu Tag schöner!« Mathis’ Stimme schwoll nun an. »Erst letztes Jahr haben sie sich eine neue Glocke gießen lassen. Vom Geld ihrer hungrigen leibeigenen Bauern!«
Agnes war selbst dabei gewesen, als die Eußerthaler Glocke im vergangenen Sommer prunkvoll und aufwendig eingeweiht worden war. Die Bauern der Umgebung hatte man zuvor mit ein paar Almosen abgespeist. Mathis, der den Glockenguss aufmerksam verfolgt hatte und dem Meister gelegentlich zur Hand gegangen war, war der Feier deshalb ferngeblieben. In den Tagen darauf hatte er sich mit einigen Unbekannten im Wald getroffen und äußerst geheimnisvoll getan.
»Was ist los mit dir? Träumst du schon wieder? Du weißt, du machst mir Sorgen, wenn du solche Löcher in die Luft starrst.« Agnes zuckte zusammen, als Mathis’ Stimme sie aus ihren Gedanken riss. Er klang nun viel schüchterner als noch vor einer guten Stunde. Trotz ihrer Sorgen musste sie unwillkürlich lächeln.
»Und wenn schon? Wäre das so schlimm, wenn ich träumen würde?«
»Solange du nur von mir träumst.« Mathis grinste so breit, dass sie seine Zähne blitzen sah. Doch gleich darauf legte sich ein Schatten über sein Gesicht. »Vermutlich hast du recht. Wenn wir deinem Vater von der gestohlenen Arkebuse erzählen, wird er mich bei lebendigem Leib häuten.«
»Natürlich wird er dich nicht häuten, du Dummkopf! Wer soll ihm denn sonst seine geliebten Schwerter und Dolche schmieden, wenn es dein kranker Vater einmal nicht mehr kann? Du wirst sehen, alles wendet sich zum Guten.« Agnes nickte aufmunternd, während sie insgeheim krampfhaft überlegte, was sie über das Geschehene erzählen sollte. Was würde sie tun, wenn Philipp von Erfenstein sie tatsächlich auf die fehlende Arkebuse ansprach? Ihn einfach anlügen? Vermutlich würde er sie sofort durchschauen, dafür kannte der Burgvogt seine Tochter zu gut. Im Grunde konnte sie nur beten, dass ihr Vater das Fehlen der Waffe nie bemerkte.