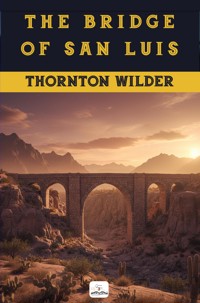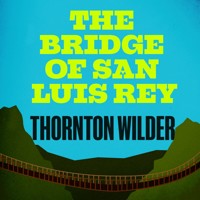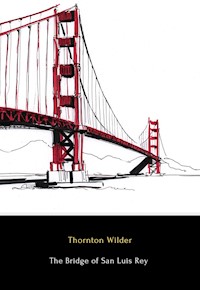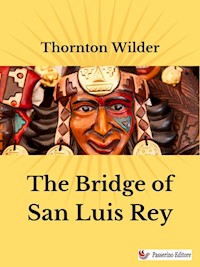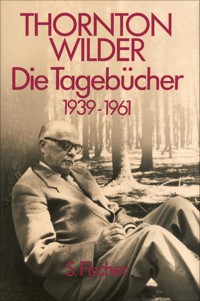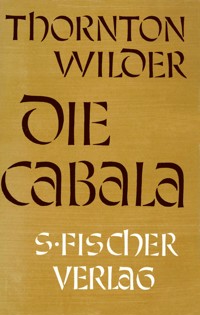
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thornton Wilders Roman ›Die Cabala‹ schildert die Begegnung eines jungen Amerikaners mit einem Kreis seltsamer junger Leute in Rom - Menschen, die wie Götter leben. Dem nüchternen jungen Mann ist diese Gesellschaft verdächtig, ein letztes Geheimnis, das er nicht enträtseln kann, beunruhigt ihn. Als er fragt, lautet die Antwort: »Die Götter der Antike sind nicht gestorben beim Aufkommen des Christentums, sie verloren nur ihre göttlichen Attribute.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Thornton Wilder
Die Cabala
Roman
Über dieses Buch
›Die Cabala‹ (1925) schildert die Begegnung eines jungen Amerikaners mit einem Kreis seltsamer junger Leute in Rom – Menschen, die wie Götter leben. Dem nüchternen jungen Mann ist diese Gesellschaft verdächtig, ein letztes Geheimnis, das er nicht enträtseln kann, beunruhigt ihn. Als er fragt, lautet die Antwort: »Die Götter der Antike sind nicht gestorben beim Aufkommen des Christentums, sie verloren nur ihre göttlichen Attribute.«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thornton Wilder wurde am 17. April 1897 in Madison, Wisconsin, als Sohn eines Zeitungsverlegers geboren, der als Generalkonsul nach Hongkong und Schanghai ging. Thornton Wilder erhielt für sein umfangreiches literarisches Werk zahlreiche Auszeichnungen, u. a. dreimal den Pulitzer-Preis und 1957 in Frankfurt am Main den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Er starb am 7. Dezember 1975 in Hamden, Connecticut.
Impressum
Covergestaltung: Martin Andersch
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 1926 unter dem Titel ›The Cabala‹ bei Albert & Charles Broni Inc., New York
© Thornton Wilder 1926
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1974
Für diese Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403452-2
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Meinen Freunden an der
Erstes Buch ERSTE BEGEGNUNGEN
Zweites Buch MARCANTONIO
Drittes Buch ALIX
Viertes Buch ASTRÉE-LUCE UND DER KARDINAL
Fünftes Buch GÖTTERDÄMMERUNG
Meinen Freunden an der
Amerikanischen Akademie
in Rom, 1920–1921
Erstes BuchERSTE BEGEGNUNGEN
Der Zug, welcher mich zum erstenmal nach Rom brachte, war verspätet, überfüllt und kalt. Es hatte mehreres Halten auf offener Strecke gegeben, und um Mitternacht bewegten wir uns immer noch durch die Campagna langsam auf die schwachgefärbten Wolken zu, die über Rom hingen. Bisweilen hielten wir an Bahnsteigen, wo grell flackernde Lampen für Augenblicke manch einen prächtigen wettergefurchten Kopf beleuchteten. Finsternis umgab diese Bahnsteige und ließ bloß ein Stück Straße und die Umrisse einer Hügelkette erkennbar werden. Es war Virgils Land, und der darüber herkommende Wind schien sich von den Feldern zu erheben und mit einem langen virgilischen Seufzer auf uns herabzuwehen, denn die Landschaft, die des Dichters Stimmung hervorruft, erhält zuletzt ihre Stimmung von ihm.
Der Zug war überfüllt, weil einige Vergnügungsreisende tags zuvor entdeckt hatten, daß die Bettler Neapels nach Karbolsäure rochen. Sie schlossen sogleich, daß die Behörden ein paar Fällen von indischer Cholera auf die Spur gekommen seien und die Unterwelt der Stadt durch ein System zwangsweiser Bäder zu desinfizieren suchten. Die Luft Neapels zeugt Legenden. Bei dem plötzlichen Exodus wurden Fahrkarten nach Rom fast unerhältlich, und Reisende erster Klasse fuhren dritter, und interessante Leute reisten in der ersten.
Im Waggon war es kalt. Wir saßen in unsern Mänteln gedankenverloren da, die Augen glasig von Resignation oder dem grellen Lampenlicht. In dem einen Abteil sprach eine Gesellschaft der Nation, die am meisten reist und am wenigsten Vergnügen davon hat, unermüdlich von schlechten Hotels; die Damen hatten die Röcke eng um die Beine gezogen, um Flöhen das Emporklettern zu verleiden. Ihnen gegenüber rekelten sich drei amerikanische Italiener, die nach zwanzig Jahren im Obst- und Juwelenhandel auf dem obern Broadway in ihr Heimatdorf im Apennin zurückkehrten. Sie hatten ihre Ersparnisse in den an ihren Fingern glitzernden Diamanten angelegt, und ihre Augen glitzerten nicht minder vor Freude auf die Wiedervereinigung mit ihrer Familie. Man konnte sich vorstellen, wie ihre Eltern sie anstarren würden, unfähig, die Veränderung zu begreifen, durch welche ihre Söhne die Anmut, die der Boden Italiens auch seinen unscheinbarsten Kindern verleiht, eingebüßt hatten, und bloß gewahrend, daß sie mit derben Zwiebelgesichtern wiedergekommen waren, sich barbarischer Redewendungen bedienten und für immer der witzigen Intuition ihrer Rasse beraubt waren. Es standen ihnen einige schlaflose Nächte ratloser Verwirrung über dem Lehmboden und den munkelnden Hühnern ihrer Mütter bevor.
In einem andern Abteil lehnte eine Abenteuerin im Silberzobelpelz die Wange an die schütternde Fensterscheibe. Ihr gegenüber saß eine funkeläugige Matrone und starrte sie mit herausfordernder Beharrlichkeit an, bereit, jeden Blick abzufangen, den die Person auf den schlummernden Gemahl würfe. Zwei junge Offiziere lungerten eindrucksvoll im Seitengang und angelten nach ihrem Blick, wie diese Insekten in der schönen Schilderung Fabres unter aussichtslosen Verhältnissen das Ritual des Flirts vor einem Stein vollziehen, bloß weil assoziativ gewisse Impulse ausgelöst wurden.
Ferner war noch ein Jesuitenpater mit seinen Schülern da und füllte die Zeit mit lateinischer Konversation aus; ein japanischer Diplomat, der andachtsvoll über seine Briefmarkensammlung gebeugt saß; ein russischer Bildhauer, der düster den Knochenbau unsrer Schädel entzifferte; einige sorgfältig fürs Fußwandern gekleidete Oxforder Studenten, welche über das ergiebigste Wanderland Italiens im Eisenbahnzug dahinfuhren; das unvermeidliche alte Weib mit einer Henne; und der unvermeidliche glotzende junge Amerikaner. Eine Gesellschaft, wie Rom sie täglich zehnmal in seine Mauern aufnimmt und dabei Rom bleibt.
Mein Gefährte las eine betrampelte Nummer der Londoner Times: Realitätenmarkt, militärische Beförderungen und alles übrige. James Blair war mit seinen sechs Jahren klassischer Studien in Harvard nach Sizilien geschickt worden, als archäologischer Berater einer Filmgesellschaft, die vorgehabt hatte, die gesamte griechische Mythologie auf die Leinwand zu bringen. Die Gesellschaft war zugrunde gegangen und in alle Winde zerstoben, und Blair hatte sich sodann im ganzen Gebiet des Mittelmeers herumgetrieben, gelegentliche Anstellungen gefunden und dickleibige Merkbücher mit Beobachtungen und Theorien gefüllt. Sein Geist war randvoll von Spekulationen über die chemische Zusammensetzung der Farben Raffaels; über die Lichtverhältnisse, unter denen die Bildhauer der Antike ihre Werke sehen wissen wollten; über die Entstehungszeit der allerunzugänglichsten Mosaiken in Santa Maria Maggiore. Er gestattete mir, Aufzeichnungen über alle diese Theorien zu machen, ja ich durfte sogar einige Diagramme in Tuschfarben kopieren. Für den Fall, daß er samt seinen Merkbüchern auf hoher See verschollen bliebe – einen nicht unwahrscheinlichen Fall, da er den Atlantik auf obskuren und geldsparenden Fahrzeugen zu überqueren pflegte, die, sogar wenn sie untergingen, in keiner Zeitung erwähnt wurden, – erwüchse mir die einigermaßen Verlegenheit bereitende Pflicht, dieses Material der Bibliothek von Harvard zum Geschenk zu machen, wo seine Unverständlichkeit ihm vielleicht einen unschätzbaren Wert verleihen würde.
Blair legte alsbald seine Zeitung beiseite und entschloß sich zu reden: »Du bist zwar nach Rom gekommen, um zu studieren, aber ehe du dich in die Alten vertiefst, sieh zu, ob du nicht einige interessante Moderne findest!«
»Bis jetzt gibt es noch kein Doktorat der römischen Moderne; das wird erst unsre Nachwelt einführen. Was für Moderne meinst du übrigens?«
»Hast du jemals von der Cabala gehört?«
»Von welcher?«
»Einer Gruppe von Leuten, die in der Umgebung Roms leben.«
»Nein.«
»Sie sind sehr reich und haben Ungeheuern Einfluß. Alle Welt hat Angst vor ihnen. Alle Welt hat sie im Verdacht, umstürzlerische Pläne auszuhecken.«
»Politische?«
»Nein … Manchmal.«
»Spitzen der Gesellschaft?«
»Ja, selbstverständlich. Aber sie sind auch mehr als das. Rasende intellektuelle Snobs, das sind sie. Madame Agaropoulos fürchtet sich nicht wenig vor ihnen. Sie sagt, daß sie von Zeit zu Zeit aus Tivoli herabkommen und mit allerlei Intrigen ein Gesetz im Senat durchdrücken oder eine Ernennung im Klerus bewirken oder irgendeine bedauernswerte Dame aus Rom vertreiben.«
»Tsch!«
»Einfach weil sie sich langweilen. Madame Agaropoulos behauptet, daß sie sich entsetzlich langweilen. Sie haben alles seit so langer Zeit besessen. Ihr Hauptmerkmal ist, daß sie alles hassen, was noch nicht lange besteht. Sie verbringen ihre Tage damit, neue Titel und neuen Reichtum und neue Ideen herabzusetzen. In vielen Dingen sind sie mittelalterlich; in ihrem Auftreten, zum Beispiel, und in ihren Anschauungen. Ich stelle es mir ungefähr so vor: Du hast gewiß von Forschungsreisenden gehört, die in der Nähe Australiens Inseln entdeckten, wo Tiere und Pflanzen vor Jahrtausenden aufhörten, sich weiter zu entwickeln; wo sich mitten in einer Welt, die weiter fortgeschritten ist, eine Nische archaischer Zeit findet. Nun, mit der Cabala muß es sich irgendwie ähnlich verhalten. Da lebt also eine Gruppe von Leuten, die schlaflose Nächte wegen einer Menge Ideen verbringen, denen die Welt schon seit Jahrhunderten entwachsen ist: das Recht einer Herzogin, vor einer andern eine Tür zu durchschreiten; die Wortfolge in einem Dogma der Kirche; das Gottesgnadentum der Könige, besonders der Bourbonen. Sie nehmen noch immer Dinge leidenschaftlich ernst, die wir andern als recht antiquarische Wissenschaft betrachten. Und was mehr ist, diese Leute, denen solche Ideen am Herzen liegen, sind nicht etwa Einsiedler und unbeachtete Sonderlinge, sondern Mitglieder eines so mächtigen und exklusiven Zirkels, daß ganz Rom mit angehaltenem Atem von ihnen als von der Cabala spricht. Laß dir sagen, sie gehn mit unglaublicher Spitzfindigkeit zu Werk und verfügen über unglaubliche Hilfsquellen an Vermögen und Ergebenheit. Ich zitiere bloß Madame Agaropoulos, die eine Art hysterischer Angst vor ihnen hat und sie für übernatürliche Wesen hält.«
»Aber sie muß doch einige von ihnen persönlich kennen?«
»Selbstverständlich; auch ich kenne einige.«
»Man fürchtet sich nicht vor Leuten, die man kennt. Wer gehört zu ihnen?«
»Ich werde dich morgen zu einer von ihnen, zu dieser Miss Grier, mitnehmen. Sie ist die Anführerin des ganzen internationalen Klüngels. Ich habe für sie ihre Bibliothek katalogisiert – oh, auf eine andre Weise hätte ich sie nie kennengelernt. Ich wohnte damals bei ihr im Palazzo Barberini und wurde mitunter von einem Hauch der Cabala gestreift. Außer ihr ist auch ein Kardinal dabei und die Prinzessin d'Espoli; sie ist verrückt. Und Frau Bernstein – aus der deutschen Bankiersfamilie. Jedes von ihnen besitzt irgendeine hervorragende Begabung, und alle zusammen stehn sie turmhoch über der nächst tiefern sozialen Schicht. Sie sind so fabelhafte Leute, daß sie sich einsam fühlen. Ich zitiere bloß. Sie sitzen abseits droben in Tivoli, und ein jedes bemüht sich, aus der Vortrefflichkeit der andern so viel Trost als möglich zu gewinnen.«
»Nennen sie selbst sich die Cabala? Sind sie organisiert?«
»So, wie ich es sehe, nicht. Wahrscheinlich ist es ihnen selbst nicht einmal aufgefallen, daß sie so etwas wie einen Zirkel bilden. Ich sage dir ja, studiere du diese Leute! Spüre es aus, das ganze Geheimnis! Mir liegt so etwas nicht.«
In der darauffolgenden Pause wehten Bruchstücke von Gesprächen aus benachbarten Abteilen in unsern eben erst mit halbgöttlichen Persönlichkeiten beschäftigt gewesenen Geist. »Ich habe nicht den leisesten Wunsch zu streiten, Hilda«, murrte eine der Engländerinnen. »Du hast selbstverständlich alle Anordnungen für diese Reise getroffen, so gut du konntest. Ich behaupte bloß, daß dieses Stubenmädchen den Waschtisch nicht täglich gereinigt hat. Die Platte war immer voller Ringe.«
Und von einem der amerikanischen Italiener klang es herüber? »Ick ihm sagen, das nix sein von seine gottverdammte Sack. Trag deine gottverdammte Gesickt aus das Lokal! sagen ick. Er rennen, ick dir sagen; er rennen so schnell, du nix sehn kein Staub von ihm, so geronnen er.«
Der Jesuitenpater und seine Schüler hatten sich höflich für die Briefmarken zu interessieren begonnen, und der japanische Attache murmelte: »Oh, ganz außerordentlich selten! Die Vier-Cents ist blaßlila, und wenn man sie gegen das Licht hält, zeigt sie ein Wasserzeichen, ein Seepferd. In der ganzen Welt gibt es nur sieben Stück, und drei von ihnen sind in der Sammlung des Barons Rothschild.«
Symphonisch betrachtet, vernahm man, daß kein Zucker darin war, daß sie Marietta an drei aufeinander folgenden Morgen gesagt hatte, sie solle Zucker hineintun oder Zucker mit hereinbringen, obwohl die Republik Guatemala sie sogleich eingezogen hatte, was nicht verhinderte, daß doch einige in die Hände von Sammlern gerieten und mehr Muskatmelonen, als man für möglich halten würde, alljährlich an der Ecke des Broadway und der 126. Straße verkauft wurden. Vielleicht geschah es aus Abscheu vor solch kleiner Münze, daß sich in mir der erste Impuls regte, jenen Olympiern nachzuspüren, die möglicherweise gelangweilt und auf Irrwegen waren, von denen aber jeder und jede zumindest »irgendeine hervorragende Begabung« besaß.
In solcher Gesellschaft also, und in der niederdrückenden Stimmung von ein Uhr nachts, kam ich zum ersten Mal in Rom an, auf diesem Bahnhof, der häßlicher ist als die meisten, noch mehr behängt mit Plakaten von Heilwässern, und noch stärker nach Ammoniak riecht. Während der Reise hatte ich mir ausgemalt, was ich sogleich nach meiner Ankunft tun wollte: mich mit Kaffee und Wein vollfüllen und in der erhabenen Mitternacht die Via Cavour entlanglaufen. Unter der Andeutung der Morgendämmerung würde ich die Tribuna von Santa Maria Maggiore gewahren, über mir hockend wie die Arche auf dem Ararat, und den Geist Palestrinas in einer unsaubern Sutane aus einem Seitenpförtchen schlüpfen und zu einer fünfstimmigen Familie heimeilen sehen; ich würde weiterhasten, zur Plattform vor dem Lateran, wo Dante sich unter die Jubeljahrmenge mischt; würde mich über das Forum beugen und um den verschlossenen Palatin streichen; würde dem Fluß folgen bis zu dem Gasthof, wo Montaigne ob seines Leidens stöhnte; und würde in starres Staunen versinken vor des Papstes felsengleicher Wohnung, wo Roms größte Künstler arbeiteten, der eine, der niemals unglücklich war, und der andre, der niemals etwas andres war. Ich würde mich zurechtzufinden wissen, denn mein Geist wurde auf dem Plan der Stadt aufgebaut, der während der acht, in Schule und College verbrachten Jahre über meinem Schreibtisch hing, einer Stadt, nach der ich mich so sehr gesehnt hatte, daß mir schien, ich hätte im Grunde meines Herzens niemals ernsthaft geglaubt, sie je zu erblicken.
Als ich dann endlich ankam, lag der Bahnhof verlassen da; es gab keinen Kaffee, keinen Wein, keinen Mond, keine Geister; bloß eine Fahrt durch schattendunkle Straßen beim Klang plätschernder Brunnen und dem eigenartigen Echo travertinischen Pflasters.
Während der ersten Woche war Blair mir behilflich, eine Wohnung zu finden und einzurichten. Sie bestand aus fünf Zimmern in einem alten Palazzo jenseits des Flusses, einen Steinwurf weit von der Basilika Santa Maria in Trastevere. Die Räume waren hoch und feucht und schlechtes achtzehntes Jahrhundert. Die Decke des Salons war bescheiden kassettiert, und in der Halle fanden sich Reste abbröckelnder Stuckarbeit mit Spuren von Bemalung in schwachem Blau, Rosa und Gold; jedes Fegen am Morgen entführte wieder ein Stückchen einer Engelslocke oder einer Ranke oder Girlande. In der Küche war ein Freskogemälde, Jakobs Kampf mit dem Engel darstellend, aber der Herd verdeckte es zum Teil. Wir brachten zwei Tage damit zu, Tische und Stühle auszusuchen, sie auf Karren zu verladen und persönlich in unsre schäbige Gasse zu geleiten; vor einem Dutzend Läden um lange Streifen graublauen Brokats zu feilschen, stets bedacht auf Abwechslung in Flecken, Zerschlissenheit und Falten; unter den vielen flotten Nachahmungen diejenigen Kandelaber auszuwählen, die am erfolgreichsten hohes Alter und reine Linienführung vortäuschten.
Ottima akquiriert zu haben, war ein Triumph Blairs. An der nächsten Straßenecke befand sich eine Trattoria, eine von Müßiggang und lässigem Geschwätz erfüllte Weinschenke, die von drei Schwestern geführt wurde. Blair studierte sie eine Zeitlang und schlug schließlich der dem reifern Alter sich nähernden, intelligenten und humorvollen vor, sie solle zu mir ziehen und »für ein paar Wochen« meine Köchin sein. Italiener haben eine Abneigung gegen langfristige Vereinbarungen, und diese Klausel war es, wodurch Ottima sich gewinnen ließ. Wir machten uns erbötig, jeden beliebigen Mann, den sie empfehlen würde, als Hilfskraft für die grobe Arbeit aufzunehmen, aber mit verdüsterter Miene entgegnete sie, sie könne sehr gut auch die grobe Arbeit verrichten. Die Übersiedlung in meine Wohnung mußte sich als eine von der Vorsehung gesandte Lösung irgendeines Problems in ihrem Leben eingestellt haben, denn Ottima widmete sich mit einer wahren Leidenschaft ihrer Arbeit, meiner Bequemlichkeit und ihren Gefährten in der Küche, Kurt, dem Schäferhund, und Messalina, der Katze. Jedes drückte ein Auge zu über die Schwächen des andern, und so schufen wir ein Heim.
Am Tag nach unsrer Ankunft hatten wir dem neuesten Diktator Roms unsre Aufwartung gemacht und uns einer fast knabenhaften alten Jungfer gegenüber befunden, an der einem die interessanten, leidenden Gesichtszüge, die unruhigen, vogelartigen Bewegungen und die Zurschaustellung einer mit Gereiztheit abwechselnden Freundlichkeit auffielen. Es war fast sechs Uhr, als wir ihren Salon im Palazzo Barberini betraten und daselbst vier Damen und einen Herrn vorfanden, die ein wenig steif um einen Tisch saßen und sich in französischer Sprache unterhielten. Madame Agaropoulos stieß beim Anblick Blairs, des zerstreuten Gelehrten, dem sie so zugetan war, einen Freudenschrei aus; Miss Grier, die Hausfrau, echote ihn. Eine magere Mrs. Roy wartete, bis etwas über unsre verwandtschaftlichen Beziehungen in die Konversation eingestreut wurde, ehe sie sich ein entspanntes Lächeln gestattete. Der spanische Gesandte und seine Frau verwunderten sich, wie in aller Welt Amerika ohne ein System von Titeln auskomme, durch das man unfehlbar seinesgleichen zu erkennen vermöge, und die Marchesa erschauerte ein wenig, als wir zwei jungen Rothäute in den Salon eindrangen, und begann im Geist den fehlerhaften französischen Satz zu formen, mit dem sie sich alsbald zu verabschieden gedachte. Eine Weile flatterte die Unterhaltung unstet und abgerissen umher, mit einem Anflug der förmlichen Anmut jeder Konversation, die in einer Sprache geführt wird, welche die Muttersprache keines der Anwesenden ist.
Plötzlich wurde ich auf eine in dem Raum entstandene Spannung aufmerksam. Ich spürte die Ansätze zu einer Intrige, ohne daß ich ihre Ziele auch nur im entferntesten zu ahnen vermochte. Miss Grier tat, als plauderte sie leichthin, aber in Wirklichkeit war es ihr ganz ernst, und Mrs. Roy machte sich im Kopf Aufzeichnungen. Die Episode entwickelte sich zu einem typischen, wenn auch nicht sehr komplizierten Beispiel eines in der römischen Gesellschaft üblichen Kuhhandels mit seinen charakteristischen Verzweigungen in das kirchliche, politische und häusliche Leben. Im Licht viel später erhaltener Aufklärungen kann ich hier darlegen, welchen Dienst Mrs. Roy von Miss Grier erwiesen haben wollte, und was Miss Grier als Gegenleistung dafür verlangte.
Mrs. Roy hatte nahe beieinander stehende Augen und einen Mund, der soeben Chinin geschmeckt haben mußte; während sie sprach, rasselten ihre Ohrgehänge um die vorstehenden Schlüsselbeine. Sie war Katholikin und in ihrer politischen Betätigung eine Schwarze von schwärzester Färbung. Während ihres römischen Aufenthalts hatte sie sich damit befaßt, gewisse amerikanische Wohltätigkeitsunternehmen der Beachtung des Stellvertreters Gottes auf Erden näherzubringen. Verleumdung unterschob ihr für ihre guten Werke die verschiedensten Beweggründe, von denen der am wenigsten diffamierende die Hoffnung war, zu einer Gräfin des Kirchenstaats ernannt zu werden. Tatsächlich jedoch suchte Mrs. Roy mit solcher Aufdringlichkeit Audienzen im Vatikan, weil sie Seine Heiligkeit bestimmen wollte, ein Wunder zu wirken, nämlich, ihr die Trennung ihrer Ehe auf Grund des Paulinischen Privilegs zu gewähren. Die Erfüllung – und es fehlte nicht an Präzedenzfällen – hing von einer Reihe von Bedingungen ab.
Ehe er einen solchen Schritt unternähme, müßte der Vatikan sehr sorgfältig feststellen, wie groß das Befremden in römisch-katholischen Kreisen wäre; von den Kardinälen in Amerika würde man einen vertraulichen Bericht über den Charakter der Matrone einfordern, und die Glaubenstreuen in Rom und Baltimore würden, ohne daß sie es merkten, ausgeholt werden. Hierauf würde man es angezeigt finden, das Maß von Hohn oder Beifall abzuschätzen, das der Schritt in protestantischen Kreisen auslösen könnte. Mrs. Roys Ruf war, wie es sich traf, über jeden Vorwurf erhaben und ihr Recht auf eine Ehetrennung unbestreitbar (ihr Gatte hatte in jeder Kategorie von Gründen Verstöße begangen; er war seiner Frau untreu gewesen; er hatte einer viel Höheren die Treue gebrochen; und er war ein animae periculum geworden, das heißt, er hatte versucht, seine Frau in einen lästerlichen Streit über die Verflüssigung des Blutes des hl. Januarius zu verwickeln). Dennoch war das protestantische Imprimatur nötig. Und wessen Meinung konnte in dieser Hinsicht wertvoller sein als die der sittenstrengen Führerin der amerikanischen Kolonie? Man würde also – und beide Frauen wußten das – durch Mittelsleute von ebensoviel Takt wie Gewicht an Miss Grier herantreten; und falls die Antwort vom Palazzo Barberini einen Ton der Ungewißheit enthielte, würde die wohlbekannte Entscheidung »Untunlich« gefällt und die Frage nie wieder aufgerollt werden.
Mrs. Roy, die so viel von Miss Grier zu erbitten hatte, wollte wissen, ob es irgendeinen Gegendienst gäbe, den sie ihr erweisen könnte.
Es gab einen.
Kein Werk der klassischen Kunstepochen darf Italien verlassen, ohne daß eine ungeheure Ausfuhrsteuer dafür entrichtet wird. Wie kam es dann, daß Mantegnas »Madonna mit dem hl. Georg und der hl. Helena« jemals in die Alumnenhalle des Vassar-College gelangte, ohne durch die Hände der Zollbehörde gegangen zu sein? Das Gemälde war zuletzt vor drei Jahren in der Sammlung der verarmten Principessa Gaeta gesehn worden; es wurde auch während der folgenden Jahre in den Listen des Ministers der Schönen Künste als Stück dieser Sammlung geführt, ungeachtet des Gerüchts, daß es den Museen von Brooklyn, Cleveland und Detroit angeboten worden sei. Es wechselte sechsmal den Besitzer, aber Händler, Kunstgelehrte und Galeriedirektoren waren so sehr von dem Problem in Anspruch genommen, ob der linke Fuß der hl. Helena (wie Vasari behauptet) von Bellini übermalt worden sei oder nicht, daß sie nie auf die Frage verfielen, ob das Bild an der Grenze registriert worden war. Zuletzt wurde es von einer verschrobenen alten Bostoner Witwe mit lavendelfarbener Perücke gekauft und von ihr, als sie im Sterben lag, zusammen mit drei zweifelhaften Botticelli, eben jenem College vermacht, zu dem für sie jede Beziehung schon durch ihre verbrecherische Rechtschreibung ausgeschlossen war, außer der einer Kuratorin.
Der Minister der Schönen Künste hatte soeben von der Schenkung erfahren und war in Verzweiflung. Wenn die Sache ruchbar würde, wäre es um seine Stellung und seinen Ruf geschehn. Alle seine gewaltige Arbeit für sein Land (exempli gratia: er hatte sich zwanzig Jahre lang der Ausgrabung Herkulaneums widersetzt; er hatte die Fassaden von zwanzig prachtvollen Barockkirchen zerstört, in der Erwartung, ein Fenster aus dem dreizehnten Jahrhundert aufzudecken, usw.) würde ihm in den drohenden Stürmen der römischen Journalistik nichts nützen. Alle ihr Vaterland liebenden Italiener schmerzt es, sehn zu müssen, wie ihre Kunstschätze nach Amerika verschleppt werden; sie warten bloß auf einen Anlaß, einen Staatsbeamten in Stücke zu reißen und ihren verletzten Nationalstolz zu kühlen. Die amerikanische Botschaft wand sich bereits in Vermittlungskrämpfen. Man konnte vom Vassar-College nicht erwarten, daß es das Bild herausgeben oder den für geschmuggeltes Gut festgesetzten Straf zoll bezahlen werde. Morgen würden die römischen Leitartikel ein barbarisches Amerika schildern, das Italien seine ureigensten Kinder stehle, und Anspielungen auf Cato, Äneas, Michelangelo, Cavour und San Francesco würden nicht fehlen. Und dann ritte der Senatus Romanus auf jedem heikeln kleinen Staatsgeschäftchen herum, an dessen günstiger Erledigung Amerika gelegen wäre.
Miss Grier nun war ebenfalls eine Kuratorin des Vassar-College. Sie hatte einen schmeichelhaften Platz in dem langen Festzug, der sich im Juni zwischen den Sonnenuhren und instruktiven Sträuchern formiert. Sie war bereit, die Gefällsstrafe zu zahlen, aber nicht eher, als bis sie die Stadtväter beschwichtigt hätte. Dies ließe sich durch Bewirkung einer günstigen Abstimmung in dem Ausschuß erreichen, welche an ebendiesem Abend eine Sitzung abhalten sollte. Er bestand aus sieben Mitgliedern; über vier ihrer Stimmen verfügte Miss Grier bereits; die anderen waren Schwarze. Damit die Sache im Interesse der Principessa Gaeta fallen gelassen würde, war Stimmeneinheit nötig.
Wenn Mrs. Roy sich sogleich zu ihrem Auto hinunterbegäbe, hätte sie noch Zeit, zur amerikanischen Akademie auf der Piazza di Spagna zu fahren und sich mit dem guten alten, allwissenden Pater O'Leary zu beraten. Wunderbar ist die Akustik der Kirche! Noch vor zehn Uhr desselben Abends würden die drei schwarzen Stimmen, wie es sich gehörte, für eine Versöhnung abgegeben werden. Es war Miss Griers Aufgabe, dieses lange Expose Mrs, Roy über den Teetisch hinweg zu vermitteln und dabei den unaussprechlichen Gegendienst anzudeuten, den sie ihr für eine Gefälligkeit zu leisten vermöchte. Die Aufgabe wurde dadurch noch verwickelter, daß weder Madame Agaropoulos, noch die Gemahlin des Gesandten (Männer zählen nicht!) das geringste geheime Einverständnis argwöhnen durften. Glücklicherweise vermochte die Gemahlin des Gesandten rasch gesprochenes Französisch nicht zu verstehn, und Madame Agaropoulos konnte, da sie sentimental war, beständig durch schöngefärbte und in Rührung getunkte kleine Brocken von der Hauptsache abgelenkt werden.
Miss Grier spielte ihre unterschiedlichen Karten mit der Sparsamkeit und Genauigkeit einer fehlerlosen Technik aus. Sie besaß diese Fähigkeit, die ein ganz eigenartiger Teil der echten, den großen Monarchen innewohnenden Herrschergabe ist und sich besonders bei Elisabeth von England und Friedrich dem Großen zeigte, nämlich die Kunst, Drohungen genau auf denjenigen Grad abzustimmen, der anreizt, ohne aufzureizen. Mrs. Roy verstand sogleich, was von ihr erwartet wurde. Sie hatte nun schon seit Jahren Ausschußwahlen gemacht und versauerte päpstliche Kämmerer und klerikal gesinnte Italiener beschwichtigt; mit Beziehungen und Einfluß Handel zu treiben, war ihr tägliches Brot. Überdies vermag Freude äußerst fördernd auf die Auffassungsgabe zu wirken, und sie fühlte, daß die Trennung ihrer Ehe nunmehr sehr nahegerückt war. Hastig erhob sie sich.
»Wollen Sie mich entschuldigen, wenn ich schon gehe?« murmelte sie. »Ich versprach Julia Howard, sie von den Rosalis abzuholen, und ich muß vorher noch etwas auf der Piazza di Spagna besorgen.«
Sie nickte uns zu und enteilte. Welches Gefühl ist es, das solch nüchternen Füßen Flügel leiht und Überschwang solch saftlosem Temperament? Ein Jahr darauf heiratete sie einen jungen französischen Segelsportler, halb so alt wie sie selbst; sie ließ sich in Florenz nieder und schenkte einem Sohn das Leben. Die Schwarzen redeten, wenn sie in deren Salons erschien, nicht mehr von Abstimmungen. Das Vassar-College blieb im Besitz des Gemäldes und bewahrt in seinem Archiv einen Brief des italienischen Außenministers, der sich wie eine Schenkungsurkunde liest. Die Wirkung eines Kunstwerks auf zufällig Vorübergehende ist zu subtil für eine genaue Abschätzung, aber bei genügender Glaubensstärke kann man überzeugt sein, daß die Hunderte von jungen Mädchen, die täglich an dem Mantegna vorbeigehn, aus ihm Antriebe gewinnen, die sie zu edleren Gattinnen und Müttern machen. Das zumindest ist, was das Ministerium in jenem Brief dem College versprach.
Als die andern gegangen waren, schnitt Miss Grier ein Gesicht hinter ihnen drein, dämpfte die Beleuchtung und bat uns, ihr von New York zu erzählen. Sie schien Vergnügen an solch exotischer Gesellschaft wie die unsre zu finden, aber ihre Gedanken wanderten, bis sie, plötzlich aufspringend, die Falten ihres Kleids zurechtstrich und uns auftrug, schnell nach Hause zu gehn, uns umzukleiden und um acht Uhr zum Dinner wiederzukommen. Wir waren überrascht, aber der Situation gewachsen, und eilten in den Regen hinaus.