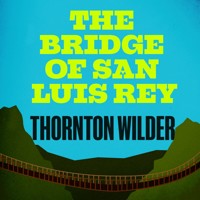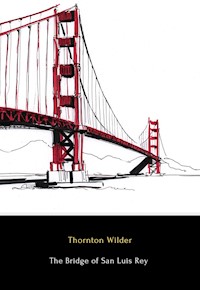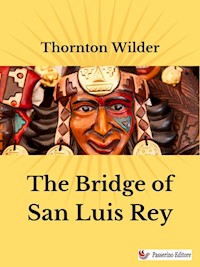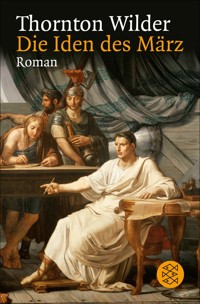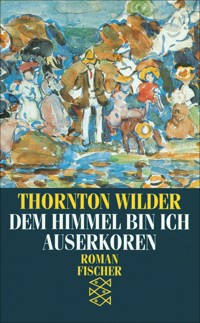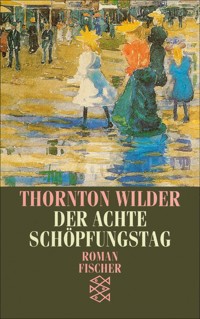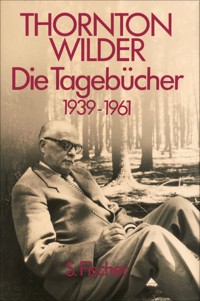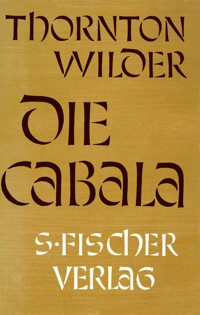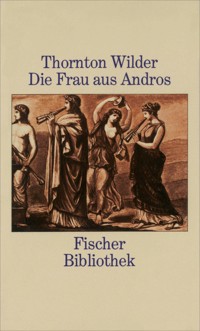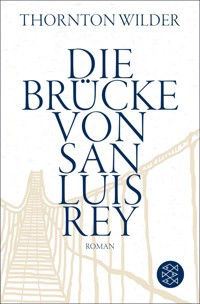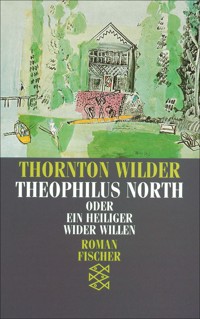
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Thornton Wilders letzter Roman - sein autobiographischster, sein menschenfreudlichster. Überall, wo er auftaucht, gelingt es Theophilus North auf wundersame Weise, die Dinge ins Lot zu bringen. Er befreit eine junge Millionenerbin von einem Mitgiftjäger, stiftet oder kittet Ehen, heilt Kranke und entlarvt eine Fälscherbande. Es ist der alte Traum von Thornton Wilder, das Märchen vom guten Menschen, der in Gestalt von Theophilus North im Amerika von 1926 Frieden stiftet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Thornton Wilder
Theophilus North oder Ein Heiliger wider Willen
Roman
Über dieses Buch
Thornton Wilders letzter Roman – sein autobiographischster, sein menschenfreudlichster.
Überall, wo er auftaucht, gelingt es Theophilus North auf wundersame Weise, die Dinge ins Lot zu bringen. Er befreit eine junge Millionenerbin von einem Mitgiftjäger, stiftet oder kittet Ehen, heilt Kranke und entlarvt eine Fälscherbande. Es ist der alte Traum von Thornton Wilder, das Märchen vom guten Menschen, der in Gestalt von Theophilus North im Amerika von 1926 Frieden stiftet.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Thornton Wilder wurde am 17. April 1897 in Madison, Wisconsin, als Sohn eines Zeitungsverlegers geboren, der als Generalkonsul nach Hongkong und Schanghai ging. Thornton Wilder erhielt für sein umfangreiches literarisches Werk zahlreiche Auszeichnungen, u.a. dreimal den Pulitzer-Preis und 1957 in Frankfurt am Main den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Er starb am 7. Dezember 1975 in Hamden, Connecticut.
Impressum
Covergestaltung: Buchholz / Hinsch / Hensinger
Coverabbildung: Raoul Dufy, ›Oarsmen on the Marne‹ / VG-Bildkunst, Bonn, 2014
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1973 unter dem Titel ›Teophilus North‹ bei Harper & Row, Publishers, Inc., New York
© 1973 by Thornton Wilder
Für die deutschspachige Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 1974
Für diese Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2014
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403457-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Robert Maynard Hutchins
Erstes Kapitel Die neun Ambitionen
Zweites Kapitel Die neun Städte von Newport
Drittes Kapitel Diana Bell
Viertes Kapitel Das Wyckoff-Haus
Fünftes Kapitel »Neun Giebel«
Sechstes Kapitel RIP
Siebentes Kapitel Bei Mrs. Keefe
Achtes Kapitel Die Fenwicks
Neuntes Kapitel Myra
Zehntes Kapitel Mino
Elftes Kapitel Alice
Zwölftes Kapitel »Der Hirschpark«
Dreizehntes Kapitel Bodo und Persis
Vierzehntes Kapitel Edweena
Fünfzehntes Kapitel Der Dienstbotenball
Für Robert Maynard Hutchins
Erstes KapitelDie neun Ambitionen
Im Frühling 1926 kündigte ich meine Stellung auf.
Die ersten Tage nach einer solchen Entscheidung ähneln denen der Entlassung aus dem Hospital nach langer Krankheit. Man lernt langsam wieder gehen, hebt langsam und verwundert den Kopf.
Ich erfreute mich der besten Gesundheit, nur innerlich war ich erschöpft. Ich war viereinhalb Jahre lang als Lehrer an einer Knabenschule in New Jersey tätig gewesen und dreieinhalb Sommer lang als Tutor in einem von der Schule organisierten Ferienlager. Nach außen hin wirkte ich heiter und pflichtbewußt, aber im Grunde war ich zynisch und brachte andern Menschen, mit Ausnahme meiner nächsten Familienangehörigen, nur wenig Sympathie entgegen. Ich war neunundzwanzig Jahre alt, beinahe dreißig. Ich hatte zweitausend Dollar gespart – beiseite gelegt und nicht angetastet –, um entweder nach Europa zurückzukehren (ich hatte 1920-21 ein Jahr in Frankreich und Italien verbracht), oder um mich an irgendeiner Universität zu immatrikulieren. Mir war noch gar nicht klar, was ich werden wollte. Auf keinen Fall Lehrer, obwohl ich wußte, daß ich dafür begabt war; dieser Beruf ist nur allzu häufig ein Sicherheitsnetz für solch unschlüssige Naturen wie mich. Ich mochte auch kein Schriftsteller werden, der seinen Unterhalt mit der Feder verdient; ich wollte viel tiefer ins Leben eintauchen. Sollte ich wirklich, was man so »schreiben« nennt, je aufgreifen, dann erst nach meinem fünfzigsten Jahr. Sollte es mir aber bestimmt sein, vorher zu sterben, besaß ich immerhin die Gewißheit, so vielfältige Erfahrungen wie nur irgend möglich gemacht zu haben – und nicht auf jenes noble, aber vorwiegend sitzende Streben nach den »schönen Künsten« beschränkt gewesen zu sein.
Berufe. Lebensläufe. Karrieren. Man tut gut daran, den Ambitionen, die in buntem Wechsel die Phantasie eines heranwachsenden Knaben oder Mädchens überfluten, Beachtung zu schenken. Sie hinterlassen tiefe Spuren. Wenn der erste Saft aufsteigt, läßt der zukünftige Baum bereits seine Umrisse erkennen. Wir werden durch die Verheißungen unserer Phantasie geformt.
Neun Ambitionen haben im Lauf der Jahre meine Begeisterung entzündet – nicht immer der Reihe nach, mitunter auch gleichzeitig; manche wurden begraben und später von neuem lebendig, mitunter sogar sehr lebendig, obschon in veränderter Form, und zu meiner eigenen Verwunderung waren sie erst wiederzuerkennen, nachdem die Ereignisse, die sie aus dem Unterbewußtsein heraufgeschwemmt hatten, bereits der Vergangenheit angehörten.
Die erste, und früheste, Ambition tauchte zwischen meinem zwölften und vierzehnten Jahr auf. Fast schäme ich mich, von ihr zu erzählen. Ich wollte ein Heiliger werden, ein Missionar unter primitiven Völkern. Ich hatte zwar noch nie einen Heiligen zu Gesicht bekommen, aber schon sehr viel darüber gehört und gelesen. Ich besuchte damals eine Schule in Nord-China, und die Eltern aller meiner Mitschüler (und auf ihre Art auch die Lehrer) waren Missionare. Es traf mich wie ein Schlag, als mir zum erstenmal auffiel, daß sie (vielleicht ohne es zu merken) die Chinesen für ein primitives Volk hielten. Ich wußte es besser. Trotzdem hat es mich nicht von meinem Plan abgebracht, als Missionar inmitten eines wirklich primitiven Stammes zu wirken. Ich würde ein beispielhaftes Leben führen und vielleicht sogar die Märtyrerkrone erringen. In den folgenden zehn Jahren überblickte ich allmählich die Schwierigkeiten dieser Laufbahn. So viel glaubte ich nun zu wissen, daß der Heiligenanwärter vollkommen in seiner Beziehung zu Gott aufgehen muß, in seinem Bestreben, Ihm zu gefallen und Seinen Kreaturen hier auf Erden zu dienen. Leider hatte ich bereits 1914 (in meinem siebzehnten Jahr) aufgehört, an die Existenz Gottes zu glauben; meine Vorstellung von dem zutiefst Göttlichen in meinen Mitmenschen (und in mir selbst) hatte sich verflüchtigt, und niemals würde ich den Geboten striktester Selbstlosigkeit, Wahrhaftigkeit und Keuschheit genügen können.
Vielleicht habe ich als Folge dieses kurzen Strebens eine zeit meines Lebens immer wieder auftauchende Kindlichkeit bewahrt. Mir fehlten Aggressionen und der Antrieb zum Wettkampf. Ich konnte mich über einfache Dinge freuen wie ein Kind, das am Meeresufer mit Muscheln spielt. Ich wirkte oft »leer« und abwesend. Manch einen störte das; sogar von mir geschätzte Freunde, Männer wie Frauen (vielleicht auch mein Vater), brachen die Beziehung ab mit dem Vorwurf, ich wäre nicht »seriös«, oder eben »einfältig«.
Meine zweite Ambition – eine Säkularisierung der ersten – war: Anthropologe unter primitiven Völkern, und dieses Interesse hat sich auch später immer wieder erneuert. Vergangenheit und Zukunft sind stets in uns gegenwärtig. Der Leser wird bemerken, daß der Anthropologe und sein Sprößling, der Soziologe, weiterhin durch dieses Buch geistern.
Dritte Ambition: Archäologe.
Vierte Ambition: Detektiv. Im dritten Collegejahr nahm ich mir vor, ein staunenerregender Detektiv zu werden. Ich las die einschlägige Literatur, nicht nur Kriminalromane, sondern auch Sachbücher über die verfeinerten wissenschaftlichen Methoden auf diesem Gebiet. Chief Inspector North sollte eine führende Rolle spielen unter allen, die unser Leben in dem braven Heim und der Werkstatt vor dem Einbruch des auflauernden Bösen und des Wahnsinns beschützen.
Fünfte Ambition: Schauspieler. Ein genialer Schauspieler. Diese Selbsttäuschung dürfte im Zusammenhang mit den übrigen acht Ambitionen nicht weiter überraschen.
Sechste Ambition: Zauberer. Ich hatte mir dieses Ziel nicht ausgesucht, und es fällt mir schwer, ihm einen Namen zu geben. Jedenfalls hatte es nichts mit Vorführungen auf einem Theater zu tun. Schon früh hatte ich eine heilende Kraft in mir entdeckt, eine Gabe, die an »Mesmerismus« erinnerte, oder – darf ich so sagen? – an Dämonenaustreibung. Ich begriff, worauf sich ein »Schamane« oder ein Medizinmann verläßt. Diese Gabe freute mich nicht, und ich machte auch nur selten davon Gebrauch: Er wurde mir, wie der Leser noch sehen wird, gelegentlich aufgezwungen. Ein gewisses Maß von Betrug und Quacksalberei gehört dazu. Je weniger Worte man darüber verliert, desto besser.
Siebente Ambition: der Liebhaber. Was für ein Liebhaber? Ein Allesfresser wie Casanova? Nein. Ein Liebhaber der edlen und erhabenen Frau, wie die provençalischen Troubadoure? Nein.
Jahre später hat mich ein höchst kenntnisreicher Gesprächspartner über den von mir vertretenen Typus belehrt. Sigmund Freud verbrachte jeden Sommer in Grinzing. Ich verbrachte damals auch einen Sommer in Grinzing und, ohne daß ich etwas dazu getan hätte, erhielt ich die Einladung, mich am Sonntagnachmittag zu seinen sogenannten »Plaudereien« in seiner Villa einzufinden. In einer dieser äußerst reizvollen Plaudereien kam auch die Rede auf den Unterschied zwischen »lieben« und »sich verlieben«.
»Herr Doktor«, sagte er, »kennen Sie eine alte englische Komödie – der Name ist mir entfallen –, in welcher der Held an einer ganz bestimmten Hemmung leidet? In Gegenwart von ›Damen‹ und wohlerzogenen Mädchen ist er scheu und stumm, er kann die Augen kaum vom Boden erheben. Aber in der Gegenwart von Dienst- und Barmädchen und den sogenannten emanzipierten Frauen‹ ist er äußerst dreist und unverschämt. Wissen Sie zufällig den Titel dieser Komödie?«
»Ja, Herr Professor, ›She Stoops to Conquer‹.«
»Und wer ist der Autor?«
»Oliver Goldsmith.«
»Danke vielmals. Wir Ärzte haben herausgefunden, daß Oliver Goldsmith auf beispielhafte Weise ein Problem dargestellt hat, das wir häufig bei unseren Patienten vorfinden. Ach, die Dichter haben alles gekannt.«
Er erklärte mir dann, wie dieses Problem mit dem Ödipus-Komplex zusammenhängt sowie mit dem Inzest-Tabu, demzufolge »ehrbare« Frauen, die mit der Mutter und den Schwestern des Mannes assoziiert werden, »jenseits des Erlaubten« stehen.
»Wissen Sie noch, wie der junge Mann heißt?«
»Charles Marlow.«
Er wiederholte den Namen, befriedigt lächelnd. Ich beugte mich vor und sagte: »Herr Professor, könnten wir dies nicht den Charles-Marlow-Komplex nennen?«
»Ja, das wäre durchaus angebracht. Ich habe schon lange nach einem passenden Namen gesucht.«
Theophilus litt, wie man so sagt (obwohl kein Leiden damit verbunden war), an dieser Hemmung. Mögen doch die anderen Monat um Monat den stolzen Schwan und die unnahbare Lilie umwerben und umschmeicheln und Theophilus die kecke Elster und das nickende Gänseblümchen überlassen!
Achte Ambition: der Schurke. Hier muß ich meine Zuflucht zu einem Fremdwort nehmen – el pícaro. Meine Neugier wirft ihre Netze weit aus. Mich hat immer ein Charakter fasziniert, der das Gegenteil meines neuenglisch-schottischen Erbes verkörpert – der Mann, der, einen Schritt dem Sheriff voraus, ein skrupelloses Leben führt, ohne festen Plan, ohne Ehrgeiz, am Rande der Ehrbarkeit; mit Vergnügen legt er die Dummköpfe herein, die Vorsichtigen, die Geldgierigen, die Nörgler und die Selbstgefälligen. Ich träumte davon, leichten Fußes, mit leichtem Gepäck und leichter Geldbörse die ganze Welt auszukundschaften, in Millionen Gesichter zu sehen und Hunger, Kälte und anderem Elend durch meinen Witz ein Schnippchen zu schlagen. Das gilt nicht nur für Betrüger, sondern auch für Abenteurer. Neiderfüllt hatte ich viele Lebensläufe studiert und dabei festgestellt, wie oft sie, zu Recht oder Unrecht, ins Gefängnis führten. Mein Instinkt sagte mir, und gelegentlich hatten Angstträume es mir bestätigt, daß eingesperrt zu sein das schlimmste Leiden sei, das ich mir vorstellen konnte. Zwar war ich hin und wieder ein fast gerissener Schurke gewesen, aber ich hatte mir vorher jedesmal das damit verbundene Risiko klar vor Augen geführt. Diese achte Ambition führt mich gradeswegs zu der letzten, die alle andern in den Schatten stellt.
Die neunte Ambition: ein freier Mensch zu sein. Man beachte all die andern nicht aufgegriffenen Projekte. Ich wollte weder Bankier, Kaufmann oder Rechtsanwalt werden, noch irgendeine Karriere einschlagen, die von Verwaltungs- und Aufsichtsräten bestimmt wurde – Politiker, Verleger, Weltreformer oder dergleichen kamen nicht in Frage. Ich mochte keinen Boß über mir dulden, überhaupt keine Beaufsichtigung. In all meinen Ambitionen drückte sich der Wunsch aus, mit Menschen zu tun zu haben – aber mit Menschen als Individuen.
Wie der Leser feststellen wird, wirkten alle diese Aspirationen weiterhin in mir fort. Wenn sie miteinander in Konflikt gerieten, brachten sie mir Scherereien; da sie aber einem inneren Bedürfnis entsprachen, verschaffte mir ihre Verwirklichung oft ein Gefühl tiefer Befriedigung.
Nach viereinhalb Jahren bedingter Gefangenschaft war ich nunmehr ein freier Mensch. Seit meiner Reise nach Übersee vor sechs Jahren hatte ich ein Tagebuch geführt (von dessen beträchtlichem Umfang das vorliegende Buch nur einen Auszug von viereinhalb Monaten bildet). Die meisten Eintragungen dieses Tagebuches zeichnen Charakterskizzen von Männern und Frauen, die ich kannte, und berichten von ihren Lebensläufen, soweit ich sie in Erfahrung bringen konnte. Ich selbst spielte nur die Rolle des Zeugen – obwohl sich einige noch unverdaute Brocken versuchter Selbstdarstellung unter den Notizen befinden. Fast könnte ich sagen, daß jene Porträtgalerie in den letzten zwei Jahren zu meinem eigentlichen Lebensinhalt geworden war. Erst viel später wurde mir klar, daß dieser Blick nach außen eine Form der Introspektion bildete. Wunderbar, wie die Natur immer wieder die Harmonie in uns herzustellen vermag.
Seit ich mich entschlossen hatte, meine Stellung aufzugeben, zwei Tage vor Verlassen der Schule, merkte ich, daß meine neugewonnene Freiheit mich verwandelte. Ich entdeckte den Geist des Spiels wieder – nicht des jugendlichen Spiels, des Sports (durch Regeln gebändigte Aggression), sondern des kindlichen Spiels, das nichts als Phantasie, nichts als Improvisation ist. Es stieg mir zu Kopf. Der Geist des Spiels fegte den Zynismus hinweg und die Gleichgültigkeit, die mich befallen hatten. Darüber hinaus erwachte in mir eine neue Bereitschaft zum Abenteuer, zum Risiko, das Verlangen, mich in das Leben anderer einzumischen, Spaß an der Gefahr zu haben.
Der Zufall wollte es, daß ich 1926 von meiner Freiheit früher, als ich es erwartet hatte, Gebrauch machen konnte. Sechs Wochen vor Schulschluß brach in New Jersey eine Grippe-Epidemie aus. Die Schulklinik war schnell überbelegt, und Betten wurden im Turnsaal aufgestellt, der bald einem Lazarett glich. Eltern reisten an, um ihre Söhne mit nach Hause zu nehmen. Der Unterricht wurde abgebrochen und uns Lehrern freigestellt, wegzufahren. Ich ließ es mir nicht zweimal sagen. Ich kehrte nicht einmal mehr in mein Elternhaus in Connecticut zurück, da ich dort erst vor kurzem genußreiche Osterferien verbracht hatte. Einem Kollegen, Eddie Linley, hatte ich einen Wagen abgekauft unter der Bedingung, daß er ihn von unserer Schule in New Jersey zu seinem Haus in Providence, Rhode Island, fahren würde, wo ich ihn dann übernehmen wollte. Ich kannte den Wagen recht gut. Er gehörte zu dem Ferienlager in New Hampshire, in dem Eddie ebenfalls als Tutor angestellt war. Wir fuhren abwechselnd mit den anderen Lehrern die Schüler – meist in den größeren Fahrzeugen – zur Kirche, zum Tanz oder ins Kino. Der kleine Wagen, »Hannah« genannt nach dem damals populären Schlager »Hartherzige Hanna«, wurde für kürzere Routinefahrten eingesetzt: zum Postamt ins nächste Dorf, zum Einkaufen, zum Arzt, und gelegentlich entführte sie ein paar Lehrer zu einem gemütlichen Gläschen Calvados. »Hannah« konnte auf eine lange Dienstzeit zurückblicken und stand kurz vor dem Zusammenbruch. Zwei Jahre zuvor hatte die Direktion des Ferienlagers sie Eddie für fünfzig Dollar verkauft. Eddie war ein geborener Mechaniker. Die arme »Hannah« wollte sich nur noch auf irgendeinem Schutthaufen in New Hampshire zur Ruhe legen, aber Eddie hielt sie unermüdlich am Leben. Er wußte über ihre Mucken Bescheid, er nahm sich ihrer an. »Hannah« pendelte zwischen New Hampshire, Rhode Island, und New Jersey hin und her. Ich bot ihm fünfundzwanzig Dollar unter der Bedingung, daß er mir ein paar knappe Anweisungen für den Notfall mitgebe. Er willigte ein, und ich fuhr ihn nach Trenton und wieder zurück. »Hannah« benahm sich bewunderungswürdig. Er lud mich ein, ihn nach Providence zu begleiten, aber ich sagte ihm, ich wolle eine Nacht in New York bleiben und mich erst am nächsten Tag bei ihm melden. Er erklärte sich bereit, zwei kleine Koffer und ein paar Bücher mitzunehmen – die geringen Habseligkeiten, die sich in den Jahren meiner Lehrtätigkeit angesammelt hatten, darunter die beiden Bände meines kostbaren Tagebuchs. Ich fuhr nach New York nur mit einer leichten Reisetasche. Von diesem Tage an, einem Dienstag, war ich endgültig frei.
Damals fand ich New York die wunderbarste Stadt auf der Welt, und heute, nach etwa fünfzig Jahren, bin ich noch immer derselben Meinung. Ich hatte bereits viele andere Städte kennen- und liebengelernt: Rom und Paris, Hong-Kong und Schanghai, wo ich einen Teil meiner Jugend verbracht hatte; später sollte ich mich auch in London, Berlin und Wien zu Hause fühlen. Aber keine Stadt kann es mit New York aufnehmen, mit seiner Vielfalt, seiner Fülle an Überraschungen und mit seinem Klima.
Außergewöhnlich an diesem Klima sind nicht nur die extreme Hitze und Kälte, sondern die von Sonnenlicht strahlenden Tage im strengen Winter und jene wunderbaren Tage eines wohltemperierten Wetters, mit denen New York in den Monaten Juli und August gesegnet ist. Überdies glaubte ich damals (und glaube heute noch daran) an die immer wieder von sogenannten Autoritäten verbreitete Theorie, derzufolge sich ein magnetähnliches Band, ungefähr hundert Meilen breit und tausend Meilen lang, unterhalb des Erdbodens von New York bis Chicago hinzieht. Menschen in dieser Gegend werden von einem galvanischen Strom belebt, sie sind wach, erfinderisch, optimistisch und sterben früh. Herzerkrankungen durch Überanstrengungen kommen häufig vor; jeder steht vor der Wahl des Achilles, und er muß sie akzeptieren: entweder ein kurzes, aber bewegtes Leben oder ein ruhiges und ereignisloses. Männer, Frauen und Kinder sind sich der Kraft bewußt, die aus dem Pflaster von New York und Chicago aufsteigt (samt allen dazwischen liegenden Städten), vor allem im Frühling und Herbst. Entomologen berichten, daß sogar Ameisen in diesen Zonen sich schneller fortbewegen.
Ich hatte vor, die Nacht – wie meist – in dem Klubhaus der Verbindung zuzubringen, der ich während meines Studiums in Yale angehört hatte, und ich wollte mich für den Abend verabreden. Von meiner Schule in New Jersey aus hatte ich einige meiner Freundinnen angerufen.
»Guten Morgen, hier ist Dr. Caldwell aus Montreal. Kann ich Mrs. Denham sprechen?«
Der Butler antwortete. »Mrs. Denham ist in North Carolina, Sir.«
»O danke vielmals. Ich melde mich wieder, wenn ich das nächste Mal in New York bin.«
»Danke sehr, Sir.«
»Guten Morgen, hier ist Dr. Caldwell aus Montreal. Kann ich Miss LaVigna sprechen?«
»Welche Miss LaVigna, Anna oder Grazia?«
»Miss Grazia, bitte.«
»Grazia nicht mehr wohnen hier. Sie einen Job haben in Newark. ›Aurora Schönheitssalon‹. Im Telefonbuch.«
»Vielen Dank, Mrs. LaVigna. Ich werde dort anrufen.«
Ich war derart enttäuscht, daß ich meinen Plan änderte. Ich stieg in New York nur um und fuhr sofort nach Providence weiter. Ich übernachtete in einem Hotel und ging am nächsten Nachmittag bei Eddie Linley vorbei, um mein Auto abzuholen.
Ich war mir nicht ganz klar, wie ich den Sommer verbringen sollte. Man hatte mir gesagt, in der Provinz Quebec könne man verhältnismäßig billig leben. Ich würde mich also kurz in der mir kaum bekannten Gegend von Boston aufhalten, mir Concord ansehen, Waiden Pond, Salem, und dann durch Maine nach Norden fahren und meinem Vater eine Ansichtskarte aus seinem Geburtsort schreiben … irgendsoetwas.
Mir genügte, am Steuer meines eigenen Wagens zu sitzen, die Straßen der Nördlichen Hemisphäre vor mir … dazu vier Monate ohne eine einzige Verpflichtung.
Zweites KapitelDie neun Städte von Newport
Am frühen Nachmittag stellte ich mich also bei Eddie Linley ein, um »Hannah« und meine Sachen abzuholen. Ich bat Eddie, während der Fahrt durch die Stadt neben mir zu sitzen und mich noch einmal über die Idiosynkrasien des alten Autos zu unterrichten.
Plötzlich fiel mein Blick auf ein Schild: Newport, 30 Meilen
Newport! Ich wollte Newport wiedersehen, wo ich vor sieben oder acht Jahren gedient hatte, allerdings bescheiden, erst als Gemeiner, dann als Korporal der Küsten-Artillerie, die die Bucht von Narragansett verteidigen mußte. In meiner Freizeit hatte ich oft auf langen Spaziergängen die Gegend durchstreift, und ich hatte die Stadt liebengelernt, die Bäume, das Meer, das Wetter, den nächtlichen Himmel. Ich kannte dort nur eine einzige Familie, gastfreundliche Menschen, die dem Gebot »Jeden Sonntag ein Soldat zum Abendessen« nachgekommen waren, und die Einwohner der Stadt hatten auf mich einen recht guten Eindruck gemacht. Von dem berühmten »Kurort der Schwerreichen« war wenig zu sehen, ihre Luxusvillen blieben den Blicken Neugieriger entzogen, und da das Benzin rationiert war, drehten sich nicht viele Räder auf der Bellevue Avenue. Als ich das Schild entdeckte, fiel mir ein, ich könnte mir durch eine Teilzeitbeschäftigung meinen Lebensunterhalt verdienen und brauchte meine Ersparnisse gar nicht anzugreifen. Ich setzte Eddie vor seiner Tür ab, schüttelte den verschiedenen Familienmitgliedern die Hände, bezahlte ihm die fünfundzwanzig Dollar, und los ging’s nach Newport auf der Insel Aquidneck.
Was für ein Tag! Was für ein Vorgeschmack des noch immer sich verzögernden Frühlings! Wie viele Anzeichen, daß ich mich dem Meer näherte!
»Hannah« benahm sich recht gut bis zur Stadtgrenze, dort begann sie zu husten und zu stolpern. Wir schafften aber noch Washington Square, wo ich anhielt und mich nach der Adresse des »Christlichen Vereins Junger Männer« erkundigte, nicht des CVJM für Soldaten und Matrosen gleich vor meiner Nase, sondern des CVJM für Zivilisten. Ich ging in einen Laden, in dem Zeitungen, Postkarten usw. verkauft wurden – die Besitzer treffen wir in dem Kapitel »Nino« –, und fragte telefonisch beim CVJM an, ob noch ein Zimmer frei wäre. Ich fügte munter hinzu, ich sei unter dreißig, als Angehöriger der Ersten Kongregationalen Kirche in Madison, Wisconsin, getauft und im übrigen ein ziemlich umgänglicher Mensch. Eine müde Stimme antwortete: »Wozu die Aufregung, mein Lieber? Geht in Ordnung. Fünfzig Cents pro Nacht.« »Hannah« verweigerte die Weiterfahrt, ließ sich dann aber überreden, in die Thames Street einzubiegen. Ich hielt vor »Josiah Dexter. Garage. Reparaturen«. Ein Mechaniker untersuchte »Hannah« lange und nachdenklich und murmelte einige mir unverständliche Worte.
»Wieviel kostet das alles ungefähr?«
»Sieht mir nach fünfzehn Dollar aus.«
»Kaufen Sie alte Autos?«
»Mein Bruder. Josiah! Josiah!«
Das war im Jahre 1926, als alle Mechaniker, Elektriker und Klempner nicht nur zuverlässig waren, sondern auch in hohem Ansehen standen als Eckpfeiler eines jeden Haushalts, der etwas auf sich hielt. Josiah Dexter war viel älter als sein Bruder. Er hatte eins von jenen Gesichtern, wie man sie jetzt nur noch auf Daguerreotypien von Richtern und Vikaren findet. Auch er untersuchte das Auto. Sie berieten miteinander.
Ich sagte: »Ich verkaufe Ihnen den Wagen für zwanzig Dollar, wenn Sie mich und mein Gepäck zum CVJM fahren.«
Josiah Dexter sagte: »Abgemacht.«
Wir luden mein Gepäck in seinen Wagen um, und ich wollte schon einsteigen, als ich sagte: »Einen Augenblick!« Die Luft war mir zu Kopf gestiegen, war ich doch etwa eine Meile von dem Ort entfernt, an dem ich mit zwanzig und einundzwanzig Jahren einen Teil meines Lebens verbracht hatte. Ich drehte mich zu »Hannah« um und streichelte ihre Haube. »Lebwohl, Hannah, nichts für ungut, beiderseits. Verstehst du?« Dann flüsterte ich in den einen Scheinwerfer, der mir am nächsten war: »Alter und Tod kommen zu jedem von uns. Sogar der müdeste Fluß windet sich dem Meer entgegen. Oder wie Goethe sagt: ›Balde ruhest du auch‹.«
Dann setzte ich mich neben Mr. Dexter. Nachdem er langsam einen Block entlang gefahren war, sagte er: »Haben Sie den Wagen lange gehabt?«
»Genau eine Stunde und zwanzig Minuten bin ich der Eigentümer dieses Wagens gewesen.«
Nach dem nächsten Block: »Regt Sie alles so auf, das Ihnen gehört?«
»Mr. Dexter, ich war im Krieg auf Fort Adams stationiert. Jetzt bin ich wieder hier, seit einer Viertelstunde wieder in Newport. Es ist ein wunderbarer Tag. Es ist ein wunderbarer Ort. Ich bin überdreht. Traurigkeit ist die Kehrseite des Glücks.«
»Darf ich Sie fragen, was Sie zu dem Auto gesagt haben?«
Ich wiederholte meine Abschiedsworte, wobei ich ihm das Zitat ins Englische übersetzte. »Es sind Gemeinplätze, Mr. Dexter, aber in letzter Zeit habe ich eingesehen, wenn wir vor Gemeinplätzen zurückschrecken, schrecken die Gemeinplätze vor uns zurück. Ich mache mich nie über die Gedichte von Henry Wadsworth Longfellow lustig, der so viele glückliche Wochen in und um Newport verbracht hat.«
»Ich weiß.«
»Können Sie mir sagen, wo ich hier ein Fahrrad mieten kann?«
»Bei mir.«
»Dann werde ich in einer Stunde bei Ihnen in der Garage vorsprechen. Mr. Dexter, hoffentlich nehmen Sie mir meine Verdrehtheit nicht übel!«
»Wir Neu-Engländer haben dafür nicht viel übrig, aber ich habe nichts Kränkendes gehört. Was hatte dieser Deutsche doch gleich gesagt?«
»Er sprach zu sich selbst in einem Gedicht, spät in der Nacht, in einer Holzhütte im tiefen Wald. Er schrieb die Verse auf die Bretterwand. Sie hörten die letzten Worte des berühmtesten Gedichtes in deutscher Sprache. Er war Anfang dreißig. Mit dreiundachtzig fand er seine Ruhe.«
Wir hatten den Eingang des CVJM erreicht. Er hielt und saß einen Augenblick still da, die Hand auf dem Steuerrad, dann sagte er: »Morgen sind es fünf Wochen, daß ich meine Frau verloren habe … Sie hat viel von Longfellows Gedichten gehalten.«
Er trug mit mir das Gepäck in die Halle, drückte mir einen-Zwanzig-Dollar-Schein in die Hand, nickte kurz und sagte: »Guten Tag auch«, und verließ das Gebäude.
Eine Stunde später war Josiah Dexter nicht in seiner Garage, aber sein Bruder half mir, ein Velo – wie man damals sagte – auszusuchen. Ich fuhr die Thames Street entlang und dann den »Zehn-Meilen-Fahrweg«, vorbei an dem Eingang zu Fort Adams (»Korporal North, T!« – »Hier!«), vorbei an Agassiz-Haus (»Selten ist ein großer Reichtum an Wissen so leicht getragen worden«) bis zur Seemauer vor dem Budlong-Haus. Den Wind im Gesicht, schaute ich über das glitzernde Meer in Richtung Portugal.
Noch vor sechs Monaten – ich fühlte mich innerlich ja so erschöpft – hatte ich einen Kollegen abgekanzelt: »Schlag dir diese Ideen aus dem Kopf. Das Meer ist weder grausam noch freundlich. Es ist so wesenlos wie der Himmel. Nur eine große Ansammlung von H2O. Und selbst Worte wie ›groß‹ oder ›klein‹, ›schön‹ oder ›gräßlich‹ entsprechen lediglich den Vorstellungen und Wertbegriffen, die ein menschliches Wesen von durchschnittlicher Körpergröße darauf projiziert. Ebenso dichtet man Farben und Formen gerne Eigenschaften an, die dem entsprechen, was wir als angenehm oder unangenehm, eßbar oder ungenießbar, sexuell anziehend, unsern Sinnen schmeichelnd und dergleichen empfinden. Die ganze physische Welt ist eine leere Seite, auf der wir unsere ständig wechselnden Bemühungen, uns unserer Existenz bewußt zu werden, aufschreiben oder ausradieren. Beschränke dein Staunen auf ein Glas Wasser oder einen Tautropfen – beginne dort, du wirst nicht weiterkommen.« Aber an diesem Nachmittag spät im April brachte ich nur mühsam die Worte hervor: »O Meer! O mächtiger Ozean!«
Ich fuhr die zehn Meilen der berühmten Straße nicht ganz ab, sondern kehrte auf einer Abkürzung in die Stadt zurück. Ich wollte durch ein paar Straßen gehen, die ich so oft während meines ersten Aufenthaltes in dieser Stadt durchwandert hatte. Vor allem wollte ich die Bauten meiner Lieblingsepoche – des achtzehnten Jahrhunderts – wiedersehen, Kirche, Rathaus, Villen, und dann die herrlichen Bäume von Newport: mächtig, schattenspendend und mannigfaltig. Im östlichen Teil von Rhode Island begünstigt das Klima, nicht der Boden, das Wachstum großer exotischer Bäume. Eine ganze Generation von Gelehrten hatte sich offenbar ein Vergnügen daraus gemacht, ausländische Bäume auf der Insel Aquidneck anzupflanzen, und danach hatte eine ganze Generation von Hochseeseglern miteinander gewetteifert, Exemplare aus fernen Ländern hierher zu bringen. Viel Mühe war damit verbunden gewesen. Karawanen von Eisenbahnwaggons hatten Erde aus dem Inneren herbeigeschleppt. Später stellte sich heraus, daß viele Bewohner nicht einmal die Namen der schönen Bäume auf ihrem Anwesen kannten. »Wir glauben, dies hier ist ein indischer Feigenbaum oder ein … Arekanusbaum.« »Ich glaube, Großvater hat gesagt, der hier stammt aus Patagonien … Ceylon … Japan …«
Zu meinen später wieder aufgegebenen Ambitionen hatte auch der Archäologe gehört. Ich hatte in Rom sogar fast ein Jahr dem Studium der Archäologie, ihren Methoden und Fortschritten gewidmet. Aber schon viel früher war ich – wie viele andere Jungen – von Schliemanns Entdeckung des antiken Troja fasziniert: neun Städte lagen dort übereinander. In den viereinhalb Monaten, über die dieses Buch berichtet, stellte ich fest, daß Newport sich aus neun Städten zusammensetzte, einige waren übereinandergelagert, andere ohne nähere Beziehung zu den übrigen geblieben, jede war auf ihre Weise schön, eindrucksvoll, absurd oder nichtssagend, und die eine beinahe schmutzig.
Die erste Stadt – sie trägt die Spuren der ersten Siedler – ist ein Dorf aus dem siebzehnten Jahrhundert mit dem berühmten runden Turm aus Stein, der, Schauplatz von Longfellows Gedicht »Das Gerippe in Waffen«, noch lange Zeit für ein Überbleibsel aus der Zeit der Wikinger gehalten wurde. Heute glaubt man, daß es sich um eine alte Mühle handelt, erbaut von dem Vater oder Großvater Benedict Arnolds.
Die zweite Stadt stammt aus dem achtzehnten Jahrhundert und weist einige der schönsten öffentlichen und privaten Gebäude Amerikas auf. Es war diese Stadt, die eine so wichtige Rolle im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg spielte, denn von ihr aus führten die begeisterten und hochherzigen französischen Freunde unserer Erhebung unter Rochambeau und Washington die Kampagne zur Vertreibung der Briten aus ihren Stützpunkten entlang der Küste, was dem Krieg die Wendung zum guten Ende geben sollte.
Die dritte Stadt besteht aus den Überresten eines der blühendsten Seehäfen Neu-Englands, die sich jenseits der Thames Street in das zwanzigste Jahrhundert hinüberretten konnten. Die dritte Stadt mit ihren Werften und Docks und nach Teer und Werg riechenden Krämerläden, ihren flüchtigen Ausblicken auf trocknende Netze und zum Flicken ausgelegte Segel ist jetzt im wesentlichen auf die vor Anker liegenden Yachten und Vergnügungsdampfer angewiesen; ihre Vergangenheit lebt fort in einer Reihe schmutziger Bars und Tavernen, wie sie die Seeleute lieben, in die sich aber eine Landratte kaum ein zweites Mal wagen würde.
Die vierte Stadt gehört dem Heer und der Marine. Schon seit langem gibt es ein ganzes System von Festungswerken, um die Bucht von Narragansett zu verteidigen. Der Kriegshafen und die Ausbildungsstation sind während des Krieges beträchtlich ausgebaut worden – es ist eine Welt für sich.
Die fünfte Stadt wird seit Beginn des neunzehnten Jahrhunderts von einigen hochintellektuellen Familien aus New York, Cambridge und Providence bewohnt, nachdem sie das schöne Newport als Sommerfrische entdeckt hatten. (Nur wenige Leute aus Boston tauchten hier auf, da sie ihre Sommerfrischen an der Nord- oder Südküste verbrachten.) Der Philosoph in der Nachfolge Swedenborgs, Henry James, brachte seine Familie hierher, darunter der junge Philosoph William James und der junge Romancier Henry James. In seinem letzten, unvollendeten Roman »Der Elfenbeinturm« kehrt dieser in seiner Erinnerung zu den Häusern und Gärten zurück, die vom Klippenweg eingesäumt werden. Hier lebte bis in ihr hohes Alter Julia Ward Hower, Verfasserin des »Kampflieds der Republik«. Eine ganze Schar von Harvardprofessoren hatte sich eingefunden. Das Haus von John Louis Rudolph Agassiz, an dem ich soeben vorbeigefahren war, hatte man in ein Hotel umgewandelt, und das ist es bis heute, 1927, geblieben. Bei einem späteren Besuch gelang es mir, das fünfeckige Turmzimmer zu reservieren, und von diesem magischen Raum aus konnte ich nachts die Lichter von sechs verschiedenen Leuchttürmen sehen und das Heulen oder Läuten von ebenso vielen Bojen hören.
Die sechste Stadt wurde von den Millionären errichtet, den Unternehmensgründern, die von ihren Schlössern am Hudson oder ihren Villen in Saratoga Springs gekommen waren, da sie plötzlich gemerkt hatten, wie entsetzlich heiß der Sommer im Staate New York sein kann. Mit ihnen erschienen Eleganz, modischer Wettbewerb und das befriedigende Gefühl der Exklusivität. Dieses sogenannte »Große Zeitalter« war längst vorbei, vieles freilich blieb davon übrig.
In einer Großstadt mischt sich die Armee der Dienstboten mit der übrigen Bevölkerung, aber auf einer kleinen Insel, und gar einem kleinen Teil dieser Insel, bilden die Dienstboten eine siebente Stadt. Alle, die den Vordereingang des Hauses, in dem sie leben, nur betreten, um ihn zu putzen, werden sich ihrer Unentbehrlichkeit inne und entwickeln eine Art Untergrundsolidarität.
Die achte Stadt (wie die siebente Stadt von der sechsten abhängig) bevölkern Schlachtenbummler und Parasiten: neugierige Journalisten, Detektive, Mitgiftjäger, halbverrückte Anwärter auf soziales Prestige, Propheten, Gesundbeter, fragwürdige Proteges beiderlei Geschlechts – wunderbares Material für mein Tagebuch.
Endlich gab, gibt es und wird es noch lange geben die neunte Stadt des amerikanischen Mittelstandes, die Handel treibt, Kinder aufzieht und ihre Toten begräbt, viel zu beschäftigt, um den acht so eng benachbarten Städten besondere Beachtung zu schenken.
Ich beobachtete sie alle und machte meine Aufzeichnungen: allmählich fühlte ich mich wie Gulliver auf der Insel Aquidneck.
Am Morgen nach meiner Ankunft holte ich mir Rat bei einem Mann, zu dem ich eine entfernte Beziehung zu haben glaubte – William Wentworth, Direktor des Casino. Vor zehn Jahren hatte mein Bruder noch während seines Studiums in Yale an den Tennis-Meisterschaften von New England teilgenommen und einen der vorderen Plätze belegt. Er hatte mir von Mr. Wentworths gewinnendem Wesen und seiner unermüdlichen Hilfsbereitschaft erzählt. Ich schlenderte durch den Eingang, besichtigte die Tennisplätze und die Anlage der Zuschauertribüne. Das Gebäude war – wie auch andere in Newport – von dem ebenso brillanten wie unglücklichen Architekten Stanford White entworfen worden. Wie jedes seiner Werke war es zugleich hervorragend durchdacht und phantasievoll. Obwohl der Frühling erst begonnen hatte, bildeten die berühmten Rasenplätze bereits einen Teppich aus Grün.
Ich klopfte an die Tür der Verwaltung und wurde von einem frisch aussehenden Mann um die Fünfzig eingelassen. Er streckte seine Hand aus und sagte: »Guten Morgen, Sir. Bitte nehmen Sie Platz. Womit kann ich Ihnen dienen?«
Ich erzählte ihm, daß mein Bruder an den Tennismeisterschaften teilgenommen hatte.
»Lassen Sie mich mal nachdenken. Neunzehnhundertsechzehn. Hier ist sein Bild. Und hier ist sein Name auf dem Pokal. Ich erinnere mich noch sehr gut an ihn, ein feiner Junge und ein erstklassiger Tennisspieler. Was macht er jetzt?«
»Er ist Geistlicher.«
»Gut«, sagte er.
Ich erzählte ihm von meinem Militärdienst auf Fort Adams. Ich erzählte ihm, daß ich vier Jahre ununterbrochen unterrichtet hatte, daß ich Abwechslung brauchte und einen weniger anstrengenden Stundenplan. Ich zeigte ihm den Entwurf einer Annonce, die ich in die Zeitung setzen wollte, und bat ihn um die Gefälligkeit, eine Abschrift davon mit Reißzwecken an das schwarze Brett des Casino zu heften. Er las und nickte.
»Mr. North, die Saison fängt erst an, aber es gibt immer Schüler, die aus irgendeinem Grunde jetzt zu Hause sind und einen Tutor brauchen. Meist wenden sie sich an die Lehrer der in der Nähe gelegenen Schulen, aber die Lehrer haben gegen Ende des Semesters kaum noch Zeit für sie. Vielleicht können Sie ihnen einige Schüler abnehmen. Aber es gibt noch eine andere Gruppe, die Ihre Dienste gewiß sehr gerne in Anspruch nimmt. Würden Sie sich bereit erklären, alten Leuten mit schlechten Augen vorzulesen?«
»Ja, Mr. Wentworth.«
»Alle nennen mich Bill, ich hingegen nenne jeden über sechzehn Mister. Spielen Sie auch Tennis?«
»Natürlich nicht so gut wie mein Bruder, aber ich bin zum Teil in Kalifornien aufgewachsen, und da spielt jeder Tennis.«
»Glauben Sie, daß Sie Kindern zwischen acht und fünfzehn Trainerstunden geben könnten?«
»Ich habe zahllose Trainerstunden gehabt.«
»Bis um zehn Uhr dreißig sind drei Plätze für Kinder reserviert. Der angestellte Trainer trifft erst Mitte Juni ein. Ich werde Ihnen gleich eine Tennisklasse zusammenstellen. Ein Dollar pro Stunde und Kopf. Sie können zwei Dollar pro Stunde für Ihr Vorlesen verlangen. Haben Sie Ihre Tennissachen mitgebracht?«
»Ich kann mir leicht welche beschaffen.«
»Wir haben ein ganzes Hinterzimmer voll mit diesem Zeug, weggeworfen, verloren, vergessen und so weiter. Ich habe sogar einen ganzen Stoß Flanellhosen auf Vorrat, chemisch gereinigt, damit sie nicht verkommen. Auch Schuhe und Schläger in allen Größen. Ich zeige Ihnen alles später. Können Sie tippen?«
»Ja, Bill.«
»Gut, dann setzen Sie sich mal hier an diesen Tisch und tippen Sie Ihre Annonce für die Zeitung. Sie sollten sich übrigens ein Postfach für die Antwortbriefe mieten. Und geben Sie die Telefonnummer des CVJM an. Ich muß mich jetzt um die Handwerker kümmern.«
Freundlichkeit ist nichts Ungewöhnliches, aber Freundlichkeit mit schöpferischer Phantasie verbunden, kann umwerfend wirken.
Ich bin selbst mitunter altruistisch – aber nur aus Freude am Spiel. Geben ist einfacher als nehmen. Ich schrieb:
T. Theophilus North
Yale, 1920. Lehrer an der Raritan-Schule in New Jersey; 1922–1926. Tutor für Schul- und Collegeexamen in Englisch, Französisch, Deutsch, Latein und Algebr a. Mr. North steht zum Vorlesen in den genannten Sprachen sowie im Italienischen zur Verfügung. Zwei Dollar die Stunde. Adresse: CVJM, Zimmer 41
Ich ließ die Anzeige in drei aufeinanderfolgenden Ausgaben der Zeitung erscheinen.
Schon nach vier Tagen gab ich Trainerstunden auf dem Tennisplatz, und die Arbeit machte mir Spaß. (Früher hatte ich mich für Tennis nicht sonderlich interessiert. Im Casino fand ich ein paar Handbücher mit vielen Eselsohren: »Die neue Tennisschule«, »Tennis für Anfänger«. Auch respektablere Berufe als der meine können nicht auf ein Element von Bluff verzichten.) Eine Woche lang bekam ich täglich Briefe und Telefonanrufe. Einer der ersten Briefe enthielt die Aufforderung, mich in den »Neun Giebeln« vorzustellen, was zu Komplikationen führen sollte – doch davon später. Eine alte Dame verlangte, ich solle aus den Werken von Edith Warton vorlesen, da sie Mrs. Warton noch gekannt hatte, als sie in Newport lebte; und derlei mehr. Die Telefonanrufe boten eine bunte Palette. Zum erstenmal machte ich die Erfahrung, wer sich der Öffentlichkeit stellt, läuft Gefahr, mit Spinnern, wie man sie leichthin nennt, in Kontakt zu kommen. Eine zornige Stimme ließ mich wissen, daß ich ein deutscher Spion wäre und daß »wir Sie nicht aus den Augen verlieren werden«. Eine Frau wollte mich überreden, Globo zu lernen und zu lehren, um die Welt auf den ewigen internationalen Frieden vorzubereiten.
Andere Anrufe muteten mir mehr zu.
»Mr. North, hier spricht Mrs. Denbys Sekretärin. Mrs. Denby möchte gerne wissen, ob Sie ihren Kindern jeden Donnerstagnachmittag zwischen drei Uhr dreißig und sechs Uhr dreißig vorlesen könnten.«
Ich merkte sofort, daß es sich um den freien Nachmittag des Kindermädchens handelte. Ich war noch immer leicht verdreht und zu allerhand Streichen aufgelegt. Am Telefon kann ich viel deutlicher und sogar unhöflicher werden als bei einer persönlichen Begegnung. Das liegt vermutlich daran, daß ich dem andern nicht in die Augen zu sehen brauche.
»Darf ich fragen, wie alt Mrs. Denbys Kinder sind?«
»Nun … sie sind sechs, acht und elf Jahre alt.«
»Wünscht Mrs. Denby, daß ich ihren Kindern ein bestimmtes Buch vorlese?«
»Das überläßt sie ganz Ihnen, Mr. North.«
»Ich danke Mrs. Denby. Würden Sie ihr bitte ausrichten, daß es unmöglich ist, ein Kind länger als vierzig Minuten lang mit einem Buch zu beschäftigen. Ich schlage vor, daß die Kinder Streichhölzer als Spielzeug erhalten sollten.«
»Oh!«
Ende des Gesprächs.
»Mr. North, Mrs. Hugh Cowperthwaite ist am Apparat. Ich bin die Tochter von Mr. Eldon Craig.«
Sie machte eine Pause, um mich die Würze des mir eingeräumten Privilegs auskosten zu lassen. Ich habe immer vergessen, woher der Reichtum meiner Arbeitgeber stammte. Bis heute weiß ich nicht, ob Mr. Craig in dem Rufe stand, er verdiene jedesmal einen halben Dollar, wenn die Tür eines Lastwagens mit Gefrierfleisch sich schloß, oder er verdiene ein Zehn-Cent-Stück, wenn ein Schlächter eine neue Rolle von braunem Packpapier holte.
»Ja, gnädige Frau?«
»Mein Vater möchte mit Ihnen besprechen, ob es Ihnen möglich wäre, ihm die Bibel vorzulesen … Ja, die ganze Bibel. Er hat sie bereits elfmal gelesen, und er möchte wissen, ob Sie sehr schnell lesen können … Sehen Sie, er will seinen eigenen Rekord brechen, der, wenn ich mich nicht irre, vierundachtzig Stunden beträgt.«
»Ich werde mir die Sache durch den Kopf gehen lassen, Mrs. Cowperthwaite.«
»Falls Sie ein Interesse daran haben, möchte er wissen, ob Sie vielleicht zu – Sondervereinbarungen bereit sind.«
»Sondervereinbarungen?«
»Nun ja, Rabatt sozusagen.«
»Ich verstehe. Der volle Betrag beläuft sich meiner Schätzung nach auf über hundertundfünfzig Dollar. Das ist gewiß eine ganz erhebliche Summe.«
»Ja, mein Vater möchte darum wissen, ob Sie eventuell …«
»Darf ich Ihnen einen Vorschlag machen, gnädige Frau? Ich könnte das Alte Testament auf Hebräisch lesen. Im Hebräischen gibt es keine Vokale, nur sogenannte ›Atempausen‹. Das würde die Zeit um sieben Stunden reduzieren. Vierzehn Dollar gespart.«
»Aber das würde er doch nicht verstehen, Mr. North.«
»Verstehen spielt hier keine Rolle, Mrs. Cowperthwaite. Mr. Craig hat das Alte Testament bereits siebenmal gehört. Es auf Hebräisch zu hören, würde bedeuten, Gottes eigene Worte zu hören, wie Er sie Moses und den Propheten diktiert hat. Außerdem könnte ich das Neue Testament auf Griechisch vorlesen. Griechisch ist voll von tonlosen Digammas und Enklitikons und Prolegomena. Kein Wort wird verlorengehen und meine Rechnung würde sich auf einhundertundvierzig Dollar reduzieren.«
»Aber mein Vater …«
»Ferner könnte ich im Neuen Testament die Worte unseres Herrn in seiner eigenen Sprache lesen, aramäisch. Sehr kurz und kondensiert. Es ist mir gelungen, die Bergpredigt in vier Minuten einundsechzig Sekunden zu lesen, nicht mehr und nicht weniger.«
»Würde auch nach diesen Regeln ein neuer Rekord Gültigkeit haben?«
»Es tut mir leid, daß Sie es nicht so sehen wie ich, Mrs. Cowperthwaite. Ihr verehrter Vater hat die Absicht, seinem Schöpfer zu gefallen. Ich mache Ihnen einen Sonderpreis: einhundertundvierzig Dollar.«
»Ich muß leider die Unterhaltung beenden, Mr. North.« »Sagen wir einhundertunddreißig.«
Ende des Gesprächs.
Bald radelte ich also die Avenue hinauf und hinunter wie ein Lieferjunge. Unterrichtsstunden. Lesungen. Die Arbeit machte mir Freude (die Fabeln von Lafontaine im »Hirschpark«, die Werke von Bischof Berkeley in den »Neun Giebeln«), aber bald stieß ich auf die allerseits bekannte Wahrheit, daß die Reichen niemals zahlen – oder nur gelegentlich. Ich verschickte meine Rechnungen alle vierzehn Tage, aber selbst die liebenswürdigsten Arbeitgeber übersahen sie geflissentlich. Ich griff mein Kapital an und wartete, aber mein Traum von einer eigenen Wohnung (ein Traum, der natürlich andere Träume nach sich zog) schien auf unbestimmte Zeit hinausgeschoben. Abgesehen von ein paar Verpflichtungen, nach Einbruch der Dunkelheit vorzulesen, war ich abends frei, und das machte mich ruhelos. Ich schaute in die Tavernen der Thames Street und der Langen Werft, spürte aber keine Lust, mich einer dieser trübe beleuchteten, lärmenden Runden anzuschließen. Kartenspiele waren in den Aufenthaltsräumen des CVJM erlaubt, vorausgesetzt, daß es nicht um Geld ging, doch mein Interesse schwand schnell ohne den Anreiz auf Gewinn.
Schließlich geriet ich in »Hermanns Billardsalon«, zwei langgestreckte Räume mit sieben Tischen unter grellen Hängelampen und einer Bar, an der gesetzlich erlaubte Getränke ausgeschenkt wurden, denn noch herrschte die Prohibition. Man drückte zwar ein Auge zu, wenn einer Alkohol in der eigenen Tasche mitbrachte, aber wie die meisten Spieler begnügte ich mich mit »Bevo«. Dieses Lokal sagte mir zu. An den Wänden standen zwei Reihen Bänke, eine erhöhte für die Zuschauer, eine niedere für die wartenden Spieler. Damals spielte man vor allem Poule. Es ist weniger ein fröhlicher als ein in sich gekehrter Sport, begleitet von Grunzlauten, stummen Schwüren, Stoßgebeten, unterbrochen durch Aufschreie des Triumphes oder der Verzweiflung. Die Habitues in »Hermanns Salon« waren Diener von den großen Besitzungen, Chauffeure, auch ein paar Verkäufer fanden sich ein, meistens jedoch Dienstboten. Gelegentlich wurde ich zum Mitspielen aufgefordert. Ich stellte mich vor als der Tennistrainer vom Casino, der für Anfänger Stunden gab. Ich spiele Poule ziemlich gut (viele Stunden lang in meiner Studentenzeit), aber ich spürte, daß man mich zusehends kühler behandelte. Ich wollte mir schon einen neuen Billardsalon suchen, als mich Henry Simmons adoptierte und damit meinem Außenseitertum ein Ende setzte.
Was sollte ich Henry nicht alles verdanken: seine Freundschaft zu mir, die Bekanntschaft mit seiner Verlobten Edweena, der unvergleichlichen Edweena, und mit Mrs. Cranston samt ihrer Pension sowie all das, was sich daraus ergab. Henry war ein hagerer englischer Diener von vierzig Jahren; sein Gesicht – länglich, rot, pockennarbig – belebten zwei dunkle, scharf beobachtende Augen. Seine Rede hatten sieben Jahre Amerika geläutert, doch in gehobener Stimmung fiel er in die Sprache seiner Jugend zurück, eine Sprache, die mich entzückte, weil sie Erinnerungen an Figuren derselben Herkunft bei Dickens und Thackeray heraufbeschwor. Er war bei einem bekannten Hochseesegler und Regatta-Enthusiasten angestellt, den er sehr bewunderte – ich werde ihn hier Timothy Forrester nennen. Wie auch andere seiner gesellschaftlichen Klasse und seiner Generation, stellte Mr. Forrester seine Yacht wissenschaftlichen Expeditionen und Forschungsfahrten zur Verfügung, wo ein Gentleman-Diener nicht am Platz gewesen wäre. Da er selbst daran teilnahm, blieb Henry oft monatelang allein in Newport zurück. Diese Einteilung paßte ihm um so mehr, als die Frau, die er heiraten wollte, den größten Teil des Jahres ebenfalls in Newport verbrachte. Henry trug stets wunderbar geschneiderte schwarze Anzüge, nur die auffallend bunten Westen zeugten von seinem individuellen Geschmack. Er war allgemein beliebt in »Hermanns Salon«, den er durch seine halblaut hingeworfenen Scherze um ein Element extravaganter und exotischer Komik bereicherte.
Offenbar hatte er mich ziemlich lange beobachtet und mich mit meiner Zeitungsannonce in Verbindung gebracht, denn als ich eines Abends bereits viel zu lange auf der Bank gewartet hatte, kam er plötzlich auf mich zu und sagte: »Sie hier, Professor! Wie wär’s mit einem Spielchen. Drei Sätze zu 12 1/2 Cents. Wie war doch gleich Ihr Name, Kamerad? Ted North? Ich heiße Henry Simmons.«
Zur Zeit unserer ersten Begegnung war Henry ein sehr unglücklicher Mensch. Sein Herr hatte sich einem Team angeschlossen, das die Vögel der Tierra del Fuego photographierte, und Henry haßte das Nichtstun. Seine Verlobte war ebenfalls verreist, und er vermißte sie aufs schmerzlichste. Wir spielten ohne viel zu reden. Ich hatte eine Glückssträhne, vielleicht auch hielt sich Henry zurück. Als das Spiel zu Ende war, leerten sich bereits die Räume. Er lud mich zu einem Drink ein. Einige Kisten Ale blieben hier stets für seinen persönlichen Gebrauch reserviert, ich aber bestellte das übliche Ersatzbier.
»Also, erzählen Sie von sich, Ted, sind Sie glücklich und zufrieden? Ich werde Ihnen sagen, wer ich bin. Ich stamme aus London und bin mit zwölf von der Schule abgegangen. Ich habe Schuhe geputzt und Barbierläden ausgefegt. Ich hab’ meine Augen aufgemacht und was gelernt. So bin ich ein Diener geworden, ein Gentleman-Diener.« Er hatte seinen Gentleman nach Amerika begleitet und war schließlich von Mr. Forrester engagiert worden. Er erzählte mir von seiner Edweena, die zur Zeit als Zofe eine Damengesellschaft auf einer berühmten Yacht bediente. Er zeigte mir einige bunte Postkarten, die sie ihm aus Jamaica, aus Trinidad und von den Bahamas geschickt hatte – ein magerer Trost.
Dann erzählte ich ihm meine Lebensgeschichte – Wisconsin, China, Kalifornien, Schulen und Anstellungen, Europa, der Krieg, zuletzt die Gründe, die mich nach Newport geführt hatten. Dann stießen wir miteinander an und unsere Freundschaft war besiegelt. Diesem ersten folgten noch viele Poulespiele mit anschließendem Gespräch. Beim zweiten oder dritten fragte ich ihn, warum die Spieler sich soviel Zeit ließen, mich aufzufordern. Lag es etwa daran, daß ich ein Neuankömmling war?
»Kamerad, in Newport ist man furchtbar mißtrauisch gegen Neuankömmlinge. Argwöhnisch, wenn Sie verstehen, was ich meine. Es gibt eine ganze Menge Typen, die wir hier nicht haben wollen. Nehmen wir einmal an, ich wüßte nicht, daß Sie in Ordnung sind. Verstanden? Darf ich jetzt ein paar Fragen stellen? Mr. North, sind Sie nach Newport abkommandiert worden?«
»Was soll das heißen?«
»Gehören Sie irgendeiner Organisation an? Hat man Sie mit einem besonderen Auftrag hierhergeschickt?«
»Ich habe Ihnen doch gesagt, warum ich herkam.«
»Ich frage wie bei einem Gesellschaftsspiel. Sind Sie ein Flikker?«
»Ein was?«
»Ein Detektiv?«
Die Wandlung bestimmter Wörter auf ihrem Weg von Land zu Land und durch die Jahrhunderte hat mir immer Vergnügen bereitet. »Flicker« ist ein Vogel, eine in Amerika vorkommende Spechtart, und der Titel eines Films im Jahre 1926. Aber in Frankreich ist ein »flic« ein Polizist oder ein Detektiv, dieses Wort muß den Kanal überquert haben und in den Slang der englischen Unterwelt eingedrungen sein. Nach Newport ist es wahrscheinlich von Henry selbst importiert worden. Ich hob die Hand wie zum Schwur. »Ich schwöre bei Gott, Henry, nie im Leben habe ich damit zu tun gehabt.«
»Als ich in der Zeitung las, daß Sie Latein unterrichten, wußte ich Bescheid. Kein Flicker hat sich jemals auf Latein eingelassen. Es ist nämlich so: nichts gegen den Job, man kann sein Geld auf hundert verschiedene Arten verdienen. Wenn die Saison beginnt, tauchen die Flicker scharenweise auf. Wochenlang findet jeden Abend ein großer Ball statt. Für prominente Besucher oder schwindsüchtige Kinder, zum Beispiel. Diamantencolliers. Versicherungsgesellschaften schicken ihre Männer her, als Kellner verkleidet. Manchmal werden sie sogar offiziell als Gäste eingeladen. Kleben mit ihren Augen an dem Gefunkel. Viele Familien sind so ängstlich, daß ein Flicker die ganze Nacht wach neben dem Safe sitzen muß. Eifersüchtige Ehemänner lassen ihre Frauen von einem Flicker beschatten. Ein Mann wie Sie kommt in die Stadt, kennt niemanden, kein triftiger Grund, hier zu sein. Vielleicht ist er ein Flicker – oder ein Dieb. Als erstes pflegt sich ein regulärer Flicker beim Polizeichef zu melden, um ihm reinen Wein einzuschenken. Aber viele machen das nicht, sie möchten ganz geheim bleiben. Sie können Gift darauf nehmen, daß Sie noch nicht drei Tage in der Stadt waren, als der Chef Sie bereits ins Auge gefaßt hatte. Gut, daß Sie gleich ins Casino gingen und den alten Bericht über sich ausgruben …«
»In Wirklichkeit über meinen Bruder.«
»Wahrscheinlich hat Bill Wentworth den Chef angerufen und ihm gesagt, daß er Vertrauen zu Ihnen hat.«
»Danke für diese Mitteilung. Doch Ihr Vertrauen nützt mir in ›Hermanns Salon‹ mehr als alles andere.«
»Es verkehren sogar hier ein paar Flicker, doch keinesfalls wollen wir einen Flicker unter uns haben, der vorgibt, keiner zu sein. Immer wieder hat man von einem Flicker gehört, der Smaragde stiehlt.«
»Und mit was für verdächtigen Typen könnte man mich noch verwechseln?«
»Das werde ich Ihnen später erzählen. Jetzt sind Sie dran.«
Ich erzählte ihm, was ich über die herrlichen Bäume von Newport herausgefunden und zusammengetragen hatte. Ich erzählte ihm von meiner Theorie der »Neun Städte von Newport« (und von Schliemanns Troja).
»Das sollte Edweena hören! Edweena liebt Fakten und das Herausschälen von Ideen aus Fakten. Sie sagt immer, die Leute in Newport können bloß klatschen und tratschen. Oh, diese Sache mit den Bäumen würde ihr gefallen und auch die Sache mit den neun Städten.«
»Bisher habe ich nur fünf ausfindig gemacht.«
»Vielleicht sind’s fünfzehn. Vielleicht können Sie das mit einer Freundin von mir, mit Mrs. Cranston besprechen. Ich hab ihr von Ihnen erzählt und sie möchte Sie gerne kennenlernen. Das ist eine ganz besondere Ehre, Professor, denn sie macht selten eine Ausnahme: im allgemeinen empfängt sie nur Diener oder Dienstboten bei sich zu Hause.«
»Aber ich bin ein Diener, Henry.«
»Darf ich Sie etwas fragen: in all diesen Häusern, in denen Sie Schüler haben, treten Sie da durch die Vordertür ein?«
»Nun … ja.«
»Sind Sie jemals zum Mittag- oder Abendessen eingeladen worden?«
»Zweimal, aber ich bin nie …«
»Dann sind Sie kein Diener.« Ich schwieg. »Mrs. Cranston weiß sehr viel von Ihnen, aber sie meinte, sie würde sich sehr freuen, wenn ich Sie zu einem Besuch überreden könnte.«
»Mrs. Cranstons Pension«, im Schatten der Dreifaltigkeitskirche gelegen, war ein großes Gebäude, das aus drei aneinandergebauten Häusern bestand, so daß man nur die Wände hatte durchbrechen müssen. Die Sommerkolonie in Newport wurde von fast eintausend Dienstboten versorgt, von denen die meisten in dem Haus, in dem sie beschäftigt waren, auch schliefen. Mrs. Cranstons Pension war eine vorübergehende Bleibe für viele und eine ständige für wenige. Zur Zeit meines ersten Besuches waren die meisten der großen Häuser (die Cottages) noch nicht geöffnet, aber die bereits vorausgeschickten Dienstboten sollten alles für die Saison herrichten. In vielen Fällen hatten weibliche Dienstboten sich geweigert, die Nacht allein in den abgelegenen Häusern an der Ozeanstraße zu verbringen. Außerdem beherbergte Mrs. Cranston eine beträchtliche Anzahl von Aushilfen für besondere Gelegenheiten, obwohl sie mit aller Deutlichkeit erklärt hatte, kein offizielles Stellenvermittlungsbüro zu sein.
Das Haus war in der Tat ein Segen für die siebente Stadt – für die Alten, die vorübergehend Stellenlosen, die plötzlich Entlassenen – zu Recht oder häufiger zu Unrecht Entlassenen – und für Rekonvaleszenten. Der große Salon und die sich anschließenden Aufenthaltsräume neben dem Vestibül dienten als ein Treffpunkt und waren an Donnerstag- und Sonntagabenden überfüllt. In einem Rauchzimmer hinter dem vorderen Salon wurden gesetzlich erlaubtes Bier und Fruchtsäfte verabreicht für vertrauenswürdige Freunde des Hauses – männliche Dienstboten, Kutscher und sogar Küchenchefs. Das Speisezimmer war ausschließlich für die ständigen Gäste reserviert, sogar Henry hatte es noch nie betreten.
Mrs. Cranston achtete darauf, daß in ihrem Unternehmen das Dekorum gewahrt blieb, kein Gast hätte je ein unfeines Wort über die Lippen gebracht, und sogar der Klatsch über den jeweiligen Arbeitgeber hielt sich in Grenzen. Mit Staunen entdeckte ich, daß Geschichten über das legendäre Newport – die glorreichen Tage vor dem Ersten Krieg – nur selten erwähnt wurden, ebenso die Fehden zwischen den tonangebenden Familien, die Grobheiten einer berühmten Gastgeberin, die babylonische Extravaganz phantastischer Masken- und Kostümbälle, jeder kannte das alles. Auch in jüngster Zeit hatte es in den Sommermonaten nicht an großen Ereignissen gefehlt, an Verrücktheiten, Dramen und Melodramen, aber darüber unterhielt man sich nur streng vertraulich.
Mrs. Cranston ließ verlauten, es sei berufsschädigend, das Privatleben von Leuten durchzuhecheln, die uns ernähren. Sie war zwar jeden Abend anwesend, verzichtete jedoch darauf, über der allgemeinen Unterhaltung zu thronen. Sie pflegte reihum an den kleinen Tischen zu sitzen und bestellte lieber ihre Freunde, entweder allein oder zu zweit, zu sich. Sie hatte einen hübschen, vornehm frisierten Kopf und eine eindrucksvolle Figur, sie sah und hörte ausgezeichnet. In der Kleidung ahmte sie Damen nach, bei denen sie in jungen Jahren angestellt gewesen war – enggeschnürtes Oberteil, schwarze Jetperlen und ein halbes Dutzend rauschender Unterröcke. Nichts machte ihr mehr Vergnügen, als in irgendeiner problematischen Angelegenheit, die Diplomatie und eine gründliche Lebenserfahrung verlangte, um Rat gebeten zu werden. Ich kann mir sehr wohl vorstellen, daß sie schon manche Seele vor dem Ertrinken gerettet hatte. Vom Geschirrwaschen und anderem niederen Küchendienst hatte sie sich in den Rang einer Zofe emporgearbeitet. Einem Gerücht zufolge – das ich erst jetzt nach so vielen Jahrzehnten weitergebe – hat es niemals einen »Mister« Cranston gegeben (Cranston ist ein kleiner Ort, etwa einen Krähenflug von Newport entfernt), ein bekannter Bankier soll ihr die Pension eingerichtet haben.
Mrs. Cranstons beste Freundin war die unvergleichliche Edweena, die auf unbegrenzte Zeit die Gartenwohnung zu ebener Erde gemietet hatte. Edweena wartete nämlich auf den längst überfälligen Zusammenbruch und Tod ihres alkoholischen Gatten im fernen London, um danach ihre Hochzeit mit Henry Simmons zu feiern. Ein Vorteil, den der Besitz der Gartenwohnung ihr eintrug, erkannten einige Beobachter ohne Mühe: Henry konnte nach Belieben ein- und ausgehen, ohne einen Skandal zu erregen.
Nach den Regeln des Hauses mußten sich sämtliche Damen – mit Ausnahme von Mrs. Cranston und Edweena – um dreiviertel elf für die Nacht zurückziehen, entweder auf ihr Zimmer im oberen Stock oder in ihre Bleibe in der Stadt. Die Herren gingen erst um Mitternacht. Henry war der große Favorit der Dame des Hauses, der er eine noch aus der Alten Welt stammende Ehrerbietung entgegenbrachte.
Diese letzten fünfviertel Stunden waren Henry (und unserer Gastgeberin) besonders lieb. Die Mehrzahl der Männer blieb an der Bar sitzen, aber gelegentlich leistete Mrs. Cranston ein sehr alter, leichenblasser Mr. Danforth Gesellschaft, ebenfalls ein Engländer, der einst in großen Häusern in Baltimore und Newport als ein zweifellos majestätischer Butler gedient hatte. Sein Gedächtnis ließ sehr nach, aber er wurde noch immer von Zeit zu Zeit eingestellt, um ein Büfett oder ein Vestibül durch seine Anwesenheit zu veredeln.
Um diese nächtliche Stunde stellte mich Henry Mrs. Cranston vor. »Mrs. Cranston, ich möchte gern, daß Sie meinen Freund Ted North kennenlernen. Er arbeitet im Casino und liest einigen Damen und Herren laut vor, deren Augen nicht mehr das sind, was sie früher waren.«
»Ich freue mich, Ihre Bekanntschaft zu machen, Mr. North.«
»Danke vielmals, gnädige Frau, ich betrachte es als einen besonderen Vorzug.«
»Soweit mir bekannt ist, besitzt Ted nur einen Fehler, gnädige Frau, er kümmert sich nicht um anderer Leute Angelegenheiten.«
»Das macht ihn mir um so sympathischer, Mr. Simmons.«
»Henry überschätzt mich, Mrs. Cranston. Gewiß ist dies meine Absicht gewesen, aber während meines kurzen Aufenthaltes in Newport habe ich bereits entdeckt, wie schwierig es ist, nicht in halsbrecherische Situationen verwickelt zu werden.«
»Zum Beispiel mit jener Person, die ihren Eltern davonläuft. Es ist noch gar nicht lange her.«
Ich war wie vom Donner gerührt. Wie konnte jenes kurze Abenteuer publik geworden sein! Ich war gewarnt. Zum ersten Mal erfuhr ich, daß in Newport nichts geheim bleibt, auch nichts, was in einer Großstadt kaum bemerkt werden würde. (Schließlich wird Dienstpersonal hochgepriesen, wenn es seinem Arbeitgeber jeden Wunsch von den Augen abliest, und das erfordert eine niemals erlahmende Aufmerksamkeit. Aquidneck ist keine große Insel, und das Herz ihrer sechsten Stadt ist dementsprechend eng.)
»Gnädige Frau, man kann es mir nicht verübeln, wenn ich meinem Freund und Arbeitgeber im Casino einen Gefallen erweisen wollte.«
Sie senkte den Kopf und lächelte leise, doch mit Wohlwollen. »Mr. Simmons, entschuldigen Sie bitte, aber würden Sie vielleicht für ein paar Minuten in die Bar gehen? Ich möchte mit Mr. North etwas besprechen, was für ihn wichtig sein könnte.«
»Ja, aber gewiß, Verehrteste«, sagte Henry erfreut und verließ das Zimmer.
»Mr. North, diese Stadt hat eine ausgezeichnete Polizei und einen hochintelligenten Polizeichef. Sie setzt diese Kräfte nicht nur zum Schutz von Wertgegenständen einiger Bürger ein, sondern auch zum Schutz einiger ihrer Bürger vor sich selbst und vor unliebsamen Enthüllungen. Was immer man Ihnen vor zweieinhalb Wochen aufgetragen hat, Sie haben sehr geschickt gehandelt. Das Ganze hätte ebenso gut auch in einer Katastrophe enden können. Sollten Sie je wieder in eine solche Lage kommen, so bitte ich Sie, sich an mich zu wenden. Ich habe dem Polizeichef manche Gefälligkeit erwiesen, und er ist freundlicherweise auch mir und meinen Pensionsgästen oft gefällig gewesen.« Sie legte ihre Hand kurz auf die meine. »Merken Sie sich das bitte ein für allemal.«
»Ja, ganz gewiß. Ich danke Ihnen, Mrs. Cranston, daß Sie mir erlauben, Sie zu behelligen, wenn die Situation es erfordert.«
»Mr. Simmons! Mr. Simmons!«
»Ja, gnädige Frau?«
»Sie können wiederkommen, wir wollen ein wenig das Gesetz übertreten.« Sie läutete eine Tischglocke und gab dem Jungen an der Bar eine geheime Order. Zum Zeichen unserer Verbundenheit bekamen wir einen Drink serviert, den ich als Gin-Fizz in Erinnerung habe. »Durch Mr. Simmons habe ich schon gehört von Ihren Theorien über die Bäume und über die verschiedenen Städte in Newport. Wollen Sie es mir nicht mit Ihren eigenen Worten erzählen?«
Ich erzählte, Schliemann und Troja und alles. Meine Aufteilung Newports war natürlich noch unvollständig.
»So! So! Vielen Dank. Ach, wie wird sich Edweena freuen, davon zu hören. Ich habe zwanzig Jahre in der Bellevue-Avenue-Stadt gelebt, wie die meisten Gäste von mir im oberen Stock, aber jetzt bin ich eine Pensionsinhaberin in der letzten Ihrer Städte, und ich bin sogar noch stolz darauf. Henry Simmons sagt mir, die Männer in ›Hermanns Billardsalon‹ hielten Sie für einen Detektiv.«
»Ja, Mrs. Cranston, sie vermuteten sogar noch Schlimmeres, das er mir aber nicht verraten will.«
»Gnädige Frau, ich wollte unserem jungen Freund in den ersten Wochen nicht zuviel zumuten. Glauben Sie, er ist stark genug zu hören, daß er im Verdacht stand, ein Jiggala oder gar ein Schmierer zu sein?«
»Oh, Henry Simmons, Sie reden Ihre eigene Sprache. Sie meinen Gigolo. Ja, ich glaube, man sollte ihm alles sagen. Es wird ihm auf die Dauer nützen.«
»Ein Schmierer, Teddie, ist ein Journalist, der Unrat wittert, ein Skandal-Bluthund. Während der Saison schwirren sie wie Fliegen hier herum. Sie versuchen sogar, die Dienstmädchen zu bestechen, um zu erfahren, was vorgeht. Wenn sie keinen Schmutz finden, dann erfinden sie welchen. In England ist es genauso. ›Herzogstochter in Opiumhöhle – hier der genaue Bericht‹. Und Millionen und Millionen lesen mit Genuß über die verruchten Reichen. Jetzt ist Hollywood dran mit den Fillum-Stars. Die meisten Schmierer sind Frauen, aber es gibt auch viele Männer darunter. Mit denen wollen wir nichts zu tun haben, nicht wahr, Mrs. Cranston?«
Sie seufzte. »Man darf ihnen nicht alles ankreiden.«
»Wenn Teddy jetzt die Avenue hinauf und hinunter radelt, werden ihm Fühler dafür wachsen. Hat man sich schon an Sie herangemacht, alter Junge?«
»Nein«, sagte ich aufrichtig. Im nächsten Augenblick hielt ich den Atem an. Man hatte sich in der Tat schon an mich »herangemacht«, doch ich hatte nicht gemerkt, daß etwas dahinter steckte. Flora Deland! Ich werde später davon berichten. Mir fiel ein, daß ich mein Tagebuch einschließen sollte – es enthielt bereits geheimes Material.
»Und der Gigolo, Mr. Simmons?«
»Wie Sie wünschen, gnädige Frau. Sie werden mir verzeihen, wenn ich meinem Freund dann und wann einen Spitznamen gebe. Das ist so meine Art.«
»Und welchen Spitznamen würden Sie Mr. North jetzt geben?«
»Seine Zähne, Gnädigste, sie blenden mich. Dann und wann muß ich ihn ›Hacker‹ nennen.«
An meinen Zähnen war nichts Bemerkenswertes. Ich erklärte ihm, daß ich meine ersten neun Jahre in Wisconsin verbracht hatte, einem Staat mit viel Milchwirtschaft, der seine Kinder unter anderem mit ausgezeichneten Zähnen beschenkt. Henry hatte allen Grund, mich darum zu beneiden. Kinder, die im Herzen Londons aufwachsen, sind in dieser Hinsicht oft benachteiligt. Das konnte Henry nicht verschmerzen.
»Hacker, alter Junge, die Männer in ›Hermanns Billardsalon‹ glaubten eine Zeitlang, Sie wären einer von diesen …«
» … Gigolos.«