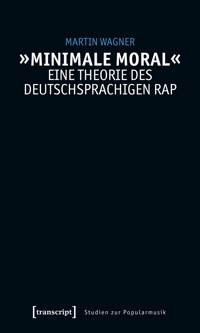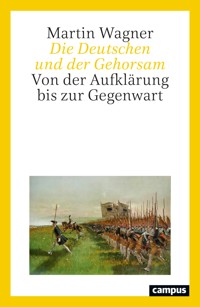
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Galten die Deutschen bis zur frühen Neuzeit noch als freiheitsliebend und schwer zu unterwerfen, verkehrte sich dieses Stereotyp seit dem späten 18. Jahrhundert zunehmend ins Gegenteil. Doch so oft die deutsche Identität seitdem auch mit dem Wert oder Unwert des Gehorsams verknüpft wurde, so hat man bislang nie eingehend untersucht, was Gehorsam in Deutschland in verschiedenen Epochen im Detail bedeutete und wie sich Rechtfertigung und Kritik dieses Werts verschoben. Wurde Gehorsam mit der Autorität der Befehlenden gerechtfertigt oder mit der Rationalität des Befehls? Mit der heroischen Leistung der Gehorchenden oder schlicht pragmatisch damit, dass ein gewisses Maß an Gehorsam für das Funktionieren gesellschaftlicher Prozesse notwendig ist? Was veränderte sich zudem im Diskurs über Gehorsam, je nachdem ob man von Gehorsam gegenüber personaler Macht oder legalen Strukturen spricht? Und in welchem Maße kann Gehorsam als das Produkt einer freien Entscheidung gelten? Martin Wagner verfolgt die Wandlungen des Gehorsamsbegriffs von der Aufklärung bis zu den Protesten der »Querdenker:innen« in der jüngsten Vergangenheit und schafft damit die Grundlage für eine historisch informierte Debatte über ein Reizwort der deutschen Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 426
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Martin Wagner
Die Deutschen und der Gehorsam
Von der Aufklärung bis zur Gegenwart
Campus VerlagFrankfurt/New York
Über das Buch
Galten die Deutschen bis zur frühen Neuzeit noch als freiheitsliebend und schwer zu unterwerfen, verkehrte sich dieses Stereotyp seit dem späten 18. Jahrhundert zunehmend ins Gegenteil. Doch so oft die deutsche Identität seitdem auch mit dem Wert oder Unwert des Gehorsams verknüpft wurde, so hat man bislang nie eingehend untersucht, was Gehorsam in Deutschland in verschiedenen Epochen im Detail bedeutete und wie sich Rechtfertigung und Kritik dieses Werts verschoben. Wurde Gehorsam mit der Autorität der Befehlenden gerechtfertigt oder mit der Rationalität des Befehls? Mit der heroischen Leistung der Gehorchenden oder schlicht pragmatisch damit, dass ein gewisses Maß an Gehorsam für das Funktionieren gesellschaftlicher Prozesse notwendig ist? Was veränderte sich zudem im Diskurs über Gehorsam, je nachdem ob man von Gehorsam gegenüber personaler Macht oder legalen Strukturen spricht? Und in welchem Maße kann Gehorsam als das Produkt einer freien Entscheidung gelten? Martin Wagner verfolgt die Wandlungen des Gehorsamsbegriffs von der Aufklärung bis zu den Protesten der »Querdenker:innen« in der jüngsten Vergangenheit und schafft damit die Grundlage für eine historisch informierte Debatte über ein Reizwort der deutschen Geschichte.
Vita
Martin Wagner ist Professor of German an der University of Calgary (Kanada).
Übersicht
Cover
Titel
Über das Buch
Vita
Inhalt
Impressum
Inhalt
Einleitung
Geschichte eines Stereotyps
Deutscher Gehorsam in der historischen und psychologischen Forschung
Vier Thesen
Gehorsam und Pflicht
Anmerkung zur Vorgehensweise
1.
Das Ende des Gehorsams oder die Erfindung des Gehorsams? Von der Aufklärung bis zu den Befreiungskriegen (1750–1815)
Erfindung der Autonomie?
Gesetzesgehorsam
Militärischer Gehorsam
Grenzen des militärischen Paradigmenwechsels
Gehorsam als Treue
2.
Neuansätze und Kontinuität: Das »kurze« 19. Jahrhundert (1815–1871)
Alltagsgehorsam
Ungleichzeitige Entwicklungen? Militär, Pädagogik, Ehe
Soziale Frage und beginnende Marginalisierung des Gehorsams
3.
Konjunktur und Krise des Gehorsams: Das Deutsche Kaiserreich (1871–1918)
Ambiguität des Militarismus
Die Köpenick-Affäre
Marginalisierung des Gehorsams
Koloniale Fantasien von Gehorsam und Ungehorsam
4.
Zwischen sozialistischem Paradigmenwechsel und konservativem Geist: Die Weimarer Republik (1918–1933)
Sozialistisches Desinteresse am Gehorsam
Das Ende der Moral
Gehorsam in der (Anti-)Kriegsliteratur
Autoritäres Erbe und neuer konservativer Geist
Liberales und autoritäres Denken in der Jugendbewegung
5.
Nationalsozialistische Kompromissbildungen: Das Dritte Reich (1933–1945)
Gehorsamskritische Rhetorik
Nationalsozialistisches Desinteresse am Gehorsam
Orte des Gehorsams: Parteiorganisationen, Kindererziehung, Propaganda-Filme
Nationalsozialistische Neuansätze?
Identität von Führer- und Volkswillen
Gehorsam und Staatskritik
Gehorsam des stillen Befehls
6.
Auf dem Weg zum gesellschaftlichen Konsens: Nachkriegszeit und Bundesrepublik (1945–1990)
Die antiautoritären 1950er Jahre
Konservative Gegenströmungen
Radikale Gehorsamskritik
Ungehorsam ist anstrengend
Die konkurrierenden Narrative von »1968«
Ziviler Ungehorsam
Alternativen zum Gehorsam
7.
Diesseits und jenseits des Gehorsams: Die DDR (1949–1990)
Sozialistischer Gehorsam in den Augen des Westens
Gehorsam im sozialistischen Freiheitsbegriff
Faschismus-Theorie ohne Gehorsam
»Die Partei hat immer recht.« Anpassungsprobleme und melancholische Einwilligung
8.
Konsens und Öffnung des Diskurses: Die jüngste Vergangenheit (1990–2024)
Konsens gegen den Gehorsam
Autorität ohne Gehorsam
Ergebnisoffene Betrachtungen
Epilog: Möglichkeiten der Ideengeschichte
Dank
Literatur
Einleitung
Geschichte eines Stereotyps
Lange Zeit galten die Deutschen anderen und sich selbst gegenüber als ungehorsam. In Germania, dem 1496 gedruckten humanistischen Brieftraktat des Renaissance-Gelehrten und Kardinals Enea Silvio Piccolomini, wird den Deutschen, die als solche in diesem Buch erstmals nach Tacitus’ gleichnamiger antiker Schrift aus dem Jahr 98 wieder ausführlich beschrieben werden, ein Mangel an Gehorsam attestiert. Die Fähigkeit der Deutschen (die an dieser Stelle des Traktats direkt adressiert werden), ihrem Kaiser zu folgen, sei äußerst mäßig: »Ihr gehorcht ihm nur, soweit ihr wollt, und ihr wollt so wenig wie möglich.«1 Dieser mangelnde Gehorsam gegenüber dem Kaiser werde dabei jedenfalls bei einem Teil der Deutschen, so Piccolomini, vom Ungehorsam gegenüber dem Papst flankiert.2
Piccolominis Beschreibung entspricht derjenigen der freiheitsliebenden Germanen in Tacitus’Germania anderthalb Jahrtausende zuvor. Sofern sich die Germanen ihrem König unterordnen, so Tacitus, geschehe dies nur, weil sie dieser überzeugen kann – und nicht aus einer inhärenten Autorität und Befehlsgewalt des Königs.3 Dabei ist der Mangel an Unterwürfigkeit bei Tacitus (im Gegensatz zu Piccolomini) teilweise positiv konnotiert mit der Stärke und Unabhängigkeit des von den Römern gefürchteten Gegners im Norden. Größtenteils aber wird der Mangel an Gehorsam mit dem insgesamt primitiven, unproduktiven Charakter der arbeitsscheuen und trunksüchtigen Germanen in Verbindung gebracht. Wie Tacitus hervorhebt, führt die Freiheitsliebe dazu, dass sich die Germanen nie pünktlich zu einer Versammlung einfinden können – da solche Pünktlichkeit sich ja als Gehorsam gegenüber einem Befehl interpretieren ließe. Stets werden zwei oder drei Tage damit verschwendet, auf die Eintreffenden zu warten.4 Von deutscher Pünktlichkeit ebenso wie von deutschem Gehorsam ist hier noch keine Spur.
Um zu verstehen, dass Tacitus den germanischen Ungehorsam insgesamt negativ beurteilt (wenn das Porträt der einfachen und freiheitsliebenden Germanen bei ihm, wie gesagt, sicher auch einige positive Züge trägt),5 ist es aufschlussreich, einen Blick in Tacitus’ ehrfürchtige Biografie seines Schwiegervaters Agricola zu werfen, an der Tacitus um die gleiche Zeit arbeitete wie an Germania. Denn Agricola zeichnet sich in Tacitus’ Porträt gerade durch seinen großen Gehorsam aus.6 Es gehört zudem zu den von Tacitus hervorgehobenen Leistungen des Agricola, auch die Truppen unter seinem Befehl zu größerem Gehorsam ausgebildet zu haben.7 Gehorsam ist somit bei Tacitus in erster Linie ein positives Zivilisationsmerkmal und ein wichtiger Garant effizienter Staats- und Militärführung.
In den Beschreibungen der einzelnen germanischen Stämme in den späteren Abschnitten der Germania hebt Tacitus wiederholt hervor, in welchem Grad diese Stämme nun doch ein gewisses Maß an Gehorsam vorweisen können. Positiv fallen ihm etwa die Chatten auf (ein im heutigen Hessen zu verortender Volksstamm), die sowohl gehorsamer als auch verständiger seien als die meisten anderen Germanen.8 Negativ beschreibt Tacitus den Gehorsam in dieser Schrift nur in Bezug auf die im Norden angesiedelten Sitoner – und zwar deswegen, weil diese sich der Herrschaft von Frauen unterordnen würden.9
Tacitus’ Germania entfaltete im modernen Deutschland eine immense Wirkung. Manfred Fuhrmann spricht gar davon, dass die Germania »das deutsche Nationalbewußtsein und den deutschen Nationalismus intensiver beeinflußt hat als jedes andere Dokument der geschichtlichen Überlieferung«.10 Die Deutschen der späteren Jahrhunderte nahmen auch Tacitus’ mindestens teilweise negativ gemeinte Charakterisierung der ungehorsamen Germanen gerne wieder auf. Dabei wurde der Mangel an Gehorsam nun als positive Qualität der Deutschen hervorgehoben. Auch wenn die Deutschen später eher mit Gehorsam assoziiert wurden, blieb die Idee »germanischer Freiheit« noch mindestens bis in die Zeit des Nationalsozialismus hinein präsent.
Die Frage des relativen deutschen Gehorsams oder Ungehorsams wurde fester Bestandteil der Debatten darüber, was typisch deutsch sei – Debatten über den eigenen Nationalcharakter also, wie sie die Deutschen, so hat Friedrich Nietzsche im 19. und so hat Norbert Elias im 20. Jahrhundert gesagt, mehr als andere europäische Nationen auszeichnen.11 Dabei war man wohl zumeist unbekümmert um den Wahrheitsgehalt von Tacitus’ Schrift sowie um deren Übertragbarkeit auf eine stark veränderte Gesellschaft etliche Menschenalter später – und schließlich auch darum, dass Tacitus, wie bereits die Parallele zum Agricola nahelegt, in der Diskussion von Freiheit und Gehorsam vor allem zentrale Werte Roms (und nicht der Germanen) verhandelte.12
Noch ganz im Geiste der Idee »germanischer Freiheit« beschrieb der junge Carl von Clausewitz die Deutschen 1807 als besonders unabhängig. Er kontrastiert sie mit den Franzosen, in denen der Sonnenkönig Ludwig XIV. ebenso wie später Napoleon »gehorsame Unterthanen«13 gefunden habe. Clausewitz resümiert:
»Alles dies, führt es nicht auf dem natürlichsten Wege zu dem Schlusse: daß der Zwang der Formen und positiven Gesetze und die Aufopferungen, ohne welche ein Staat nicht bestehen kann, dem Deutschen in seinem Streben überall hinderlicher sind als dem Franzosen, daß er folglich häufiger Veranlassung findet, sich um die Maßregeln der Regierung zu bekümmern, folglich häufiger tadelt und dem Zwecke der Regierung sich mit allen Kräften entgegenstellt?«14
Ähnlich beharrt auch Johann Gottlob Fichte in seinen berühmten Reden an die deutsche Nation (1806/07) auf dem Freiheitssinn als einem wesentlichen Charakteristikum der Deutschen.15 Heinrich Heine spricht im Jahr 1844 in Deutschland. Ein Wintermärchen immerhin noch ironisch von »deutscher Freiheit«.16 Und noch einige Jahre später urteilt der Staatswissenschaftler Karl Hermann Scheidler in einem 1853 publizierten Aufsatz für die Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste, die Deutschen seien in besonderem Maße der Freiheit zugetan. Der relative Mangel an Gehorsam dient Scheidler als Unterscheidungsmerkmal innerhalb eines rassistisch geprägten Weltbilds. Scheidler erklärt, dass die Völker Asiens und Afrikas von tiefstem Gehorsamsdenken geprägt seien, während sich allein bei den »kaukasischen« Völkern klarere Abstufungen und ein deutlicher Begriff von Freiheit finden lassen. Scheidler verurteilt »den viehischen Sklavensinn der mongolischen Nomadenvölker, die sich von ihren Oberhäuptern oder Fürsten berauben, verschenken, vermachen, Nasen oder Ohren abschneiden lassen, ohne nur zu murren«.17 Gleichfalls behauptet er von den Afrikanern, dass sie »ihre größte Ehre in den Titel eines ›königlichen Sklaven‹, ihre tiefste Schande in den Namen eines freien Mannes setzen«.18
Auch bei den Europäern unterscheidet Scheidler scharf zwischen sklavischen Slawen einerseits und den freiheitsliebenden Germanen andererseits. Allein den Engländern wird noch ein größerer Freiheitssinn zugestanden als den Deutschen. Die »kelto-romanischen Stämme« (also auch die Franzosen) werden zwischen Germanen und Slawen verortet. Das Judentum ebenso wie der Katholizismus werden als Gehorsamsreligionen stark abgewertet und dem Protestantismus gegenüber als minderwertig entgegengesetzt.
Doch während im 19. Jahrhundert noch an der Idee der freiheitsliebenden Deutschen weitergeschrieben wurde, etablierte sich gleichzeitig bereits das gegenteilige Stereotyp der gehorsamsliebenden Deutschen, das bis heute dominant geblieben ist. So charakterisiert der deutsche Philosoph und Theologe Johann Gottfried Herder in einem Entwurf für seine Briefe zur Beförderung der Humanität (1793–1797) die Deutschen als eine Nation,
»die sich durch gutwillige Treue und fast blinden Gehorsam gegen ihre Landesherrn seit Jahrtausenden in der Geschichte bemerkbar gemacht hat, daher auch Deutschland selbst vom päpstlichen Hofe mit dem Ehrennamen eines Landes des Gehorsams vorzüglich benannt, und diesem Namen gemäß behandelt wurde«.19
Bereits rund zehn Jahre zuvor hatte sich Herder in seinen monumentalen Ideen zur Geschichte der Philosophie der Menschheit (1784) ähnlich geäußert und dort, in klarem Widerspruch zu Tacitus, bereits den alten Germanen einen ausgeprägten Gehorsamssinn zugeschrieben. Dabei ist bei Herder – wie bei Tacitus – der Gehorsam deutlich positiv konnotiert.
Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts blieb der Gehorsam ein umstrittener Begriff, zu dem sich sowohl positive als auch negative Bezugnahmen finden. Erst nach 1945 begann das Lob des Gehorsams gänzlich an den Rand des Diskurses zu rücken. Bei Herder jedenfalls wird der Gehorsam der deutschen Krieger als Erklärung für die militärischen Erfolge der deutschen Völker angeführt, sei es als Söldlinge Roms oder als Kämpfer für das eigene Volk:
»Ihr großer, starker, und schöner Körperbau, ihre fürchterlich-blauen Augen wurden von einem Geist der Treue und Enthaltsamkeit beseelt, die ihren Obern gehorsam, kühn im Angriff, ausdauernd in Gefahren, mithin anderen Völkern, zumal den ausgearteten Römern zum Schutz und Trutz sehr wohlfällig oder furchtbar machten.«20
Ähnlich, wenn auch etwas nuancierter, äußerte sich die zeitweise aus ihrer französischen Heimat vertriebene Autorin Madame de Staël in dem 1813 erschienenen, Epoche machenden Essay De l’Allemagne. Während die Deutschen in ihrem Denken große Unabhängigkeit zeigen, sei ihr äußeres Verhalten von tiefem Gehorsam geprägt. Madame de Staël führt diese Folgsamkeit der Deutschen auf die strikten Standesunterschiede sowie die prominente Stellung des Militärs in Deutschland zurück (wobei sie vor allem Preußen im Blick gehabt haben mag):
»Daher kommt es, daß sie die größte Kühnheit im Denken mit dem folgsamsten Charakter verbinden. Der Vorzug, den der Soldatenstand hat, und die Verschiedenheit der Stände überhaupt, haben sie in allen Verhältnissen des geselligen Lebens an die genaueste Unterwürfigkeit gewöhnt; der Gehorsam ist bei ihnen nicht Knechtschaft, er ist Regelmäßigkeit. Sie sind in Erfüllung der an sie ergehenden Befehle so pünktlich, als ob jeder Befehl eine Pflicht wäre.«21
Im Jahr 1864 stellt dann ein anonymer Autor der Deutschen Wehrzeitung schlicht fest: »der Deutsche gehorcht gern«. Und das war wieder positiv gemeint. Denn aufgrund dieses »Nationalcharakters« seien die Deutschen leichter und schneller als die Franzosen zu Soldaten auszubilden: »Deshalb werden unsere Gegner niemals durch noch so lange Gewöhnung an dienstlichen Gehorsam die Franzosen zu Soldaten nach unseren Begriffen machen.«22
Weniger positiv erfolgt die Entgegensetzung des gehorsamen deutschen Nordens mit dem gesetzesabtrünnigen italienischen Süden bei Nietzsche, in dessen Fröhlicher Wissenschaft (1882):
»Im Norden imponirt das Gesetz und die allgemeine Lust an Gesetzlichkeit und Gehorsam, wenn man die Bauweise der Städte ansieht: man erräth dabei jenes innerliche Sich-Gleichsetzen, Sich-Einordnen, welches die Seele aller Bauenden beherrscht haben muss. Hier [im Süden] aber findest du, um jede Ecke biegend, einen Menschen für sich, der das Meer, das Abenteuer und den Orient kennt, einen Menschen, welcher dem Gesetze und dem Nachbar wie einer Art von Langerweile abhold ist[…].«23
Pointierter noch wird Nietzsche in Der Fall Wagner (1888): »Definition des Germanen: Gehorsam und lange Beine …«24 Und als Mark Twain im Frühjahr 1892 für die Chicago Tribune aus Berlin berichtete, betonte er die Ordnungsliebe der Bewohner und schrieb über die Stadt: »Für alles hat sie eine Regel, und für die Einhaltung der Regeln wird gesorgt.«25
Während im 19. Jahrhundert das Stereotyp Herders, Madame de Staëls, Nietzsches und Twains mit dem von Tacitus und Scheidler noch konkurrierte, gewann ersteres im 20. Jahrhundert klar die Oberhand. Dazu trug sicher auch der Nationalsozialismus bei, selbst wenn dessen Gehorsamsverständnis, wie noch genauer zu zeigen sein wird (Kapitel 5), durchaus vielschichtig war. Jedenfalls stellenweise präsentierten die Nazis den Gehorsam als positives Alleinstellungsmerkmal der Deutschen und als dem Ausland unzugängliches Geheimnis deutscher Einigkeit und Stärke. So betonte der NS-Propagandaminister Joseph Goebbels in einer Rede vom 19. April 1940 (anlässlich von Hitlers Geburtstag am folgenden Tag):
»Die englische Plutokratenschicht hat nicht einmal eine blasse Vorstellung davon, welche Wandlung das deutsche Volk seit 1918 und vor allem in den letztvergangenen sieben Jahren durchgemacht hat. Es gibt nichts, was die Deutschen [voneinander] unterscheidet in der Liebe, im Gehorsam und im Vertrauen zum Führer, und wir sind uns auch alle klar darüber, daß das der stärkste Panzer ist, der die deutsche Nation in ihrem Schicksalskampf umgibt.«26
Und der Maler Otto Engel versicherte den deutschen Soldaten an der russischen Front noch im November 1943, als die Lage dort bereits katastrophal und der Endsieg in weite Ferne gerückt war, dass ihr Gehorsam sie an das »Sein« selbst heranführe:
»Aber Ihr, die Ihr draußen steht und standhaltet, ›wie das Gesetz es befahl‹, Ihr tut das Notwendige. Denn Ihr habt, was durch den Schleier der Wort- und Gedankenketten hindurch an das Sein heranführt: den Gehorsam.«27
Nach 1945 setzte sich das Stereotyp der gehorsamen Deutschen endgültig durch.28 Die ältere Vorstellung germanischer Freiheit wurde nicht mehr wiederbelebt. Als Bertolt Brecht im Jahr 1950 die Komödie Der Hofmeister des »Sturm und Drang«-Dramatikers J. M. R. Lenz inszenierte, schrieb er dazu einen Prolog, in dem er den Gehorsam als Hauptcharaktermerkmal der Deutschen hervorhob. Die Gehorsamsbereitschaft, die sich historisch erst gegenüber dem Adel und dann gegenüber dem Bürgertum manifestiert habe, sei dem deutschen Wesen zutiefst eingeprägt und erkläre die »Teutsche Misere«: die Unfähigkeit der Deutschen zu einer erfolgreichen Revolution.29 Brechts Sprachrohr für diese Analyse der Deutschen ist der titelgebende »Hofmeister« Läuffer, ein Hauslehrer im Dienst des preußischen Landadels. Dabei bedient sich Brecht für den Prolog des ansonsten in Prosa gehaltenen Dramas des frühneuhochdeutschen holprigen Knittelverses in einfachen Reimpaaren, der um 1800 als Merkmal naiv-volkstümlicher Dichtung wiederentdeckt wurde. Mit dieser formalen Entscheidung betont Brecht augenzwinkernd, was eigentlich der Geist der »urdeutschen« Poesie sei:
»Freilich, die Zeiten wandeln sich grad:
Der Bürger wird jetzt mächtig im Staat
Und ich bedenk schon früh und spät
Daß ich in seine Dienste tret.
Er hätte in mir, wie das so heißt
Allezeit einen dienenden Geist:
Der Adel hat mich gut trainiert
Zurechtgestutzt und exerziert
Daß ich nur lehre, was genehm
Da wird sich ändern nichts in dem.
Will’s euch verraten, was ich lehre:
Das ABC der Teutschen Misere!«30
Deutscher Gehorsam in der historischen und psychologischen Forschung
Inwiefern das Stereotyp der gehorsamen Deutschen einer geschichtlichen Realität entspricht (oder jedenfalls entsprochen hat), ist schwierig zu eruieren und heute höchst umstritten. Lange Zeit aber haben historische Studien dieses Stereotyp unterstrichen, fügte es sich doch so gut in die Idee eines deutschen »Sonderwegs«, der seinerseits erklären sollte, warum die deutsche Geschichte in das NS-Regime anstatt zu einer modernen liberalen Demokratie geführt habe.
Der angesehene US-Historiker Gordon Alexander Craig stellte sich so in seinem 1982 erschienenen Buch The Germans die Frage, auf welchem Wege sich der Obrigkeitsgehorsam zu einem Kernmerkmal der Deutschen herausbilden konnte und wie dieser noch nach seinem tragischen Höhepunkt in der NS-Zeit in der Bundesrepublik nachwirke. Dabei betont Craig, der zum Zeitpunkt der Publikation von The Germans bereits Mitte sechzig war, dass diese Frage ihn seit seiner Jugend beschäftigt habe.
Craig erzählt von einer Deutschlandreise aus dem Jahr 1935, in deren Verlauf der damalige College-Student Craig auf den amerikanischen Konsul Charles M. Hathaway in München traf. Craig war schockiert von dem in Deutschland herrschenden Führerkult:
»Ich sagte etwas in dieser Richtung zu dem amerikanischen Konsul in München, ein netter Mann namens Hathaway, und ich fügte hinzu, dass ich es seltsam fände, dass ein Volk, das für seinen unbändigen Individualismus in Religion und Philosophie berühmt gewesen war, Gehorsam gegenüber der politischen Führung zu einer Leittugend erklärt haben sollte.«31
Dabei wiederholte Craig in der Formulierung dieser Spannung im deutschen Nationalcharakter freilich nur die schon hundert Jahre zuvor von Madame des Staël beschworene Janushaftigkeit der Deutschen. Der Diplomat Hathaway bestätigte das Sentiment des angehenden Historikers:
»Ach ja, ganz genau. Ich wohne in einem kleinen Dorf südlich von München, und die Menschen dort sind fleißig und freundlich und interessieren sich im Allgemeinen nicht für Politik, und wir verstehen und respektieren einander. Aber wenn irgendein Uniformierter zu ihnen käme und sagen würde ›Marschiert!‹, so würden sie marschieren. Und wenn er sagen würde, ›Los, hackt Hathaway seinen Kopf ab! Er ist ein schlechter Mensch!‹, so würden sie antworten: ›Das wussten wir nicht!‹ Aber meinen Kopf würden sie mir doch abhacken.32
In seiner Studie The Germans, die über vier Jahrzehnte nach diesem Gespräch erschien, schlägt Craig einen weiten historischen Bogen, um den von ihm beobachteten deutschen Gehorsam zu erklären. Dabei setzt er beim Ende des Dreißigjährigen Krieges im Jahr 1648 an. Politisch habe der Westfälische Friede, der den Krieg formal beendete, die Fürsten und kleineren Landesherrn gestärkt und einer Zentralisierung Deutschlands ebenso wie einer Zusammenlegung verschiedener Territorien im Wege gestanden. Gleichzeitig waren viele freie Städte, wie Nürnberg und Augsburg, die früher Hauptstätten der kulturellen Entwicklung gewesen waren, durch den Krieg erheblich geschwächt worden, und es waren nun die Residenzstädte der Landesherrn (wie Würzburg, Karlsruhe und Mannheim), die an deren Stelle traten. In diesen Residenzstädten herrschte der Adel, unterstützt von einer wachsenden Bürokratie, die sich aus dem gebildeten Bürgertum rekrutierte. Die neuen Beamten waren Bürger, deren Vorfahren sich hundert Jahre zuvor noch dem Handel verschrieben hatten, sich aber nun in dem von Krieg, Hunger und Pest wirtschaftlich geschwächten Deutschland an den Höfen ein sicheres Auskommen erhofften. Als Resultat dieser Konzentration auf den Landesherrn und die fortschreitende Bürokratisierung entwickelte sich in deutschen Landen, so Craig, »ein ausländischen Beobachtern unmäßig erscheinender Obrigkeitsgehorsam«.33
Dieser im 17. Jahrhundert begründete Obrigkeitsgehorsam habe sich dann über Jahrhunderte in der deutschen Geschichte fortgesetzt, auch lange nachdem diese kleinstaatlichen Staatsgebilde ihren direkten Einfluss auf das gesellschaftliche und politische Leben Deutschlands verloren hatten. Begünstigt wurde dieser Trend durch eine Reihe späterer Tatbestände, vor allem eine im europäischen Vergleich schwache und kurzlebige Aufklärungsperiode sowie den besonderen deutschen Nationalismus, der sich seit dem späten 18. Jahrhundert (unter anderem durch Johann Gottfried Herder beeinflusst) ausprägte: ein Nationalismus, der durch die Versteifung auf kulturelle Besonderheiten eine apolitische Tendenz hatte und der fortlaufenden Akzeptanz der Obrigkeit nicht im Wege stand.
Craigs Ausführungen stellen in ihrer strengen Fokussierung auf den Gehorsam in Deutschland einen Extremfall unter den größer angelegten Studien zur deutschen Geschichte dar. Doch tendenziell ähnliche Sichtweisen finden sich, in unterschiedlichen Schattierungen, in zahlreichen wichtigen Monografien aus den Jahrzehnten vor und nach Craigs Buch – von Leonhard Kriegers richtungsweisender Arbeit The German Idea of Freedom (1957) bis zu Heinrich August Winklers Der lange Weg nach Westen (2000), T. J. Reeds Mehr Licht in Deutschland. Eine kleine Geschichte der Aufklärung (2009) und Jonathan Israels A Revolution of the Mind (2010).
Auch Hannah Arendt sprach 1964 im Kontext des Prozesses gegen Adolf Eichmann in Jerusalem davon, dass die »geradezu verrückte Idealisierung des Gehorsams« »spezifisch deutsch« sei.34 Und jedenfalls in eher essayistischen als wissenschaftlichen Publikationen erfreut sich das Stereotyp des deutschen Gehorsams weiterhin einiger Beliebtheit, wenn auch mit nun teilweise stärkerer Nuancierung. So sieht der amerikanische Anarchist James C. Scott in einem Essay aus dem Jahr 2012 den deutschen Gehorsamsgeist darin bestätigt, dass deutsche Fußgänger angeblich minutenlang an einer roten Ampel stehenbleiben, auch wenn kein Auto weit und breit zu sehen ist. Gleichzeitig aber konzediert Scott, dass es in Deutschland, früher als in anderen Ländern, eine Bereitschaft gegeben habe, Ungehorsam in der Gestalt von militärischen Deserteuren ausdrücklich zu würdigen:
»Es ist keine große Überraschung, dass Deutschland, das zweifellos einen hohen Preis für den Patriotismus im Namen unmenschlicher Vorhaben bezahlt hat, zu den Ersten zählte, die öffentlich den Wert des Gehorsams hinterfragten, und dass es Deserteuren auf öffentlichen Plätzen Denkmäler errichtete, wie sie sonst Martin Luther, Friedrich dem Großen, Bismarck, Goethe und Schiller geweiht sind.«35
In der neueren historischen Forschung wird die Vorstellung einer besonderen Gehorsamsbereitschaft der Deutschen stärker in Frage gestellt – eine Entwicklung, die sich an die inzwischen schon länger kritisch betrachtete Leitthese eines deutschen Sonderwegs anschließt. Deutschland, so etwa die Historikerin Hedwig Richter, sei immer »Teil des Westens« gewesen, und es sei irreführend, »das Menschheitsverbrechen des Holocaust mit langen Kausalketten von Untertanengeist und Pickelhauben zu erklären«.36 Auch der führende englischsprachige Historiker der NS-Zeit, Richard J. Evans, sieht die Versuche, auf der Grundlage isolierter Zitate »blind obedience« als historisch tief verankertes Charakteristikum der Deutschen zu beschreiben, äußerst kritisch.37 Selbst das Bild Preußens, das Kerngebiet deutschen Gehorsams schlechthin, hat sich gewandelt. Historiker hinterfragen auch hier das Stereotyp der »Unterwürfigkeit« und zitieren dabei »bemerkenswerte Fälle von Ungehorsam« (wie es Christopher Clark in seinem Standardwerk zur preußischen Geschichte zusammenfasst).38
Einen starken Kontrast zu den älteren Analysen der Historiker bilden auch empirische psychologische Untersuchungen aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Diese deuten darauf hin, dass sich unterschiedliche Länder in Bezug auf den Gehorsam ihrer Einwohner kaum voneinander unterscheiden. Den klassischen Bezugspunkt bilden hierbei Stanley Milgrams Laborstudien zum Gehorsam, die der damalige Yale-Professor in den 1960er Jahren in Nordamerika durchführte.39 Seinen Probanden wurde vorgespiegelt, an einem wissenschaftlichen Experiment zum Gedächtnistraining teilzunehmen. Dabei wurden sie aufgefordert, zunehmend starke elektrische Schläge einem anderen Probanden zuzufügen, wenn dieser eine falsche Antwort gab. In Wirklichkeit handelte es sich bei dem zweiten Probanden um einen Schauspieler, der den Schmerz der Stromschläge nur vorspielte. Was wirklich getestet wurde, war die Bereitschaft der Menschen, Befehle auszuführen, die anderen (unschuldigen) Menschen schadeten.
Milgrams Experimente entstanden explizit unter dem Eindruck des Holocaust, den er als Produkt des Gehorsams verstand. Gleichzeitig aber betrachtete er den Gehorsam nicht als spezifisches Charaktermerkmal der Deutschen. Wenn der Gehorsam auch kein allgemein-menschliches Charakteristikum war, so war er doch, für Milgram, aufgrund des globalen Festhaltens an Autorität nahezu überall wirksam. Gewaltsamer Gehorsam war, wie Milgram betonte, nicht auf autoritäre Regime beschränkt, sondern konnte sich überall dort sichtbar machen, wo Autorität anerkannt war – in Diktaturen ebenso wie in Demokratien:
»Denn das Problem ist nicht ›Autoritarismus‹ als Form politischer Organisation oder als Ensemble politischer Einstellungen, sondern Autorität selbst. Autoritarismus mag in demokratische Praxis überführt werden, aber Autorität an sich kann nicht eliminiert werden, solange das, was wir als Gesellschaft kennen, bestehen bleibt.«40
Angesichts dieser Verankerung des Gehorsams in einem sehr weitreichenden Begriff von Autorität fühlte sich Milgram auch berechtigt, in seinen Experimenten den spezifischen historischen Kontext des Holocaust außer Acht zu lassen. Milgram glaubte, über den Gehorsam die Essenz des Holocaust untersuchen zu können, ohne sich mit den historischen Details Deutschlands und Zentraleuropas um die Mitte des 20. Jahrhunderts auseinandersetzen zu müssen:
»Es drängt sich die Frage auf, ob es irgendeine Verbindung gibt zwischen dem, was wir im Labor beobachtet haben und den Formen des Gehorsams, die wir während der Zeit des Nationalsozialismus so sehr beklagt haben. Die Unterschiede zwischen diesen beiden Situationen sind natürlich enorm, und doch mögen sich die Unterschiede in Ausmaß, Zahl und politischem Kontext als relativ unwichtig erweisen, solange einige bestimmte Kernmerkmale bewahrt bleiben.«41
Aus Milgrams Perspektive agierten die Täter des Holocaust ebenso wie die US-amerikanischen Soldaten in Vietnam basierend auf dem gleichen psychologischen Mechanismus, der den Gehorsam immer auszeichnet: »Ein Mensch betrachtet sich als das Instrument zur Ausführung der Wünsche eines anderen und fühlt sich daher nicht länger verantwortlich für seine Handlungen.«42
Dabei schienen Milgrams Annahmen darin Bestätigung zu finden, dass in einer Reproduktion seiner Experimente in anderen Ländern und zu späteren Zeiten mit einiger Zuverlässigkeit ein vergleichbares Maß an Gehorsam gemessen wurde. In insgesamt rund zehn weiteren Ländern (darunter auch Westdeutschland) wurden zwischen 1968 and 1985 ähnliche Versuchsreihen durchgeführt, und der Anteil der gehorsamen Probanden war in diesen Wiederholungen insgesamt vergleichbar, wenn auch nicht identisch.43 Schaut man sich die Daten näher an, fallen die Ergebnisse nicht unbedingt günstig aus für Deutschland, doch wie belastbar diese Werte sind, ist unklar. Gemäß einer Studie gehörte Deutschland, minimal hinter Südafrika und auf identischem Niveau mit Italien, zu den Spitzenreitern im internationalen Vergleich. Während in Milgrams Experimenten in den USA rund 60 Prozent der Versuchsteilnehmer bis zuletzt gehorsam blieben (also die elektrischen Schläge bis zur stärksten Stufe applizierten), waren es in Deutschland und Italien 85 Prozent und in Südafrika 87,5 Prozent. In Österreich waren es immerhin noch 80 Prozent. Jedoch haben andere Experimentreihen in den USA ähnlich hohe – oder sogar noch höhere – Zahlen wie in Deutschland hervorgebracht, sodass es wohl unzulässig ist, basierend auf den Milgram-Kriterien einen besonders stark ausgeprägten Gehorsam in Deutschland zu behaupten.44
Der Sozialpsychologe Thomas Blass sieht in den Ergebnissen der weltweiten Milgram-Experimente einen Hinweis darauf, dass der Gehorsam eine relativ konstante transkulturelle Größe darstellt: »Die ausgeprägte Neigung der Menschen, Autoritätsfiguren zu gehorchen könnte eine Universalie sozialen Verhaltens darstellen.«45 Wenn dieses Resümee auch von einem anderen Forscher als übereilt kritisiert und kulturelle Unterschiede unter Sozialpsychologen weiter diskutiert werden,46 stellen die Befunde doch in Frage, inwiefern sich ein besonderer Gehorsam der Deutschen empirisch nachweisen lässt. Das jüngsthin vorgebrachte Argument, dass Milgrams Versuche eigentlich gar nicht den Gehorsam der Probanden an sich testen, da sie deutlich mehr auf Überzeugungsarbeit fußen als gemeinhin dargestellt, untermauert diesen Punkt eher noch mehr.47
Erwähnenswert jenseits der international wiederholten Milgram-Experimente ist auch eine andere Studie zum Gehorsam, in der Deutschland sogar auf den unteren Rängen landete. Die Studie fragte in verschiedenen EU-Mitgliedsstaaten zwischen den 1980er und den 2000er Jahren wiederholt danach, ob Gehorsam ein Wert sei, der wichtig für Kinder zu Hause zu lernen sei. Befragte in Deutschland zeigten sich vergleichsweise wenig gehorsamsaffin: Nur rund 15 Prozent der Deutschen antworteten mit »Ja« auf diese Frage. Der Mitte der 1990er Jahre in Deutschland gemessene Wert von 12,3 Prozent ist sogar der niedrigste, der in der EU überhaupt je notiert wurde. In Frankreich lag der Wert in den frühen 1990er Jahren noch bei 53 Prozent (für die Mitte der 1990er Jahre liegen für Frankreich keine Daten vor). England lag Mitte der 90er Jahre bei 49,6, Polen bei 48,7 und Spanien bei 43,8 Prozent.48
Vielleicht mindestens so schwierig, wie es ist, zu ermitteln, ob (und wann) die Deutschen besonders gehorsam (gewesen) sind, ist es, zu belegen, inwiefern das Verhalten deutscher Bürokraten, Soldaten, Lehrer, Eheleute und Kinder sich in bestimmten Situationen aus ihrem Gehorsam ableiten lässt. Dabei wurde diese Frage ausführlich und kontrovers im Zusammenhang mit den Verbrechen der NS-Zeit diskutiert. Milgrams Annahme, dass der Holocaust grundsätzlich mit dem Gehorsam gegenüber staatlichen Autoritäten zu erklären sei, sind einflussreich geblieben. Durchsetzen konnten sie sich gegenüber anderen Theorien jedoch nicht, und insgesamt überwiegt heute die Skepsis.
Vor allem Historiker, aber auch Sozialpsychologen haben auf eine Reihe anderer Faktoren hingewiesen, die für den Mord von sechs Millionen Juden entscheidend waren und die sich nicht unter die Kategorie des Gehorsams subsumieren lassen. Dazu gehören unter anderem divergierende situationspsychologische Mechanismen – wie der Gruppenzwang unter Soldaten und die zunehmende Verrohung des NS-Staats nach dem Einmarsch in die Sowjetunion im Sommer 1941 und nach der Vernichtung behinderter Menschen in den Jahren 1940 und 1941. Ebenso sind politisch-institutionelle Erklärungen zu berücksichtigen, die hervorheben, dass der Massenmord aus einem komplexen Ineinanderwirken verschiedener, miteinander konkurrierender Teile des NS-Apparats resultierte.49
Eine klare und endgültige Antwort auf die Frage, was den Holocaust letztlich ermöglichte und welche Rolle dem Gehorsam zukam, steht auch achtzig Jahre nach Ende des NS-Terrors weiter aus. Einen bemerkenswerten Versuch, den Einfluss des Gehorsams mit anderen strukturellen und bürokratischen Mechanismen zusammenzudenken, hat vor einigen Jahren der kanadische Soziologe Nestar Russell unternommen.50 Wie Russell in seiner zweibändigen Studie Understanding Willing Participants: Milgram’s Obedience Experiments and the Holocaust argumentiert, basierte der Holocaust weniger auf einer simplen psychologischen Bereitschaft, Befehlen Folge zu leisten, als auf einem für die Moderne typischen bürokratischen und rationalen Optimierungsmechanismus, in dem leitende Persönlichkeiten des NS-Staats in Kooperation mit Funktionären auf der mittleren Ebene und durch Beobachtung des Verhaltens von Opfern Prozesse entwickelten, die einen möglichst reibungslosen Gehorsam auf allen Ebenen garantierten. Wie Russell darüber hinaus provokativ behauptet, beruhte auch Milgrams eigene Arbeit – teilweise unbewusst – auf ähnlichen rationalen Optimierungsmechanismen. Milgram, so Russell, fand nicht direkt den Gehorsam seiner amerikanischen Probanden vor, sondern entwickelte gemeinsam mit seinen Assistenten und basierend auf ersten Testversuchen Verfahren, die besonders eindrucksvolle Ergebnisse für seine Experimente erbrachten.
Vier Thesen
Die ernüchternde Feststellung, dass sich weder das Maß deutschen Gehorsams im internationalen Vergleich noch die Wirkung des Gehorsams auf den Gang der deutschen Geschichte eindeutig eruieren lässt, impliziert nicht, dass die Forschung zum Gehorsam keine wichtigen Ergebnisse liefern kann. Modifiziert werden muss allerdings die Fragestellung, mit der man sich dem Phänomen des deutschen Gehorsams nähert. Aufschluss verspricht vor allem eine Untersuchung, die zu beantworten sucht, was der Begriff Gehorsam zu verschiedenen Zeiten für die Deutschen überhaupt bedeutete und welchen Stellenwert er in unterschiedlichen Epochen im Diskurs besaß. Erstaunlicherweise wurden genau diese Fragen, trotz der Breite, in der der Gehorsam in Deutschland diskutiert wurde, noch nie eingehend gestellt. Dabei lässt sich – das ist die zentrale Prämisse dieses Buches – ein entscheidender historischer Wandel im Verständnis des Gehorsams über die vergangenen 300 Jahre verzeichnen. Gehorsam bedeutet heute etwas wesentlich anderes als noch im 18. Jahrhundert, und dieser Wandel lässt sich nicht allein auf die unterschiedliche Wertschätzung des Gehorsams reduzieren.
Dieses Buch folgt im Nachvollzug der Veränderungen im Gehorsamsverständnis von der Aufklärung bis zur Gegenwart einer chronologischen Ordnung. Die einzelnen Kapitel orientieren sich an bekannten politischen Wegmarken, wie dem Ende der Befreiungskriege im Jahr 1815, der Gründung des Kaiserreichs im Jahr 1871 oder dem Beginn des sogenannten Dritten Reichs im Jahr 1933. Angelegt in dieser chronologischen Ordnung ist ein Interesse an einem diachronen Wandlungsprozess: Wie hat sich das Gehorsamsverständnis über die Jahrzehnte und Jahrhunderte entwickelt?
Gleichzeitig aber führen die Kapitel auch ein gewisses Eigenleben, in denen sich der Fokus von den großen historischen Entwicklungen unmerklich auf die Binnendifferenzierung – die Debatten, Widersprüche und interessanten Einzelaspekte – individueller Epochen verschiebt. Im Dickicht der historischen Analyse rücken die Hauptthesen und roten Fäden so stellenweise zugunsten der klareren Darstellung von Einzelproblemen in den Hintergrund. Vier zentrale Thesen seien deswegen hier schon vorab in aller Kürze zusammengefasst – gleichsam als Wegweiser für den Gang durch die folgenden Kapitel.
Alle vier Thesen verstehen sich als akzentuierte Formulierungen historischer Tendenzen. Die Ideengeschichte des Gehorsams liefert uns wenige definitive historische Zäsuren. Alte Ideen leben zumindest als Standpunkte von Randgruppen noch beachtliche Zeit fort; neue Ideen werden oft, lange bevor sie gesellschaftliche Dominanz erreichen, bereits von diesem oder jenem in den Diskurs eingeführt. Selbst die Frage, wann genau eine Idee Dominanz erlangte oder verlor, ist in der Praxis oft nur schwer zu beantworten. Die sich nur sehr allmählich durchsetzende Marginalisierung des Gehorsams im Zeichen der verstärkten Aufmerksamkeit auf ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse – These 4 – bildet dafür das klarste Beispiel in diesem Buch.
These 1: Der Wertewandel wird befeuert – und eingeschränkt – durch das sich wandelnde Verständnis der Freiheit im Gehorsam.
Als vielleicht wichtigstes Moment der historischen Entwicklung entpuppt sich die Frage, ob der Gehorsam auf einer freien Entscheidung basiert. Mit der sich wandelnden Antwort auf diese Frage wird auch die Kategorie des Gehorsams selbst unterschiedlich bewertet. Je weniger der Gehorsam als Produkt einer freien Entscheidung verstanden wird, desto negativer fällt die Bewertung des Gehorsams aus. Oder, anders gesagt: Das Lob des Gehorsams in älteren Zeiten hängt zusammen mit einer damals noch gegebenen Vorstellung, dass es so etwas wie eine Freiheit zum Gehorsam gibt.
Die berühmte deutschsprachige Enzyklopädie der Aufklärungszeit, Johann Heinrich Zedlers Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschafften und Künste (1731–1754), definiert den Gehorsam als »eine vernünfftige Bereitwilligkeit unsern an sich selbst freien Willen nach dem Willen des Gesetzgebers einzurichten«.51 Über die kommenden Jahrhunderte wurde diese Freiheit zum Gehorsam zunehmend skeptischer gesehen. Bereits im 19. Jahrhundert wurde stärker auf die Möglichkeit unfreiwilligen Gehorsams hingewiesen. So liest man 1827 im Encyclopädischen Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Gewerbe, dass Gehorsam eine »entweder aus Gründen, oder auch bloßer Gewohnheit und Furcht vor Strafe hervorgegangene Unterwerfung unter den Willen eines Höheren, Vorgesetzten« bedeute.52 Im Jahr 1890 wird in der vierten Auflage von Meyers Konversationslexikon noch ausdrücklicher auf die unfreien Momente im Gehorsam aufmerksam gemacht und zur klareren Definition des Gehorsams dieser von der »Folgsamkeit« unterschieden. Während Folgsamkeit immer freiwillig sei, bestehe Gehorsam darin, dass man »das Gebotene auch wider Willen thut«.53 Spätestens in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist von der Freiheit zum Gehorsam kaum noch etwas übriggeblieben. In der neunten Auflage von Meyers Enzyklopädisches Lexikon (1973) wird zwar zunächst noch zwischen unfreiwilligem und freiwilligem Gehorsam unterschieden – dann jedoch eingeschränkt, dass auch der vermeintlich freie Gehorsam eigentlich unfrei sei: »Aber auch der vermeintl. freiwillige G. erfolgt nach einer phylogenet. erworbenen Verhaltensdisposition, sofern die Autorität frei gewählt oder als legitimiert angesehen wird.«54
Gelobt wurde der Gehorsam in der Moderne in Deutschland vor allem in jenen Zeiten, in denen Gehorsam als vereinbar mit Freiheit verstanden wurde. Das gilt, mit Einschränkungen, noch für den Nationalsozialismus. In der unter dem deutlichen Einfluss nationalsozialistischer Ideologie entstandenen achten Auflage von Meyers Lexikon liest man zum Gehorsam in einem Eintrag aus dem Jahr 1938: »Zu unterscheiden sind freiwilliger und erzwungener G. Nach nordischer Auffassung findet nur der freiwillige G., der den Willen nicht zerbricht, positive Bewertung.«55 Wenn man diesen Aspekt zu Ende denkt, dann hat es über die vergangenen Jahrhunderte einen deutlichen schwächeren Wertewandel gegeben, als es zunächst den Anschein haben mag. Denn gleich, ob Gehorsam gelobt oder geringgeschätzt wurde: Gleich blieb das Festhalten am Wert der Freiheit (die entweder als kompatibel oder als inkompatibel mit dem Gehorsam betrachtet wurde).
Die These einer zunehmenden Skepsis an der Freiheit zum Gehorsam kann sich auf in der Forschung bestätigte, analoge Befunde in anderen Bereichen der Kulturgeschichte stützen. So hat die Historiographie der Konzentration herausgestellt, dass das 18. Jahrhundert noch daran glaubte, Konzentration hänge vom Willen des Individuums ab. In der psychologischen Forschung vom frühen 19. bis zum frühen 20. Jahrhundert wurde dagegen immer wieder in Frage gestellt, inwieweit Konzentration wirklich aktiv gewollt werden kann.56 Mit einiger Verzögerung gilt das Gleiche auch für den Gehorsam, der ebenfalls immer weniger als Produkt des freien Willens gesehen wurde.
These 2: Die Abwertung des Gehorsams geht einher mit einer Neubewertung der Anstrengung, die Ungehorsam erfordert.
In seinem Aufsatz »Der Ungehorsam als psychologisches und ethisches Problem« aus dem Jahr 1963 fragt Erich Fromm: »Weshalb ist der Mensch so leicht bereit zu gehorchen, und weshalb fällt ihm der Ungehorsam so schwer?«57 Diese Fragestellung wäre noch ein halbes Jahrhundert zuvor kaum vorstellbar gewesen. Lange Zeit galt als vorausgesetzt, dass der Gehorsam Anstrengung erfordert und dem Kind erst mühsam beigebracht werden müsse. Ungehorsam dagegen galt als Zugeständnis an unmittelbare Triebregungen. Bezeichnenderweise fällt die starke Abwertung des Gehorsams im 20. Jahrhundert tendenziell zusammen mit der Umkehr im Verständnis dessen, was als größere Anstrengung betrachtet wird. Während lange Zeit der Gehorsam als mühevoll galt, verdrehte sich die Sichtweise nach 1945 tendenziell in ihr Gegenteil. Bei allem Wertewandel blieb also konstant, dass gelobt wurde, was Anstrengung erfordert. Diese These verweist damit auf eine ähnliche Struktur wie die erste These. Ebenso wie der Gehorsam in dem Maß an Achtung verlor, in dem die Möglichkeit der Freiheit zum Gehorsam ausgeschlossen wurde (und also Freiheit nach wie vor als Wert hochgehalten wurde), verlor der Gehorsam in dem Maße an Wertschätzung, in dem er als weniger schwer als der Ungehorsam galt (die positive Wertung dessen, was schwer ist, blieb bestehen).
These 3: Um die komplexe Geschichte des Gehorsams zu verstehen, muss die Spannung zwischen personalem und legalem Gehorsam beachtet werden.
Die Debatten zum Gehorsam ergeben sich zu einem wesentlichen Anteil aus dem Spannungsverhältnis zwischen zwei verschiedenen Gehorsamstypen: dem »personalen Gehorsam« gegenüber einzelnen Autoritäten und dem »legalen Gehorsam« gegenüber einem Kodex von Regeln und Gesetzen. Auf der einen Seite bietet sich der transparente und egalitäre legale Gehorsam als befreiendes, fortschrittliches Moment gegenüber der älteren Tyrannei personalen Gehorsams an. Die Geschichte des zivilisatorischen Fortschritts in der Moderne ist die Geschichte einer Substitution von personalem durch legalen Gehorsam. Andererseits wird gerade im System der rechtsstaatlichen Ordnung das Befolgen von Gesetzen als ein die Individuen limitierender Gehorsam erfahren. Gewissermaßen ließe sich sogar behaupten, dass die Gehorsamskritik mit der Rechtsstaatlichkeit zusammen steigt (und nicht schwindet, wie zu erwarten wäre). Schon Max Weber betonte, dass die moderne legale, bürokratische Herrschaft, in der alles durch schriftlich festgesetzte Regeln vorgeschrieben ist, den einzelnen Menschen austauschbar erscheinen lässt. Damit wird aber die Erniedrigung, die im Gehorsam steckt, auf die Spitze getrieben.58
Aus dieser Perspektive ist auch die vielbeschworene Janusköpfigkeit des preußischen Staates – zwischen konservativem ständischem Obrigkeitsdenken einerseits und progressiver legalistischer Egalität andererseits – durchaus weniger widersprüchlich, als sonst anzunehmen wäre.59 Denn auch die vielbeschworene Gleichheit vor dem Gesetz kann immer wieder als ein Autoritarismus sui generis empfunden werden. Die Fortschrittlichkeit des 20.000 Paragraphen umfassenden preußischen Allgemeinen Landrechts von 1794 (eingeführt zehn Jahre vor dem viel gerühmten Code Napoléon in Frankreich) wurde darin gesehen, dass hier »die Vorstellung einer Mitgliedschaft an die Stelle des Untertanentums« tritt.60 Außerdem sollte hier nicht (oder nicht nur) die Unterwerfung der niedrigen unter die höheren Stände gepredigt, sondern in handgreiflicher Weise die Gleichheit vor dem Gesetz institutionalisiert werden: »Die Gesetze des Staates«, so heißt es im 22. Paragrafen, »verbinden die Mitglieder desselben ohne Unterschied des Standes, Ranges und Geschlechts.«61 Doch in der kulturgeschichtlichen longue durée der historischen Diskursgeschichte ist der egalitäre Gesetzesglaube selbst zu einem wesentlichen Instrument des preußischen Untertanentums geworden.
Die charismatische Herrschaft in der Moderne mobilisiert ihre Anhänger auch dadurch, dass sie als quasi-revolutionäre Bewegung mit der verhassten Regelhaftigkeit des Lebens aufzuräumen verspricht. Während sowohl rationale als auch traditionale Herrschaft auf unterschiedliche Weise regelgebunden sind, gilt dies für die charismatische Herrschaft nicht.62 Der charismatische Herrscher definiert sich, wie Max Weber es schreibt, über die Maxime »es steht geschrieben, – ich aber sage euch«.63 Und auch dieser Gestus ist für die Moderne folgenreich. Der aus eigener Sicht egalitäre Gesetzesgehorsam wird immer wieder zum Stein des Anstoßes, und aus seiner Kritik erwachsen neue autoritäre Bewegungen.
Spätestens mit der Diskussion über den zivilen Ungehorsam in der Bürgerrechtsbewegung der 1980er Jahre wurde die Kritik am Gesetzesgehorsam auch Bestandteil der linken Theoriebildung. Jürgen Habermas prägte in diesem Zusammenhang, im deutschen Sprachgebrauch, den Begriff des »autoritären Legalismus« (zu dieser Debatte siehe Kapitel 6).
These 4: Die Kategorie des Gehorsams gerät in dem Maße aus dem Blick, in dem ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse in den Vordergrund geraten.
Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts verdrängte die Aufmerksamkeit auf ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse langsam das Interesse am Gehorsam. Anders als der Vasall seinem Herrn, schwört der industrielle Arbeiter seinem Lohngeber keinen Gehorsam. Und anders als manchmal behauptet, setzten sich die neuen Vermögenden auch nicht an die Stelle des alten Adels. Die Rede vom »Geldadel« führt auf eine falsche Fährte. Wenn der Kapitalismus auch neue Ungleichheiten und Abhängigkeitsverhältnisse schuf, so wurden diese doch tendenziell weniger personalisiert und essenzialisiert und mehr als Ausdruck kontingenter Vermögensverhältnisse verstanden, die immer auch anders sein konnten. Im Vordergrund der Wahrnehmung standen nicht Autorität und Gehorsam, sondern Reichtum und Armut, Haben und Nicht-Haben. Der Mensch im Kapitalismus, so die neue Wahrnehmung, handelt aus ökonomischer Not: Einen von diesem ökonomischen Zwangsverhältnis unabhängigen Entschluss zur Unterwerfung des Willens gibt es nicht. Bereits um 1850 wurde diese Sichtweise erstmals explizit. Doch es brauchte seine Zeit, bis sie den Gehorsamsdiskurs in der Breite affizierte. Der Historiker James Sheehan nimmt für das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts an, dass nun die Verteilung des Besitzes zur ausschlaggebenden Kategorie der sozialen Ordnung wurde.64 Und er zitiert dabei die Beobachtung, dass Lehrlinge um diese Zeit schon nur mehr durch finanzielle Bedingungen an ihren Meister gebunden waren. Die Lehrlinge arbeiteten bei ihrem Meister, aber sie wohnten und aßen nicht mehr bei ihm. Das alte patriarchale System hatte ausgedient. Gleichzeitig schränkt Sheehan seine Bemerkungen wieder ein und stellt klar, dass nicht nur Geld, sondern auch Amt und Beruf noch eigenständige Machtfundamente darstellten.65 Erst in der Weimarer Republik, so mein Befund, verdrängen im politischen Diskurs die Debatten über finanzielle Abhängigkeitsverhältnisse breitenwirksamer die älteren Debatten über Gehorsamsverhältnisse.
Die These einer inversen Korrelation zwischen dem Interesse am Gehorsam einerseits und dem Augenmerk auf ökonomische Abhängigkeit andererseits findet eine Bestätigung in der starken Divergenz der Aufmerksamkeit, die dem Gehorsam in den zwei Staaten des geteilten Deutschlands zukam. Unter dem sozialistischen Fokus auf ökonomische Abhängigkeitsverhältnisse in der DDR geriet die Kategorie Gehorsam sehr viel stärker in den Hintergrund als in der Bundesrepublik. Dabei sind die ökonomischen Theorien sicher nicht allein verantwortlich für die zunehmende Marginalisierung des Gehorsams. Vielmehr wurde die ökonomische Perspektive ab dem frühen 20. Jahrhundert flankiert von einer Reihe (ebenfalls in diesem Buch behandelter) soziologischer und psychologischer Ansätze, die gleichfalls auf die Marginalisierung des Gehorsams hinausliefen.
Gehorsam und Pflicht
Nach einem Vortrag zum protofaschistischen Gehorsamsbegriff bei Hedwig Courths-Mahler und Gerhart Hauptmann, den ich bei der amerikanischen Germanistentagung im Herbst 2022 gehalten hatte, bemerkte der Historiker Andrew Donson, dass es doch wohl relevanter sei, sich mit dem Begriff der Pflicht als mit dem des Gehorsams auseinanderzusetzen. Pflicht (viel mehr als Gehorsam), so Donson, sei es gewesen, der von den preußischen Lehrern den Kindern eingebläut worden sei.
Donson trifft damit einen sehr wichtigen Punkt, und bevor im Folgenden in der Hauptsache vom Gehorsam geredet werden soll, gilt es, das Verhältnis dieser Begriffe zueinander näher zu betrachten. Richtig ist, dass sich Pflicht in der Neuzeit als deutlich prominenter (oder jedenfalls häufiger gebrauchter) Begriff durchsetzte. Statistiken zur relativen Frequenz, mit der diese Begriffe benutzt wurden, zeigen, dass seit dem 18. Jahrhundert die »Pflicht« häufiger in Anspruch genommen wurde als der »Gehorsam«. Unterschiedliche Textkorpora verorten den Punkt, an dem die »Pflicht« den »Gehorsam« überholte, leicht unterschiedlich, doch das 18. Jahrhundert kommt wiederholt als entscheidende Epoche zutage. Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache veranschlagt diesen Wendepunkt um das Jahr 1720. Laut Googles ngram wird Gehorsam von Pflicht um das Jahr 1760 überholt. Beide digitalen Werkzeuge aber lassen annehmen, dass mit der Aufklärung der Begriff Gehorsam gegenüber dem der Pflicht deutlich ins Hintertreffen geriet.
Auch auf andere Weise lässt sich die Dominanz des Begriffs der Pflicht über dem des Gehorsams belegen, wenn auch hier mit anderen historischen Nuancen. Betrachtet man die Titel von Büchern, so kommt man für das 19. Jahrhundert auf etwa sechs- bis siebenmal so viele Bücher, die »Pflicht« im Titel führen, wie die, die »Gehorsam« im Titel nennen.66 Für das 18. Jahrhundert fällt die Tendenz ähnlich aus. Hier sind es achtmal so viele Titel mit »Pflicht« wie mit »Gehorsam«.67 Anders als bei der Worthäufigkeit insgesamt, ist bei den Titeldaten aber auch im 17. Jahrhundert noch eine – wenn auch spürbar schwächere – Dominanz der Pflicht zu bemerken (etwa viermal so viele Titel mit »Pflicht«).68 Betrachtet man dann die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts allein, so gibt es dort eine annähernde Parität der beiden Begriffe in den Titeln.69 Auch die Statistik zu den Buchtiteln legt also nahe, dass sich grob im Umfeld der Aufklärung (wenn man diese hier schon um die Mitte des 17. Jahrhunderts einsetzen lässt) eine Schwerpunktverschiebung vom Gehorsam zur Pflicht als Leitbegriff vollzieht.
Diese statistischen Erhebungen bestätigen das etablierte geistesgeschichtliche und sozialgeschichtliche Narrativ, wie es vor allem durch das Standardwerk von Norbert Elias, Über den Prozeß der Zivilisation (erstmals erschienen 1939), prägend geworden ist. Elias’ Hauptthese seines zweibändigen Opus magnum lautet, dass es im historischen Gang der Zivilisation – und vor allem seit dem späten Mittelalter – zu einer markanten Ablösung von einem externen Zwang zu einem (teilweise bewussten, aber zunehmend auch automatisierten) Selbstzwang gekommen ist. Elias schreibt, dass »Fremdzwänge sich in Selbstzwänge verwandeln«.70 Der moderne Mensch reguliert sich zunehmend selbst. Dieser Wandel ließe sich auch als ein Wandel von Gehorsam zu Pflicht umschreiben.
Nun ist aber die begriffliche Differenzierung zwischen Pflicht und Gehorsam nicht ganz leicht oder eindeutig, zumal wenn man auf das 18. Jahrhundert schaut – jener entscheidenden Epoche also, in der die Pflicht an Konjunktur zu gewinnen scheint. In Johann Christoph Adelungs Grammatisch-kritischem Wörterbuch der hochdeutschen Mundart, das den deutschen Wortschatz der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts erfasst und in vier Auflagen zwischen 1774 und 1811 erschien, findet sich so als erstes Satzbeispiel unter dem Eintrag »Pflicht«: »Es ist deine Pflicht mir zu gehorchen.«71 Darüber hinaus erklärt der Eintrag, dass sich der Begriff der Pflicht etymologisch von dem des Befehls herleite (»Von der veralteten Bedeutung des Activi befehlen, und des Neutrius, verpflichtet verbunden sein.«). Parallel dazu liest man zu Beginn des Eintrags »Gehorsam« ebenfalls, dass es sich bei diesem wesentlich darum handle, Befehle zu befolgen: »Die Bereitwilligkeit, und in engerer Bedeutung, die Fertigkeit, sein Verhalten nach den Befehlen eines anderen zu bestimmen.«
Geht es also, laut Adelung, in beiden Fällen nur darum, dass ein Individuum seine Entscheidungen an die Befehle eines anderen bindet? Nicht ganz. Denn wie sich im Adelung-Beitrag »Pflicht« auch lesen lässt, hat dieser Begriff die weitere Bedeutung, dass er »zuweilen auch den Zustand bedeutet, in welchem eine moralische Nothwendigkeit vorhanden ist«. In Immanuel Kants Philosophie ist diese zweite Lesart der Pflicht dahingehend zugespitzt, dass für ihn alle Pflicht aus einem Prozess der vernünftigen Selbstregulierung resultiert. Pflicht, so Kant, kann allein aus dem kategorischen Imperativ resultieren – und den kategorischen Imperativ gibt jedes Subjekt qua seiner Vernunft sich selbst. Kant schreibt, dass, »wenn Pflicht ein Begriff ist, der Bedeutung für unsere Handlungen enthalten soll, diese nur in kategorischen Imperativen […] ausgedrückt werden könne«.72
Es ist in diesem Sinne einer Selbstregulierung entlang vernunftbestimmter Maximen, dass der Begriff der Pflicht als Gegenbegriff zur unmittelbaren »Neigung« in der Zeit um 1800 seine große Bedeutung gewinnt. Der Ausgleich von (moralischer, vernunftbestimmter) Pflicht und (unmittelbarer, gefühlsmäßiger) Neigung wird vor allem bei Friedrich Schiller zum zentralen Anliegen.73 In Schillers berühmter Definition der Schönheit als Ausgleich von Pflicht und Neigung tritt auch sein von Kant geprägter Pflichtbegriff zutage:
»Wenn nämlich weder die über die Sinnlichkeit herrschende Vernunft, noch die über die Vernunft herrschende Sinnlichkeit sich mit Schönheit des Ausdrucks vertragen, so wird (denn es gibt keinen vierten Fall), so wird derjenige Zustand des Gemüths, wo Vernunft und Sinnlichkeit – Pflicht und Neigung zusammenstimmen, die Bedingung sein, unter der die Schönheit des Spiels erfolgt.«74
In diesem vernunftbestimmten oder moralischen Sinne ist der Begriff der Pflicht gegenüber dem des Gehorsams (gegenüber externen Autoritäten) ambivalent: Pflicht kann zum Gehorsam binden, kann aber auch, wie vor allem in der Literatur des 19. Jahrhunderts vielfach ausgespielt wurde, mit dem Gehorsam in Konkurrenz treten – so, wenn sich die patriotischen Soldaten aus Verpflichtung gegenüber ihrem Vaterland über die Befehle der Vorgesetzen hinwegsetzen, wenn diese Befehle nicht im Landesinteresse sind.75
Aus anderer Perspektive aber kann man wiederum für die tendenzielle Austauschbarkeit der Begriffe »Pflicht« und »Gehorsam« votieren. Gemäß dieser Sichtweise ist die Entgegensetzung von fremdgesteuertem Gehorsam und moralisch-selbstbestimmter Pflicht ein ideologisches Blendwerk, das die Fremdsteuerung in der Pflicht zu verdecken sucht. In diesem Sinne äußert sich etwa der deutsch-amerikanische Psychologe Arno Gruen, der Pflicht schlicht als eine verinnerlichte Form des Gehorsams beschreibt, wobei Gehorsam als »die Unterwerfung des Willen unter einen anderen«76 definiert wird. Über die Nähe von Pflicht und Gehorsam schreibt Gruen: »Pflichterfüllung aber hat mit Gehorsam zu tun. Indem man sich pflichtbewusst verhält, bleibt man dem Bild treu, das Eltern und andere Autoritätspersonen von sich selbst vermittelt haben.«77
Wichtiger dafür, warum es in diesem Buch primär nicht um Pflicht, sondern um Gehorsam gehen soll, ist aber noch eine andere Überlegung. Denn wenn auch Pflicht seit dem 18. Jahrhundert zu dem häufiger verwendeten Begriff wird, bleibt Gehorsam doch die Kategorie, um den sich die deutlich schärferen Debatten bilden. Weit mehr als die bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts weitgehend konsensfähige Pflicht wird der Gehorsam spätestens seit dem 18. Jahrhundert zum Streitpunkt und zum Gegenstand signifikanter historischer Umbildungen. Es ist der Gehorsam, der historisch eine wesentliche Abwertung erfährt – und dann stellenweise wieder polemisch aufgewertet wird. Und es ist der Gehorsam, an dem sich daher auch viel eher interessante Debatten über das »warum«, »wann« und »wieviel« (Gehorsam) entzünden. Der Begriff der Pflicht erscheint dem gegenüber bereits als eine von zahllosen Kompromissbildungen zwischen Gehorsam und Freiheit (zwischen den Erwartungen der anderen und dem Imperativ des eigenen Ichs), die sich im Laufe der vergangenen 300 Jahre herausgebildet haben. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gerät der Begriff der Pflicht ob seiner Verwandtschaft mit der Kategorie des Gehorsams selbst zunehmend in die Kritik. Der Gehorsam dagegen ist der dezidiert unmoderne Begriff. Er bezeichnet die Unterwerfung des Individuums unter eine andere, höhere Macht – und gerade an den Debatten um diesen kontroversen, zunehmend marginalen und doch nie ganz verschwindenden Begriff lassen sich gewinnbringend entscheidende Aspekte der deutschen Moderne nachvollziehen.
Anmerkung zur Vorgehensweise
Dieses Buch setzt sich zum Ziel, einen ideengeschichtlichen Wandel über rund 300 Jahre nachzuvollziehen und dabei einerseits die diachrone Dynamik sichtbar werden zu lassen, andererseits aber auch den einzelnen Epochen in ihrer gedanklichen Mannigfaltigkeit gerecht zu werden. Das Quellenmaterial, das sich hierbei anbietet, ist schier unendlich. Denn ausdrücklich soll es nicht darum gehen, den Wandel im Gehorsamsbegriff nur an einer Handvoll kanonisierter literarischer oder philosophischer Werke abzulesen.78 Was Gehorsam in einer Epoche bedeutet, ergibt sich nicht aus den Werken Kants, Hegels und Nietzsches allein, sondern höchstens aus der Zusammenschau dieser und anderer philosophischer Werke mit der literarischen und journalistischen Produktion sowie den offiziellen politischen Verlautbarungen der Zeit. Jede Auswahl aus dem sich derart massenweise anbietenden Quellenmaterial muss sich mit dem Vorwurf konfrontiert sehen, entweder wahllos oder, im Gegenteil, allzu gezielt auf der Suche nach Belegen für vorgefasste Thesen im Archiv gewühlt zu haben.
Ich bin diesem Problem dadurch begegnet, ausgedehnte Fallstudien einzelner Zeugnisse zu vermeiden und stattdessen bei der Analyse in die Breite zu gehen, um in jedem Kapitel möglichst viele verschiedene Stimmen einer Epoche zu Wort kommen zu lassen. Um die Vielstimmigkeit der Epochen einzufangen, habe ich mich bemüht, in die verschiedenen politischen Lager zu schauen und sowohl einfache als auch komplexere Textarten zu berücksichtigen. Zudem sollte keine einzelne Disziplin und kein einzelnes Gesellschaftsfeld privilegiert werden. Weder Philosophie noch Theologie oder politische Theorie bestimmen den Ton. Nur Literatur – und in späteren Kapiteln Film – wird ein relativ prominenter Raum beigemessen. Dafür gibt es, so meine ich, gute Gründe. Nicht nur dienen diese Medien als Schmelztiegel zahlreicher spezialisierter Diskurse, sondern es wird hier auch sichtbar, wie sich bestimmte theoretische Vorstellungen in konkreten Geschichten menschlichen Handelns bewähren.