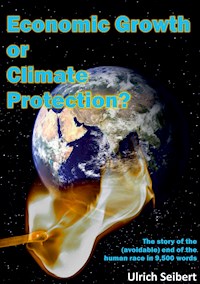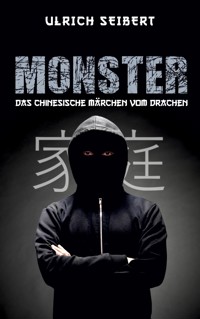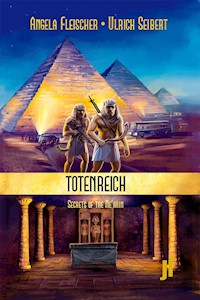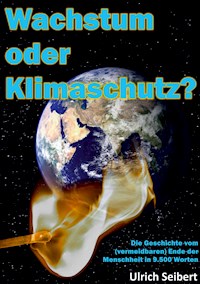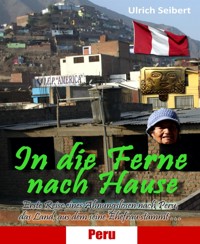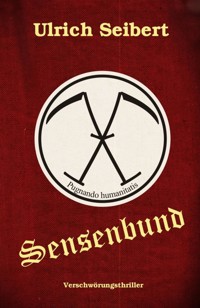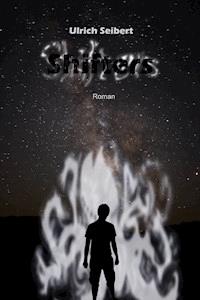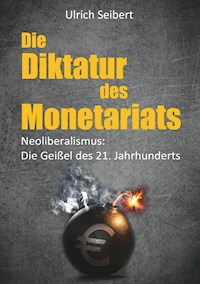
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Seit den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Neoliberalismus, ausgehend von den USA ("Reagonomics") die Welt erobert. Doch Neoliberalismus ist keine Fortschreibung der menschlichen Zivilisation, er ist das glatte Gegenteil: Neoliberalismus ist ein Rückfall in das längst überwunden geglaubte Recht des Stärkeren, in Zeiten von extremer Ausbeutung, die in seinen Ausprägungen der Sklavenhaltung und dem Imperialismus des vorletzten Jahrhunderts in nichts nachsteht, ein System, das Solidarität und Menschlichkeit gezielt unterdrückt, ein System, von dem selbst Papst Franziskus sagt: "Diese Wirtschaft tötet". Der Autor und Diplomkaufmann Ulrich Seibert geht in diesem Buch den Fragen nach, woher Neoliberalismus kommt, wer seine Akteure sind, wie dieses System installiert wurde, was die konkreten Auswirkungen sind, die uns alle betreffen und wer davon profitiert ... und wer nicht. Er versucht nachzuweisen, dass Neoliberalismus die großen Probleme unserer Zeit (z.B. Umweltzerstörung, Klimakrise), wenn nicht sogar verursacht, dann diese zumindest noch verschärft. Außerdem zeigt er auf, welche Möglichkeiten zur Umkehr es geben könnte und stellt linke Vorschläge für alternative Wirtschaftssysteme auf den Prüfstand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 507
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Humanität besteht darin, dass niemals ein Mensch einem Zweck geopfert wirdAlbert Schweitzer
Inhalt
Über den Autor
Vorwort
PROLOG
P.1. Vision einer möglichen Entwicklung der Bevölkerung dieses Planeten
P.2. Zentrale Aufgabe der Politik
P.3. Kernthesen
TEIL 1: Was genau ist Neoliberalismus?
1.1. Begriffsbestimmung
1.2. Die Geschichte des Neoliberalismus
1.2.1. Die Geburt des Neoliberalismus
1.2.2. Der heimliche Systemwechsel am Beispiel Deutschlands
1.3. Theoretische Grundlagen
1.3.1. Theorie und Ideologie in den Wirtschaftswissenschaften
1.3.2. Die Basis: Der Liberalismus des Adam Smith
1.3.3. Das 20. Jahrhundert: Keynesianismus und Neoklassik
1.4. Versuch einer Einordnung des Neoliberalismus
1.5. Zielkonflikte
1.6. Kernthesen
TEIL 2: Auswirkungen des Neoliberalismus
2.1. Weltweite Kriege, Konflikte und Fluchtbewegungen
2.1.1. Produktion und Vertrieb von Waffen und Munition
2.1.2. Schaffung frischer Märkte durch Zerstörung und Wiederaufbau
2.1.3. Sicherung von (billigen) Rohstoffen und Lebensmitteln für die Industrienationen
2.1.4. Verarmung ganzer Regionen
2.1.5. Verhinderung starker, vom globalen Finanzwesen unabhängiger Wirtschaftsblöcke
2.1.6. Konflikte aufgrund des weltweit wachsenden Widerstands gegen westliche Politik
2.2. Massive Umverteilung von unten nach oben
2.2.1. Umverteilung als systemimmanentes Prinzip
2.2.2. Privatisierung von Gewinnen, Sozialisierung von Verlusten
2.2.3. Schiedsgerichte in „Freihandelsabkommen“
2.2.4. Die Politik des billigen Geldes
2.2.5. Spekulationen mit Grundnahrungsmitteln und Rohstoffen
2.2.6. Steuer- und Abgaben-„Subventionen“ der Superreichen
2.2.7. „Entwicklungshilfe“
2.3. Demokratieabbau und politische Entmündigung der Staatsbürger
2.3.1 Die gekaufte Politik
2.3.2 Fassaden-Demokratie
2.3.3. Wie konnte das geschehen?
2.3.4. Der privatisierte Staat
2.4. Irreversible Umweltzerstörung
2.5. Kernthesen
TEIL 3: Wer sind die neoliberalen Akteure?
3.1. Das superreiche Prozent der Gesellschaft
3.2. Treuhänder des Monetariats
3.3. Handlanger des Monetariats
3.3.1. Hochschulen
3.3.2. Das öffentliche Bildungswesen
3.3.3. Die Politik
3.4. Die Rolle der Medien und der Journalisten
3.5. Kernthesen
TEIL 4: Die Strategien hinter dem Neoliberalismus
4.1. Lobbyismus
4.2. Schockstrategien
4.3. Psychologie und Sprache
4.4. Institutionalisierung des Neoliberalismus
4.5. Networking
4.6. False Flag-Auftritte und Astroturfing
4.7. Gegeneinander-Ausspielen der „Produktionsfaktoren“
4.8. Kernthesen
TEIL 5: Auswege?
5.1. Das große Ziel
5.2. Das bedingungslose Grundeinkommen als Lösungsansatz?
5.3. Das Umfeld für Veränderungen
5.4. Transformation versus Revolution
5.5. Der Ansatz der linken Bewegung: Enteignung von Produktionskapital
5.6. Kritik am Ansatz der Enteignung
5.7. Der Weg des aristotelischen Diktators
5.7.1. Die Sozialbilanz
5.7.2. Transparenz und Korruptionsbekämpfung
5.7.3. Steuerpolitik
5.7.4. Reorganisation der Daseinsvorsorge
5.7.5. Leistung und Wettbewerb
5.7.6. Außen- und Wirtschaftspolitik auf Basis internationaler Fairness
5.7.7. Einführung eines Unternehmensstrafrechts
5.7.8. Reform des Bildungssystems
5.7.9. Reform der öffentlich-rechtlichen Medien
5.8. Konsum und Glück – ein untrennbares Junktim?
5.9. Umgang mit der „Angst“
5.10. Kernthesen
EPILOG
Danksagung
Index der Personen und Organisationen
Weitere Bücher des Autors
Anmerkungen
Über den Autor
Ulrich Seibert, Jahrgang 1964, studierte in Regensburg Betriebswirtschaftslehre sowie Grundzüge der Volkswirtschaftslehre und schloss das Studium mit dem Titel Diplom-Kaufmann ab. Er arbeitete in verschiedenen mittelständischen Unternehmen der Musikbranche.
Nach über zehn Jahren wechselte Seibert nach einer Zwischenstation als freiberuflicher Mitarbeiter einer Steuerberatungskanzlei zu einem bayerischen Unternehmerverband, wo er sich überwiegend um die Sorgen und Nöte kleiner und mittlerer Firmen der Branche kümmerte.
Seit 2013 arbeitet Seibert freiberuflich als Autor. Zu seinen Werken gehören mehrere Romane, Kurzgeschichten sowie Reise- und Fachliteratur.
Das Interesse für das Thema „Neoliberalismus“ ergab sich aus der Zusammenarbeit mit einem Kreisverband der Partei der LINKEN, für den er unter anderem aufgrund des Studiums und der Erfahrungen in der Wirtschaft mehrere Vorträge zu diesem Thema ausarbeitete und hielt. Die Idee zu diesem Buch ergab sich aus dem Wunsch mehrerer Hörer, den Inhalt dieser Vorträge nachlesen zu können.
Vorwort
Das Überleben der Menschheit ist so gefährdet wie nie zuvor in ihrer Geschichte: Klimakrise, Ressourcenknappheit (auch Entwaldung, zum Beispiel des Amazonas-Urwalds), Überbevölkerung, Verschmutzung der Luft und der Ozeane, nicht zu vergessen weltweit ansteigende Konflikte und Migrationsbewegungen werden zu globalen und höchst brisanten Problemen, von denen eines alleine schon ausreichen würde, um den Tod von Milliarden von Menschen zu verursachen. Diese Aufgaben sind so gewaltig, dass sie nur in internationaler Kooperation und in einem überparteilichen Konsens gelöst werden können. Überparteilich bedeutet, dass rechte wie linke Kräfte an einem Strang ziehen müssen, wenn wir noch eine Chance für ein weiteres Millennium auf diesem Planeten bekommen wollen – und das rasch!
Viele Menschen haben sich zu diesen Themenkomplexen bereits den Kopf zerbrochen. Ich möchte in diesem Buch nur den zentralen Punkt, also des Pudels Kern, herausgreifen und behandeln, denn nur, wenn wir es schaffen, hier anzusetzen, können unsere Bemühungen in den anderen genannten Themenbereichen mit der Aussicht auf Erfolg belohnt werden. In meinen Augen liegt das Hauptproblem in dem Wirtschaftssystem, das wir – die Bürger der westlichen Industrienationen – in den letzten Jahrzehnten übergestülpt bekommen haben, einem Wirtschaftssystem, das Egoismen und das Recht des Stärkeren propagiert und somit ein Klima schafft, das fortschrittlichen und sozialen Kräften, die in anderen Kategorien als der des Profits denken, den Boden unter den Füßen wegzieht. Sahra Wagenknecht hat dieses System in ihrem Buch „Reichtum ohne Gier“1 auf ganz hervorragende Weise analysiert und mit vielen Beispielen dokumentiert. Ich werde daher nicht so tief in die Analyse einsteigen wie Frau Wagenknecht das getan hat und auch nicht so viele Beweise anführen, sondern werde mich auf andere Aspekte und vor allem auf Lösungsansätze konzentrieren. Gleichwohl empfehle ich zusätzlich die Lektüre dieses hochinteressanten Buchs. Leider fand ich die Schlussfolgerungen und Lösungsansätze, die sie daraus gezogen hat und präsentiert, zwar gut gemeint, allerdings teilweise wenig zielführend, da schlechterdings in der heutigen politischen Konstellation nicht umsetzbar. Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass es auch innerhalb dieses politischen Umfelds aus deutschem Grundgesetz und Einbindung in die Europäische Union Wege geben könnte, aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Dieser Weg versucht gar nicht erst, mit dem Kapitalismus, schon gar nicht mit der Marktwirtschaft, zu brechen, sondern die Werte persönliche Freiheit, Demokratie, Unternehmertum in einem echten Wettbewerb, aber auch Humanität und Solidarität, nicht nur aufrecht zu erhalten, sondern diesen nach Möglichkeit wieder einen Boden zu bereiten, auf denen diese gedeihen können. Der Leitsatz dabei muss allerdings immer lauten: Wirtschaft und Geld haben den Menschen zu dienen, nicht umgekehrt! Wir waren schon einmal fast an dieser Stelle und hatten diesbezüglich einen starken gesellschaftlichen Konsens, als die soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik etabliert wurde. Sie wurde aufgegeben von Menschen, die vorgaben, die Interessen Vieler zu vertreten, in Wahrheit aber zugunsten der Interessen einiger Weniger agierten. Von daher hoffe ich, dass die gemachten Vorschläge über Parteigrenzen hinaus Akzeptanz finden können.
Dieses Buch richtet sich an Menschen, die sich für das Thema interessieren, unabhängig von politischer Ausrichtung oder davon, ob schon Grundkenntnisse in Wirtschaft oder Politik vorhanden sind. Aus diesem Grund wird auf theoretische Grundlagen, wo sie denn nötig sind, nicht, wie in der Wirtschaftslehre üblich, anhand mathematischer Modelle, sondern in möglichst einfach gehaltenen Sätzen eingegangen werden. Der Fokus bei diesem Werk liegt weniger in der Tiefe als vielmehr in einem möglichst umfassenden Überblick über die essenziellen Aspekte des Neoliberalismus. Der Autor ist sich der Problematik, dass sich bei einer tiefschürfenden Herangehensweise zu jedem einzelnen Kapitel ganze Bände schreiben ließen, durchaus bewusst.
PROLOG
P.1. Vision einer möglichen Entwicklung der Bevölkerung dieses Planeten
Nicht zuletzt aufgrund der technischen Fortschritte hat die Menschheit insbesondere der letzten 150 Jahre beachtliche Wohlstandssprünge erfahren. Wir müssen heute kein brackiges Wasser mehr aus einem Brunnen schöpfen und nach Hause schleppen, jeder Haushalt hat fließendes Wasser, die meisten sogar in der gerade gewünschten Temperatur. Wenn wir sehen wollen, wie es woanders aussieht, wie andere Menschen leben, schalten wir eine Kiste namens Fernseher ein. Wir können mit jedem Menschen auf diesem Planeten sprechen als stände er direkt neben uns dank Internet und Telefon. Wir stecken unsere getragene Wäsche oder unsere schmutzigen Teller in eine Maschine und wie durch Zauberei können wir sie kurze Zeit später wieder sauber herausholen. Wir müssen dank verschiedener Hilfsmittel nicht mehr schwer schleppen und nur noch in wenigen Berufen harte körperliche Arbeiten verrichten. Wir können unsere Notdurft im Privaten und unter besten Hygiene- und Komfortbedingungen verrichten. Wenn wir Hunger bekommen, greifen wir in den Kühlschrank. Jeder hat ein Dach über dem Kopf, das ihn zuverlässig vor Wind und Wetter schützt. Wir können uns sicher fühlen vor Raubtieren, denn das einzige Raubtier, das uns wirklich noch gefährlich werden kann, ist der Mensch selbst. Wer menschliche Zuwendung vermisst, dem stehen mehr Möglichkeiten denn je zuvor zur Verfügung, einen anderen Menschen zu finden, den dasselbe Problem plagt – und wir sind völlig frei in unserer Partnerwahl, niemand schreibt uns vor, wen wir aus welchem Grund heiraten müssen. Mittlerweile können wir sogar gleichgeschlechtlich heiraten, wenn wir das wünschen. Wir haben sehr viele gefährliche Krankheiten besiegt und selbst das Weltall erreicht. Wenn es uns in unserem sicheren Heim zu langweilig wird, können wir innerhalb von Stunden beinahe jeden beliebigen Ort auf diesem Planeten erreichen. Wir versinken nicht in einem Morast aus Abwasser, Kloake und Abfall und Weichspüler macht unsere Handtücher schön flauschig. All das nehmen wir heute als selbstverständlich an, als quasi „gottgegeben“; wir gehen davon aus, auch künftig einen Anspruch auf all das zu haben.
Wenn wir einem Vorfahren vor, sagen wir, 500 Jahren von diesen Errungenschaften erzählt hätten, würde er denken, dass die Menschen unserer Zeit sorgenfrei im Paradies lebten. Aber das gelingt uns offensichtlich nicht. Es geht schon los damit, dass nur ein kleiner Bruchteil der Menschen diese Errungenschaften überhaupt genießen kann. Der Großteil der Menschen, nämlich zwei Drittel der Weltbevölkerung leiden mindestens einen Monat pro Jahr unter Wassermangel2. 663 Millionen Menschen, beinahe ein Zehntel der Weltbevölkerung, haben laut Fact Sheet Wasser (Stand 03/2017) der Welthungerhilfe überhaupt keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Derselbe Bericht führt aus: „Pro Tag sterben 1.000 Kinder unter fünf Jahren an Durchfallerkrankungen. Insgesamt sterben jährlich etwa 842.000 Menschen aufgrund verunreinigten Trinkwassers sowie schlechter Hygiene- und Sanitärbedingungen.“3
Man könnte denken: „Schicksal! Wir sind einfach viel zu viele Menschen für diesen Planeten und es reicht halt nicht für alle. Solange ich genug habe …“ Doch diese Sichtweise greift zu kurz. Wir haben genug von allem und es würde durchaus für alle reichen. Wir verfügen über genug Wasser und wir haben die Kapazitäten, es überall auf der Welt zu reinigen und wir könnten insbesondere in einigen, heißen und trockenen Teilen dieses Planeten, in denen es mehr als genug Sonnenenergie gibt, relativ kostengünstig Meerwasser entsalzen und es auf diese Weise trinkbar machen. Wir produzieren heute mehr Lebensmittel als die Weltbevölkerung insgesamt benötigt. Dennoch hungern laut Welthungerhilfe 795 Millionen Menschen4. Alle zehn Sekunden stirbt ein Kind unter fünf Jahren, meist an den Folgen von Unterernährung oder als Folge eigentlich heute leicht behandelbarer Krankheiten. Seit Sie begonnen haben, dieses Kapitel zu lesen, sind demnach etwa weitere 13 Kinder dieser Katastrophe erlegen. Sicher, die Vereinten Nationen haben schon einiges in Bezug auf die dringendsten Ernährungsprobleme in Angriff genommen und auch schon große Erfolge erzielt hat, wenn man bedenkt, dass die Zahl der Hungernden zu Beginn der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts noch bei über einer Milliarde Menschen lag5.
Allein, es reicht nicht! Bei weitem nicht! Jedes Kind, das in einer Welt des Überflusses an Hunger stirbt, ist eines zu viel. Wir, die wir so viel von allem haben – und allein in Deutschland landen elf Millionen Tonnen (!!) Lebensmittel pro Jahr auf dem Müll6 - sind letztlich die Schuldigen, das Strafgesetzbuch nennt diesen Tatbestand „unterlassene Hilfeleistung“. Nur hat unser Strafgesetzbuch keine Geltung für solche Fälle …
Wollen wir so leben?
Wollen wir eine Gesellschaft sein, deren wichtigste Lebensinstrumentarien der Ellbogen und rücksichtsloser Egoismus sind?
Menschen haben sich die Erde untertan gemacht, weil sie zusammengearbeitet haben. Ein einzelner Jäger hätte sich niemals alleine mit Erfolgsaussichten einem Mammut entgegenstellen können. Der Mensch ist ein soziales Wesen, auch wenn die Erziehung in der heutigen Zeit Individualismus um jeden Preis lehrt, wobei gleichzeitig paradoxerweise der Anpassungsdruck an gesellschaftliche Normen höher ist als je zuvor. Immer mehr Eltern sehen ihre eigenen Kinder als hochbegabte Genies an, erzählen ihnen, wie einzigartig sie sind und dass sie alles haben könnten, wenn sie es nur wollten und sich ein klein wenig dafür anstrengten. Gesellschaftliche Visionen von liberté, égalité, fraternité die Menschen zu Zeiten der französischen Revolution und lange danach antrieben, nach einer besseren, gerechteren Gesellschaftsform zu streben, scheinen allesamt verschwunden zu sein, obwohl wir doch noch lange nicht an diesem hehren Ziel angekommen sind. Diejenigen, die über solche Visionen nachdenken, werden als „Gutmenschen“ oder als idealistische Spinner abgetan mit dem Hinweis, dass das herrschende System „alternativlos“ sei. Doch weder ist es alternativlos, noch auch nur ansatzweise zielführend. Angesichts der Situation auf der Welt, Stichwort ständig ansteigende Zahlen von Flüchtenden, zahlreiche Konflikte, Klimakrise ist der Mensch mehr denn je gefordert, nach anderen Wegen zu suchen, um kommenden Generationen noch eine Lebensgrundlage auf diesem Planeten zu hinterlassen. Ein „Weiter so!“ führt die Menschheit unmittelbar in den Abgrund. Selbst ein CSU-Minister hat die Situation mittlerweile erkannt und eingestanden7.
Wer ein Problem nachhaltig lösen möchte, muss sich zunächst einmal auf die Suche nach dessen Ursachen begeben.
Zum einen wird hier gerne und mit Recht die Überbevölkerung ausgemacht. Es gibt 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt, mehr als zu jedem anderen Zeitpunkt der Erdgeschichte, Tendenz stark steigend. Die Ursachen dafür variieren je nach Kontinent und Region und liegen neben hohen Fortpflanzungsraten ebenso bei sinkender Säuglingssterblichkeit und steigender Lebenserwartung. Milliarden von Menschen, die immer mehr werden bei gleichzeitig sinkenden Ressourcen … es leuchtet unmittelbar ein, dass die Menschheit hier vor einem gewaltigen, womöglich existenziellen Kollaps steht … wenn wir das Problem nicht rechtzeitig in den Griff bekommen. Ansätze wie die 1979 in China eingeführte und inzwischen wegen des verheerenden „Erfolges“ schon wieder sanft begrabene Ein-Kind-Politik gibt es, meist bedeuten sie für die Betroffenen allerdings einen starken Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte und sind somit moralisch zumindest fragwürdig. Ebenso fragwürdig sind auch alle anderen Zwangsmaßnahmen, denn sie würden immer auf einen empfindlichen, staatlichen Eingriff in die konkrete Lebensgestaltung und Familiensituation der Menschen hinauslaufen. Sicher, wenn es wirklich keinen anderen Weg gäbe, müsste das Wohl vieler beziehungsweise Aller vermutlich über das Wohl eines Einzelnen gestellt werden … Aber diesen Weg gibt es! Die Lösung für das Problem der Überbevölkerung liegt in greifbarer Nähe, denn in einigen Ländern wurde die Lösung bereits mit großem Erfolg umgesetzt: Ausgerechnet in den Industrienationen, den Ländern mit der höchsten potenziellen Lebensqualität, sinkt die Bevölkerungszahl, zumindest in Bezug auf die native Bevölkerung8. Trotz Zuwanderung nimmt die Gesamtbevölkerung beispielsweise in Deutschland nicht zu, „entlastet“ aber gleichzeitig die Regionen, aus denen die Migranten kommen. Die Entwicklung war bisher stets dieselbe: Mit wachsendem Wohlstand und steigender Bildung geht die Zahl der Geburten pro Frau zurück, teilweise ziemlich deutlich. Voilà, da halten wir den Schlüssel für die Lösung des Problems der Überbevölkerung schon seit geraumer Zeit in der Hand! Wenn es gelänge, für eine halbwegs gerechte, weltweite Verteilung des Wohlstands zu sorgen und natürlich für Bildung, die einem Jeden unabhängig von Hautfarbe, Alter, Geschlecht, Religionszugehörigkeit oder sexueller Ausrichtung jederzeit kostenfrei beziehungsweise notfalls für jeden problemlos erschwinglich zur Verfügung zu stehen hätte, dann stünden die Chancen gut, dass sich Überbevölkerung damit wirksam stoppen und mit der Zeit sogar umkehren ließe. Falls dies in einigen Regionen nicht ausreichen sollte, kann eine sinnvolle Anreiz-Politik die Entwicklung in die richtige Richtung ebenfalls beeinflussen, ohne dass dazu Zwangsmaßnahmen oder staatliche Eingriffe in die Privatsphäre nötig würden.
Sicher, diese Aufgabe präsentiert sich alles andere als trivial, aber sie wäre lösbar, wenn nur der politische Wille vorhanden wäre, in dieser Sache wirklich etwas zu bewegen. Doch will ich zu diesem Thema an dieser Stelle nicht weiter ins Detail gehen. Denn die nicht erfüllte Grundvoraussetzung für diesen Lösungsansatz führt zum zweiten großen Problem, das für die Situation auf diesem Planeten verantwortlich ist: die stets wachsende Verteilungsungerechtigkeit und zwar sowohl die nationale, erst recht aber die internationale. Bevor wir nicht über Mechanismen verfügen, mittels derer sichergestellt werden kann, dass wir die Ressourcen dieses Planeten allen Menschen darauf zur Verfügung stellen können, ist der Versuch, die Überbevölkerung auf dem oben skizzierten Weg (oder auch das Problem der Klimakrise) in den Griff zu bekommen, von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Daher ist die Lösung des Verteilungsproblems die vordringliche Aufgabe und wir könnten damit gleich mehrere Fliegen mit einer Klatsche erschlagen: Nicht nur würden damit zahllose Konflikte um Ressourcen im Sande verlaufen, auch Fluchtursachen würden sich damit erledigen. Wir alle könnten mit den vorhandenen Ressourcen ein sorgenfreies, erfülltes Leben führen, wären sie nur allgemein verfügbar. Momentan verbraucht die Menschheit pro Jahr das etwa 1,6-fache dessen, was der Planet an erneuerbaren Ressourcen hervorbringt9. Das bedeutet nichts anderes, als dass die Menschheit momentan von der Substanz des Planeten lebt, also Schulden aufbaut, die unsere Kinder oder Enkel einst zu tilgen haben werden, denn wir können nicht davon ausgehen, dass die Natur der Menschheit eine Fristverlängerung gewährt. Der Astrophysiker Steven Hawking rechnet beispielsweise damit, dass unsere Mutter Erde unserer Spezies gerade einmal noch einhundert Jahre lang Kost und Logis gewähren kann10. Dabei ist ein großer Teil der Weltbevölkerung aus rein materiellen Gründen gar nicht in der Lage, auch nur annähernd ein Konsumverhalten zu pflegen, wie es die Bevölkerung der sogenannten westlichen Welt an den Tag legt. Der Schweizer Soziologe und Politiker Jean Ziegler wähnt im Vorwort seines Buchs „Der schmale Grat der Hoffnung“ gar: „Der dritte Weltkrieg gegen die Völker der Dritten Welt hat längst begonnen“11. Wer in diesen Konflikten nicht mithalten kann, macht sich auf den Weg, um sich im „Paradies Westen“ einen Platz zu sichern. Die heutigen Fluchtbewegungen, die nach aktuellen Zahlen 65 Millionen Menschen umfassen, sind nur ein Bruchteil dessen, was auf uns zukommt, sobald der Konflikt um die allernotwendigsten Lebensressourcen in vollem Gang ist. Wer nicht fliehen kann, wird vermutlich umkommen. Dies wird die Realität sein, wenn wir nicht sofort damit beginnen, umzusteuern.
Nur wenige Abenteuerlustige verlassen ihre Heimat, wenn sie zu Hause eine Perspektive haben, ihren Kindern eine Perspektive anbieten können, und nicht um Leib und Leben fürchten müssen. Wer sonntags im Kreis seiner Familie und Freunde gemütlich Kaffee und Kuchen genießen kann, macht keine Revolution, entführt keine Schulmädchen und folgt keinen religiös auftretenden Hasspredigern. Fluchtursachen bekämpfen, bedeutet nicht, die „Festung Europa“ abzuschotten, es bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als diesen Menschen dasselbe Recht auf Leben und Unversehrtheit zuzugestehen, welches wir für uns ganz selbstverständlich in Anspruch nehmen.
Sicher nicht die einzige, aber bei weitem die wichtigste Voraussetzung dafür wäre eine Weltwirtschaftsordnung, die genau diesen Punkt in ihr Kalkül einbezieht. Handelsbeziehungen müssen fair sein und dürfen nicht von der Dominanz des Stärkeren gegenüber dem Schwächeren geprägt sein, wie im Augenblick. Momentan bedeutet deutsche „Entwicklungshilfe“ immer noch allzu oft Wirtschaftshilfe für große, vorzugsweise deutsche Konzerne, ohne dass die offiziell ausgewiesenen „Empfänger“ einen echten Nutzen daraus ziehen können.
In diesem Buch wird die These aufgestellt, dass der Neoliberalismus nicht nur nicht in der Lage ist, die gegenwärtigen Probleme der Menschheit zu lösen, sondern diese sogar noch an Dimension derart potenziert, dass der Untergang zumindest eines Großteils der Menschheit nur noch eine Frage der Zeit ist, wenn er nicht gestoppt wird. Doch wie stoppt man einen Moloch, der weltweit die Herrschaft übernommen hat und den die Politiker der meisten Parteien als „alternativlos“ bezeichnen?
Die großen Fragen, die wir uns zu stellen haben, lauten:
Wie wollen wir künftig als Menschheit leben? Mit der ständigen Angst um die eigene Existenz (und bei den sensibleren Individuen auch um die Existenz der Anderen ...) oder in der Gewissheit, dass uns eine solidarische Gesellschaft auffangen und uns dabei unsere Würde lassen wird, wenn uns ein Schicksalsschlag eines Tages der Fähigkeit beraubt, für uns selbst zu sorgen (was auch unsere Bereitschaft impliziert, unsererseits ein Teil dieser Solidargemeinschaft zu sein)?
Wollen wir unsere Daseinsvorsorge zu einer reinen Ware verkommen lassen oder soll jedermann das Recht haben, diese bei Bedarf zu nutzen, unabhängig von Einkommen, Vermögen und/oder Status?
Wollen wir den Menschen im Rest der Welt dieselben Rechte auf ein Leben in Würde einräumen, die wir für uns reklamieren? Wollen wir die christliche Botschaft der Nächstenliebe, aber vor allem auch über die Jahrhunderte erst mühsam entwickelte, humanistische Grundwerte wie die Gleichwertigkeit aller Menschen auch leben, anstatt sie nur zu predigen?
Wollen wir dazu beitragen, den Nettoressourcenverbrauch so zu steuern, dass einerseits nicht mehr verbraucht wird, als wir nachhaltig erwirtschaften können, andererseits aber auch dafür eintreten, dass diese Ressourcen weltweit zumindest halbwegs gerecht verteilt werden?
Vor allem aber: Wollen wir in diesen wichtigen Fragen mitentscheiden oder diese ausgerechnet allein den mächtigen Geschäftsleuten dieser Welt überlassen?
Diese Fragen müssen unsere Leitlinien sein insbesondere auf der Suche nach einem funktionierenden Alternativsystem für den Neoliberalismus.
Also täten wir gut daran, nicht in Feindbildern zu denken, sondern stattdessen zu versuchen Lösungen zu finden, unter der Voraussetzung, dass wir auch bereit sind, uns selbst an die Nase zu fassen. Wir können dabei nur gewinnen …
P.2. Zentrale Aufgabe der Politik
Sehen wir uns doch einmal ein Stück weit an, nach welchen Mechanismen die Verteilung der Güter funktioniert. Der Wirtschaftswissenschaftler verwendet in diesem Zusammenhang gerne den Begriff der Allokation, ein Wort, das für die Zuordnungsmöglichkeiten knapper Ressourcen zu verschiedenen Verwendungen steht und er befasst sich mit den (Markt-)Vorgängen, die dies möglichst effektiv bewirken. Diese Allokation ist der Schlüssel zu allem, denn mit ihr steht und fällt die Produktion als Ausgangspunkt allen wirtschaftlichen Handelns. Ohne an dieser Stelle in den Diskurs der Experten eingreifen zu wollen, gehe ich im Folgenden von einer Begrifflichkeit aus, die diese beiden Termini, Verteilung und Allokation unterschiedlich verwendet. Allokation findet statt im Rahmen von Verhandlungen und Geschäften zwischen Wirtschaftssubjekten, während ich den Begriff „Verteilung“ eher für Zuwendungen an jene verwende, die am Wirtschaftsleben nicht oder nicht ausreichend teilhaben können. „Allokation“ ist ein sachlich-technischer Begriff, während der Begriff „Verteilung“ darüber hinaus auch eine moralische Komponente enthält. Erstere fällt in den Zuständigkeitsbereich „der Wirtschaft“ beziehungsweise – viele würden sagen – der Märkte, letztere in die Zuständigkeit der Politik. Und hier haben wir auch schon unsere beiden Schlüsselkomponenten: Die Wirtschaft einerseits und der Staat andererseits. Beide sind mitnichten Gegensätze, im Optimalfall ergänzen sie sich gegenseitig. Leider gibt es über die Art und den Umfang der Zusammenarbeit unterschiedliche Auffassungen. Die rechtsgerichteten Parteien tendieren dazu, der Wirtschaft nicht nur freie Hand zu lassen („Laissez-faire“), sondern der Wirtschaft des eigenen Landes auch besonders günstige Rahmenbedingungen und somit Vorteile auf dem internationalen Parkett zuzuschanzen. Der Ausgangspunkt für dieses Denken ist die Idee, dass die Wirtschaft dann am besten „brummt“, wenn die Wirtschaftsteilnehmer dicke Gewinne – die Motivation für Investition – einfahren können. Denn nur, wenn die Wirtschaft rund läuft, können alle Beteiligten, und dazu gehören die Menschen die ihr Einkommen direkt aus der Wirtschaft beziehen, beispielsweise Angestellte, aus ihrer Tätigkeit ein ausreichendes Einkommen erzielen. Läuft die Wirtschaft dagegen schlecht, ist eine hohe Arbeitslosigkeit die Folge, mit der Konsequenz, dass die Lebensumstände für viele deutlich schwieriger werden.
Die linksgerichteten Parteien fordern dagegen die Dominanz der Politik über die Wirtschaft, mit dem Argument, dass jeder Mensch, auch diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer ihr Einkommen nicht aus der Wirtschaft beziehen (können), ein Anrecht auf ein menschenwürdiges Leben hat, ohne sich versklaven zu müssen.
Natürlich ist es schön, wenn die Wirtschaft brummt, aber wer ein gutes Geschäft wittert, macht dieses Geschäft auch dann, wenn seine Gewinne durch Besteuerung gemindert werden. Eine Position, die übrigens in dem Multi-Milliardär Warren Buffet einen Kronzeugen anführen kann12, der nun wirklich völlig unverdächtig ist, dem Kommunismus das Wort zu reden. Aber eine Wirtschaft, deren Wertschöpfung zu einem großen Teil nur einer winzig kleinen Klasse von Vermögenden zukommt, während ein großer Teil der Bevölkerung abgehängt wird, wird ihrem Zweck nicht mehr gerecht. Wirtschaft muss wie gesagt den Menschen dienen, nicht umgekehrt.
Wer nun recht hat, darüber lässt sich trefflich streiten. Doch bevor wir damit beginnen, uns den Neoliberalismus genauer anzusehen, sei zunächst das Verhältnis von Politik und Wirtschaft beleuchtet.
Was genau ist Wirtschaft?
In Wikipedia ist dieser Begriff folgendermaßen definiert: „Wirtschaft oder Ökonomie ist die Gesamtheit aller Einrichtungen und Handlungen, die der planvollen Befriedigung der Bedürfnisse dienen. Zu den wirtschaftlichen Einrichtungen gehören Unternehmen, private und öffentliche Haushalte, zu den Handlungen des Wirtschaftens Herstellung, Absatz, Tausch, Konsum, Umlauf, Verteilung und Recycling/Entsorgung von Gütern. Solche Zusammenhänge bestehen zum Beispiel auf welt-, volks-, stadt- und betriebs- und hauswirtschaftlicher Ebene.“13
Mit anderen Worten: Indem wir Güter oder Geld verwenden oder Anstrengungen unternehmen, um diese zu beschaffen, sind wir ein Teil dieser Wirtschaft. Egal, ob wir unseren Frühstückskäse oder die Tageszeitung kaufen, ob wir arbeiten gehen oder unsere künstlerischen Tätigkeiten gegen Geld darbieten, wir sind immer ein Teil dieser Wirtschaft. Geld, das wir ausgeben, um uns beispielsweise eine Fahrkarte in die Stadtmitte zu kaufen, fließt den städtischen Verkehrsbetrieben zu, die davon Züge kaufen, Sicherheits-Technik anschaffen oder Lokführer bezahlen. Alles ist mit allem verwoben. Wirtschaft ist also ein riesiges, allumfassendes Netzwerk, ohne das – von einem Einsiedler vielleicht abgesehen – in unserer arbeitsteilig ausgerichteten Gesellschaft kein Mensch überleben könnte. Und wie in jedem Netzwerk bestehen bei engen Verflechtungen auch Abhängigkeiten. Ein Streik in einem fernen Land kann dazu führen, dass bei uns ein Rohstoff kurzfristig nicht mehr verfügbar ist. Der Hersteller eines Automobilteils, der diesen Rohstoff benötigt, kann nicht mehr produzieren. Also bekommt die Automobilindustrie Teile nicht mehr, die sie für ihre Autoendmontage benötigt. Also werden Arbeitnehmer in den Urlaub geschickt oder entlassen. Diese kaufen aufgrund ihres Einkommensrückgangs weniger ein, der Umsatz im Einzelhandel geht nach unten. Und so weiter und so fort … Alle Maßnahmen führen gleichzeitig zu Rückkopplungen an anderer Stelle und dies macht es so schwer, Ereignisse in der Wirtschaft zu prognostizieren oder gar zu steuern. Planwirtschaft ist daher allein schon wegen dieser enormen Komplexität von vorneherein zum Scheitern verurteilt, es sei denn vielleicht, die Wirtschaft würde extrem simplifiziert werden, zum Beispiel in der Weise, dass es nur noch ein Automobilmodell gäbe oder nur noch ein T-Shirt für alle, nur eben in ein paar unterschiedlichen Größen.
Die Unwägbarkeiten der Wirtschaft sind aber nicht die einzigen Gründe, warum manche Menschen nicht (mehr) in der Lage sind, sich aus diesem System ein ausreichendes Einkommen zu sichern. Krankheit, Berufsunfähigkeit, Alter oder auch eine unzureichende Ausbildung können dafür sorgen, dass ein Einzelner nichts mehr hat, was er auf dem Markt zu einem Preis anbieten kann, der ihm ermöglicht, das zu erwerben, was er benötigt. Vorausgesetzt, wir wollen als soziale Wesen diese Menschen nicht ihrem Schicksal überlassen, benötigen wir für all diese Fälle eine Institution, die anstelle der Wirtschaft dafür sorgt, dass die „Abgehängten“ wieder ein Einkommen bekommen, mit dem sie zumindest ihre legitimen, menschlichen Grundbedürfnisse befriedigen können.
Damit sind wir dann bei der Politik, respektive dem Staat angelangt. Die allermeisten staatlichen Institutionen beschäftigen sich unmittelbar mit Fragen der Wirtschaft, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ebenso wie das für Bildung und Forschung (Infrastrukturleistung), Ernährung und Landwirtschaft, etc. Die einzigen Ressorts, die nicht unmittelbar der Wirtschaft zuarbeiten, sind Inneres und Verteidigung, Ressorts, die sich um innere und äußere Sicherheit kümmern. Ansonsten kümmert der Staat sich (oder sollte sich kümmern) um folgende Aufgabengebiete:
Unter anderem für die Unternehmen baut er die Infrastruktur aus und erhält sie aufrecht, sodass diese ihre Tätigkeiten von der Beschaffung über die Produktion bis hin zum Vertrieb reibungslos abwickeln können. Der Staat sorgt mit stabilen Rahmenbedingungen dafür, dass die Unternehmer ihren Betrieb verlässlich durchkalkulieren können und den Rechtsrahmen kennen, innerhalb dem sie sich zu bewegen haben. Natürlich kontrolliert der Staat auch die Einhaltung dieses Rechtsrahmens, ansonsten wäre es beispielsweise für eine an einem Fluss gelegene Papierfabrik schon sehr verführerisch, die Entsorgungsvorschriften für giftige Chemikalien mal schnell zu „übersehen“. Wichtig ist – wie der Nationalökonom Adam Smith bereits vor 250 Jahren erkannt hatte – für Unternehmer insbesondere, dass der Staat strikte Neutralität wahrt, also nicht andere Wirtschaftssubjekte wie Konkurrenten oder andere Branchen einseitig bevorzugt.
Auch Arbeitnehmer hängen vom Staat ab, denn dieser muss garantieren, dass sie den Unternehmern auf Augenhöhe begegnen können, um beispielsweise die Höhe der Gehälter aushandeln zu können. Dafür muss der Staat die Organisationsmöglichkeit für Arbeitnehmer gewährleisten. Ein Staat, der hier seine Aufgaben vernachlässigt und Gewerkschaften schwächt, sorgt automatisch dafür, dass diese den Unternehmen nicht mehr auf Augenhöhe gegenüberstehen und damit unter Umständen auch keine angemessenen Gehälter und sonstige Arbeitsbedingungen mehr aushandeln können. Da auch die Arbeitnehmer ein Teil – und kein unwesentlicher – der Wirtschaft sind, ist der Staat auch hier gut beraten, sich neutral zu verhalten, also keine anderen Wirtschaftssubjekte zu bevorzugen. Auch Arbeitnehmer sind auf stabile Rahmenbedingungen beispielsweise im Arbeitsrecht oder im Arbeitsschutzrecht angewiesen. Der Staat organisiert darüber hinaus die soziale Absicherung für Alter oder Arbeitsunfähigkeit aus anderen Gründen.
Außerdem ist der Staat für Transferleistungen zuständig.
Wie nun genau läuft das Zusammenspiel zwischen Staat und Wirtschaft – beziehungsweise wie sollte es laufen? Sehen wir uns einmal nur die Einkommenssituation in einer sehr stark vereinfachten Grafik an:
Die blaue Ellipse repräsentiert das Einkommen, welches die Wirtschaftssubjekte aus ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit, während die braune für das Volkseinkommen steht. Diese beiden Ellipsen sind hier nicht deckungsgleich, weil, wie gesagt, ein Teil der Bevölkerung nicht in der Lage ist, ihr Einkommen aus einer wirtschaftlichen Betätigung zu bestreiten. Nur wo die Schnittfläche lila dargestellt ist, bekommen wir eine Deckung. Die meisten Menschen können ihr Einkommen also aus der Wirtschaft erzielen. Vielen bleibt sogar noch etwas übrig: nachdem alle Kosten gedeckt, alle Angestellten (hoffentlich anständig) bezahlt wurden, bleibt meist ein Gewinn, der auf vielfältige Weise verwendet werden kann: Wiederum als Einkommen des Unternehmers, für die Schuldentilgung oder zur Tätigung neuer Investitionen. Und hier setzt nun der Staat an: er nimmt sich einen Teil dieses Gewinns und verwendet ihn, um seinen Infrastrukturaufgaben nachzukommen und natürlich um die Einkommenslücke aufzufüllen.
Im Optimalfall decken die Transferleistungen des Staates die Einkommen der finanziell Schwachen, um ihnen die Befriedigung der Grundbedürfnisse und somit ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass es der Wirtschaft gut genug geht, dass der Staat „seinen“ Anteil von den Gewinnen (und dazu zählen hier auch Einkommen von Angestellten, die ein höheres Einkommen erwirtschaften als das, was zur Grundsicherung nötig wäre; wie gesagt: nicht nur Unternehmen, sondern wir alle sind Teil der Wirtschaft) abschöpfen und seinen Aufgaben nachkommen kann. Eine brummende Wirtschaft liegt damit im ureigenen Interesse eines Staates und seiner Bevölkerung.
So weit, so gut. Doch was wir seit einigen Jahren beobachten, ist, dass das Verhältnis von Transferleistungen und Gewinnabschöpfungen des Staates stark aus dem Gleichgewicht geraten ist, eine der vielen Ursachen für die aufklaffende Schere zwischen reich und arm. Vereinfacht gezeichnet, sieht das nun eher folgendermaßen aus:
Der Transferanteil reicht nicht mehr aus, um die nötigen Staatsausgaben zu decken. Dies betrifft übrigens nicht nur den Transfer von Einkommen für diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr in der Lage sind, ihr eigenes Einkommen aufzubringen, es betrifft auch öffentliche Investitionen, beispielsweise in Infrastruktur oder Bildung oder auch in eine funktionierende Justiz. Hier ist ganz allgemein das Thema „Diktat der leeren Kassen“ angesprochen, auf welches wir später wieder zurückkommen werden. Auf Anfrage hat mir das statistische Bundesamt eine Tabelle der Entwicklung der zu versteuernden Einkommen einerseits und der Steuereinnahmen aus Lohn- und Einkommensteuer andererseits zugesandt, die ich Ihnen an dieser Stelle nicht vorenthalten möchte:
Das zu versteuernde Einkommen (Spalte 3) sank zwischen 1992 und 2013 (bei Drucklegung die aktuellste verfügbare Zahl) um 59,9 Milliarden Euro, das Steueraufkommen verminderte sich dadurch, aber auch um die Senkung des Steuersatzes um satte 30,3 Milliarden Euro. Das sind beinahe zehn Prozent des gesamten Bundeshaushalts. In diesem Zeitraum hat sich das Bruttoinlandsprodukt aber verdoppelt (!!), nämlich von 1,695 Billionen Euro (1992) auf 3,144 Billionen Euro14. Da Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU, Bundesfinanzminister von 2009 – 2017) seit 2014 seine Vision der „Schwarzen Null“ reitet, liegt auch die Nettokreditaufnahme der Bundesrepublik momentan bei 0,00 €, sodass der Staat effektiv über einen weitaus geringeren finanziellen Spielraum verfügt als noch vor 25 Jahren, als die Wirtschaftskraft des Landes nur halb so stark war. Während die Nettogewinne der Unternehmen und Superreichen also ins Unermessliche wachsen (und damit meine ich nicht nur die offiziell angegebenen, sondern auch die über Steueroasen ausgeschleusten und über Steuervermeidungstricks niemals in eine offizielle Statistik eingeflossenen Überschüsse), reichen die Transferleistungen nicht mehr aus, um der gesamten Bevölkerung ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Das Resultat ist Armut in einem reichen Land, eine Entwicklung, die wir zunehmend durchaus auch hier in Deutschland beobachten können. Daraus kann man – unter der Prämisse, dass die erste Aufgabe des Staates darin besteht, (allen!) seinen Bürgern die Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen – durchaus ableiten, dass der Staat bereits versagt hat. Sicher, das kann man durchaus als ein „Jammern auf hohem Niveau“ klassifizieren, insbesondere dann, wenn man die Zustände in den meisten anderen Teilen der Welt mit ins Kalkül einbezieht. Aber sollte man sich wirklich an denen orientieren, denen es noch schlechter geht, oder doch lieber an denen, die es besser machen und an einem Ziel, das einer modernen Zivilisation würdig ist? Ein Grund dafür, warum wir einen höheren Zivilisationsgrad nicht erreichen können, heißt … Neoliberalismus. Neoliberale Akteure behaupten gerne, dass es einem Land nur gut geht, wenn die Wirtschaft brummt. Wie gesagt, d‘accord. Sozial ist, was Arbeit schafft. Eine Floskel, die gerne von CSU über FDP bis hin zur SPD zu hören ist. Was wiederum nichts daran ändert, dass sie einfach unvollständig ist. Klaus Ernst, Bundestagsabgeordneter der Linken, sagte einmal überspitzt, aber treffend: „Wenn das stimmt, dass sozial ist, was Arbeit schafft, dann war das alte Rom ein Sozialstaat“15. Sozial ist nicht, was Arbeit schafft, sondern sozial ist, was angemessen bezahlte Arbeit schafft. Und auch dieser Satz gilt so nur in Zeiten der Vollbeschäftigung. Arbeit ist für die meisten Menschen in nichtselbständigen Arbeitsverhältnissen nun mal kein Selbstzweck, sondern eine Möglichkeit, für sich und ihre Familie ein Auskommen zu schaffen. Zumindest gilt das für die Welt, in der wir momentan noch leben. Für eine Zukunft, in der Digitalisierung und Maschinen die meiste Arbeit erledigen und Roboter sogar in Alten- und Krankenpflege oder als Chirurgen eingesetzt werden, muss der Begriff „sozial“ definitiv anders definiert werden.
Die Sozialabgaben der Unternehmen wären zu hoch, argumentierte der SPD-Kanzler Gerhard Schröder. Dann das demografische Problem: Immer mehr Junge müssen immer mehr Alte versorgen! „Da muss man kein Mathematiker sein, da reicht Volksschule Sauerland, um zu wissen: Wir müssen irgendetwas machen“, meinte gar SPD-Vorstand Franz Müntefering16 und bewies damit, wie wenig Sachverstand er in dieser Frage mitbrachte. Denn eine Änderung des Rentenalters und eine „Rentenanpassung“ nach unten wären gar nicht nötig gewesen! Warum nicht? Wegen der seit Jahrzehnten stets ansteigenden Produktivität! Aufgrund von Forschung und Entwicklung, verbesserten Produktionsverfahren, Rationalisierung etc. können Produkte heute mit geringerem Aufwand hergestellt werden als je zuvor. Obwohl die Bevölkerungszahl seit Jahren trotz Zuwanderung von außen in der Tendenz abnimmt, steigt das Bruttoinlandsprodukt (die Summe aller umgesetzten Güter und Dienstleistungen im Land, Abkürzung BIP) jährlich stetig um ein bis zwei Prozent an. Wenn aber der Kuchen größer wird, während gleichzeitig die Anzahl der Leute, auf die der Kuchen verteilt werden soll, kleiner wird, dann … sollte eigentlich auch die von einer Volksschule im Sauerland vermittelte Bildung ausreichen, zu erkennen, dass dann jeder mehr vom Kuchen haben könnte, wenn wir nur ein halbwegs gerechtes Verteilungssystem hätten. Geschehen ist aber das Gegenteil: Für 40% der Lohnempfänger wurde der Anteil am Kuchen kleiner. Für die Rentner wurde der Kuchen ebenfalls kleiner, und zwar deutlich! Gerhard Schröder rühmte sich 2005 auf einer Rede vor dem World Economic Forum in Davos mit folgendem Satz: „Wir haben einen der besten Niedriglohnsektoren aufgebaut, den es in Europa gibt.“17 Gleichzeitig sind die Vermögen der Reichen und Superreichen exorbitant angestiegen. Was hier stattgefunden hat, war der Putsch eines Wirtschaftssystems, das Neoliberalismus genannt wird.
Dass dies keine ideologisch gefärbte Floskel ist, möchte ich im Folgenden nachweisen.
Im ersten Teil werden wir uns dem Begriff des Neoliberalismus selbst widmen. Was ist das eigentlich, woher kommt er, auf welchen theoretischen Grundlagen basiert er, wer hat ihn aus welchen Motiven in die Welt gesetzt? Im zweiten Teil geht es um die Frage, was der Neoliberalismus mit der Welt anstellt, wem er nützt und wem er schadet. Der dritte Teil beschäftigt sich genauer mit den Akteuren des Neoliberalismus, also denjenigen, die in aufgeklärten Zeiten dermaßen vehement ein System, das sich wirtschaftspolitisch ganz rechts außen befindet (was im ersten Teil nachgewiesen werden wird), propagieren. Die Strategien des Neoliberalismus, also mit welchen Methoden er großgemacht und großgehalten wurde und wird, sind das Thema des vierten Teils. Im fünften Teil werde ich versuchen zu ergründen, ob es einen Weg aus diesem neoliberalen Teufelskreis geben und wie dieser aussehen könnte.
P.3. Kernthesen
Die Menschheit hat technologisch ein Niveau erreicht, das eine materiell sorgenfreie Existenz für alle ermöglichen könnte.
Leider hat die zivilisatorische Entwicklung der Menschheit damit nicht Schritt gehalten. Konzepte zur gesellschaftlichen Weiterentwicklung im Sinne von Teilhabe aller Menschen am sozialen Leben, ob sie nun am Wertschöpfungsprozess teilnehmen (können) oder nicht, werden an maßgeblicher Stelle noch nicht einmal mehr diskutiert.
Der Kampf um mehr und immer mehr Wohlstand wird auch, aber nicht überwiegend, national, sondern international ausgetragen. Neben Überbevölkerung sind die rein auf kurzfristigen Profit ausgelegten Aktivitäten der Mächtigen und die daraus resultierende Verteilungsungerechtigkeit das maßgebliche Hindernis für die Lösung der meisten globalen Probleme.
Um diese Probleme so rasch wie möglich angehen zu können, ist es erforderlich, dass dem Neoliberalismus als Instrument, das der Gier freie Fahrt lässt und auf dem Recht des Stärkeren basiert, die Legitimität und die Handlungsfreiheit entzogen wird.
Die Bevölkerung, nicht nur einige wenige einflussreiche Geschäftsleute, sollten in einem System, das sich demokratisch nennt, die „Richtlinienkompetenz“ haben und über die großen Themen unserer Zeit entscheiden.
Unter dem Einfluss des Neoliberalismus zieht sich der Staat mehr und mehr aus seinen eigentlichen Kernaufgaben zurück und überlässt den Wirtschaftsmächtigen das Feld. Dass es im Leben Bereiche gibt, die der Markt eben nicht regeln kann, wie so gerne postuliert wird, wird dabei gerne geflissentlich ausgeblendet.
TEIL 1: Was genau ist Neoliberalismus?
1.1. Begriffsbestimmung
Carl Friedrich von Weizsäcker, Physiker und Bruder des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, sagte bereits 1983 den Untergang der Sowjetunion innerhalb weniger Jahre voraus. Er prophezeite darüber hinaus unter anderem in einem in dem Buch „Der bedrohte Frieden“ veröffentlichten Aufsatz:
„Um ihre Herrschaft zu sichern, werden diese Eliten frühzeitig den totalen Überwachungsstaat schaffen und eine weltweite Diktatur errichten. Die ergebenen Handlanger dieses Geldadels werden korrupte Politiker sein. Die Kapitalwelt fördert einen noch nie da gewesenen Faschismus. Zum Zweck der Machterhaltung wird man die Weltbevölkerung auf ein Minimum reduzieren. Dies geschieht mittels künstlich erzeugter Krankheiten. Hierbei werden Bio-Waffen als Seuchen deklariert, aber auch mittels gezielter Hungersnöte und Kriege. Die Menschheit wird nach dem Niedergang des Kommunismus ein skrupelloses und menschenverachtendes System erleben, wie es die Welt noch nie erlebt hat. Das System, welches für diese Verbrechen verantwortlich sein wird, heißt ‚unkontrollierter Kapitalismus'“ 18
Den Begriff „Neoliberalismus“ im heutigen Sinne kannte von Weizsäcker damals noch nicht, aber er meinte genau dieselbe Sache, wenn er von unkontrolliertem Kapitalismus spricht. Neoliberalismus heutigen Zuschnitts war zu jener Zeit noch ziemlich frisch als Kampfbegriff oppositioneller Wirtschaftswissenschaftler aus Chile verwendet worden, dem Land, das als erstes als Versuchskaninchen für die neoklassische Lehre der Chicagoer Schule diente.
Der Begriff des Neoliberalismus war ursprünglich allerdings nicht so negativ belegt wie heute.
Sehen wir uns zunächst einmal die Herkunft an: Liberalismus kommt aus dem lateinischen Wort „liberalis“, was „Die Freiheit betreffend“ bedeutet. Dieser Begriff stammt aus der Aufklärung und wurde wohl erstmals im Nachklang der englischen Revolutionen des 17. Jahrhunderts gebraucht. Freiheit in diesem Sinne wird verstanden als politische, ökonomische, aber auch soziale Freiheit. Liberalität ist Voraussetzung für weitgehend selbstbestimmtes Leben, mithin für Individualität und die Suche nach persönlichem Glück.
Somit per se nichts Negatives. Einer, der sich mit diesem für die damalige Zeit neuen Freiheitsgedanken intensiv beschäftigte, war der schottische Nationalökonom Adam Smith, der in der Wirtschaftswissenschaft heute als Vater des Liberalismus gilt. Wir kommen im nächsten Kapitel wieder auf die Lehren Smiths zurück.
Das „Neo“ deutet eine Rückkehr zu den und gleichzeitig eine Erneuerung der Gedanken an, die auf Adam Smith zurückgehen. Diese positive konnotierte Verwendung des Begriffs herrschte bis in die Mitte des 20. Jahrhundert vor. Die besondere Gewichtung des Neoliberalismus in dieser, seiner ursprünglichen Bedeutung, war die Untersuchung der Auswirkungen der Ordnungspolitik, die Bedeutung privatwirtschaftlicher Initiative und die Untersuchungen von Wettbewerbsverzerrungen aufgrund privater oder staatlicher Einflüsse. Unter Neoliberalismus wurden sowohl der Ordoliberalismus der Freiburger Schule (Walter Eucken), als auch der Laissez-Faire-Liberalismus der Chicagoer Schule (auch Neoklassische Schule, Milton Friedman) oder der Österreichischen Schule (Friedrich von Hayek) gerechnet. In Worten des normalen Lebens: Das System der sozialen Marktwirtschaft, das nach dem Krieg in Deutschland etabliert wurde, fiel demnach ursprünglich ebenfalls unter diesen Begriff, denn über allem schwebte der Grundgedanke der individuellen Freiheit19, Liberalismus im wahren Sinne des Wortes, also.
Zu einer Umdeutung des Begriffs kam es wie gesagt erst in den 80er Jahren durch chilenische Wirtschaftswissenschaftler, aus gutem Grund: Zum ersten Mal wurde in Chile 1970 mit Salvador Allende ein sozialistischer Präsident gewählt. Drei Jahre später wurde dieser vom Militär entmachtet und tötete sich ob der Aussichtslosigkeit seiner Situation wohl selbst. Mittels des gegenüber den USA und den neoklassischen Jüngern des Wirtschaftswissenschaftlers und Nobelpreisträgers Milton Friedman gefügigen Diktators Augusto Pinochet wurde – neben zahllosen Menschenrechtsverletzungen – Chile ein Wirtschaftssystem übergestülpt, das Armut für viele und Reichtum für wenige brachte. Im nächsten Kapitel werde ich auf diese Thematik näher eingehen.
Im Folgenden werden wir den Begriff „Neoliberalismus“ im Sinne der chilenischen Oppositionellen verwenden: Als Begriff für einen Raubtier-Kapitalismus, der …
rein auf ökonomischen (!) Liberalismus abstellt, während politischer Liberalismus durchaus gerne auf der Ersatzbank Platz nehmen darf;
vorgibt, der neoklassischen Lehre zu folgen und der
wie wir noch sehen werden, wortwörtlich über Leichen geht.
Diese Begriffsabgrenzung halte ich deshalb für so wichtig, weil Neoliberale gerne den alten, positiv konnotierten Begriff für sich in Anspruch nehmen, während sie in Wirklichkeit etwas völlig anderes, den Neoliberalismus neuer Prägung vertreten.
Um Missverständnisse zu vermeiden, möchte ich einige andere Begriffe einführen und gegeneinander abgrenzen, und zwar die Begriffe Marktwirtschaft und Kapitalismus, zumal diese oftmals, insbesondere von Linksgerichteten, allzu oft synonym verwendet werden. Dies kann sich in einer Diskussion aber als fatale Falle herausstellen, wenn es dem politischen Gegner wissentlich oder „aus Versehen“ gelingt, Kritik am Neoliberalismus als Kritik am Kapitalismus oder gar der freien Marktwirtschaft umzudeuten. In einzelnen Diskussionspunkten mag solch verallgemeinernde Kritik ja auch durchaus einmal zutreffen, eine Verallgemeinerung verkennt aber die wesentlichen Unterschiede und damit auch die darin verborgenen Lösungsansätze.
Private Marktwirtschaft und globaler Handel sind beileibe keine Errungenschaften der Neuzeit. Als Howard Carter im Grab Tutanchamuns einen baltischen Bernstein fand, stand fest, dass es selbst im Altertum Handelsbeziehungen zwischen fernen Ländern gegeben haben musste. Handel, zunächst in Form von Tauschgeschäften, später mittels Edelmetallen und Geld, war von Anbeginn an ein Element, das die Menschen miteinander verband, indem Güter weiträumig ausgetauscht wurden. Das römische Reich lieferte an der Erzfeind Germanien Schmuck und Wein und bekam dafür Holz und Bleibarren. Im Mittelalter kamen Gewürze aus Indien und die Fugger und andere Familien verdienten sich eine goldene Nase. Dennoch würde wohl niemand auf die Idee kommen, diese Epochen als Kapitalismus zu bezeichnen. Von letzterem spricht man erst, wenn die Gewinnerzielung und die Akkumulation, also die Anhäufung von Kapital in einer Hand, in den Vordergrund des wirtschaftlichen Interesses gerät. Natürlich gibt es durchaus Parallelen zwischen beispielsweise Merkantilismus und Kapitalismus, aber diese sollen hier nicht weiter diskutiert werden; hier soll lediglich dargestellt werden, dass Kapitalismus lediglich (und vereinfacht ausgedrückt) eine Teilmenge der Marktwirtschaft ist, weil durchaus auch andere, nicht-kapitalistische Formen der Marktwirtschaft existieren. Wenn man einen Gegensatz zur Marktwirtschaft bemühen wollte, ließe sich die Planwirtschaft anführen, bei der weder etwas dem Zufall, noch einzelnen Individuen, die autark voneinander agieren, überlassen wird. Man könnte auch Mischformen der Plan- und der Marktwirtschaft anführen, wie sie zum Beispiel in Kuba existiert.
Marktwirtschaft und dem Sozialismus ähnliche Systeme schließen einander, wie die Geschichte zeigt, durchaus nicht aus. Sowohl bei den Ägyptern als auch bei den Römern oder beispielsweise bei den Inka in Peru wurden Nahrungsmittel zentral verwaltet und ausgegeben, wenn man so will, im Rahmen der Daseinsvorsorge. In Peru trauern viele Menschen bis heute dem System der Inka nach (trotz des ansonsten absolutistischen Charakters dieses Regierungssystems), weil dies die einzige geschichtliche Epoche des Landes war, in der niemand Hunger leiden musste.
Gleichwohl gab es in all diesen Zivilisationen Märkte, in denen man sich Kleidung, Luxusartikel und dergleichen kaufen konnte.
Kapitalismus und Neoliberalismus lassen sich ebenfalls nicht gleichsetzen. Zwar ist Neoliberalismus in jedem Fall auch Kapitalismus, aber nicht umgekehrt ist jede Form der Kapitalismus gleichzeitig Neoliberalismus im hier verwendeten Kontext. Im Kapitel über die theoretischen Grundlagen werde ich auf die Unterschiede detaillierter eingehen. Hier nur so viel: Auch die soziale Marktwirtschaft, die unter Ludwig Erhard ihren Siegeszug angetreten hat, ist letztendlich eine Form des Kapitalismus, ein Kapitalismus, dem rigide Grenzen gesetzt wurden, wenn man so möchte, während Neoliberalismus weitgehend dereguliert ist, die Marktteilnehmer also immer weniger Gebote beachten und immer weniger zum Gemeinwohl beitragen müssen.
1.2. Die Geschichte des Neoliberalismus
Wer sich nur für die aktuelle Situation interessiert, mag dieses Kapitel gern überspringen. Ich persönlich halte es für sehr wichtig, zu verstehen, was wann durch wen organisiert und gemacht wurde, um ein Wirtschaftssystem zu installieren, welches das gesamte globale Machtgefüge durcheinandergewirbelt hat und sich – so scheint es – fast schon irreversibel in Diktaturen ebenso wie in Demokratien festgesetzt hat.
1.2.1. Die Geburt des Neoliberalismus
Lassen Sie uns der Einfachheit halber mit dem schon erwähnten Adam Smith beginnen, dem schottischen Nationalökonomen, der von 1723 bis 1790 lebte, der also den Beginn der sogenannten industriellen Revolution hautnah miterlebte. Seine Kernaussage lautet in etwa, dass das allgemeine, gesellschaftliche Glück maximiert werden würde, indem jedes Individuum im Rahmen seiner gesellschaftlichen Grenzen versucht, sein persönliches Glück zu erhöhen. Wir werden auf die Kernthesen Smiths im folgenden Kapitel (theoretische Grundlagen) wieder kurz, aber etwas detailreicher zurückkehren. Smith war nicht der einzige Nationalökonom, der sich Gedanken über das Funktionieren der Wirtschaft auf mikroökonomischer (den Einzelnen betreffend) und makroökonomischer (alle „Teilnehmer“ an einer Volkswirtschaft betreffend) Ebene gemacht hat, aber er war einer der ersten, der diese ähnlich wie nach ihm Karl Marx in einem „globalen“ Konzept zusammengefasst hat. Vieles aus seiner Feder wurde vielleicht nicht ganz ohne Hinterlist fehlinterpretiert, wie zum Beispiel die „unsichtbare Hand des Marktes“, die ihm immer wieder zugeschrieben wird.
Smith war nicht nur als Theoretiker ein Meilenstein, er hatte auch Gelegenheit, einen gesellschaftlichen Wandel zu beobachten, denn die Epoche, in der er lebte, kann man vielleicht auch als die Geburtsstunde des Kapitalismus ansehen. Die industrielle Revolution beginnt mit der Erfindung der Dampfmaschine, mittels deren Kraft man plötzlich Maschinen antreiben kann, die immer wiederkehrende, stupide Bewegungsabläufe erheblich beschleunigen und somit den Produktions-Output deutlich zu steigern vermögen. Viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen (insbesondere in den Webereien) verlieren dadurch ihre Arbeitsstelle. Warum beginnt hier Kapitalismus? Nicht wegen der Ausbeutung, die hat es seit Anbeginn der Zeit unter Menschen gegeben, unabhängig vom Regierungs- oder Wirtschaftssystem. Man denke nur an die Arbeiter, die gegen Kost und Logis die Pyramiden in Gizeh zu errichten hatten oder die Sklaven Roms. Ausbeutung ist durchaus keine neue Errungenschaft des Kapitalismus.
Um eine Fabrik zu betreiben, wird es plötzlich nötig, über Kapital zu verfügen. Man braucht große Hallen, um die Maschinen vor der Witterung (oder vor Sabotage) zu schützen, die Maschinen selbst kosten zunächst ein Heidengeld. Nur wirklich Reiche können in dieses Geschäft einsteigen und das ist teilweise noch immer so. Eine Automobilfabrik benötigt dermaßen viel Kapital, dass es entweder nur durch einen Superreichen oder ein Konsortium aus Reichen oder vielen, vielen Aktionären einerseits (also privat) oder durch den Staat andererseits (man denke an die Volkswagen AG während der Nazi-Diktatur oder an Trabant oder Wartburg in der DDR) aufgebracht werden kann. Die Anhäufung von Kapital (Kapitalakkumulation) ist also zunächst nicht unbedingt ein Selbstzweck, sondern eröffnet die Möglichkeit, wenn nötig oder gewünscht die Mittel an der Hand zu haben, um zeitnah im großen Stil investieren zu können. In solchen Fabriken kann nun weit mehr – und günstiger – produziert werden als zuvor, die Produktivität steigt an.
Gleichzeitig erlebt der technische Fortschritt einen bis heute anhaltenden Aufstieg. Dies geht einher mit Bevölkerungswachstum, aber auch mit Land-/Stadt-Flucht und mit neuen sozialen Problemen, ausgelöst unter anderem durch nicht vorhandene Infrastruktur (fehlender angemessener Wohnraum) oder prekär vergütete Arbeitsverhältnisse.
Karl Marx schreibt „Das Kapital“. Seit dieser Zeit etablieren sich die „Kapitalisten“ zunehmend als die wirtschaftlich dominierende Klasse, eine Entwicklung, die auch von zwei Weltkriegen und diversen Systemwechseln nicht unterbrochen werden kann. Wirtschaftswissenschaftler und Politiker grübeln darüber nach, welches die rechte Vorgehensweise im Umgang mit dieser neuen Macht sein könnte. Einfach machen lassen? Der Markt wird’s schon richten? Der französische Begriff „Laissezfaire“, der für die neoliberale Wirtschaftsauffassung steht, besagt genau dies. Oder ordnungspolitisch an die Kandare nehmen und dem Staat Dominanz über die Wirtschaft zu gewähren?
Italien geht einen Sonderweg. Unter Benito Mussolini verbünden sich Politik, Wirtschaft und Militär miteinander, um ihre Interessen gemeinsam durchzusetzen, ohne dass dagegen Widerstand möglich wäre. Unter dem Logo gebündelter Ruten („fasces“), die seit dem alten Rom als ein Symbol der Stärke stehen, etabliert sich der Faschismus. Adolf Hitler geht in Deutschland einen ähnlichen Weg.
In den USA ist Demokratie die offizielle Staatsform. Doch auch hier bekommen die Politiker die starke Hand des Kapitals mittlerweile massiv zu spüren. In einer Rede beklagt Franklin Delano Roosevelt, 32. Präsident der Vereinigten Staaten: „We had to struggle with the old enemies of peace — business and financial monopoly, speculation, reckless banking, class antagonism, sectionalism, war profiteering. They had begun to consider the Government of the United States as a mere appendage to their own affairs. We know now that Government by organized money is just as dangerous as Government by organized mob. “20– „Wir hatten gegen die alten Feinde des Friedens zu kämpfen – Geschäfts- und Finanzmonopole, Spekulation, rücksichtsloses Banking, Klassengegensätze, Partikularismus, Kriegsgewinnlerei. Sie hatten begonnen, die Regierung der Vereinigten Staaten als ein bloßes Anhängsel ihrer eigenen Interessen anzusehen. Wir wissen jetzt, dass Regierung durch organisiertes Geld genauso gefährlich ist wie Regierung durch einen organisierten Mob.“
Doch während in Europa die Klasse der Kapitaleigner noch weitgehend freie Hand hat, in Deutschland und Italien zumindest insoweit, als sie ihre Ziele denen ihrer autokratischen Staatsführer unterordnen (offensichtlich kein allzu großes Problem, schließlich lässt sich auch am Krieg ganz prächtig Geld verdienen), will Roosevelt in den USA die Karten neu mischen. Er ruft den „New Deal“ (englischer Ausdruck für das Ausgeben neuer Spielkarten – eigentlich waren es zwei New Deals, einer vor, einer nach der Wiederwahl Roosevelts) aus und initiiert in dem von der Weltwirtschaftskrise und den von ihm im obigen Zitat genannten Profitgeiern gebeutelten Amerika weitreichende Reformen. Sozialstaatliche Neuerungen nach europäischem Vorbild werden eingeführt (Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung). Im arbeitsrechtlichen Bereich wird beispielsweise das Streikrecht gesetzlich verankert und ein Mindestlohn eingeführt. Das Banken- und Finanzwesen wird reguliert, letzteres, damit sich ein Börsencrash wie der von 1929 nicht wiederholen konnte. Leider werden die Reformen der New Deals insbesondere unter den Nachfolgern Roosevelts nicht mehr ganz so energisch weiterverfolgt, sodass viele Aspekte seiner Sozialreformen im Ansatz steckengeblieben sind. Die weitreichendste und vermutlich durchschlagendste Reform aber ist ein Paradigmenwechsel in der Geldpolitik. Um wirtschaftliche Depression mittels staatlicher Maßnahmen wirksam begegnen zu können, wird die Koppelung der Währung an staatlicherseits gelagerte Goldbestände aufgehoben. Im Zuge dessen werden auch die Verträge von Bretton Woods abgeschlossen, die diesen Schritt international absichern, indem feste Wechselkurse zwischen den Währungen der teilnehmenden Länder beschlossen werden, wobei der Dollar als Leitwährung fungiert. Zusammen mit den Finanzmarktregulierungen des New Deal wird somit Währungsspekulanten wirksam das Handwerk gelegt. Aber die Verträge haben einen weiteren, wesentlichen Effekt: Das Hilfsmittel, der einheimischen Wirtschaft Vorteile gegenüber ausländischen Konkurrenten über nationale Währungsabwertungen zu verschaffen, hat ausgedient. Wettbewerb zwischen Ländern erfolgt daher innerhalb eines fest vorgegebenen Rahmens, einer der Faktoren, die den Spielraum dafür schaffen, dass gute Löhne ausgehandelt und hohe von den Wirtschaftsteilnehmern hohe Steuern kassiert werden, die wiederum eine hohe Staatsquote und umfangreiche Sozialleistungen ermöglichen. Das Ergebnis ist bekannt: Niemals in der Geschichte der Menschheit, weder vorher noch nachher, kommt es zu einem dermaßen starken Anstieg des Wohlstandes einer breiten Bevölkerungsmehrheit in den Ländern des westlichen Europas und den USA. Die soziale Marktwirtschaft in Deutschland, die zunächst auch eingeführt wird, um dem „Erzfeind“ DDR zu zeigen, dass man in Sachen Sozialpolitik dem sogenannten „real existierenden Sozialismus“ des Ostens in nichts nachstünde, blüht in diesem Umfeld geradezu auf. Millionen Menschen können sich endlich etwas leisten, was zuvor als unerreichbarer Traum in weiter Ferne scheint: Fernseher, Auto, Waschmaschine, der Urlaub in Italien. Ist es ein Wunder, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland daher den Kapitalismus (soziale Marktwirtschaft ist, wie gesagt, auch eine Form des Kapitalismus) für diesen riesigen Wohlstandszuwachs verantwortlich machen? Viele übersehen dabei aber leider, dass es gerade die Zurückdrängung des ungezügelten Kapitalismus war, ermöglicht durch Roosevelts New Deals und die Verträge von Bretton Woods, die diese Entwicklung überhaupt erst bewirkt hat21.
Doch dieser Fortschritt hält nicht lange. Insbesondere in den USA mucken die Kapitaleigner auf. Das Geld, das sie „verdienen“, fließt ihnen nicht uneingeschränkt zu, sondern wandert als Kosten in die Taschen von Angestellten, während ein großer Teil ihrer Gewinne in die Staatskasse fließt. Gefühlte Ungerechtigkeit macht sich breit in der Gesellschaftsschicht der Unternehmenden und Investierenden. Diese Menschen finden ihren Fürsprecher in Milton Friedman, einem der „Väter“ unseres Neoliberalismus. Er und seine Anhänger gelangen durch entsprechend mächtige Protektion bald in exponierte Positionen. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts bitten sie Präsident Richard Nixon, beweisen zu dürfen, dass die Neoklassik (zu den theoretischen Grundlagen mehr im nächsten Kapitel) das bessere Wirtschaftssystem sei.
Nun wird im Jahr 1970 in Chile just ein sozialistischer Präsident gewählt, Salvador Allende. Nach Kuba und Vietnam et cetera ist eine weitere Ausbreitung des Sozialismus ein wahrer Albtraum für Washington. Als sich die Lage im gesellschaftlich tief gespaltenen Chile unter Allende im Lauf der Zeit immer instabiler entwickelt, begreift man diese Situation als Gelegenheit und beschließt, zusammen mit den Chicago Boys ([ehemalige] chilenische Wirtschaftsstudenten, Anhänger von Milton Friedmans Chicagoer Schule) und der CIA, einen gewaltsamen Politikwechsel in Chile herbeizuführen. Treibende Kraft ist der spätere Friedensnobelpreisträger und US-Außenminister Henry Kissinger. Der chilenische General Pinochet erhält die volle Unterstützung der USA und erklärt sich im Gegenzug bereit, sein Land als Versuchskaninchen für neoklassische Wirtschaftspolitik zur Verfügung zu stellen. Das Experiment ist „erfolgreich“. Ein Militärputsch treibt Allende in den Freitod. Tausende von Chilenen sterben oder verschwinden für immer, Hunderttausende fliehen ins Ausland, Millionen weitere verarmen. Menschenrechte und Demokratie gehen für viele Jahrzehnte den Bach hinunter. Aber: Das Land entwickelt sich prächtig, wenn auch nicht für die weit überwiegende Bevölkerungsmehrheit. Als einziges Land in Südamerika schafft Chile es, sich als Mitglied der OECD, dem exklusiven Club der sogenannten „entwickelten Länder“22, zu etablieren. Allerdings ist die Ungleichheit bei der Einkommens- und Vermögensverteilung in Chile so groß, wie in keinem anderen OECD-Land23. Und noch etwas ist geschehen, etwas, das vermutlich selbst Milton Friedman niemals beabsichtigt hatte: ein Monster wurde geschaffen, menschenverachtend, gewalttätig, suppressiv, über Leichen gehend, das von chilenischen Wirtschaftswissenschaftlern völlig zu Recht nicht als Neoklassik bezeichnet wurde, sondern einen Namen erhielt, der zunächst in linken Kreisen (aber heute längst nicht mehr nur dort) zum Kampfbegriff für den entfesselten Kapitalismus wurde: der Neoliberalismus. Was allerdings die maßgeblichen Akteure nicht davon abhält, diesen Stück um Stück fester in der Welt zu verankern.
Der Legende nach beginnt der Neoliberalismus in dem Augenblick, Mainstream zu werden, als Professor Arthur Betz Laffer24 bei einem Abendessen mit einem gewissen Ronald Reagan eine Kurve (die sogenannte Laffer-Kurve; er hat sich dazu einen Gedanken von John Meynard Keynes ausgeliehen und diesen stark vereinfacht und damit pervertiert) auf eine Serviette malt, der zufolge Staatseinnahmen steigen, wenn die Steuersätze sinken. Nun war Präsident Reagan bekanntlich ein Mann, der einfache Antworten auf komplizierte Fragen liebte und damit fällt der Startschuss für den Beginn der sogenannten Reagonomics, was der damals gebräuchliche Ausdruck für Neoliberalismus wird. Vermutlich ist diese Geschichte, die beispielsweise der Kabarettist Max Uthoff gerne kolportiert, wirklich nicht mehr als eine Legende, wenn auch sicherlich eine mit einem wahren Kern. Dennoch beginnt unter US-Präsident Reagan der unaufhaltsame Siegeszug des Neoliberalismus – und das, obwohl die Staatseinnahmen trotz der Steuersenkung – welch Überraschung! - erst einmal rapide in den Keller gehen. Sie erholen sich zwar mit den Jahren wieder und es werden mit der Zeit tatsächlich höhere Staatseinnahmen kreiert. Es mag sogar ein kurzzeitig positiver Effekt von höheren Staatseinnahmen durch niedrigere Steuern nachweisbar sein, aber der dürfte sich in erster Linie aus der Tatsache ergeben, dass Investoren ihre Gelder vorzugsweise in Niedrigsteuerländern anlegen und unter Reagan Investitionen aus dem Ausland in die USA verlagern, was dort zu mehr Wertschöpfung und Beschäftigung