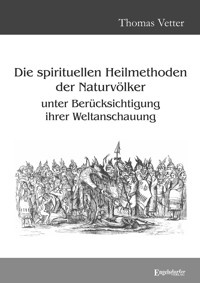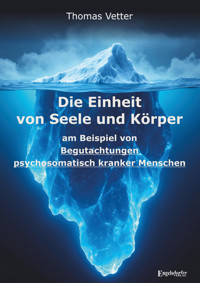
Die Einheit von Seele und Körper am Beispiel von Begutachtungen psychosomatisch kranker Menschen E-Book
Dr. Thomas Vetter
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Engelsdorfer Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie wichtig es ist, Seele und Körper gerade auch in der Medizin als Einheit zu verstehen, diskutiert der Autor am Beispiel von Menschen, bei denen ein psychosomatisches Gutachten durchgeführt wurde. Er zeigt, dass Krankheiten sehr oft einen psychischen oder psychosozialen Hintergrund haben. Er weist auf die Probleme hin, die durch die Trennung von Körper und Seele (oder Psyche) in der sachgerechten Betreuung kranker Menschen bestehen. Er wendet sich damit an Ärzte und Psychotherapeuten sowie medizinisches Personal, aber auch an Sozialrechtler und medizinische Gutachter und nicht zuletzt an Patienten und interessierte Laien.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 95
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Vetter
Die Einheit von Seele und Körper
am Beispiel von
Begutachtungen psychosomatisch kranker Menschen
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2025
Bibliografische Information durch die Deutsche Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.de abrufbar.
Angaben nach GPSR:
www.engelsdorfer-verlag.de
Engelsdorfer Verlag Inh. Tino Hemmann
Schongauerstraße 25
04328 Leipzig
E-Mail: [email protected]
Copyright (2025) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © Natsumae [Adobe Stock]
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
KritischesVorwort
Eine Analyse von psychosomatischen Gutachten im Rentenverfahren für Sozialgerichte, die ich in über 30 Jahren erstellt habe, soll dazu dienen, die Zusammenhänge und die Wechselwirkungen zwischen Seele und Körper bei Krankheiten zu verdeutlichen. Die Qualifikation zur Erstellung derartiger Gutachten resultiert aus einer 35-jährigen nervenärztlichen Tätigkeit, auch in verantwortlicher Stellung. Ich habe mich dazu entschlossen die begutachteten Menschen hier durchweg als Patienten zu bezeichnen und nicht mit dem hierfür üblichen Begriff der Probanden, da es im vorliegenden Buch um ihre Gesundheitsstörungen geht und sie sich zum Zeitpunkt der Begutachtung überwiegend auch in ärztlicher Behandlung befanden.
Mir ist bewusst, dass die Zusammenhänge zwischen Seele und Körper nur begrenzt wissenschaftlich geprüft werden können. Denn sie sind so vielfältig, wie das Leben selbst, und so individuell, wie die Einzigartigkeit des Menschen. Zudem sind Verallgemeinerungen, wie sie auch bei Begutachtungen erfolgen, immer Vereinfachungen und lassen sich nur begrenzt auf den Einzelfall übertragen.
Kranke und behinderte Menschen können oder wollen außerdem in einem Begutachtungsgespräch von ca. 2 Stunden nicht immer alles von sich, was dazu wichtig wäre, berichten. Dies kann daran liegen, dass die Betroffenen selbst bestimmte Themen für nicht wichtig erachten, oder dass belastende Ereignisse der Vergangenheit gar nicht mehr bewusst sind. Auch Scham darüber, Dinge anzusprechen oder das bewusste Verschweigen, um sich z. B. in ein bestimmtes Licht zu setzen, sind hierfür weitere mögliche Ursachen. Auch die Möglichkeit, dass die Patienten bei vorausgehenden Begutachtungen negative Erfahrungen gemacht haben, z. B. dadurch, dass die Begutachtung zu einem Ergebnis geführt hat, das nicht dem erhofften Ergebnis entsprach, oder der Gutachter bzw. die Gutachterin wenig empathisch mit ihnen umgegangen ist, kann zu Vorbehalten und Zurückhaltung bei weiterer Begutachtung führen.
Insofern sind die Informationen, die bei einer Gutachtenuntersuchung von Patienten zu erhalten sind, nicht immer vollständig. Es ist aber oberste Aufgabe eines Gutachters, wie jedes Arztes, ein Vertrauensverhältnis im Gespräch herzustellen, dass die Basis für Offenheit und Auskunftsbereitschaft bildet.
Trotz dieser und weiterer Hindernisse kann eine Gutachtenuntersuchung in vertrauensvoller Atmosphäre über zwei Stunden oder auch länger eine der ergiebigsten Methoden sein, über einen kranken Menschen und sein Leben und Befinden Entscheidendes zu erfahren. Es lassen sich meistens die wesentlichen Fragen, die die Zusammenhänge und Bedeutungen von Ereignissen im Leben von Betroffenen für die Entwicklung von psychosomatischen Gesundheitsstörungen betreffen, dann klären, wenn man sich als Gutachter umfassend darum bemüht. Welcher behandelnde Arzt kann sich über zwei Stunden Zeit für seine Patienten nehmen? Es sind nur noch die Psychotherapeuten, die in den therapeutischen Sitzungen die Gelegenheit zu einer solchen tiefgehenden Analyse haben. Aber der psychologische Ansatz von Psychotherapeuten kann der Wahrnehmung der Einheit von Seele und Körper dadurch entgegenstehen, dass die körperlichen Störungen nicht als Ausdruck und Teil seelischer Störungen erkannt werden. Inwieweit es sich schwerpunktmäßig um eine körperliche Erkrankung handelt, oder ob die körperliche Störung Ausdruck oder Folge psychischer Beeinträchtigungen ist, erfordert nicht nur psychotherapeutische sondern auch organmedizinische Erfahrungen. Psychotherapeuten sind meistens nicht organmedizinisch ausgebildet. Dies gilt zunehmend auch für Psychiater. Aber auch Organmedizinern fällt es sehr oft schwer diesbezüglich eine Einordnung zu treffen. Dies zeigt sich allein darin, dass bei psychosomatisch Kranken so viel unnütze oder falsche Diagnostik und Therapie stattfindet. Die psychosomatischen Kenntnisse und Erfahrungen sind bei ihnen meistens nicht kultiviert und nur gering ausgebildet.
Um zu einer gesetzeskonform angemessenen gutachterlichen Einschätzung zu gelangen, war es mir in allen meinen Begutachtungen wichtig, nicht nur Art und Ausmaß gesundheitlicher Beeinträchtigungen zu erfassen, sondern gerade auch nach den Ursachen und Zusammenhängen für die bestehenden Gesundheitsstörungen zu suchen, um sie besser in ihren Auswirkungen für Alltag und Leistungsfähigkeit beurteilen zu können.
Die Erkenntnisse, die ich aus allen Gutachtenuntersuchungen gewonnen habe und die ich hier darstellen möchte, beziehen sich auf eine bestimmte Gruppe von Patienten. Es handelt sich dabei um Patienten, die sich um Rente bemüht haben. Zudem handelt es sich um Patienten, denen bereits von Seiten der Versicherungen die erstrebte Anerkennung von Rente verweigert wurde. Alle Patienten befanden sich zum Zeitpunkt der Begutachtung im Klageverfahren vor dem Sozialgericht, teilweise bereits in zweiter Instanz. Es handelt sich also bei der hier durchgeführten Analyse um Ergebnisse aus Gutachten über Kläger bei Sozialgerichten. Die Belastungen durch das teilweise schon über Jahre laufende Rentenverfahren hatte dabei fast immer auch eine Bedeutung für die Gesundheitsstörungen, wie sie sich zum Zeitpunkt der Begutachtung darstellten, und musste mit beachtet werden. Allerdings sind die hier dargestellten Erkenntnisse nicht nur abgeleitet aus diesen Begutachtungen, sondern auch Resultat langjähriger nervenärztlicher Tätigkeit mit einem hohen Anteil in der Versorgung psychosomatisch kranker Patienten.
Das vorliegende Buch befasst sich nicht mit einer sozialrechtlichen Analyse, z. B. darüber wie viele Patienten nach gutachterlicher Einschätzung bei einer bestimmten Gesundheitsstörung Anrecht auf Rente haben, oder ob die gutachterliche Einschätzung bei Gericht Bestand hatte. Es befasst sich ausschließlich mit der Frage der Ursachen und Bedingungszusammenhänge von psychosomatischen Störungen und dessen Auswirkungen auf die gesundheitlichen Folgen. Dabei konnten nur die Belastungsfaktoren betrachtet werden, die in der Untersuchung auch bekannt geworden sind.
Es bleiben meistens nur markante und ausgeprägte Belastungsfaktoren der Patienten als solche erkennbar oder bewusst. Es ist aber immer auch davon auszugehen, dass unscheinbar anmutende Belastungen die sich in einer speziellen Situation oder Atmosphäre ereigneten, auch zu gesundheitlichen Folgen führen können, oder dass Belastungsfaktoren auf eine spezielle Prägung oder Disposition des Patienten und seiner Umgebung treffen und in Kombination auftreten oder sich aufsummieren können.
Um die Fülle und Bedeutung von belastenden Faktoren bei jeden einzelnen Patienten zu erfassen, müsste man als stiller Beobachter am bis dahin geführten Leben teilgenommen haben und sich zudem vollständig in die Gefühlswelt des Patienten in der Zeit entsprechender Belastungen und danach hineinversetzen können. Dies ist selbstverständlich nicht möglich. Es zeigt, dass die generelle Vielfalt und Komplexität der Bedingungsfaktoren für Gesundheitsstörungen eine wissenschaftliche Analyse von wesentlichem Aussagewert unmöglich macht. Wir können uns hier nur mit den markanten, vordergründigen und als gravierend augenscheinlichen Belastungsfaktoren beschäftigen und diese in Beziehung setzen zu den festgestellten Gesundheitsstörungen. Es handelt sich also um eine beschränkte und in der Bewertung von Belastungsfaktoren zudem auch subjektive Vorgehensweise. Denn sie ist immer auch von der persönlichen Gewichtung des Betrachters abhängig.
Aber ich hoffe, trotz der vielfältigen Unzulänglichkeiten und Hindernisse, doch einleuchtend darstellen zu können, dass es zwischen Belastungsfaktoren und seelischen und körperlichen Gesundheitsstörungen Zusammenhänge und Abhängigkeiten gibt, wie sie für die übergroße Mehrzahl der von mir untersuchten Gutachtenpatienten anzunehmen ist. Dass derartige Belastungsfaktoren für die Auslösung psychiatrischer Gesundheitsstörungen sehr oft eine wichtige Rolle spielt, damit ist jeder Psychiater und Psychotherapeut fast täglich konfrontiert. Mir geht es hier aber nicht vordergründig um die klassischen psychiatrischen Gesundheitsstörungen, sondern um die Auswirkung von Belastungsfaktoren auf möglicherweise jede Form von Gesundheitsstörungen und Erkrankungen.
Die im vorliegenden Buch dargelegten Hypothesen und Erkenntnisse stützen sich vorrangig auf Erfahrungswissen. Die dargelegte statistische Auswertung der Gutachten ist dabei lediglich ein Baustein, der einen Überblick über die untersuchten Patienten geben soll und dazu dienen, das Erfahrungswissen zu illustrieren und ins Verhältnis zu setzen. Statistische Erhebungen sind in der Medizin generell und bei psychischen Krankheiten insbesondere mit nicht geringen Problemen belastet. Sie sind auf Verallgemeinerung, Selektion und Kategorienbildung angewiesen und können damit die Individualität des kranken Menschen mit seinem spezifischen Störungsbild nicht abbilden. Im Bemühen um Hilfe für kranke Menschen sind aber die individuellen Gegebenheiten des Einzelnen hinsichtlich Ursache, Entwicklung und Ausprägungsform der Krankheit nicht nur bei psychischen oder psychosomatischen Störungen von entscheidender Bedeutung. Nur wenn bei den einzelnen Patienten die Krankheit auslösenden und Krankheit unterhaltenden Gegebenheiten, die psychosozialen Rahmenbedingungen und das individuelle Erleben der Störungen bekannt ist, kann man dem Patienten gerecht werden. Statistiken können dabei Erkenntnisse liefern, die die durchschnittliche Häufigkeit dieser Bedingungen für eine größere Anzahl von Patienten betreffen. Sie können damit helfen den Blick für Risikofaktoren und dessen Beachtung zu schärfen.
Die hier enthaltenden statistischen Ergebnisse werden im Bewusstsein einer nicht unproblematischen Verallgemeinerung und Kategorienbildung dargestellt, die die individuellen Gegebenheiten von Patienten in Gruppen vereinen und damit nicht vordergründig den entscheidenden Bedingungen des einzelnen Patienten entsprechen müssen. Insofern sind die Erfahrungen, die aus den einzelnen Begutachtungen gewonnen worden und aus dem langjährigen Umgang mit psychosomatisch kranken Patienten, nicht identisch mit den statistischen Ergebnissen. Sie sind aber für Bewertungen und Schlussfolgerungen durchaus von Wert.
Das vorliegende Buch soll insofern kein vorrangig wissenschaftliches Werk sein. Die entscheidenden Erkenntnisse und Schlussfolgerungen sind vielmehr aus den Gesamterfahrungen einer langjährigen nervenärztlichen Tätigkeit abgeleitet.
Gliederung
Cover
Titel
Impressum
Kritisches Vorwort
Gliederung
Einleitung
Auswertung der psychosomatischen Gutachten
Fragestellung
Hypothesen
Untersuchte Patienten
Ablauf der Begutachtung
Inhalt der gutachterlichen Untersuchung
Statistische Auswertung
Ergebnisse
Fallberichte
Zusammenfassende Erkenntnisse
Erfahrungswissen
Schlussfolgerungen
für psychische Störungen
für körperliche Störungen
für die Einheit von Psyche und Körper
Konsequenzen
Einleitung
Über Jahrtausende wurde in der Heilkunde nicht zwischen Körper und Geist unterschieden. Die Krankheiten galten von Dämonen, Göttern, durch Zauber oder Hexerei verursacht. Es war dabei unerheblich, ob sie sich in Raserei, Verwirrung oder Anfällen bzw. in Hautausschlag, Verletzungen oder Bauchkrämpfen äußerten. Sie wurden mit Austreibung von Dämonen, Beschwörung von Göttern oder Ahnen oder mit Gegenzauber behandelt. Bei der Lektüre von Beobachtungsberichten über Krankheiten und deren Behandlung bei Naturvölkern, aus denen durchaus auch Rückschlüsse auf frühere Zeiten gerechtfertigt sind, drängt sich immer wieder der Eindruck auf, dass die dort geschilderten Krankheiten zwar nicht grundsätzlich unseren heutigen Krankheitskategorien zugeordnet werden können. Aber viele der dort beschriebenen Krankheiten würden wir wohl heute den psychosomatischen Krankheiten zuordnen. Psychosomatische Krankheiten sind Krankheiten, die sich in körperlichen Störungen äußern, für die es aber keinen eindeutig zuordenbaren körperlichen Befund gibt, und für die eine psychische Grundlage anzunehmen ist.
Bei Naturvölkern konnte das Werk von Dämonen oder Zauberern aber nicht nur psychische oder psychosomatische Störungen auslösen, sondern immer auch körperliche Störungen bis hin zum körperlichen Verfall und Tod, teilweise innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen. Andererseits konnten Dämonenaustreibung oder Gegenzauber ebenfalls innerhalb von Stunden oder Tagen zur Genesung führen. Dies wurde oft auch bei krankhaften Störungen beschrieben, die aus heutiger Sicht nur mit modernen Therapiemaßnahmen behandelbar gewesen wären. Es ist offensichtlich, dass es sich um psychische Faktoren handelte, die für das damalige Verständnis von Entstehung, Verschlimmerung oder Genesung von Krankheiten eine grundsätzliche Rolle gespielt haben. Die gemeinschaftliche Überzeugung über Verursachung und Art der Behandlung war von wesentlicher Bedeutung für Erfolg oder Misserfolg von Genesung. Die feste Überzeugung von einer feindlichen Person verzaubert worden zu sein, konnte zum Tod führen. Die feste Überzeugung, dass mit bestimmten Maßnahmen der krankheitsverursachende Dämon aus dem Körper ausgetrieben wurde oder der Gegenzauber wirksam ist, konnte zur Heilung führen.
Es sind Überzeugung und Plausibilität, wohl im Zusammenhang mit Ritualen, die die seelischen Kräfte und damit die körperlichen Kräfte stärken oder Schwächen konnten und Heilung oder Verschlechterung bewirken konnten. Dies gilt in gewisser Weise auch heute noch, wenn auch auf anderer Grundlage.
Wir betreiben heute eine Medizin, für die Krankheitsverursachung durch Dämonen oder Zauberei nicht mehr plausibel ist. Wir orientieren uns bei körperlichen Erkrankungen sowieso und bei psychischen Erkrankungen zunehmend an der Frage nachweisbarer körperlicher Veränderungen, sogenannter Biomarker, als vermeintliche Ursache von Krankheiten und der Beeinflussung dieser Veränderungen als Grundlage für Behandlung. Unsere heutige Medizin gründet sich also auf eine vorrangig körperliche Betrachtungsweise.