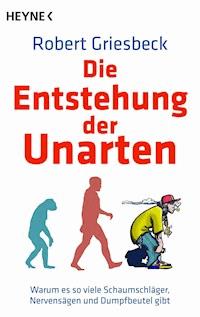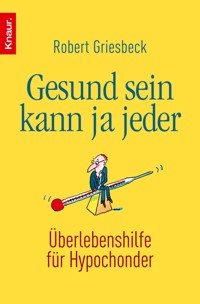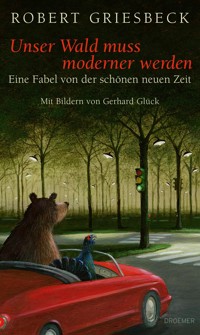Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Aficionados
Arbeitsplatzvernichter
Astrologen
Baumarkt-Männer
Berufsverbesserer
Betroffene
Betroffenheitshausierer
Charity Ladys
Classic-Simpel
Coaches
Coiffeure
Couch-Potatos
Derivatehändler
Designer
Diäthungrige
Diktatoren
Elitekinder
Emoticon-Tipper
Endzeitpropheten
Entrepreneure
Ernährungs- und Diätberater
Esoteriker
Eventmanager
Experimentalköche
Experten
Feministen
Fernsehautoren
Fitnesstrainer
Fremdschämer
Fun- und Extremsportler
Fußballer
Fußballreporter und -analysten
Global Player
Graffitikünstler
Großraummagier
Guten-Morgen-Moderatoren
Handyterroristen
Heimatsucher
Heizpilzraucher
Hotline-Helfer
Humoristen
Hütchenspieler
Insider
Instant-Philosophen
Klosprücheschreiber
Laubbläser
Lebensberater
Lebensmenschen
Light-Menschen
Markendesigner
Messies
Mülltrenner und Müllnichttrenner
Multiple-Choice-Menschen
Nannys
Networker
Ökophobiker
Ökoromantiker
Online-Bankkunden
Online-Betrüger
Ostalgiker
Outsourcer
Päpste
Partnervermittler
Performer
Politisch Korrekte
Privatpolizisten
Professionelle
Prominente
Rekordhalter
Schnäppchenjäger
Schönheitsoperierte
Schuhverkäufer
Selbstvermarkter
Selfness-Menschen
Silberzwiebeln
Sinusmenschen
SMS-Schreiber
Sprachpanscher
Sprachpfleger
Sprachverwirrte
Statistiker
Stilberater
Studienentwickler
SUV-Fahrer
Talkshow-Gäste
Telefonterroristen
Testkunden
TV-Abzocker
Unternehmensberater
Urgesteine
Verkehrsplaner
Verkürzer
Verschwörungstheoretiker
Vornamenrebellen
Werbetexter
Wir-Menschen
Workaholics
Wortakrobaten
Zapper
Zum guten Schluss
Copyright
Robert Griesbeck, geboren 1950, studierte Grafik-Design, Informationsästhetik und Politologie und arbeitet seit dreißig Jahren als Grafiker, Buchherausgeber und Autor. Er hat Kinderbücher, Romane und Sachbücher geschrieben, Zeitschriftenkonzepte entwickelt und war als Chefredakteur für diverse Magazine tätig.
Vorwort
Was wären wir ohne den Naturforscher Charles Robert Darwin und seine Evolutionstheorie? Wir würden heute noch daran glauben, dass Gott die Welt in sieben Tagen erschaffen hat, zusammen mit all ihren Bewohnern – den Seeigeln, Galapagosfinken, Plattwürmern, Leoparden, Seegurken, Walrössern, Stubenfliegen, Rauhaardackeln und Menschen. Wir hießen auch noch Menschen und nicht, wie wir uns heute korrekterweise bezeichnen – Homo sapiens. Der »kluge, weise Mensch« entwickelte sich aus ein paar Vorfahren, unter anderem aus dem Homo sapiens idaltu, dem Homo sapiens balangodensis und dem Homo sapiens neanderthalensis. Nach der biologischen Systematik ist der Mensch ein höheres Säugetier aus der Ordnung der Primaten. Er gehört zur Unterordnung der Trockennasenaffen und dort zur Familie der Menschenaffen.
Aber es war ein schwerer Denkfehler Darwins anzunehmen, dass die Entwicklung der menschlichen Rasse zu seiner Zeit schon beendet gewesen wäre. Dabei hätte er sich das doch denken können, schließlich bedeutet Evolution ja Entwicklung, und wer wollte schließlich annehmen, dass eine Entwicklung ausgerechnet in dem Moment abgeschlossen wäre, in dem man ihr auf die Schliche gekommen ist!
Charles Darwin kam 1809 im englischen Shrewsbury zur Welt und studierte Medizin, Theologie, Biologie und Geologie. Als Zweiundzwanzigjähriger machte er sich auf eine Reise, die fast fünf Jahre dauern und zur Initialzündung seiner Evolutionstheorie werden sollte. Auf der HMS Beagle, einem Vermessungsschiff der Royal Navy, fuhr der junge Darwin einmal um die ganze Welt und veröffentlichte 1839 darüber einen Reisebericht. Mit seiner Theorie über die Entstehung der Korallenriffe und weiteren geologischen Schriften erlangte er in wissenschaftlichen Kreisen erste Anerkennung als Geologe.
Doch es dauerte noch 20 Jahre, bevor er sein Hauptwerk beendet haben sollte. 1837 begann Darwin mit der Niederschrift seiner Überlegungen in Notizbüchern, den Notebooks on Transmutation. Unter der Notiz »I think« skizzierte er erstmals seine Idee vom Stammbaum des Lebens und von der Anpassung all seiner Mitglieder an den Lebensraum durch Variation und natürliche Selektion in verschiedene Arten. Über 20 Jahre lang trug er Belege für diese Theorie zusammen. Darwins Überlegungen zur Entstehung der Arten waren begleitet von einer breitgefächerten Recherche in den Bereichen Medizin, Psychologie, Naturwissenschaften, Philosophie, Theologie und politische Ökonomie. Das Ziel Darwins war es, die Entstehung von Arten auf naturwissenschaftliche Grundlagen zu stellen.
1859 erschien endlich das Werk, das wir als Die Entstehung der Arten kennen, das natürlich (Wissenschaftler!) im Original einen bedeutend längeren und ausführlicheren Titel trägt: On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or The Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life. In diesem Buch legte Darwin seine Evolutionstheorie schlüssig dar und beschrieb im Einzelnen die Veränderlichkeit der Arten, die gemeinsame Abstammung aller Lebewesen, die Änderung durch kleinste Schritte, die Vermehrung der Arten und die natürliche Selektion als wichtigsten Mechanismus der Evolution.
Heute stellt die von Darwin begründete und seitdem ständig weiterentwickelte Evolutionstheorie für die Biologie das grundlegende Paradigma dar: Durch sie werden alle biologischen Teildisziplinen – Zoologie, Botanik, Verhaltensforschung, Embryologie und Genetik – unter einem einheitlichen Dach versammelt. Darwins Werke, allen voran Die Entstehung der Arten und Die Abstammung des Menschen, lösten schon kurz nach ihrem Erscheinen eine Flut der unterschiedlichsten Reaktionen aus. Darwins Theorien berühren ja nicht nur biologische Grundfragen, sie haben auch weitreichende Auswirkungen für die Theologie, Philosophie, Psychologie und Politik. Vor allem beim Klerus stießen die Theorien auf großen Widerspruch. Dass der Mensch keine eigenständige Schöpfung ist, sondern ein Evolutionsprodukt wie Millionen anderer Arten, steht schließlich im Widerspruch zur christlichen Lehre ebenso wie zu den Auffassungen vieler philosophischer Schulen. Wo war der Schöpfer auf einmal geblieben? Und welche Stellung hatte der Mensch plötzlich in der Natur?
Darwin, der in seiner Jugend immerhin Theologie studiert hatte, wurde im Alter nicht zuletzt wegen dieser Angriffe zum Agnostiker. Hätte er gar geahnt, dass die Evolution des Homo sapiens in der Zukunft zur Entwicklung der Unarten führen würde, wäre das für ihn wahrscheinlich der endgültige Beweis gewesen, dass es keinen Gott gibt. Denn welches klar denkende, höhere Wesen erschafft solche Unarten wie Latte-macchiato-Mütter, Verschwörungstheoretiker, Baumarkt-Männer, Couch-Potatos, Betroffenheitshausierer, Charity Ladys, Telefonterroristen und Online-Betrüger?
Die Anti-Darwinisten, die sich heute Kreationisten nennen und die Schöpfungsgeschichte der Bibel wörtlich nehmen, bestehen allerdings immer noch darauf, dass die international akzeptierte Grundlage der biologischen Entwicklung eine Lüge ist. Warum sie so eisern daran festhalten, dafür hatte ein anderer großer Wissenschaftler eine plausible Erklärung. Sigmund Freud, der Vater der Psychoanalyse, bezeichnete die Evolutionstheorie als eine der drei Kränkungen der Eigenliebe der Menschheit. Und eine solche Kränkung ist nicht auszuhalten, jedenfalls für naive Kreationisten, die Darwin zu Unrecht vorwerfen, er hätte behauptet, der Mensch stamme vom Affen ab.
Der Zoologe und Genetiker Theodosius Dobzhansky formulierte 1973 den treffenden Satz: »Nichts in der Biologie ergibt einen Sinn – außer im Licht der Evolution.«
So gesehen, wird auch die Entwicklung der Unarten einen Sinn ergeben. Warten wir es ab.
Aficionados
Früher waren Aficionados auch schlicht als Liebhaber bekannt oder einfach als Leute, die gerne mal eine gute Zigarre rauchen. Aber das reicht heute nicht mehr. Beispiel Zigarre: Man braucht zwei Meter Zigarrenliteratur im Schrank, einen Humidor und ein gediegenes Fachwissen, man muss sich mit den speziellen Anzünderitualen auskennen, echte Havannas importieren und lässige Handhaltungen üben, um heutzutage als Zigarrenraucher auch einen hohen sozialen Status zu erringen. Einfach nur Zigarren rauchen, weil sie einem schmecken, das geht nicht mehr.
Zuerst muss man ein Aficionado sein, dann ein Connaisseur, zum Schluss ein Experte. Und nach den Zigarren-Aficionados hat man die professionelle Liebhaberschiene verbreitert – nun darf man auch von anderen Sachen besessen sein. Jetzt heißt es Schokoladen-Workshops, Rauchclubs, Bordeaux-Verkostungen und Trüffelschnupperkurse zu besuchen, zum Zigarrenrollen nach Cuba zu fahren, zur Champagnerernte nach Epernay, zur Obstbrandverkostung nach Kitzbühel. Es ist nicht mehr so einfach wie früher. Für alles, was man ohne anständige Ausbildung nicht richtig zu sich nehmen kann (oder nicht bei sich behalten kann), braucht man eine Zusatzausbildung.
Nehmen Sie nur die Schokolade. Früher war Schokolade etwas für Kinder. Das süße Zeug wurde gemampft, wann immer man es in die Finger bekam, und hinterher sahen die Finger auch dementsprechend aus.
Das ist heute ganz anders. Kinder mögen lieber kleine bunte Döschen mit Flüssigkeiten, deren Geschmack an aufgelöste Gummibärchen erinnert. Kinder (die als Kids angesprochen werden) trinken – weil sie nicht schon aufgedreht genug sind – mit Vorliebe Energy-Drinks wie »Fliegende Pferde« oder »Roter Bulle«, die aus Wasser, Saccharose, Glucose, Natriumcitraten, Kohlensäure, Taurin, Glucuronolacton, Koffein, Inosit, Niacin, Pantothensäure, Riboflavin und Farbstoffen bestehen. Schokolade? Ha! Nicht mal Schokodrinks, mit denen man die Kakao-Tetrapacks mal ablösen wollte, werden noch eines Blickes gewürdigt.
Schokolade ist was für die Alten geworden. Und für die Aficionados. Daher hat man der Schokolade ein neues Image verpasst. Zum einen ist sie gesund. Ja, das ist schon mal eine gute Nachricht. Das machen die Flavonoide, die auch gegen Arterienverkalkung, Alzheimer, Demenz, Nierenversagen und Stottern helfen. Obendrein macht Schokolade auch noch glücklich! Denn sie enthält auch die Aminosäure Tryptophan, eine Vorstufe des Glückshormons Serotonin. Das mit dem Glück konnte man noch einigermaßen glauben, als Schokolade noch süß schmeckte, aber inzwischen heißt es: je bitterer, je besser. Auch daran musste man sich gewöhnen. Bei einem Kakaoanteil über 80 Prozent wirft die Oberfläche einer untrainierten Zunge schon mal Blasen. Da muss man durch als Schoko-Aficionado. Und Schokolade wird heutzutage nicht mehr in einer Tafel gekauft, außen Papier, dann Alufolie und innen bruchfertige Abteilungen – nein, heute kauft man in Handarbeit hergestellte Schokospezialitäten, Bruchtafeln mit Goldstaub und eingelagerten Chilischoten und einer Glasur aus grünem Tee. Schließlich muss man ja die Höchstpreise für De-luxe-Ausführungen auch nachvollziehen können.
Man lernt bei »Schokolade-Workshops« den richtigen Umgang mit der kostbaren Ware und dass die Zeiten vorüber sind, als Schokolade noch süß schmeckte. So ähnlich muss sich Hernán Cortés gefühlt haben, als ihn die Azteken (die paar, die er am Leben gelassen hatte) in das Geheimnis der Kakaobohne einweihen wollten. Er empfand das bittere Zeug als abstoßend und eher etwas für Schweine denn für Menschen. Was Cortés gefiel, war, dass man Kakaobohnen als Zahlungsmittel verwenden konnte. Also, auch hier wurde der eindeutige Evolutionsrückschritt nachgewiesen: Wir essen wieder Bitterschokolade wie die Aztekenkönige vor 2000 Jahren.
Und dabei waren wir doch schon mal viel weiter. 1959 sang Trude Herr: »Ich will keine Schokolade, ich will lieber einen Mann!« Damals war die Evolution noch auf dem richtigen Weg.
Arbeitsplatzvernichter
Früher haben wir für uns gearbeitet, und wenn wir für andere arbeiteten, bekamen wir Geld dafür. Das ist heute anders. Wir ziehen unser Bargeld aus dem Geldautomaten, holen in SB-Restaurants das Essen ab und stellen die leeren Teller und Gläser wieder in den Wagen zurück. Wir bauen unsere Möbel selber zusammen und bringen den Verpackungsmüll weg. Wir torpedieren kleine, engagierte Buchläden, in denen uns Profis noch spannende Lesetipps geben können, und kaufen lieber bei Amazon, am liebsten den aktuellen Bestseller mit leichten Gebrauchsspuren und dafür um die Hälfte billiger.
Wer denkt dabei schon an Arbeitsplatzvernichtung? Außerdem: Kann man doch nichts machen, schließlich waren das die Vorschläge der bösen Unternehmensberater, und die Turbokapitalisten haben es gierig umgesetzt. Was sollen wir denn machen? Revolution? In Deutschland!?!
Nein, aber betrachten darf man es trotzdem. Man darf sich ärgern, und man kann sogar die schlimmsten Auswüchse boykottieren. Denn nicht nur Arbeitsplätze sind vernichtet worden, die Kunden sind auch als neue Mitarbeiter – natürlich unbezahlte – nachgerückt. Und das ist der eigentliche Skandal. Wir konsumieren nicht nur so kräftig, wie wir können, wir arbeiten auch noch für die Läden, in denen wir einkaufen!
Zuerst haben wir zähneknirschend unsere romantischen Tante-Emma-Läden aufgegeben, im Tausch gegen Parkplätze in Hülle und Fülle vor gigantischen Supermärkten. Wir haben es eingesehen, dass Obst und Gemüse immer in Großfamilienklumpen verblistert wird oder eigenhändig in Plastiktütchen eingesammelt werden muss. Wir wiegen die Beutel ab, recherchieren die dazugehörige Codenummer, tippen sie ein und kleben den Preis auf. Wir schieben gutmütig die Joghurts mit fast abgelaufenem Datum zur Seite und wühlen uns tiefer in das Kühlregal hinein, denn dort hinten, fast am Ende unserer Reichweite, stehen die frischen Becher. Klar, die alten müssen ja auch weg.
Wir stecken unsere leeren Pfandflaschen in die richtigen (es gibt jede Menge falscher) Öffnungen riesiger computergestützter Leergutannahmeautomaten, den Flaschenboden bitte nach vorne. Wir warten geduldig, bis auf den schrillen Alarmton nach der dritten Flasche jemand vom Personal kommt, uns streng mustert (»Haben Sie etwa unseren teuren, computergestützten Leergutannahmeautomaten falsch bedient? Am Ende hat er einen bleibenden Schaden davongetragen!«), den futuristischen Metallschrank aufsperrt, den vollen Flaschencontainer ins Lager fährt und wieder einen leeren hineinstellt. Wir unterdrücken auch die Frage, was denn so unpraktisch daran war, dass wir die Flaschen früher gleich im Lager abgegeben haben, aber wir tun das eher, weil wir die Berieselung mit transzendentaler Schaumweinmusik nicht mehr aushalten.
Das alles ertragen wir, aber das mit den Einkaufswagen, das geht wirklich zu weit. Die Entwicklung der münzabhängigen Rollcontainer ist ein besonders zynisches Beispiel für Arbeitsplatzvernichtung auf Kosten der Kunden – im modernen Sprachgebrauch »partial employee« genannt. Früher war der Kunde König, heute ist er unbezahlter Mitarbeiter.
Wir legen zum Beispiel den Weg zu einem der verstreuten Einkaufswagenterminals zurück – traditionell im strömenden Regen. Hier stehen die Wagen, hier ist … leider keine Euromünze. Warten wir eben. Hoppla, der erste Kunde hat seinen Wagen so schnell zurückgestöpselt, dass uns gar keine Zeit blieb, ihm den Austausch für eine Handvoll Kleingeld anzubieten. Außerdem tun das Deutsche nicht gerne. Sie möchten am liebsten ihre Münze wiederhaben. Seltsam, aber nach so vielen verlorenen Kriegen auch irgendwie verständlich. Inflationsangst. Obwohl die Mark längst passé ist. Na, vielleicht kommt gleich ein Grieche. Oder ein Italiener oder ein Türke.
Wenn wir einen Wagen eintauschen und ein Kleinkind mitführen, können wir mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass ausgerechnet dieser Wagen keinen Klappsitz für unseren Nachwuchs hat. Aber das merken wir immer erst eine Sekunde zu spät. Und es wird unseren Einkauf nicht gerade einfacher gestalten.
Nach der Kassenabfertigung folgt Phase zwei. Wir schippern (natürlich im Regen) zu unserem Fahrzeug, laden die teure Fracht ein, schnallen (so vorhanden) unseren Nachwuchs in die Kindersitze und schieben den Wagen zurück. Dabei kommen wir uns ungemein dämlich vor. Zu Recht.
Denn eigentlich ist mit der Bezahlung und dem Ladevorgang unsere Arbeit hier mehr als getan, doch jetzt müssen wir sogar noch die Aufräumarbeiten übernehmen. Und dafür sind Arbeitskräfte ausgestellt worden, die an jedem Arbeitsamt für unvermittelbar gelten, weil ihre Spezialausbildung nicht mehr gefragt ist. Das machen doch inzwischen die Kunden.
Die münzgestützten Einkaufswagen haben inzwischen eine Mutation durchgemacht, natürlich von nachdenklichen Menschen initiiert, wahrscheinlich vom McKinsey-Kernteam Heavy Braintrust Hamburg-West. Durch einen unverschuldeten Selbstversuch kam ich dem Geheimnis der neuen Einkaufswagenzombies auf die Schliche.
Nachdem ich eines Tages mal wieder einen dieser Einkaufswagen durch den Einsatz einer Euromünze aus seinem Gefängnis befreit hatte und das Gefährt nach erfolgtem Einkauf wieder in einen der Unterstände zurückstellen wollte, ließ sich der Wagen nicht mehr an der Reihe anstöpseln. Zuerst dachte ich, der Steckschlitz hätte sich verbogen oder wäre durch einen Einkaufswagenvandalen beschädigt worden. Ich versuchte es also an einer anderen Reihe. Fehlanzeige.
Ein älterer Mann beobachtete meine vergeblichen Versuche mit sichtlichem Wohlgefallen, kam langsam näher und sprach mich an: »Da werden Sie kein Glück haben, guter Mann.«
In seiner Stimme schwang eine Mischung aus triumphierender Überheblichkeit und selbstgefälligem Herrschaftswissen. Eine Mischung, die manchmal schuld daran ist, dass solche Männer Probleme mit anfänglich freundlich gestimmten Mitmenschen bekommen.
»Da hat sich jemand was dabei gedacht«, sagte er genüsslich.
»So, was denn?«
»Das ist Or-ga-ni-sa-tion! Die Leute denken nämlich nicht mit. Sind alle völlig a-so-zial!«
Er erklärte mir, dass die »Betriebsführung« durch einen geschickten Schachzug das wilde Zurückstellen von Einkaufswagen verhindert habe. Früher wären einige Einkaufswagendepots nämlich völlig überfüllt gewesen, während andere leer blieben. Also, und dabei hob er simultan die Stimme wie den rechten Zeigefinger, hätte man ein »platzweisendes Farbsystem« eingeführt, das nur bestimmten Einkaufswagen den Zutritt zu bestimmten Depots gestattet. Die Farbe der Griffe am Einkaufswagen korrespondiere mit den Farben der Depots, und so sei gewährleistet, dass jeder an einem bestimmten Depot (etwa dem roten) entnommene Einkaufswagen auch wieder am selben zurückgegeben würde. In seiner Stimme schwang Stolz, so als hätte er dieses System erfunden.
Ich fragte ihn, ob er der Meinung sei, dass es angesichts von über drei Millionen Arbeitslosen hierzulande eine gute Idee sei, jeden Furz von Nichtangestellten erledigen zu lassen, oder ob es nicht sinnvoller wäre, für die Rückführung vagabundierender Einkaufswagen einen Menschen, wenigstens auf 400-Euro-Basis, anzustellen. Er rückte seinen Hut gerade und zischte: »Kommunist!«
Eine ganz neue Form der Mitarbeit entwickelte sich in den verschneiten Weiten Schwedens, dort, wo zur Mittsommernacht nackte Menschen vor ihren Holzsaunen sitzen, dampfen und die Elche beobachten, die am Horizont vorbeiziehen. Auch Ingvar Kamprad hatte dort gesessen und sinniert. Als Junge hatte er Streichhölzer an die Bauern in den umliegenden Dörfern verkauft, später einen kleinen Versandhandel mit Sämereien und Kugelschreibern aufgemacht. »Man müsste etwas ganz Neues machen«, hatte Ingvar Kamprad geseufzt, als er eines Tages wieder vor seiner Saunahütte saß. »Vielleicht sind die Elche ein gutes Vorbild.«
»Wie, die Elche? Die sind doch doof!«, hatte sein Freund Øle gesagt.
»Ich meine ja auch nicht, wir sollten es wie die Elche machen. Aber wenn wir die Kunden wie Elche behandeln …«
Das war die Initialzündung für IKEA gewesen. Schwedische Elche sind nicht verwöhnt. Es gibt wenig Auswahl und wenig zu beißen in der harten Einsamkeit Schwedens. Ein Elch ist schon froh, wenn er sich an einem Ast mal nicht den Zahn ausbeißt. Die ersten IKEA-Kunden freuten sich wie die Elche, dass sie billige Möbel aus billigem Holz und in schlichtem Design kaufen durften, und dachten (Elche!) nicht darüber nach, was denn der Unterschied zu einem anderen Möbelhaus wäre. Etwa einem für verwöhnte Perserkatzen.
Bei IKEA wurde das Prinzip des »partial employee«, des teilweise Mitangestellten, gleich von Anfang an zur Perfektion getrieben und besteht bis heute. Der Elch ist zum Symbol für ein Unternehmen geworden, das 2008 mit über 285 Möbelhäusern in 36 Ländern und mit 127 800 Mitarbeitern einen Umsatz von 21,2 Milliarden Euro machte. Ingvar Kamprad, der inzwischen in die Schweiz umgezogen ist, weil es dort zwar keine Elche, aber eine nettere Steuerbehörde gibt, wird beim US-Magazins Forbes mit 28 Milliarden Dollar Privatvermögen als der viertreichste Mensch der Welt geführt. Damit wir uns richtig verstehen: Das gönne ich ihm, obwohl ich ihn schon oft verflucht habe, etwa als ich mir den Daumen bei der Errichtung einer Kommode »Aspelund« eingeklemmt oder verzweifelt nach der zwölften Schraube für das Hängeregal »Värde« gesucht habe.
Kamprad ist auch privat ein eiserner Sparelch, teilweise schon gespenstisch. Er hat ein hartes Leben hinter sich, eine romanhafte Karriere, und trotzdem ist das, was ihn so groß gemacht hat, ein simpler Trick:
Er hat seine Angestellten in lustige Uniformen gesteckt und das Duzen in allen Filialen zur Pflicht gemacht, aber das ist es nicht.
Er verkauft den Kunden neben Möbeln jeden Schnickschnack, auch Pommes frites, Schwedenhappen und heiße Würstchen, aber das ist es auch nicht.
Er hat einen IKEA-Club gegründet, die Family-Card eingeführt und lässt die Klappmöbel sogar liefern, aber auch das ist es nicht.
Er hat die straffste Corporate Identity nach McDonald’s und immer freie Parkplätze, aber das ist es ebenfalls nicht.
Nein, der Trick ist: Er lässt die Kunden arbeiten. Um zu verstehen, wie wir für den alten Mann schuften, nehmen wir als Beispiel »Billy«, das Regal, das jeder kennt und jeder irgendwo stehen hat. Bekannterweise besteht dieses Pressspanwunder aus zwölf Brettchen, 20 Schrauben, einem Inbusschlüssel und einer Handvoll Nägel. Ein technisch nicht völlig unbegabter Mensch braucht für den Zusammenbau etwa eine halbe Stunde. Billy ist schon bis zum Jahr 2004 über 30 Millionen Mal verkauft worden, das entspricht einer Gesamtzahl von 15 Millionen Arbeitsstunden! Und wenn wir nur einen harmlosen Stundenlohn von acht Euro ansetzen (sogar noch unter dem Mindestlohn bei der Post), summiert sich diese Aufbauarbeit an Billy zu einem volkswirtschaftlichen Aufwand von 120 Millionen Euro. Und Ingvar Kamprad hat sich diese Kosten erspart, weil er die Endmontage auf seine Kunden abgewälzt hat.
In Wirklichkeit übernehmen wir natürlich noch einiges mehr, was sich in Euro kaum ausdrücken lässt: Zuerst strapazieren wir unsere Nerven (vor allem, wenn wir den Anfängerfehler machen, an einem langen Samstag eine Regalwand zu kaufen) im zähen Geschiebe durch alle Abteilungen der schwedischen Möbelburgen, vorbei an streitenden Familien, kreischenden Kindern (nein, nicht alle sind im mit Plastikbällen gefüllten Terrarium abgegeben worden, an langen Samstagen gibt es mehr Kinder als Plastikbälle!), hysterischen Innenarchitekten (»Aber Sie haben mir doch versichert, dass der Stoff heute spätestens da ist! Das Fotoshooting ist heute Nachmittag!«) und ellenbogenstoßenden Matronen, die endlich auch mal einen Wagen fahren dürfen. Und so, wie sie ihn durchs Gedränge schieben, darf man nur hoffen, dass sie nicht auch noch am Straßenverkehr teilnehmen. Dann sammelt man seine Einkäufe in den Regalstraßen zusammen und spürt das Magengeschwür ein kleines bisschen nachwachsen bei der Nachricht, dass ausgerechnet die Rollen für den Rollschrank »Rollebör« momentan nicht lieferbar sind. Na ja, der Rest ist ja wenigstens da. Ein Rollschrank ohne Rollen? Nicht so schlimm, wenn man bedenkt, dass die meisten afghanischen Familien weder einen Schrank mit noch ohne haben. Dann steht er eben so lange rum, bis es die Rollen wieder gibt. Müssen wir in der Mittagspause eben nochmal hinfahren, Rollen kaufen und dazu einen »Köttbullar« oder ein »Kasbroed« essen. Das empfehlen uns jedenfalls die gelbblauen Streetworker von der IKEA-Family, die man an ihren Beruhigungscentern um Rat fragen kann. Hat man das Zeug dann doch irgendwie durch die Kassenstraße gequetscht und ins Auto geladen, muss man nur noch unfallfrei nach Hause fahren. Das ist bei der üblicherweise begrenzten Sicht nach hinten nicht gerade ungefährlich und verleitet uns zu irrsinnigen Überlegungen, etwa ob wir uns nicht auch mal einen Van zulegen sollten. Dabei sind die Kinder gerade aus dem Haus und kaufen selber bei IKEA ein, und das natürlich nur mit einem geliehenen VW-Bus. Aber die Nachbarn sind kinderlos und haben auch einen Van. Wahrscheinlich fahren sie öfter zu IKEA. Man kommt schon auf seltsame Gedanken nach einem Besuch im Möbelhaus der Elche, auf der schlingernden Heimfahrt, während eine Kante von »Börwöll« sich bei jeder Linkskurve unangenehm in die Schulter bohrt.
Nachdem wir die Kartons in die Wohnung gewuchtet haben, kommt nun der friedliche Teil: auspacken, die Anleitungen studieren, alle Schrauben, Dübel, Stifte, Nägel, Leimtütchen und Plastikhütchen zählen, den diversen Ziffern auf dem Bauplan zuordnen und aufbauen. Der Inbusschlüssel bleibt übrig, den darf man behalten und legt ihn zu den 67 anderen in den Werkzeugkasten.
Aber auch damit ist die Arbeit noch nicht beendet, die wir für Herrn Kamprad leisten – jetzt heißt es, den Verpackungsmüll kleinzuschneiden und in die entsprechenden Abfallkübel zu entsorgen. Seltsam, dass Verpackung in manchen Fällen ein größeres Volumen haben kann als das, was in ihr verpackt war.
Wenn wir uns dann müde auf unser Klappsofa »Schlömmvörd« werfen und den Fernseher anstellen, kann es passieren, dass wir gerade eine Werbepause erwischen und den IKEA-Spot sehen: »Wohnst du noch oder lebst du schon?« Aber weil wir so erschöpft sind und sich ein seltsamer Druck auf die Ohren gelegt hat, verstehen wir stattdessen: »Bist du noch Kunde oder arbeitest du schon für uns?«
Astrologen
Aber das sind doch keine neuen Unarten, denn Astrologen und Astrologiegläubige hat es schon immer gegeben, werden Sie jetzt sagen. Da haben Sie nicht ganz Unrecht, doch früher waren das noch vergleichsweise »zivilisierte« Sterndeuter. In der Antike ging man nur wegen großer Schicksalsfragen zur Pythia, heute kann man in jeder Zeitung nachlesen, was man besser tun oder lassen sollte: »Suchen Sie einen Ausgleich durch sportliche Aktivitäten, damit Ihnen Stress und Hektik nicht zu Kopf steigen. In der nächsten Zeit sollten Sie auf eine klare Trennung von Beruf und Privatleben achten.« Hätte das jemals eine griechische Wahrsagerin prophezeit, wäre sie sofort geköpft worden. Damals gab man sich noch Mühe, um den sorgenvollen Kunden nicht sofort zum Deppen zu machen.
Wo Vorhersagen gemacht werden, besteht immer das Problem der sich selbsterfüllenden Prophezeiungen. Wem prophezeit wird, dass ihm eine schmerzliche Erfahrung droht, wenn er nicht sehr aufpasst, dem bleiben (wenn er zum Stamm der Leichtgläubigen gehört) eben nur zwei Möglichkeiten: Entweder er macht tatsächlich eine schmerzliche Erfahrung, dann hat er eben nicht genug aufgepasst. Oder er macht keine, dann wurde er durch das Orakel glücklicherweise gewarnt und konnte sich auf die drohende Gefahr einstellen. Und um den geistigen Nährboden zu beschreiben, auf dem diese Art der »Zukunftsschau« gedeiht, möchte ich die Lieblingsgeschichte meiner Großmutter erzählen: Sitzen zwei Buben auf dem Ast eines Apfelbaums und sägen daran. Dummerweise sitzen aber auch beide auf der falschen Seite des Asts. Da kommt eine alte Frau vorbei und ruft: »Hört auf, sonst fallt ihr vom Baum!« Die beiden Buben lachen und sägen weiter. Der Ast fällt, mit ihm die Buben. Als sie im Gras liegen, kommt die alte Frau wieder vorbei. Ruft der eine Bub: »Schau, da ist sie wieder, die Hellseherin!«
Auf dieser Ebene bedienen all die Glaskugelgucker, Kartenleger, Münzenwerfer und Handleser ihre Kundschaft. Die Astrologie dagegen möchte sich gerne aus diesem Dunstkreis erheben und versucht verzweifelt, sich einen wissenschaftlichen Anspruch zu geben. Dabei ist sie kein organisiertes, zusammenhängendes Gedankengebäude, und noch dazu nach Region und Erdteil verschieden. Und sogar innerhalb der einzelnen Richtungen gibt es verschiedene Schulen, welche die Sterndeutung unterschiedlich praktizieren. Im Prinzip kann jeder Astrologe selbst entscheiden, wie und auf welche Art und Weise er Astrologie betreiben möchte. Schon wegen dieser Beliebigkeit ist es wenig sinnvoll, die Kritik an der Astrologie an einzelnen Details aufzuhängen. Astrologie ist einfach ein nettes Überbleibsel aus der Epoche des »staunenden Menschen«, der für sich Ordnung ins Chaos bringen musste, um nicht verrückt zu werden.
Dafür sind die Himmelskörper natürlich bestens geeignet, denn sie sind immer wieder zu sehen, drehen sich hin und her und rundherum – beste Voraussetzungen für ebenso verschwurbelte Deutungen. Der scheinbare wissenschaftliche Anspruch der Astrologie rührt von der »guten alten Zeit«, als Astrologen und Astronomen noch eins waren. Diese Zeiten sind allerdings lange vorbei, und man kann dazu Johannes Kepler zitieren, der von der Astrologie als das »närrische Töchterlein der Astronomie« sprach. Er besserte sein Haushaltsgeld trotzdem mit sterngläubigen Menschen auf. Und so ganz stimmt selbst die Mär von den beiden verknüpften Wissenschaften nicht; auch die Chemie und die Alchemie waren nie eines – die unterbezahlten Forscher zogen mit ihren chemischen Trickbetrügereien nur den Reichen das Geld aus der Tasche. Schließlich waren Wissenschaftler schon immer schlechter bezahlt als Geschichtenerzähler – glauben war und ist einfach sexier als verstehen oder gar selber nachdenken.
Obwohl der Wissenschaftsjournalist Hoimar von Ditfurth 1978 in einer Fernsehsendung einen relativ schlichten Beweis dafür lieferte, wie Astrologie »funktioniert«, änderte das nichts. Er ließ zehn Personen ein angeblich für jeden von ihnen speziell erstelltes Horoskop beurteilen – acht fanden, dass es wirklich für sie »weitgehend zutrifft«. Danach enthüllte von Ditfurth: Alle zehn hatten ein und denselben Text bekommen, eine Mischung aus zumeist schmeichelhaften Allerweltsfloskeln.
Astrologie erfüllt bei vielen Menschen ein Bedürfnis nach übernatürlichen Erklärungen für ihre momentane Befindlichkeit. Die nebulöse Sprache, die widersprüchlichen, sehr oft banalen, fast immer vieldeutigen Sprüche – all das kennzeichnet die magisch-mythische Qualität der Astrologie, heute wie vor Jahrhunderten und Jahrtausenden. Astrologie ist Glaubenssache, aber in allen großen Glaubenssystemen werden wenigstens ihre Repräsentanten ordentlich ausgebildet. Am besten immer noch christliche Priester, Korangelehrte und jüdische Rabbiner. Doch wie sieht es bei Astrologen aus, wie wird man überhaupt einer?
Ganz einfach. Man kauft sich ein Buch und erzählt den Leuten, was sie hören wollen. Das ist der eine Weg, der leichtere, oft schon sehr einträglich. Aber es gibt – schließlich leben wir in Deutschland – auch einen zweiten, einen »anständigen«. Will man etwa Mitglied im Deutschen Astrologenverband werden, muss man eine Aufnahmeprüfung mit schriftlichem und mündlichem Teil bestehen. Jeder Bewerber muss eine »Radixdeutung« sowie eine »metagnostische Deutung« liefern, eine Berufsberatung und eine Partnerschaftsberatung. Erst nach bestandenem Rigorosum erhält er den Titel »geprüfter Astrologe, DAV«. Ist zwar nichts Offizielles, aber der zivilisierte Mitteleuropäer denkt sich angesichts eines solchen Astrologen doch, da muss was dran sein, denn alles, was eine Prüfung verlangt, kann doch kein Mumpitz sein. Schließlich gibt es Führerscheinprüfungen, Angelund Jagdscheine – und den Großen Fahrtenschwimmer.
Dass die Menschen von allen Prognosen stets nur jene im Gedächtnis behalten, die – zufällig – eingetroffen sind, gilt als Binsenwahrheit. Geht es ans Aufrechnen der Trefferquote, sieht es nämlich für die Astrologen finster aus. So wurden 364 überprüfbare Vorhersagen, die »führende Zukunftsdeuter« in dem amerikanischen Boulevardblatt National Enquirer abgegeben hatten, nachträglich untersucht: Ganze vier waren eingetroffen. Eine solche Verlässlichkeit von wenig mehr als einem Prozent liegt sogar noch meilenweit unter der Zufallswahrscheinlichkeit.
Dazu sagt der deutsche Lyriker und Intellektuelle Hans Magnus Enzensberger, der sicher nicht der Sterndeuterei verdächtigt werden kann: »Auch ich habe mal Recht, mal nicht. Das kommt eben davon, wenn man etwas sagt – manchmal trifft es ein. Insofern hat jeder Astrologe die gleiche Chance wie ich.«
Immer mehr Bundesbürger deuten sich mit Sternentafel, Taschenrechner und Lineal ihre Zukunft selber. Millionen informieren sich in Boulevardblättern, Illustrierten und astrologischen Kalendern darüber, was angeblich in ihren Sternen steht: 54 Prozent der Deutschen, rund zehn Prozent mehr als noch vor sieben Jahren, lesen regelmäßig ihr Horoskop – und viele sind fest davon überzeugt, dass Sonne, Mond und Sternzeichen, Aszendenten, Konjunktionen und Trigone ihr Leben beeinflussen.
Wenn eine Zeitung mal vergisst, das Tageshoroskop zu drucken, ist gleich der Teufel los. Als das dem Bremer Weser-Kurier passierte, gab es einen wahren Leseraufstand. Hunderte riefen an, und die Verzweifeltsten von ihnen überlegten schon, ob sie den Tag nicht besser zu Hause verbringen sollten. Es gibt sogar ernsthafte Börsianer, die ihren Aktienhandel nach den Sternen gestalten. Ob die Finanzkrise damit etwas zu tun haben sollte?
Trotzdem ist die Astrologiegemeinde unerschütterlich im Glauben. Es ist nämlich ganz einfach: Astrologen sind unblamierbar. Sie können so viel Unsinn vorhersagen, wie sie wollen, Gläubige sind nicht zu überzeugen. Gläubige wollen sich den Glauben nicht nehmen lassen. Und das muss man respektieren.
Nicht mehr respektieren kann man allerdings inzwischen, wie niveaulos und billig die armen Sterngläubigen abgezockt werden. Seit Fernsehen, Internet und SMS-Dienste sich der Sterndeutung angenommen haben, boomt das Blitz-Horoskop-Geschäft.
Für mehr als 4000 Bundesbürger ist die Astrologie inzwischen schon ein einträgliches Gewerbe. Unter anderen offerieren Firmen wie »astro-tv«, »Astrolines24«, »NoeAstro«, »Wahrheitskugel.de« oder »Questico« (das Internetportal für alle Rat- und Hilfesuchenden) stammelnde Plauderviertelstündchen, die sie unter der hochtrabenden Bezeichnung »Astrologische Lebenshilfe« anbieten. Im Internet kann man sich auf einschlägigen Seiten Dutzende von Propheten und Wahrsagerinnen ansehen, die sich mit Foto, oft mit kleinen Videoporträts vorstellen und allen Hilfesuchenden zum Einstieg ein Gratisgespräch anbieten. Insofern unterscheiden sie sich tatsächlich von den Telefonsexanbietern, denn da gibt es nichts vorab und gratis. Der Rest ist nicht viel anders. Man behandelt ein paar »große« Menschheitsthemen: Geld, Liebe, Beruf und Gesundheit.
Besonders schlimm sind die smarten Instant-Astrologen im Privatfernsehen, die mal eben kurz die Geburtsdaten in ihren Laptop eintippen und dann eine »erstaunlich stimmige« Analyse der Vergangenheit abspulen.
»Sie haben in letzter Zeit eine kritische Phase durchgemacht.«
»Tatsächlich.« (Klar, wer sonst würde bei einem Fernsehastrologen anrufen!?)
»Sie befinden sich immer noch in einer schwierigen Konstellation …«
(Spannung halten)
»… die sich jedoch Ende des Jahres auflöst.«
»Na, Gott sei Dank.«
»Ich sehe da auch einen nicht aufgelösten Konflikt … und eine Angst, die Sie umtreibt …« (Wie kommt er nur darauf, das ist bei Menschen doch extrem selten.)
»… aber die Zukunft sieht rosig aus.«
Nicht sofort, aber wenn Sie noch ein paar Mal anrufen, könnte es jedes Mal besser werden. Die wahren Derivatehändler sitzen beim astro-tv. Sie verbrennen zwar kein Geld, aber ob es moralisch anständiger ist, emotionale Leerverkäufe und Hoffnungs-Termingeschäfte vorzunehmen, das möchte ich mal bezweifeln.
Baumarkt-Männer
Das war schon immer so in der Familie des Homo sapiens: Männer waren Jäger und Sammler, Frauen Mütter und Köchinnen – später wurden Männer auch noch Häuslebauer, und die Frauen gestalteten dafür das Heim mit Tüllvorhängen und Trockenblumensträußen aus.
Aber spätestens seit Ende der Antike baut der Mann kein Haus mehr, er lässt bauen. Spezialisierung. Männer hatten nur noch zu reparieren – quietschende Türangeln, wackelige Vorhangstangen und undichte Spülkästen. Dafür genügte ein Köfferchen mit den Abmessungen einer durchschnittlichen Damenhandtasche und sieben Werkzeuge: Hammer, Säge, Zollstock, Schraubenzieher (-dreher, ich weiß!), Kombizange, Handbohrer und Hansaplast.
Doch die Zeiten sind vorbei. Nicht, dass wir jetzt wieder unsere Häuser selber bauen würden, aber die Ausrüstung in einem durchschnittlichen »Hobbykeller« entspricht der eines Kleinunternehmens der Baubranche. Eine neue Ethnie ist entstanden: die Baumarkt-Männer.
Tatsächlich stellt der Baumarkt-Hype, der in den letzten Jahren explosionsartig zugenommen hat, eine monströse Bewegung dar, so wie es die Freikörperkultur oder die Wandervögel einmal waren. Heute ist es der Baumarkt-Star Tim Taylor aus »Hör mal, wer da hämmert«, der TV-Soap für den Schlagbohrmann. Oder die beiden als kanadische Holzfäller verkleideten Bodybuilder, die allabendlich in einem Shoppingsender wunderbar rot und blau lackierte Schlagbohrmaschinen mit Revolver(!)wechselfutter vorstellen und sich unter munterem Geplauder durch Betonwände, Tischplatten und Gullydeckel bohren und fräsen. Dabei kann man inzwischen auch in jedem Baumarkt fernsehen, all die Anleitungen, Beispielvideos und Werbespots nämlich, die auf Flatscreens über der »Schraubentheke« und im »Heißklebecenter« laufen. Vorbei die Zeit, als ein professioneller Showhandwerker die Kombizange mit 28 Zusatzfunktionen (inklusive Dosenöffner und Kompass) an seinem kleinen Stand vorführte und mit untrüglichem Gespür immer gerade den anquatschte, der sich am wenigsten wehren konnte. Den, zu dem auch jeder Punk »Has ma’nen Euro!« sagt.
Die Baumarkt-Männer sind wortkarge und zähe Burschen, absolute Fachleute und erstklassige Nervensägen – wovon das Personal der Heimwerkergroßmärkte in den Pausen traurige Lieder singt. Baumarkt-Männer wissen, dass es Schraubendreher (!) und nicht Schraubenzieher heißt, sie sprechen stotterfrei von der 44210er Schlagbohrkrone, 68 mm, geeignet für Bohrmaschinen mit SDS-plus-Werkzeugaufnahme und elektronisch regelbarer Dreh-/Schlagzahl und Dreh- und Schlagstopp, sie stehen verzaubert vor Flatscreens, auf denen Werbevideos über die Vorzüge einer neuen Heißklebepistole laufen – und sie nehmen kurz vor der Kasse noch ein Schnäppchen mit, etwa den 124-teiligen Ratschenkasten aus Chrom-Nickel-Vanadium, made in China. Gutes Werkzeug braucht man immer.
Schon diese riesengroßen Einkaufswagen! In die kann man natürlich nicht nur ein paar Lüsterklemmen, eine Rolle Isolierband und eine Tube Kontaktkleber legen, wie sieht denn das aus?! So ein Baumarkt-Einkaufswagen hat eine größere Ladefläche als ein Range Rover, außerdem kann man das Heckgitter ausklappen, damit zwei Festmeter Holzschalung mit reinpassen. Baumarkt-Männer rennen nicht durch die langen, finsteren Gänge (wie sie es etwa bei Schuhgeschäften tun), sie schlendern wohlgemut und mit wachem Auge durch die Flugzeughangars voller Werkzeug, Kleber, Dübel, Farbe, Bohrmaschinen und Elektrokram. Ihre Mimik sagt »Geht nicht, gibt’s nicht!«, und wenn sie zufällig einen Baumarkt-Angestellten treffen, stellen sie ihm eine hochkomplizierte Baumarkt-Fachfrage. Nicht, weil sie etwa die Antwort interessieren würde, sondern weil sie einem Kollegen signalisieren wollen, dass sie sich auskennen. Dass sie kein blöder Heimwerker oder Do-it-yourself-Softie sind, sondern ein ausgebuffter Profi.
Übrigens sind nicht nur die Kunden von Baumärkten durch den Wind, auch die Betreiber und Angestellten ticken nicht mehr ganz richtig. Sie haben schon eigene Internetcommunitys und Websites aufgemacht, in denen sie frustrierende Erlebnisse mit ihren Kunden abladen und sich gegenseitig bedauern. Wie grausam, wie komisch, wie tragisch! Es scheint, als ob jeder, der mit einem Baumarkt in Berührung kommt, einen leichten psychischen Schaden erfährt. Bei Überdosierung führt das zum schweren Baumarkt-Syndrom, das nur durch eine Aquarell-Selbsthilfegruppe oder strengste Abstinenz zu heilen ist.