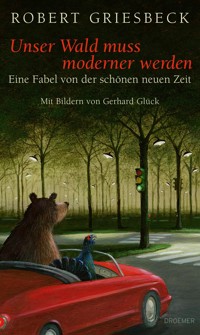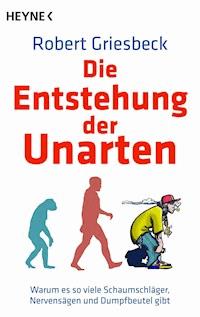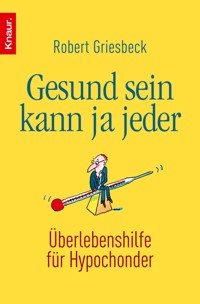
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Hypochonder sind die besseren Menschen! Sie sind unterhaltsame Gesprächspartner, begehen niemals Selbstmord, lesen gerne und wissen meistens mehr als jeder Arzt. Robert Griesbeck räumt auf mit Vorurteilen und Klischees und verrät, warum der Hypochonder besser ist als sein Ruf. Mit großem Selbsttest: Sind Sie ein echter Hypochonder oder nur ein Simulant? Gesund sein kann ja jeder von Robert Griesbeck: als eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Robert Griesbeck
Gesund sein kann ja jeder
Überlebenshilfe für Hypochonder
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Hypochonder sind die besseren Menschen! Sie sind unterhaltsame Gesprächspartner, begehen niemals Selbstmord, lesen gerne und wissen meistens mehr als jeder Arzt. Robert Griesbeck räumt auf mit Vorurteilen und Klischees und verrät, warum der Hypochonder besser ist als sein Ruf.
Mit großem Selbsttest: Sind Sie ein echter Hypochonder oder nur ein Simulant?
Inhaltsübersicht
Vorwort
Das Hohelied des aufgeklärten Hypochonders
Der Gabeltest für Hypochonder
Hypochonder und Sport
Fitness-Hypochonder
Wellness asiatisch: Die Kräfte der Selbstheilung
Gefangen im Netz: Die Fundgrube für Hypochonder
Selbstdiagnose und Wahnsinn: Sprechstunde bei Doktor Google
Hypochonder war gestern – heute leidet man virtuell
Eine Nacht in der Apotheke
Vom statistischen Risiko des Kantinenessens
Fanatische Wasser-Hypochonder und Ökomärchen
Eine neue Krankheit: der Umwelt- oder Öko-Hypochonder
Superionisiertes Wasser
Aktivwasser
Hier werden Sie verarztet!
Hackordnung und Arztklischee
Das Wohnzimmer der Hypochonder
Nur der Papst ist unfehlbar – Götter in Weiß nicht
Grundsätzliches
Demolieren Hypochonder das Gesundheitssystem?
Hypochonder sind misstrauisch, weil sie viel wissen
Theorie und Zuzahlungspraxis
Hypochonder auf Reisen
Heilung vom »Gedankenkrebs«
Hypo-Typen und versöhnliche Nachrichten
Der Happy Hypo
Der Eso-Hypochonder
Der Kontrolletti
Der Sozial-Hypochonder
Der Internet-Hypochonder, auch Cyberchonder genannt
Der Schein- oder Amateur-Hypochonder
Der Adventure-Hypochonder
Der echte Hypochonder
Irgendwas fehlt jedem – ein Resümee
Hypochonder sind die besseren Menschen
10 Gründe, warum Hypochonder die besseren Menschen sind:
Der große Hypochonder-Test
Auflösung
Weniger als 18 Punkte:
19 bis 49 Punkte:
50 bis 99 Punkte:
Über 100 Punkte:
Anhang
Das ABC der Hypochonder
Beratungsstellen und Infoservice
Bibliographie
Links
Danksagung
Vorwort
»Nur wir Kranken wissen etwas über uns selbst.«
ITALO SVEVO
Wussten Sie, dass »Placebo« lateinisch ist und »Ich werde gefallen« bedeutet? Dass »Hypochondrion« im Griechischen den Bereich unter den Rippen meint, die Gegend, in der die meisten Hypochonder diffuse Schmerzen haben? Kennen Sie Ihren Rhesusfaktor? Wissen Sie, dass Hypochondrie eine somatoforme Störung ist und heutzutage entsprechend der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-10) unter F45.2 als Hypochondrische Störung definiert wird? Sagen Ihnen die Begriffe Karzinophobie oder Nosophobie etwas?
Nein?
Einem Hypochonder schon.
Sorry, ein Hypochonder wird das alles wissen, denn Hypochondrie ist heutzutage sozusagen die Überwissenschaft, vergleichbar etwa mit dem studium generale der Humboldtschen Zeit. Dieses Studium, das alle wesentlichen Wissenschaften umfasste, ist in der heutigen Zeit spezialisierter Studiengänge nicht mehr anzutreffen. Nur Hypochonder bringen es zu dieser Allgemeinbildung auf höchstem Niveau, wobei neben Sprachkenntnissen (Latein natürlich und Englisch für alle internationalen medizinischen Veröffentlichungen) ein fundiertes Grundwissen in Pharmazie, Biochemie, Anatomie und Statistik dazugehört, und natürlich Medizin in allen Fachrichtungen. Dazu kommen alternative Heilweisen, Diät- und Ernährungskunde, Erste Hilfe, Kenntnisse von virologischen Übertragungswegen und eine komplette Übersicht des deutschen Gesundheitswesens.
Egal, ob Sie ein Hypochonder sind oder sich für dieses faszinierende Gebiet interessieren – Sie werden auf jeden Fall von den nächsten 300 Seiten profitieren. Am Ende werden Sie auch verstehen, warum Hypochonder gesünder leben …
… es aber nicht glauben wollen.
Das Hohelied des aufgeklärten Hypochonders
»Hypochondrie ist selbsttätige Gemütsbeklemmung.«
AMBROSE BIERCE
Es war so: Mein Lieblingslektor und ich trafen uns in der Cafeteria der Neuen Pinakothek, um über mein neues Buchprojekt zu reden. Ich hatte schon am Telefon den Eindruck gehabt, dass er dem Thema Deutschland Knuddeleisbärenland nicht das rechte Interesse entgegenbrachte. Darüber wollten wir sprechen. Er bestellte einen Cappuccino, ich einen Pfefferminztee, weil ich ein diffuses Kratzen im Hals verspürte, schon den ganzen Vormittag. Es war Hochsommer, die beste Zeit für eine anständige Sommergrippe. Aber ohne mich.
Als die Bedienung kam und die Getränke brachte, wies meine Tasse am Rand eine zarte bräunliche Spur auf, keinen richtigen Schmutzrand, aber ich ließ den Tee zurückgehen. Mein Lektor schaute mich seltsam an.
»So kenne ich dich gar nicht, so … penibel.«
»Was heißt penibel! Es ist gerade Hochzeit für die Sommergrippe, und ich habe keine Lust, mein Immunsystem einem Virenbombardement auszusetzen. Wer weiß, wer vor mir von dieser Tasse getrunken hat.«
Ich erzählte ihm, dass ich schon den ganzen Tag so ein komisches Kratzen im Hals spürte und mein rechtes Auge auffällig tränte, was ein böses Zeichen ist. Der seltsame Ausdruck in seinem Gesicht verschwand trotzdem nicht. Ich hatte das Gefühl, mich rechtfertigen zu müssen.
»Die Leute sind heutzutage erstaunlich oberflächlich und leichtsinnig, was ihre Gesundheit angeht. Sie essen biologisch-dynamisch und rennen in Fitnessclubs, aber die Sommergrippe unterschätzen sie. Dabei weiß doch jedes Kind, dass die Enteroviren ausgetrocknete Schleimhäute lieben. Ich sage nur: Cross-Trainer, Schwitzen, Klimaanlage, Duschen, Fahren mit nassen Haaren bei offenem Autofenster – die Hölle!«
Dann machte ich ihn darauf aufmerksam, dass unsere Bedienung ein enges, kurzes Top trug, das eine Handbreit ihrer Taille frei ließ.
»Sieht doch nett aus«, sagte mein Lektor.
»Mein Gott, nett! Das ist die perfekte Einladung für eine Nierenbeckenentzündung, gerade bei diesem Wetter. Man läuft in der Hitze herum, schwitzt, holt aus der Kühlung einen Kasten Bier oder stellt sich vor einen dieser idiotischen Ventilatoren – und peng! Das unterschätzen die jungen Leute. Sie glauben, Jugend schützt vor Krankheit.«
Ich hatte mich keineswegs, so wie mein Lektor später behauptete, in Rage geredet, aber mir fiel auf, dass er immer stiller wurde und seine Kaffeetasse nachdenklich musterte. Ich nahm sicherheitshalber eine Esberitox. Prophylaktisch. Gegen alles, was im Anflug ist – die Flak in Friedenszeiten.
»Hättest du vielleicht Lust, etwas über Hypochondrie zu schreiben?«, fragte er nach einer Pause.
»Hypochondrie? Ausgerechnet ich?«
»Na ja, du kennst dich doch ziemlich gut aus mit Krankheiten.«
»Nicht mehr als jeder andere«, sagte ich.
»Immerhin weißt du, was ein Enterovirus ist.«
»Aber das weiß doch jeder.«
»Und du hast mir dieses Weidenteer-Shampoo gegen Schuppen empfohlen. Hat übrigens nicht geholfen.«
»Hm.«
»Außerdem hast du doch letzte Woche diesen Helikopter-Schnelltest gemacht. Was ist dabei eigentlich rausgekommen?«
»Es heißt Helicobacter«, sagte ich genervt. »Genau genommen sogar Helicobacter pylori, und der Test war negativ. Aber ich misstraue diesen Tests. Werde wohl bei meiner nächsten Magenspiegelung einen Abstrich machen lassen.«
Mein Lektor sah mich glücklich an, breitete die Hände auseinander und sagte nur: »Na siehst du – du bist perfekt.«
Das klang zwar sehr nett, aber mir wäre es lieber gewesen, er hätte mein Exposé Deutschland Knuddeleisbärenland so gelobt.
Na, vielleicht würde es ja ganz interessant werden, ein paar echte Hypochonder kennenzulernen. Ich brauchte jedenfalls dringend den Vorschuss, der mich über die nächsten drei Monate retten würde.
»Ich sage nicht nein, aber ich muss es mir überlegen.«
So ging das los.
Ich ging nach unserem Gespräch noch etwas durch die Pinakothek und schaute mir die Installation von Benjamin Bergmann an. Düstere Angelegenheit. Hunderte von Körben hingen hoch oben unter der Decke des Museums und schaukelten auf und ab.
Eine Museumsführerin sprach eindringlich über die Dynamik des Lebens, über beredtes Schweigen als Metapher für einen fortwährenden Prozess des Suchens. Ich bekomme bei solchen 12 Kunstschwurbeleien leicht Sodbrennen und nahm prophylaktisch ein Rennie.1
»Ausgerechnet Hypochonder«, dachte ich, »warum nicht moderne Kunst oder Bürosport, so was schreibt sich doch wie von selbst, aber Hypochondrie …«
Da fiel mir Karen ein. Sie ist eine Amerikanerin Anfang 30, die seit zehn Jahren hier lebt und ein Studio für Webdesign hat. Sie arbeitet zu Hause, und wenn sie nicht vor dem Computer sitzt, trinkt sie Grassaft, lässt sich rolfen oder schreibt an ihrem Whole-Earth-Health-Blog. Hat sie mir jedenfalls erzählt.
Wir haben uns auf einer Veranstaltung kennengelernt, bei der junge Menschen in einer Kneipe laut Spontangedichte (die sich aber nicht reimen dürfen, jedenfalls nicht so, dass ich es merke) ins Publikum schreien. Das Ganze nannte sich Poetry Slam, und ich war dort, weil es in dem Laden einen anständigen Cabernet Sauvignon gibt. Egal. Ich saß neben dieser äußerst schlanken, fast schon anorektisch wirkenden Frau mit schwarzem Bürstenhaar, die mich irgendwann anstieß und mir ins Ohr brüllte: »It’s weird! It’s sick – and it makes me sick!« Das fand ich nett, und ich schrie zurück, dass es auch mich krank machen würde und dass ich nur noch mein Glas austrinken wolle, dann nichts wie weg. Wir gingen zusammen und rauchten draußen eine Zigarette. Später traf ich mich immer mit ihr, wenn ich ein Problem mit meinem Mac hatte, und sie baute sogar meine Website. Wenn ich mich so erinnerte, was sie mir in dieser Zeit alles von sich erzählt hatte, konnte sie eine gute Recherchequelle für Hypochondrie sein.
Sie freute sich tatsächlich, als sie mir die Tür öffnete, jedenfalls küsste sie mich auf beide Wangen und sagte, dass es sehr sweet sei, dass ich sie mal besuchte. Wir setzten uns in ihre Küche, und sie machte Grüntee.
»Keinen Grassaft mehr?«, fragte ich.
»Alles Betrug«, schnappte sie. »Trinke ich schon lange nicht mehr. Ich habe ein paar Studien dazu gelesen, und es ist nichts anderes als Katzengras, stell dir vor! Das, wovon die Katzen kotzen, das trinken wir. Weird!«
Na ja, ganz so ist es auch wieder nicht. Katzen fressen das Gras als Nahrungsergänzung, aber es stimmt schon, dass sie manchmal damit verschluckte Haarknäuel herauswürgen. Trotzdem gefiel mir der Spruch: Wir trinken das, wovon Katzen kotzen! Könnte ein Slogan werden.
»Ich werde vielleicht ein Buch über Hypochondrie schreiben«, sagte ich.
»Wow! Spannend. Verstehst du denn was davon?«
»Nicht viel. Aber ich kenne ein paar Leute, die man als Hypochonder bezeichnen könnte. Und nachdem du mir nach dem Poetry Slam so viel von deiner Spinnenphobie erzählt hast, und dass du glaubst, du könntest einen Herzfehler haben, weil deine Fingernägel so gebogen sind, und dass du jeden Morgen diesen Teststreifen benutzt …«
»Was soll das! Glaubst du etwa, ich bin eine Hypochonder?«
Eine Hypochonder? Hypochonderin2? Auch »der weibliche Hypochonder« klingt schon ziemlich seltsam. Muss mal bei der Emma-Redaktion anrufen, was die davon halten. Vielleicht sagt man offiziell Hypochondra. Klingt schön gruselig. Aber wahrscheinlich hat man sich keine Gedanken über die weibliche Form gemacht, weil es kaum weibliche Formen dieser … medizinischen Überinformiertheit gibt. Jedenfalls ist Karen die Einzige, die ich dazu zählen würde.
»Nein. Natürlich nicht. Aber du … ich dachte … es hatte den Anschein, als würdest du dich ganz gut mit Krankheiten auskennen.«
»Nicht mehr als jeder andere Mensch auch.«
Das kam mir irgendwie bekannt vor.
»Body-caring«, sagte sie und goss den Tee ein. »Ich lebe bewusst und kümmere mich darum, dass meine Zellen Licht, Luft und Liebe bekommen. Sauberes Wasser, Grüntee, Sojamilch, Tofu, Wildlachs, ungeschälter Reis, Brokkoli, Sesamknäckebrot … klingt das nach Hypochondrie? «
»Eigentlich nicht«, sagte ich, aber ich wusste auch nicht genau, wonach es wirklich klang.
»Ihr Deutschen seid viel zu verkopft. Alles wird in Frage gestellt, an allem müsst ihr herumnörgeln. Wenn man Grüntee trinkt, um seine Zellen zu schützen, kommt ihr mit irgendwelchen Studien, die beweisen sollen, dass schon mal einer, der Grüntee getrunken hat, an Krebs gestorben ist. Mind fuck!«
Hallo! Wir Deutschen! Geht das schon wieder los?
»Es könnte aber sein«, sagte ich freundlich, »dass es auffällig viele Wechsel in der alternativen Gesundheitsideologie gibt. Ich will jetzt nicht auf dem Grassaft herumreiten, aber letztes Jahr waren Mandeln angesagt, heuer sind sie verdächtig. Milch war mal ’ne prima Sache, heute verträgt sie der menschliche Körper nicht mehr, und von Lammnierchen und Rohmilchkäse will ich erst gar nicht anfangen.«
Karen lächelte dünn. »Ich weiß schon, wie du tickst, Honey. Du willst mich für dein Buch! Du hast nur dieses Thema im Kopf, und da passen plötzlich alle Leute perfekt hinein. Jeder wird ein Hypochonder, wenn man nichts als Hypochonder im Kopf hat.«
»Karen, lass doch diese Kinderpsychologie. Ich wollte dich nur fragen, weil du ein Internetcrack bist und einen Gesundheits-Blog hast und dich für Krankheiten interessierst. Vielleicht könnten wir zusammen etwas im Netz stöbern.«
Das gefiel ihr. Die Aussicht, im Netz zu stöbern, ist für einen Webfreak dasselbe wie ein Regenwurm für eine Forelle. Wir nahmen unsere Teetassen mit und gingen in ihr Büro.
Dort konnte man die Entwicklung eines Computerfreaks über die letzten Jahre verfolgen. In einer Ecke stand ein alter Power-Mac, daneben ein G3 mit einem dieser wunderschönen pfefferminzfarbenen Plastikgehäuse, zwei riesige Monitore und ein alter Laserdrucker, darüber stapelten sich Kartons, Verpackungen von Scannern, Hubs und Druckern. Wirf niemals eine Originalverpackung weg, das lernen Computerfreaks schnell. Denn einen Tag danach geht mit Sicherheit die dazugehörende Hardware kaputt. So als ob elektronische Maschinen Hypochonder wären, die erst dann erkrankten, wenn sie ihre Krankenkassenkarte verloren hatten.
Auf dem Schreibtisch stand ein nagelneuer Mac mit einem Flachbildschirm, so groß wie eine aufgeschlagene Tageszeitung. Neben der Tastatur stand eine Glasschale mit ein paar Muscheln, einer großen Amethystdruse und einem Bergkristall.
»Ich dachte, diese neuen Flatscreens senden keine schädlichen Strahlen mehr aus«, sagte ich. Denn ich erinnerte mich nur noch zu gut an die Zeiten, als die schweren Farbmonitore, so groß wie Bernhardinerhundehütten, in Redaktionen und Grafikbüros ständig mit Kristallen und Halbedelsteinen verziert worden waren – gegen die schädliche Strahlung.
»Man weiß nie«, sagte Karen. »Sicher ist sicher. Kristalle sind auf jeden Fall gut gegen jede Art von bad vibrations. Schaden wird’s auch nicht, denn irgendwelche Strahlung fliegt doch immer und überall rum. Außerdem sieht es doch hübsch aus.«
Ich fragte mich, ob ich nicht gerade eine spezielle Art der Hypochondrie entdeckte hatte, eine, die von der klassischen Medizin übersehen wird: Eine diffuse Angst vor diffusen Bedrohungen, denen mit ebenso diffusem Wissen und passenden Gegenmitteln zu Leibe gerückt wird. Wenn ich die ganzen Esotanten aus meiner Bekanntschaft als Leserinnen für das Buch gewinnen könnte, wäre es schon sicher auf der Bestsellerliste.
»Zuerst möchte ich wissen, wie viele Hypochonder es überhaupt in Deutschland gibt. Schließlich muss ich wissen, wie groß mein Publikum ist.«
»Lass uns mal bei Wikipedia nachsehen«, sagte Karen.
Der Eintrag war nicht sehr aufschlussreich.
Auf der Website, die für Internetfreaks inzwischen den großen Brockhaus ersetzt, erschien:
Hypochondrie (gr. hypochóndrion Gegend unter den Rippen) ist eine somatoforme Störung und bezeichnet nach den internationalen Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-IV eine psychische Störung, bei der die Betroffenen unter ausgeprägten Ängsten leiden, eine ernsthafte Erkrankung zu haben, ohne dass sich dafür ein objektiver Befund finden lässt.
»Sehr interessant«, sagte ich, »so weit war ich auch schon. Und ich weiß auch, dass man als Synonym der eingebildete Kranke oder – etwas abwertender – der Simulant sagt.«
»Es geht ja weiter. Hier steht, dass im Alltagssprachgebrauch unter Hypochondrie eine von Angst dominierte Beziehung zum eigenen Körper und zu dessen Funktionieren verstanden wird. Die Betroffenen sind um ihre Gesundheit besorgt, achten vermehrt auf geringe Veränderungen von Körperfunktionen und interpretieren auch geringfügige Körpersignale als möglichen Ausdruck schwerer Erkrankungen.
Eine übertriebene Selbstbeobachtung führt oft zu häufigen Arztbesuchen, wobei auch ausführliche und wiederholte Untersuchungen keine körperliche Ursache der Beschwerden ergeben. Der Hauptgegenstand der Befürchtungen ist meist über längere Zeit konstant, beispielsweise Angst vor Krebs (Karzinophobie), vor AIDS oder die Angst, überhaupt zu erkranken (Nosophobie), wobei alltägliche körperliche Wahrnehmungen als Krankheitszeichen fehlgedeutet werden.
Man spricht laienhaft von einer eingebildeten Krankheit, als ob Hypochonder ›nichts‹ hätten. Tatsächlich erleben Hypochonder Missempfindungen, aber die Bedeutung, die sie ihnen überbesorgt beimessen, erscheint der Umgebung nicht nachvollziehbar, und Heilfachkundige können gewöhnlich keine auffälligen Organbefunde feststellen. Typischerweise haben die Betroffenen bereits viele medizinische Untersuchungen hinter sich und wechseln häufig den Arzt. Das nennt man dann Doctor Hopping oder Doctor Shopping.«
»Aha, und beim Doctor Shopping geht man wahrscheinlich ins Ärztehaus und kauft sich einen. Wenn das alles ist, was zu Hypochondrie zu sagen ist, werde ich ziemliche Schwierigkeiten haben, daraus ein Buch mit 300 Seiten zu stricken.«
»Aber es ist ein Anfang«, sagte Karen und druckte mir den Wikipedia-Eintrag aus.
Stimmt, ein Anfang war es. Die dürren Daten sammelte ich an diesem Nachmittag in einer Plastikmappe, die sich nach und nach mit Karens Ausdrucken füllte.
Wir erfuhren eine ganze Menge, zum Beispiel, dass Harald Schmidt nicht der einzige prominente (und bekennende) Hypochonder ist. Sein Kollege Jürgen von der Lippe ist ebenfalls ein begeisterter Körperbeobachter. Bei Beckmann verriet er der Öffentlichkeit, wie er gewöhnlich mit Ärzten umgeht: »Damit muss der Arzt leben können, dass ich ihm erkläre, was ich gerade habe und welche Therapie ich erwarte.« Und zu der berüchtigten, Männern wie Hypochondern nachgesagten Wehleidigkeit: »Ich bin nicht wehleidig, ich möchte nur keinen Zweifel an der Schwere der Krankheit lassen.«
Es scheint unter professionellen Spaßmachern überhaupt jede Menge Hypochonder zu geben, oder vielleicht trauen die sich zumindest, das öffentlich zuzugeben. Ich glaube ja, dass diese spezielle Sichtweise der körperlichen Befindlichkeit auch unter Rockmusikern häufig vorkommt, ebenso unter Schauspielern, Autoren, Ornithologen, Parfümerieverkäuferinnen, Politikern und Ärzten. Kaum antreffen wird man Hypochonder dagegen unter Managern der Deutschen Bank, Polizisten, Metzgern und Inhabern von Imbissbuden. Warum? Meine ganz persönliche Meinung, aber wie Karen sagt: »Wenn du vom Bauch raus das Gefühl hast, stimmt es meistens.« Schrecklich, wie Amerikaner, kaum sind sie der deutschen Sprache mächtig, gleich die schlimmsten Sprachsünden aufgreifen müssen.
Zurück zu den prominenten Spaßmachern: Charlie Chaplin war auch ein Hypochonder und hatte ständig Angst vor Halsweh und Erkältung, ließ schon beim kleinsten Windhauch alle Fenster schließen und wickelte sich bis zur Nasenspitze in Decken ein. Alka-Seltzer war sein Hausmittel, das er grundsätzlich vorbeugend nach dem Abendessen einnahm. Woody Allen gar macht aus seiner Hypochondrie die besten Filmgags und definiert seine Krankheitsangst so: »Ich bin kein Hypochonder, ich bin ein Alarmist!«
Einigermaßen verbürgt ist, dass auch Gaius Caesar Augustus Germanicus – besser bekannt als Caligula – dazugehört hatte, obwohl man ihn nur schwerlich als Spaßmacher bezeichnen kann. Neben einer starken Hypochondrie zeichnete er sich hauptsächlich durch ein großes Interesse an Folterungen und sexuellen Ausschweifungen aus. Diktatoren und Staatsmänner waren anscheinend ziemlich oft Hypochonder, wahrscheinlich ausgelöst durch einen verdrängten Angstkomplex, das »Schicksal« würde sie für ihre Untaten mit grässlichen Krankheiten bestrafen. Einigermaßen gesichert ist eine solche Disposition bei Friedrich dem Großen (Staatsmann), Adolf Hitler (Diktator), George Washington (Staatsmann), Nicolae Ceau ̧sescu (Diktator) und Winston Churchill (Staatsmann).
Das hätte man dem britischen Löwen gar nicht zugetraut, dass ausgerechnet er ein kleiner Hypo war, wirkte er doch körperlich eher wie ein großer, allerdings eher ein Hippopotamus. Und er richtete auch nicht an seinen Hausarzt die legendären Worte: »I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat!«3, sondern schwor mit dieser Antrittsrede als britischer Premierminister die Engländer auf einen verlustreichen Krieg ein. Trotzdem litt dieser Krieger an diffusen Ängsten, nicht nur vor Erkältungen und Grippeviren, sondern auch davor, von einer Bahnsteigkante oder einer Schiffsreling abzustürzen, außerdem hatte er ziemliche Flugangst. Von ihm sind die hypochondrischen Worte überliefert: »Ich fliege ungern durch Wolken, es könnten Berge dahinter sein.«
Der Schriftsteller Italo Svevo lebte in ständiger Krankheitsfurcht und ließ sie auch seine literarischen Gestalten erleben, etwa Zeno Cosini, der sich immer wieder das Rauchen abgewöhnen will. Bei vielen Autoren ist man nicht sicher, ob die Hypochonder, die sie beschreiben, nicht Abbilder ihrer selbst sind, so etwa bei Philip Roth, der in Portnoys Beschwerden oder Everyman die Gedanken seiner Figuren fast lustvoll um Krankheit und Tod kreisen lässt. Thomas Bernhardt und Elfriede Jelinek decken die österreichische Hypochonderfamilie ab.
Hans Christian Andersen litt in seinem Leben unter vielen Krankheiten, aber auch unter märchenhaften Ängsten, wie der Angst vor Licht und Feuer, vor Überfällen, Tunneln, Hunden, Infektionen, dem Wahnsinn und der Angst, lebendig begraben zu werden. Émile Zola erzählte jedem, der es nicht hören wollte, von seinem beginnenden Herzleiden, dem Entstehen einer Blasenkrankheit und den Gefahren des Gliederrheumatismus. Tennessee Williams, Adalbert Stifter, Franz Kafka, Franz Grillparzer und Rainer Maria Rilke waren ebenso begeisterte Beobachter der eigenen Körperlichkeit. Thomas Mann konnte seine Krankheitsängste literarisch zwar schön verarbeiten, etwa im Zauberberg oder dem Tod in Venedig, aber in seinen Tagebüchern liest es sich eher banal:
24.12.1951: Beim Frühstück heftiges Verschlucken. Konnte kaum wieder zu Atem kommen.
25.12.1951: Morgens fieberfrei. Schwarze Zunge zum Zeichen der Infektion. Leichte Schädelschmerzen. Sehr matt.
29.12.1951: 10 Uhr zu Doktor Wolf zur Untersuchung. Natürlich liegt organisch nichts vor. Für Mittwoch Erprobung des Verdauungstrakts angesetzt – notorisch lästig und bestimmt überflüssig, da alles nervös und psychisch.
Aber es waren nicht nur Schriftsteller, die Hypochondrie war (und ist) bei den unterschiedlichsten Berufen zu Hause, bei Malern wie Andy Warhol, Musikern wie Glenn Gould und Michael Jackson, sogar bei Philosophen. Immanuel Kant hatte immerhin einen einleuchtenden Grund für seine Hypochondrie, und als Philosoph erkannte er diesen auch und nahm ihn zum Anlass, sich über die Grillenkrankheit Gedanken zu machen:
»Die Schwäche, sich seinen krankhaften Gefühlen überhaupt, ohne ein bestimmtes Objekt, muthlos zu überlassen – mithin ohne den Versuch zu machen, über sie durch die Vernunft Meister zu werden – die Grillenkrankheit (hypochondria vaga), welche gar keinen bestimmten Sitz im Körper hat, ein Geschöpf der Einbildungskraft ist, und daher auch die dichtende heißen könnte – wo der Patient alle Krankheiten, von denen er in Büchern liest, an sich zu bemerken glaubt, – ist das Widerspiel jedes Vermögens des Gemüths, über seine krankhaften Gefühle Meister zu sein, nämlich Verzagtheit, über Übel, welche Menschen zustoßen könnten, zu brüten, ohne, wenn sie kämen, ihnen widerstehen zu können; eine Art von Wahnsinn, welche freilich wol irgend ein Krankheitsstoff (Blähung oder Verstopfung) zum Grunde liegen mag, der aber nicht unmittelbar, wie er den Sinn affici, gefühlt, sondern als bevorstehendes Übel von der dichtenden Einbildungskraft vorgespiegelt wird; wo dann der Selbstquäler (Heautontimorumenos), statt sich selbst zu ermannen, vergeblich die Hilfe des Arztes anruft, durch die Diätetik seines Gedankenspiels, belästigende Vorstellungen, die sich unwillkürlich einfinden, und zwar von Übeln, wider die sich nichts veranstalten ließe, wenn sie sich wirklich einstellten, aufheben kann.«
Nach diesem Satz (Sie haben recht gelesen, es war nur ein Satz; wahrscheinlich schreiben nur Hypochonder solche Sätze, so wie Thomas Mann und Thomas Pynchon) war mir ein klein wenig schlecht. Ich nahm eine Alka-Seltzer, und Karen (»Du hast einen Flüssigkeitsmangel! Dehydrated!«) ging in die Küche, um eine Tasse Instant-Miso-Suppe zuzubereiten. Ich las inzwischen vorsichtig weiter beim großen deutschen Denker, dessen tapfere Streitschrift gegen die Grillenkrankheit mit einem ziemlich übel riechenden Eigenlob endet:
»Ich habe wegen meiner flachen und engen Brust, die für die Bewegung des Herzens und der Lunge wenig Spielraum lässt, eine natürliche Anlage zur Hypochondrie, welche in den früheren Jahren bis an den Überdruß des Lebens grenzte. Die Beklemmung ist mir geblieben; denn ihre Ursache liegt in meinem körperlichen Bau. Aber über ihren Einfluß auf meine Gedanken und Handlungen bin ich Meister geworden, durch Abwendung der Aufmerksamkeit von diesem Gefühle, als ob es mich gar nicht anginge.«
»Tough guy!«, sagte Karen, denn eine Instant-Miso-Suppe dauert nicht lange.
»Na ja, geht so. Ich finde es schrecklich eitel, wenn man sich so darstellt. Wäre er halt Hypochonder geblieben. Aber immer diese Willensnummer, wenn ich schon daran denke: Der gute Wille ist allein durch das Wollen gut! Schönen Dank.«
»Ein deutscher Denker eben«, sagte Karen und streute etwas grünliches Pulver in meine Suppe.
»Was ist das denn?«
»Seaweed flakes – getrocknete Meeresalgen aus der Bretagne.«
Ich las das Etikett auf dem Glas. Es enthielt eine fett gedruckte Warnung: »Von Natur aus hoher Jodgehalt. Eine übermäßige Zufuhr kann zu Störungen der Schilddrüsenfunktion führen.«
»Willst du mich umbringen?!«
»Es ist gesund!«
»Man kann doch einem Gast nicht einfach ungefragt Arzneimittel ins Essen kippen!«
»Hier steht: Empfohlener Tagesbedarf: 3,5 gehäufte Esslöffel. Und das war gerade mal ’ne Prise, Honey!«
»Trotzdem.«
Ich war ärgerlich, denn ich fand, dass diese Diskussion uns nur von unserem Thema ablenkte. Aber es stimmt doch: Man kann sich ganz nebenbei mit solchen harmlosen Nahrungsergänzungsmitteln eine veritable Schilddrüsenüberfunktion einhandeln.
Wir recherchierten weiter im weltweiten Netz, fanden heraus, dass in Deutschland die Hypochonderdichte am größten ist, dass es hier sogar Kliniken für Hypochonder gibt und jede Menge Selbsthilfegruppen und Ratgeberforen.
Die Instant-Miso-Suppe schmeckte erbärmlich, und ich versuchte meine Schilddrüse zu spüren. Ich schluckte ein paar Mal, und das Gefühl wurde immer ein bisschen unangenehmer. Ich nahm ein Rennie, packte meine Unterlagen zusammen und verabschiedete mich.
Es schien eine Menge interessantes Material zum Thema Hypochondrie zu geben, aber ich war mir auch nach dem Abschied von Karen noch nicht sicher, ob ich das Buch wirklich schreiben sollte. Eine Stunde später wusste ich es.
Den Ausschlag gab meine Frau. Als ich ihr beim Abendessen vom Angebot meines Lektors erzählte, sagte sie nur: »Perfekt. Das ist ja dein Lebensthema. Vielleicht kriegst du damit sogar deine Hypochondrie in den Griff.«
»Wie bitte? Meine Hypochondrie!«
Es entspann sich eine emotional äußerst aufgeladene Unterhaltung, in deren Verlauf es immer klarer wurde, dass ich dieses Buch tatsächlich schreiben musste. Seltsam, bis zu diesem Zeitpunkt war mir nicht klar gewesen, dass mich irgendjemand auf der Welt als Hypochonder ansehen könnte.
Der Gabeltest für Hypochonder
»Eingebildete Übel gehören zu den unheilbaren.«
MARIE VON EBNER-ESCHENBACH
Als ich am nächsten Tag erwachte, fühlte ich ein unangenehmes Ziehen im linken Bein, außerdem brannte meine Zungenspitze. Als ich meiner Frau davon beim Frühstück erzählte, nahm sie mir wortlos die Kaffeetasse weg.
»Was soll denn das?!«
»Wenn du wieder dein Zungenbrennen hast, solltest du alle überflüssigen Reizungen der Papillen vermeiden.«
Meine Frau kennt sich medizinisch auch ziemlich gut aus, das muss man ihr lassen. Das mit den gereizten Papillen hat sie jedoch von mir. Ich hatte in den letzten Jahren öfter dieses seltsame Zungenbrennen, und eine Internetrecherche dazu erbrachte wenig Hilfreiches. Man hat dem Symptom einen englischen Namen gegeben, mehr ist in Wissenschaft und Forschung noch nicht passiert. Das Burning-Tongue-Syndrom könnte auf Schäden des peripheren oder zentralen Nervensystems hinweisen, möglicherweise ausgelöst durch Herpes, Gewebeschwund (aber was hat den denn bitte ausgelöst?) oder vielleicht eine Reaktion auf Zahnersatz sein. Etwas sehr viel Konjunktiv, verehrte Mediziner!
»Es kann auch Stress sein«, sagte meine Frau, die leider Gedanken lesen kann.
»Stress? Ich habe keinen Stress.«
»Man kann sich Stress auch machen.«
»Willst du etwa schon wieder andeuten, dass ich ein Hypochonder bin?«
»Natürlich nicht. Du hast eben viel um die Ohren … die Steuererklärung und den Umbau, und jetzt auch noch dieses neue Buch.«
Stress, das ist für mich auch so eine typische Ausrede, die die moderne Medizin benutzt, wenn ihr nichts einfällt. Was man nicht alles kriegen kann von Stress: Durchblutungsstörungen im Gehirn, Angst, Müdigkeit, Gereiztheit, Aggressionen, Taubheit, Verwirrung, Konzentrationsschwierigkeiten, ja sogar Halluzinationen, dazu Übelkeit, Übersensibilität bei Lärm, Atemlosigkeit, Muskelschwäche, trockenen Mund, Magen- und Darmprobleme, Impotenz, Haarausfall, rote Augen, Herzstechen, Tinnitus, Gelenkschmerzen, sogar Bluthochdruck, Schlaganfall und Herzinfarkt, außerdem verminderte Kreativität, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Geistesabwesenheit, Essstörungen, Kopfweh, undefinierbare Schmerzen, Verdauungsprobleme, Durchfall und Verstopfung. Wenn ich das schon höre: Durchfall und Verstopfung! Da kann doch etwas nicht stimmen.
Aber – so weit mir der Pschyrembel versichert – Zungenbrennen gehört nicht dazu. Es wäre ja auch wirklich eine seltsame Reaktion meines Körpers, wenn er ausgerechnet auf der Oberfläche meiner Zunge neue Aspekte der medizinischen Entwicklung eröffnete.
Es ist ja nicht so, dass ich mit dieser Zunge nicht schon bei Ärzten gewesen wäre. Beim ersten – einem HNO-Arzt, was mir passend erschien – vor etwa fünf Jahren. Der besah sich die Zunge, fragte mich, ob ich rauchen und Alkohol konsumieren würde, was ich bejahte, und gab dann die diffuse Diagnose ab: »Sie wissen ja, das sind beides Zellgifte.«
»Und? Kommt daher mein Zungenbrennen?«
»Kann man nicht sagen. Gut ist es jedenfalls nicht.«
»Das Zungenbrennen?«
»Rauchen und Trinken.«
»Ach so.«
Dafür durfte er sich aber auch nur 265 Punkte4 gutschreiben, keine 20 Euro! Selber schuld. Ich hätte gerne mehr gegeben, wenn er eine vernünftige Antwort gewusst hätte.
Einer meiner damaligen Zahnärzte mutmaßte, ich hätte etwas zu Scharfes gegessen oder würde oft beim Chinesen essen (Glutamat! Siehe Anhang), was wiederum einen chinesischen Professor für TCM (Traditionelle Chinesische Medizin), bei dem ich danach vorstellig wurde, zum Lachen brachte. Er untersuchte die Zunge sehr genau, ließ dann flüssigen Stickstoff auf ein Ohrenstäbchen fließen und bestrich damit meine Zunge. Ich fragte ihn, ob das in China bei dieser Indikation üblich sei, da lachte er schon wieder und sagte, nein, das sei nicht üblich, aber er habe es eben mal ausprobiert. Ich hatte tatsächlich für ein paar Tage kein Zungenbrennen mehr; dann kam es jedoch wieder.
Chinesische Ärzte sind sowieso ein Wunder, aber darüber wird später noch Zeit sein zu berichten. Sie werden sich vielleicht wundern, warum ich vorhin von einem meiner damaligen Zahnärzte geschrieben habe. Es stimmt, es gab eine Zeit, da wechselte ich ziemlich häufig meine Zahnärzte, aber weiß Gott nicht grundlos.
Dafür muss ich etwas weiter ausholen: Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass ein Mensch heutzutage unbedingt vier wichtige professionelle Helfer braucht: einen guten Rechtsanwalt, einen guten Steuerberater, einen guten Hausarzt und einen guten Zahnarzt. Das ist quasi die Grundausstattung, ohne die geht es nicht. Was man sonst noch braucht, werde ich im Ärztekapitel erklären. Es gab also in meinem Leben eine Zeit, als mein langjähriger Zahnarzt beschloss, seine Kassenzulassung zurückzugeben, das heißt, er behandelte nur noch Privatpatienten. Nachdem ich – wie alle Autoren, Journalisten, Musiker und bildenden Künstler – Mitglied bei der Künstlersozialkasse bin, bedeutete das, dass ich in Zukunft meine Zahnarztrechnungen privat zahlen müsste. Und da hätte schon die Rechnung für eine Brücke einen Monatsverdienst aufgefressen. Also, leider, leider, denn es war ein sehr guter Zahnarzt, einer, mit dem ich vorhatte, gemeinsam alt zu werden, musste ich mir einen neuen suchen. Und das war nicht einfach.
Wenn man einen neuen Arzt braucht, gibt es eigentlich nur eine Strategie: Tipps von vertrauenswürdigen Menschen. Ärzte dürfen nämlich keine Werbung für sich machen, aber wahrscheinlich wäre auch das nicht hilfreich. Man könnte höchstens zu denen gehen, die am wenigsten mit aufgeblasenen Sprüchen Eindruck zu schinden versuchen. Ich stelle mir vor, wie spannend der Anzeigenteil unserer Tageszeitungen werden würde, wenn Ärzte werben dürften: Besuchen Sie die einladende Hautarztpraxis von Dr.Klenck! Schnelle und diskrete Diagnose aller gängigen Geschlechtskrankheiten. Wartezimmer in Séparée-Atmosphäre, amerikanische Magazine und 16:9-Flatscreen, auch DSF!
Dafür könnte man glatt auf lustige Kontaktanzeigen verzichten.
Ich holte mir also Tipps ein. Der erste Zahnarzt bespielte seine Patienten mit Meditationsmusik, hielt im Wartezimmer zerlesene Hefte über alternative Medizin bereit und hatte eine unglaublich gute Laune. Das war noch die Zeit, als Zahnärzte wirklich gut verdienten. Möchte zu gerne wissen, wie seine Laune heute ist. Er war bestimmt kein schlechter Arzt, aber er fummelte bei der Erstuntersuchung derart an den Zähnen herum, dass zwei filigrane Inlays heraussprangen und eines davon am Boden zerbrach.
»Die wären Ihnen sowieso bald von selbst herausgefallen«, sagte er munter und bereitete zwei neue Füllungen vor. Ein Kardinalproblem! Wer kann einem Arzt bei solchen kleinen Unfällen beweisen, dass es sein Fehler war? Meine Laune hatte sich getrübt, und als er beim zweiten Mal mit der Spritze in meine Zunge stach, beschloss ich, den nächsten auszuprobieren. Es blieb nicht bei einem, es brauchte ganze vier Kollegen, bis ich endlich bei meinem neuen (und hoffentlich letzten) Zahnarzt angelangt war. Der ist freundlich, souverän, zuverlässig, und er erklärt einem, was er gerade macht und wie man Zahnseide richtig verwendet – aber zum Zungenbrennen fällt auch ihm nichts ein.
Ich setzte mich also mit Zungenbrennen und einer Tasse Kamillentee an den Computer und konzentrierte mich auf mein neues Buchthema. Einige Tests für Hypochonder wurden angeboten, und ich machte spaßeshalber einen. Eine sehr schlichte Form der Wahrheitsfindung, denn statt dieses Tests hätte man die Leute auch fragen können: Sind Sie ein Hypochonder oder nicht? Aber ich bemühte mich, die Fragen ernstzunehmen und jede einzelne völlig ehrlich zu beantworten.
Sie werden es nicht glauben, aber nach diesem Test war ich ein hundertprozentiger Hypochonder! Lächerlich. Der wissenschaftliche Hintergrund dieser Erhebung schien mir doch sehr fraglich. Aber ich ärgerte mich trotzdem.
Später fand ich einen weiteren Test, mit dem man seine statistische Lebenserwartung berechnen konnte, und der war wirklich spannend. Er war zwar auf Schweizer abgestimmt (http://test.gesundheit.ch – Sie müssen Ihr Jahresgehalt auf Schweizer Franken umrechnen, doch das ist auch schon die einzig wirkliche intellektuelle Herausforderung), aber immerhin kam ich danach auf eine Lebenserwartung von 89 Jahren! Obwohl ich ein kleines bisschen geschummelt hatte. Aber ich machte den Test ein zweites Mal, ohne zu schummeln, und es waren nur zwei Jahre weniger. Das baute mich gewaltig auf und bewies mir, dass ich kein Hypochonder sein kann, denn welcher Hypochonder wird so alt?
Gute Frage. Ich merkte, dass ich überhaupt nicht wusste, wie alt Hypochonder im Schnitt werden. Ist das wissenschaftlich überhaupt untersucht? Das war also Punkt 1 auf meinem Recherchezettel.
Ich schickte Karen eine E-Mail, ob sie irgendwo eine Studie zur Lebenserwartung von Hypochondern finden könne. Schließlich war sie seit gestern meine informelle Mitarbeiterin.5
Dann rief ich bei der Medizinisch-Psychosomatischen Klinik Bad Bramstedt an. Den Tipp hatte mir mein Hausarzt gegeben. Eine überaus freundliche Dame verwies mich an einen überaus freundlichen Oberarzt, der mich wiederum an eine überaus freundliche Psychologin weitergab. Mir war schon ein bisschen schwindlig von all der Freundlichkeit, die mir im Zusammenhang mit Kliniken völlig neu und etwas deplaziert vorkam. Aber ich fing mich und vereinbarte mit der Dame einen Interviewtermin in der Klinik, die nach Eigendefinition zu den »größten Kompetenzzentren Deutschlands für die Behandlung von Angststörungen, Essstörungen, Burn-out, depressiven Erkrankungen und Schmerztherapie« gehört. Hypochondrie nennt man hier übrigens »Gesundheitsbezogene Befürchtungen«. Ich bin mir nicht sicher, ob mir dieses Wort besser gefällt als das, an das mich meine Frau und mein Lektor gerade zu gewöhnen versuchen. Wie hört sich das an, wenn man sich vorstellt: »Guten Tag, mein Name ist Robert Griesbeck, ich leide an gesundheitsbezogenen Befürchtungen.«
Das Angebot der Klinik in Bad Bramstedt war kurz und knapp: Bei gesundheitsbezogenen Befürchtungen ist das Ziel der Therapie die Reduktion der Angst vor schweren Erkrankungen. Hier werden mit den Betroffenen Zwischenziele vereinbart, die sukzessive bearbeitet werden. Neben der Information zum Zusammenhang von Angst und Körperbeschwerden werden auch hier alternative Erklärungsmodelle erarbeitet, und die Patienten lernen langfristig wirksame angstreduzierende Strategien.
Danach ließ ich mir einen Termin bei meinem Lieblingszahnarzt geben und – auch das gehört zu einem richtigen Lieblingszahnarzt – bekam ihn noch am selben Nachmittag. Der Tag bekam Struktur.
Ich fuhr mit dem Fahrrad nach Schwabing, wo mein Zahnarzt praktiziert, und hatte noch gut zwei Stunden Zeit. Zuerst stöberte ich in einem modernen Antiquariat in der Theresienstraße nach medizinischen Fachbüchern. Die meisten hatte ich schon oder kannte sie wenigstens. Über Hypochondrie gab es nur Populärwissenschaftliches (und das hatte ich ja selber vor zu schreiben, also ignorierte ich die Konkurrenz), aber immerhin fand ich einen schönen Körperatlas von 1920, ein Buch über Entsäuerung und Heilfasten und Jörg Blechs Heillose Medizin. Mit dem Antiquar alberte ich etwas herum, und wir entwarfen eine Bücherliste für Hypochonder, die ich auf einem Zettel notierte.
Pschyrembel, de Gruyter, möglichst drei Ausgaben (Klinisches Wörterbuch, Handbuch Therapie, Naturheilkunde), inzwischen auch auf CD-ROM
»Der eingebildete Kranke« von Molière
»Oblomov« von Iwan Gontscharov
»Der Zauberberg« von Thomas Mann
»Tod in Venedig« von Thomas Mann
»Zeno Cosini« von Italo Svevo
»Everyman« von Philip Roth
»Portnoys Beschwerden« von Philip Roth
Alles von Sigmund Freud
»Leib und Leben« von Adolf Muschg
Alles von Thomas Bernhardt
Nichts von Peter Handke
»März« von Heinar Kipphardt
»Die Hypochonder/Bekannte Gesichter, gemischte Gefühle« von Botho Strauß
»Les Misérables« von Victor Hugo
Elfriede Jelinek
»Saturday« von Ian McEwan
»Die Geschichte, wie der kleine Tiger einmal krank war« von Janosch
Und dazu jede Menge Diät- und Gesundheitsbücher wie:
Kursbuch Gesundheit
Pfarrer Kneipps Hausapotheke
Die Homöopathische Hausapotheke
Der große ADAC Gesundheitsatlas
Bach-Blüten für innere Harmonie
Die Heilkraft des Wassers
Das Darmheilungsbuch
Urin-Therapie
Salto vitale
Yoga für Anfänger
Der Brockhaus Gesundheit
Bioenergetik
Krieg im Körper
Außerdem hat der interessierte Hypochonder ein paar Zeitschriften abonniert, etwa »The International Journal for Vitamin and Nutrition Research«, »pharmaJournal«, »Therapeutische Umschau«, »Apothekenrundschau« (natürlich, kann man jeden Monat in der Apotheke abgreifen, schöne kleine Pharma-Product-Placement-Postille, auch PPPP genannt), dazu die vielen Krankenkassen-Mitgliedermagazine, die man eintauschen kann wie Fußballerbildchen.
Was ich jedoch nicht empfehlen kann, ist Meyers Konversations-Lexikon, jedenfalls die 3. Auflage von 1878. Darin steht zum Thema nämlich Folgendes:
Hypochondrie(Hypochondriasis, griech., v. hypochondrium [s.d.], lat. Morbus eruditorum s. flatuosus), ein den Geisteskrankheiten nahestehendes Nervenleiden, welches sich vorzugsweise bei Männern findet, und über dessen eigentlichen Sitz jederzeit unter den Ärzten sehr verschiedene Meinungen obgewaltet haben. Bald sollte der Hypochondrie ein Gallenübel, bald Stockung und Verstopfung der Unterleibsgefäße und Drüsen zu Grunde liegen. Die eine medizinische Schule sah in der Hypochondrie einen Eingeweidekrampf mit übermäßiger Darmgasentwickelung, die andre ein organisches Gehirnleiden, eine dritte eine schleichende Entzündung der Darmschleimhaut.
Die Hypochondrie ist wesentlich in einer abnormen Thätigkeit der psychischen Funktionen begründet und bildet einen Übergang zu den eigentlichen Geisteskrankheiten. Der Beginn des hypochondrischen Leidens äußert sich etwa auf folgende Weise: Die Heiterkeit des Geistes wird gestört durch den sich bei jeder Gelegenheit aufdrängenden Gedanken an ein Leiden des eignen Körpers. Der Kranke bestrebt sich, den Sitz seines Leidens genau zu bestimmen. Magen und Darmkanal werden gewöhnlich zuerst für erkrankt gehalten, da sich der Hypochondrie schon im Beginn übermäßige Gasentwickelung in den Därmen hinzugesellt. Säurebildung im Magen stellt sich ein; der Stuhlgang ist meist fest, doch hier und da mit Diarrhöe abwechselnd. Nach dem Essen klagen die Kranken über Druck und Vollsein in der Magengrube, Spannung unter den Rippen. Abgang von Blähungen nach unten und nach oben erleichtert die Kranken bedeutend, wie auch das Erfolgen des Stuhlgangs. Der Schlaf ist unruhig, nicht erquickend. Das Aussehen ist noch gut, der Körper normal genährt, Appetit vorhanden, wenn auch oft unregelmäßig.
Ganz charakteristisch für die Hypochondrie ist das ungemein häufige Wechseln des Sitzes der eingebildeten Krankheit. Ein leichter Katarrh lenkt die Aufmerksamkeit des Kranken auf seine Lungen, er vergißt seine Unterleibskrankheit und fürchtet sich einzig und allein nur vor der Tuberkulose; er fühlt Schmerzen in der Brust, untersucht ängstlich seinen Auswurf und fragt häufig seine Umgebung, ob er nicht abmagere. Bald aber stellt sich öfters Kopfschmerz ein, leichter Schwindel, Hitze und Pulsieren der Arterien, lauter Zeichen, daß ein Schlagfluß auf dem Weg ist. Oder das Herz klopft eine Zeitlang stärker, die Brust ist beklemmt, daher die Furcht vor Herzerweiterung.
Der Kranke quält seine Umgebung, weil sie nicht genug Sorgfalt für den schwer Leidenden besitzt; Ärzte werden soviel wie möglich gebraucht und populär-medizinische Werke mit ängstlichem Eifer zu Rate gezogen, denn der Kranke will sich auf alle Weise vor dem Tod retten. Dieses nervöse Leiden kann jahrelang, ja das ganze Leben hindurch bestehen. Man darf es als festgestellt ansehen, daß gewisse körperliche Leiden allerdings bei der Hypochondrie vorhanden sind, und daß die von ihnen abhängigen abnormen Empfindungen den nächsten Anstoß zur Hypochondrie geben. Gewiß thut man den Hypochondern Unrecht, wenn man ihre Leiden nur ihrer Einbildung zuschreibt. Sie fühlen sich allerdings krank, aber die Ursache dieser Empfindungen läßt sich in der Regel nicht klar durchschauen oder steht doch wenigstens außer Verhältnis mit der Schwere des subjektiven Krankheitsgefühls.
Die Hypochondrie befällt fast nur das männliche Geschlecht vom Eintritt der Geschlechtsreife an, bei erblicher Beanlagung kommt sie sogar vor dieser Entwickelungszeit zum Ausbruch. Sie kann entstehen durch alle Einflüsse, welche schwächend auf das Nervensystem wirken. Starke Anstrengung des Geistes durch übermäßiges, besonders mit Nachtwachen verbundenes Studium disponiert dazu, zumal wenn gleichzeitig Mangel an Bewegung in der freien Luft hinzukommt. Handwerker mit sitzender Lebensweise sind der Hypochondrie oft unterworfen. Sorgen und Kummer, Heimweh und Liebesgram erzeugen die Hypochondrie ebenso häufig wie allzu reichliches Leben in Unthätigkeit und geschlechtliche Ausschweifungen. Fortgesetzte Überladung des Magens mit schwerverdaulichen, fetten Speisen, zu häufiger Arzneigebrauch, Schwächung des Magens durch Fasten u. dgl. rächen sich durch Hypochondrie. Dieselbe kommt häufiger in den nördlichen Ländern vor als in den südlichen; feuchtes, nebeliges Klima, wie das Englands, scheint ihr besonders günstig zu sein. In Zeiten von herrschenden gefährlichen Epidemien tritt die Hypochondrie sehr vermehrt auf; die Furcht vor der syphilitischen Krankheit, vor Vergiftung begünstigt sie.
Die Hypochondrie ist von großer Hartnäckigkeit und begleitet den Betreffenden oft bis an seines Lebens Ende. Sie schädigt die ethische und intellektuelle Persönlichkeit des Kranken durch die überreizte und übertriebene Vorstellung der körperlichen Leiden zu krassem Egoismus, sie hemmt die Leistungsfähigkeit bis zu teilnahmslosem Hinbrüten, sie zeitigt Lebensüberdruß und kann in wirkliche Verrücktheit oder Geistesschwäche übergehen. In jedem Fall ist geringe Aussicht auf dauernde Besserung vorhanden, namentlich ist bei der Hypochondrie, wie bei andern Geisteskrankheiten (s. Geisteskrankheiten), der Versuch, das Leiden mit Logik und Vernunftgründen zu bekämpfen, absolut aussichtslos. Der häufige Wechsel der Ärzte, das übermäßige Medizinieren, das Haschen nach neuen Mitteln und die zahllosen diätetischen Fehler sind meist Hindernisse einer erfolgreichen Behandlung und einer möglichen Heilung.