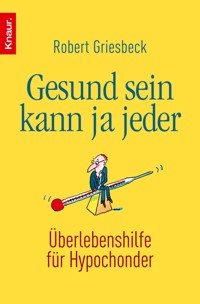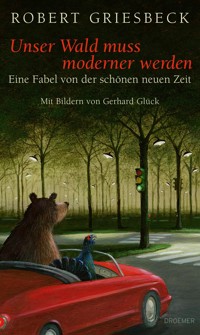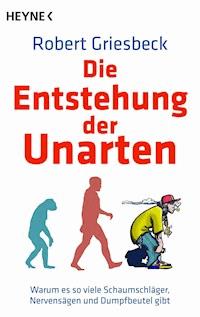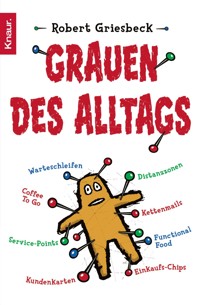
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Willkommen zur Geisterbahnfahrt durch das moderne Leben! Warteschleifen, Payback-Karten oder überdrehte Radiomoderatoren – das Grauen des Alltags hat uns fest im Griff. Brav befolgen wir die Anordnung einer automatischen Bandansage, lassen uns in »Distanzzonen« einpferchen und zu willigen Sklaven eines Systems machen, das die Selbstbedienung propagiert und immer mehr Arbeit an seine Kunden delegiert – aber seit wann arbeiten wir eigentlich für Banken, die Post oder den Discounter? Mit Wut und Witz erzählt Robert Griesbeck von den absurden Episoden unseres Alltags zwischen Konsum, Medien und Informationstechnologie – und entlarvt dabei aufs komischste eine Gesellschaft, die jede Menge heiße Luft produziert. Aber damit steigen ja bekanntlich die größten Ballons auf. Grauen des Alltags von Robert Griesbeck: Spaßmacher & Trendsetter im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 304
Veröffentlichungsjahr: 2009
Ähnliche
Robert Griesbeck
Grauen des Alltags
Von Kundenkarten, Warteschleifen, und Gute-Laune-Moderatoren
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Vorwort
1. Fürsorgliche Nachrichten auf Giften und Drogen
Haftung bei schwerer Dummheit
2. Auf Strich Überhockung – Die Kunst der Dichtung
Von der Deppenlyrik zum Werbeslogan
Die Globalisierung rasiert jede Sprache
3. Vorsicht, Lesen kann verrückt machen! – Packungsaufschriften, Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise
Bedienungsanleitungen
Die hohe Schule der Gebrauchs- und Bedienungsanleitungen
Opas Fernsehen
Sicherheitshinweise
Die Sesamstraße wird zensiert
4. Das Grauen in Supermärkten oder Der Ein-Euro-Münzen-abhängige Einkaufswagen als Arbeitsplatzvernichter
Kriminalität im Einkaufswagenmilieu
Die Weiterentwicklung des Ein-Euro-Münzenabhängigen Einkaufswagens
5. Der Kunde als Mitarbeiter
Do it yourself – aber zahl dafür!
Wie man – ganz nebenbei – die Arbeitslosenzahl erhöht
Arbeit mit und am Automaten
Beta-Tester – das neue Gesellschaftsspiel
6. »Sammeln Sie die Herzen?« – Doppelt abgezockt mit der Kundenkarte
Kundenkarten
Preisvergleich bringt mehr als Bonuskarten
Überblick bewahren
7. Service? Welcher Service?
Die neue Freiheit ist die neue Abhängigkeit
Der elektronische Kunde
Sicherheit und Bequemlichkeit?
8. McStaat oder McSchool? Die McDonaldisierung nimmt zu
McPiss – die Freiheit nehm ich mir!
9. »Einen Hazelnut-Iced-White-Vanilla-Coffee, aber bitte to go!« – Coffee-to-go und andere Peinlichkeiten
Kaffee und Kuchen
Top-Tasteless-Five
10. Der Baumarkt ist das Schuhgeschäft für den Mann
Amateure, olé!
11. »Alle unsere Plätze sind momentan belegt« – Von Callcentern, Warteschleifen und dem Knopf im Ohr
Warten mit Wagners Walküren
Hören Sie doch mal vor dem Piepton!
Das Tagesmenü: Sprachgesteuerte Weiterschaltung
Hotlines und die Hilflosigkeit der Helfer
Cold Calls und Hot Lines
Outsourcing global
Gute Unterhaltung dank Callcentern
»Sie haben gewonnen!« – Die Parole des 21. Jahrhunderts
Callcenter und Telefonmarketing
12. Urban Legends – Es geht eine Lüge auf Reisen
Telefonhysterie
Voll verseucht: Vor Tampons und Kebab wird gewarnt
13. Das Internet des Grauens – Kettenbriefe, Hoaxes und Pyramidenspiele
Make Money Fast: Gewinner werfen die Schneebälle – Opfer liegen unter der Lawine
Gier setzt das Gehirn matt
Sie haben Post!
Ausgerechnet: Schwarzgeld aus Schwarzafrika!
Große Fischzüge im globalen Goldfischglas
14. Das alltägliche Mediengrauen oder Am Weltasthmatag wird nicht gehustet!
Das versendet sich!
Pleiten, Pech und Pannen – Der TV-Alltag
Künstliche Aufgeregtheiten – Wann geht denn endlich einer?!
Fachleute, Spezialisten, Sachverständige und Betroffene
Wie man im Fernsehen viel Geld verdient
Abzockersender für Grenzdebile oder »Kennen Sie eine Automarke mit ›A‹?«
Nachtprogramm
Die Leute wollen es ja so!
Schreckliche Stimmen, schreckliche Menschen
Guten-Morgen-und-gut-drauf-Moderatoren
15. Distanzzonen oder »Wozu, glauben Sie, haben wir die gelben Striche auf den Boden gemalt?!«
16. Humor – Wie man wirklich ausgelassen wird oder Heiterkeit ohne Alkohol ist nur gekünstelt
Lustige Accessoires – Farbkleckse und Arme im Kofferraum
17. Das Glossar des Grauens
Nachwort: Die Formel des Grauens
Vorwort
Grauen und Heiterkeit liegen oft nah beieinander. Jeder, der schon einmal mit einem Telefonverkäufer plaudern durfte, von einem Laubbläser geweckt wurde, bei der Post eine Distanzzone verletzte oder sich in einer Warteschleife verfangen hat, weiß, wovon ich spreche. Als dieses Buch noch nicht mehr als eine Idee war, begann ich Beispiele des Alltagsgrauens zu sammeln. Später ordnete ich sie und machte eine erstaunliche Entdeckung: Das Grauen hat Methode. Aber welche?
Die Szenen des alltäglichen Irrsinns sind zwar unterhaltsam und witzig (manchmal allerdings auch erschreckend), aber sie beinhalten auch eine Botschaft: Sie spiegeln einen grundsätzlichen Wandel wider, der tagtäglich auf den unterschiedlichsten Ebenen spürbar geworden ist. Immer mehr Menschen fühlen sich entwurzelt und finden keinen Kontakt mehr zur eigenen Arbeit, zu Kunden und Kollegen, verzichten auf eigenständiges Denken, kopieren Lebensentwürfe aus dem Fernsehen und ersetzen die Realität durch Simulationen. Ich will keinen Kulturpessimismus verbreiten, aber ich will zeigen, dass das Grauen des Alltags keine zufällige Entwicklung darstellt.
Globalisierung und Turbokapitalismus drücken sich nicht nur durch die Verlagerung von Arbeit in Billiglohnländer aus, sie äußern sich auch in Ignoranz und Desinteresse an Kunden, in Hirnrissigkeiten und hohlem Wortgeklingel und jeder Menge heißer Luft – aber damit steigen bekanntlicherweise die größten Ballons auf. Des Kaisers neue Kleider sind der Dresscode für jeden, der in diesem Spiel mitmachen will.
Die Geschichten in diesem Buch ergeben in der Summe ein ebenso schreckliches wie komisches Bild von unserer Gesellschaft und führen zu vielen Fragen, unter anderem zu der: Hat menschliche Intelligenz vielleicht doch ein Verfallsdatum?
Robert Griesbeck
Seehausen am Staffelsee, 2008
1.Fürsorgliche Nachrichten auf Giften und Drogen
Sagen wir es mal so: Ich hatte von Anfang an so eine Ahnung, dass ich diesem gerade gelandeten Außerirdischen, der auf unserem Planeten soziologische Studien betreiben wollte und mich dazu interviewte, die Geschichte nicht plausibel machen konnte.
»Warum stehen auf den bunten Schachteln diese abscheulichen Drohungen?«
»Es sind Warnungen – keine Drohungen.«
»Gut. Man warnt Sie also davor, diese Schachteln zu kaufen. Aber Sie tun es trotzdem. Das ist doch etwas …«
»Sagen Sie es ruhig.«
»… etwas minderintelligent.«
»Man warnt uns nicht davor, diese Schachteln zu kaufen, man warnt nur davor, den Inhalt zu konsumieren. Sprich, die eingepackten Zigaretten zu rauchen.«
»Aha. Was kann man denn sonst noch mit diesen Schachteln anfangen?«
»Nichts. Man kauft sie nur, um sie zu öffnen, eine Zigarette herauszunehmen, sie sich anzuzünden und den Rauch einzuatmen.«
»Und das ist ungesund?«
»Sehr. Lange Zeit wusste man das nicht oder … na ja, man ahnte es. Aber inzwischen ist der Zusammenhang von Zigarettenrauch und Lungenkrebs recht gut erforscht. Und außerdem der Zusammenhang von Zigarettenrauch und vorzeitiger Hautalterung, möglicher Unfruchtbarkeit, Arterienverengung, chronischem Bronchialasthma und so. Aber das steht alles auf den Packungen.«
Mit diesen ergänzenden Warnhinweisen müssen die Zigarettenpackungen abwechselnd versehen werden:
Rauchen ist tödlich.
Rauchen kann tödlich sein.
Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu.
Schützen Sie Kinder – lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen!
Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle.
Rauchen lässt Ihre Haut altern.
Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben.
Raucher sterben früher.
Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht Impotenz.
Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen.
Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure.
Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an!
Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs.
Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein.
Hier finden Sie Hilfe, wenn Sie das Rauchen aufgeben möchten: 06221424200. Befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind.
Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen.
»Das hört sich ja einigermaßen gefährlich an.«
»Tja. Nur die Firmen, die Zigaretten herstellen, glauben noch nicht so ganz an diese Zusammenhänge.«
»Wie erstaunlich.«
»Dafür, dass Sie noch nicht so lange auf der Erde sind, sind Sie aber schon ganz schön sarkastisch.«
»Danke. Ich darf also zusammenfassen: Es gibt eine giftige Substanz, die, in genormten Portionen verpackt, von verschiedenen Anbietern in den Handel gebracht wird. Die Wissenschaft ist sich einig, dass der Konsum dieser Substanz dem Menschen schadet, ihn sogar töten kann.«
»So ungefähr könnte man das ausdrücken. Es ist natürlich eine sehr theoretische, kalte und vereinfachte Sichtweise … ach, ich habe ganz vergessen, dass der Staat auch etwas davon abbekommt.«
»Von den Zigaretten?«
»Ja. Er erhält eine finanzielle Abgabe für jede verkaufte Schachtel.«
Die Tabaksteuer ist ganz schön happig, dachte ich, so um die 76 Prozent, wenn ich mich nicht irre. Nicht ganz so viel wie beim Benzin, aber doch deutlich weniger, als der Staat von Büchern abbekommt. Das wunderte mich. Bedeutet das, der Staat unterstützt das Lesen? Oder ist diese Einnahmequelle so mickrig, dass er es sich leisten kann, bei Druckerzeugnissen gnädig zu sein und gerade mal 7 Prozent zu verlangen? Wenn man Außerirdische trifft, kommt man aber auch auf Gedanken …
»Sehe ich das also richtig, dass der Staat daran verdient, wenn sich seine Bürger umbringen?«
Schon wieder dieser Sarkasmus.
»Wenn Sie schon soziologische Studien treiben, sollten Sie das Ganze etwas komplexer sehen. Menschen haben schon zu allen Zeiten und in allen Kulturen Gifte in geschickt dosierten Mengen zu sich genommen. Das ist eine Tradition unserer Art. In Bayern trinkt man Bier, in Italien Wein, in Schottland Whisky, und die Schweden trinken alles, solange es nur Alkohol enthält. Und Alkohol ist ein ziemlich kräftiges Gift. Daneben gibt es noch Heroin, Tollkirschen, LSD, Haschisch, Fliegenpilze, Bilsenkraut, Psilocybin, Kokain, Peyote, Khat, Opium und …«
»Gut, gut. Ich glaube Ihnen schon, dass Sie viele gefährliche Gifte haben, die trotzdem frei verkäuflich sind, weil man sie ja mit Warnhinweisen versehen hat.«
»So einfach ist es leider nicht. Manche Gifte sind verboten, werden aber besonders geschätzt, weswegen sie sehr teuer sind und nicht offiziell gehandelt werden. Andere sind frei verkäuflich, aber nicht so teuer. Dann gibt es noch verschiedene Länder, in denen das eine verboten und das andere …«
»Erbarmen!«, unterbrach mich der Außerirdische und sah auf seine Armbanduhr. »Meine Zeit auf diesem Planeten ist sehr kurz bemessen. Bleiben wir also bitte bei den Zigaretten. Erklären Sie mir noch schnell, warum Menschen etwas kaufen, das eine Nachricht auf sich trägt, die besagt, dass sie dieses Etwas nicht konsumieren sollten.«
»Das werden Sie nie verstehen«, sagte ich. Mein Geduldsfaden war kurz vor dem Reißen. »Wir haben eben eine ganz andere Kultur!«
Im selben Moment war der Außerirdische verschwunden, und ich schämte mich unsäglich. Ich weiß ja, dass es dämlich ist zu rauchen, auch wenn ein paar gute Gründe dafür sprechen: Erinnerungen an die erste Zigarette zum Beispiel, schicke Werbung, etwas zum Festhalten für die rechte Hand, eine Daseinsberechtigung für teure Feuerzeuge und geklaute Aschenbecher, all so was.
Nein, diese Warnhinweise haben mit der Gefahr von Nikotin, Teer und Kohlenmonoxid nichts zu tun. Wer etwas herstellt, von dem er weiß, dass es Menschen umbringen kann, und das auch noch draufschreibt, um damit sein Gewissen zu beruhigen, ist ein Zyniker. Na gut, dann eben ein turbokapitalistischer Zyniker, obwohl das eine Tautologie ist. Die armen Kerle, die sich immer noch Zigaretten kaufen und diese schreienden Warnhinweise mit viel Aufwand ignorieren, indem sie sie unter bunten Aufklebern verstecken oder die Schachteln in neutrale Zweitschachteln stecken, sind eben arme Schweine. Es ist ihnen bestimmt peinlich, eine Stange Filterzigaretten zu kaufen, auf der in riesigen Bild-Lettern »Rauchen tötet!« steht. Aber das wahre Grauen sind die Leute, die sich solche »Kompromisse« ausdenken. Ernsthafte, verantwortungsvolle Politiker, die in einem Ameisenparlament sitzen und Ameisenideen aushecken. Wenn etwas gefährlich ist und man es nicht verbieten kann, weil mächtige Firmen und Lobbyisten sonst böse werden, behilft man sich mit einem Warnhinweis.
Als ich vor Jahren zusammen mit einem halben Dutzend europäischer Weinjournalisten eine Reise durch das amerikanische Napa Valley machte, kredenzte man uns zur Einstimmung auf einer Bootsfahrt vor San Francisco eine Flasche Champagner. Wir lagen kurz danach auf dem Boden, nicht weil uns der Schampus umgeworfen hatte, sondern vor Lachen. Allein vier »Warnhinweise« zählten wir auf dieser Flasche. Der lustigste war: »Don’t aim at eye while opening bottle« – »Richten Sie die Flasche beim Öffnen nicht auf Ihr Auge«. Als der schwer beleidigte Gastgeber uns zur Rede stellte, klopften wir ihm auf die Schulter und versicherten ihm, dass so etwas in »Good Old Europe« niemals passieren könnte. Dort bestehen die Menschen nämlich noch auf Eigenverantwortung und verklagen eine Burgerkette nicht auf eine Million Schadensersatz, wenn sie sich dämlicherweise selber eine Tasse heißen Kaffee auf den Schoß kippen. Ich möchte mich an dieser Stelle bei dem Herrn entschuldigen.
Das Gespräch mit dem Außerirdischen hat übrigens nie stattgefunden, es war nur ein Traum, den ich auf dem Flug nach Amerika hatte. Als die Stewardess mir zur Beruhigung (ich war schweißnass aufgewacht) einen doppelten Brandy eingoss, dachte ich daran, dass die Amis mit ihrer Prohibition auch nicht weit gekommen waren. Sie hatten gemerkt, dass Verbote nichts bewirken, und hatten stattdessen die Warnhinweise entwickelt. Allerdings erst nachdem ein paar große Firmen geblutet hatten. Als die Mutter des modernen Warnhinweises gilt die 1913 geborene Stella Liebeck, die sich im Alter von neunundsiebzig Jahren mit einem heißen Kaffee von McDonald’s die Oberschenkel verbrühte, als sie den Deckel des Kaffeebechers abnahm. Daraufhin verklagte sie den Hamburger-Multi. 1994 sprach ihr ein Gericht in Neu-Mexiko 160000 Dollar Schmerzensgeld und 480000 Dollar Schadensersatz zu. Ihren Anwälten gelang der erstaunliche Nachweis, dass McDonald’s den Kaffee heiß aufbrüht, so heiß, dass man sich damit verbrennen kann. Unglaublich! Seitdem trägt jeder Kaffeedeckel einen Warnhinweis. Und gleichzeitig entstand eine Flut von Warnhinweisen in aller Welt – nein, hauptsächlich natürlich in den USA, denn nur dort kann man für eigene Dämlichkeit solch horrende Summen einklagen. Ein Bread Pudding von Marks & Spencer erhielt den Aufkleber: »Product will be hot after heating« (»Produkt ist heiß nach Erhitzen«), auf einem Rowenta-Bügeleisen tauchte die international verständliche Warnung auf: »Do not iron clothes on body« (»Kleidung nicht auf dem Körper bügeln«), Fluggesellschaften beklebten die Nusstütchen, die sie als Ersatz für ausgefallene Menüs verteilten, mit dem Hinweis: »Vorsicht: Inhalt enthält Nüsse!«, und ein schwedischer Hersteller von Kettensägen klebte folgenden Warnhinweis auf seine Sägen: »Versuchen Sie nicht, die Kette mit bloßen Händen zu stoppen!« Aber das aufsehenerregende Kaffeeurteil der Stella Liebeck hatte noch einen anderen Effekt: Zu ihren Ehren wurde der »Stella Award« ins Leben gerufen, ein Preis, mit dem Personen geehrt werden, die in unberechtigter oder zumindest kurioser Weise gerichtlichen Schadensersatz erstreiten.
Im Flugzeug las ich die aktuellen Nominierungen für den Stella Award durch und bekam eine leise Ahnung davon, wie es wohl war, als zum ersten Mal jemand auf den Gedanken verfiel, ein Flugzeug zu entführen und den Kurs Richtung Heimat zu ändern. Es muss auf dem Weg in die USA gewesen sein – und wahrscheinlich hat er auch diese Liste gelesen. Heutzutage kann man ja nicht mehr einfach in die Pilotenkanzel gehen, den gestreckten Zeigefinger in die Sakkotasche stecken und den Rückflug befehlen. Es gibt nämlich »Spacesheriffs«, und die haben leider keine Warnhinweise auf dem Rücken kleben.
Haftung bei schwerer Dummheit
Wird für Dummheit gehaftet? Natürlich nicht. Das gibt es nur in den USA. Wenn hierzulande jemand Motoröl in den Autotank füllt und Benzin in den Motor, ist er selber schuld. Er ist zu doof. Man weiß eben, dass das Benzin in den Tank gehört und Öl in den Motor. Aber wer weiß bei einem Rasenmäher schon, in welche Öffnung Öl und in welche Benzin gehört? Wenn die Verschlüsse nicht bezeichnet sind und es keine Bedienungsanleitung gibt?
Und was tut man, wenn in der Bedienungsanleitung des Laserpointers steht, dass man auf keinen Fall die Batterie verkehrt herum einlegen darf, da sonst das Gerät beschädigt werden kann und die Garantie sofort erlischt? Wenn aber keine Markierung zu erkennen ist (nicht mal mit einer Lupe), die uns verrät, wo Plus- oder Minuspol hinkommen? Geht man das Risiko ein oder bringt man das Gerät zurück? Nimmt man die Demütigung auf sich, dass ein siebzehnjähriger Schnösel mit knietief hängender Hose lässig eine Batterie einlegt, den Laserpointer anknipst und – als er nicht geht – einfach die Batterie umdreht?
»Das hätte ich auch gekonnt.«
»Aber Sie haben es nicht gemacht.«
»Natürlich nicht. In der Betriebsanleitung steht, dass man auf keinen Fall …«
»Ach! Sie lesen die Betriebsanleitung?«
»Und dass die Garantie sofort erlischt …«
Der junge Verkäufer sieht mich nur mitleidig an. So wie man eine alte Frau ansieht, die ihren Führerschein auffrischen will und fragt, ob der starke Fahrtwind nicht vielleicht die Zündkerzen ausblasen könnte.
Schlampige Betriebsanleitung? Wer haftet? Fragen Sie lieber nicht! Mit einem guten Rechtsanwalt, viel Zeit, Geld und guten Nerven können Sie einen Hersteller haftbar machen, wenn die Bedienungsanleitung seines CD-Players missverständliche Anweisungen enthält und das Ding deshalb nicht mehr läuft. Aber trotzdem: Finger weg. Lieber beim Kauf darauf achten, dass neben dem CD-Player auch eine komplette und verständliche Bedienungsanleitung im Preis mit eingeschlossen ist. Und dass Sie das Batteriefach ohne Spezialwerkzeug öffnen können.
Kurz nachdem Stella Liebeck ihren spektakulären Prozess gegen McDonald’s gewonnen hatte, kursierten weitere wahnwitzige Beispiele amerikanischer Klageseligkeit; man vergab sogar die jährlichen Stella Awards, Preise für die verrücktesten Schadensersatzklagen. Anfangs waren das noch gut gemachte Fakes, doch seit 2002 gibt es die echten, von Rechtsanwälten gesammelten »True Stella Awards«, von denen einer 2007 durch alle Medien ging: Roy L. Pearson Jr., Richter aus Washington k.O., verklagte eine chemische Reinigung auf 65462500 Dollar Schadensersatz, weil sie ein Paar seiner Hosen verloren habe, das für ihn »einen besonderen, emotionalen Wert« habe. Am 25. Juni 2007 endete der Prozess mit einer Entscheidung zugunsten der Reinigung. Hier nun die schönsten Stella Awards aus der Zeit vor den »True Stella Awards«:
Eine zwar männerfeindliche, aber trotzdem amüsante Folgerung aus Stellas Kaffeeunfall war ein Urteil gegen eine Fluggesellschaft, die 100000 DM an eine leicht übergewichtige Frau zahlen musste. Ihr Hinterteil hatte sich auf der defekten Toilette im Flugzeug festgesaugt. Sie konnte nur befreit werden, nachdem der Kopilot seine Hand zwischen Toilettenbrille und Gesäß besagter Dame steckte, worauf der Unterdruck zischend entweichen konnte. Angeblich soll der Kopilot dabei anzüglich gegrinst haben, wodurch sich die Klägerin gedemütigt sah.
Im Januar 2000 sprach ein Gericht in Texas Kathleen Robertson 780000 Dollar zu, weil sie sich den Knöchel verstaucht hatte, als sie über ein kleines Kind stolperte, das in einem Supermarkt herumrannte. Dabei waren sich die Besitzer des Supermarkts sicher gewesen, dass sie nichts zahlen müssten, denn Kathleen Robertson war über ihr eigenes Kind gestolpert.
Im Juni 1998 erhielt der damals neunzehnjährige Carl Truman die Summe von 74000 Dollar zuzüglich Arztkosten zugesprochen, weil ihm sein Nachbar mit dem Auto über die Hand gefahren war. Dabei war Carl Truman gerade dabei gewesen, die Radkappen zu stehlen.
Dass Diebstahl in den USA einen besonderen Schutz genießt, zeigt auch das Beispiel von Terrence Dickson, der im Oktober 1998 in Pennsylvania durch die Garage in ein Haus einbrechen wollte. Wegen einer Störung im Öffnungsmechanismus des Garagentors war er nicht in der Lage, die Garage wieder zu verlassen – geschweige denn, ins Haus einzubrechen. Dummerweise waren die Bewohner in den Ferien (bekanntlich grundsätzlich ein Anreiz zum Einbruch) und kamen erst acht Tage später zurück. Der Einbrecher fand immerhin eine Flasche Cola und einen Sack Hundekuchen in der Garage und konnte somit überleben, aber er verklagte das Ehepaar prompt, nachdem sie ihn befreit hatten. Für die physische und psychische Tortur erhielt er 500000 Dollar Schadensersatz zugesprochen.
Deutlich weniger bekam Jerry Williams aus Arkansas, dem ein Gericht 14500 Dollar zuzüglich Arztkosten zugesprochen hatte, weil er vom Hund seines Nachbarn gebissen worden war. Der Hund war vielleicht etwas provoziert worden, nachdem Mr. Williams mit dem Schrotgewehr auf ihn geschossen hatte.
1997 gewann Kara Walton aus Delaware ihren Prozess gegen den Betreiber eines Nachtlokals. Sie hatte ihre Zeche von 3,50 Dollar prellen wollen, war durch das Fenster der Damentoilette ins Freie geklettert, dabei gestürzt und hatte sich zwei Zähne ausgeschlagen. Das Gericht sprach ihr immerhin 12000 Dollar Schmerzensgeld plus die Zahnarztkosten zu.
Herrliche Geschichten, aber am besten gefällt mir immer noch die Geschichte von Merv Grazinski aus Oklahoma City. Er hatte sich eins dieser grässlichen Motor Homes gekauft, kurz die Bedienungsanleitung durchgelesen und war damit nach Hause gefahren. Auf dem Highway stellte er den Tempomat auf 60 Meilen ein und ging nach hinten, um sich einen Kaffee aufzubrühen. Erwartungsgemäß fuhr das Motor Home in den Straßengraben und überschlug sich. Mr. Grazinski verklagte nun die Herstellerfirma, weil diese in der Bedienungsanleitung nicht ausdrücklich darauf hingewiesen hatte, dass ein Tempomat kein Autopilot ist und man während der Fahrt das Steuer nicht loslassen darf, um sich einen Kaffee zuzubereiten. Er erhielt tatsächlich 175 Millionen Dollar zugesprochen und ein neues Motor Home. Natürlich ließ die Herstellerfirma sofort die alten Bedienungsanleitungen zurückrufen und stattete sie mit einem Warnhinweis aus: Während der Fahrt nicht den Fahrersitz verlassen!
Wunderbare Geschichte, was? Leider ist sie nicht wahr, obwohl sie doch so schön ist und die amerikanische Mischung aus Naivität und Schlitzohrigkeit perfekt abbilden würde. Das ist ein weiteres Grauen des Alltags – die vielen World-Wide-Web-Ungenauigkeiten, unscharfen Nachrichten und Falschmeldungen, in der Internetsprache »Hoax« genannt.
Als Hoax (engl. hoax, altengl. hocus: Scherz, Falschmeldung) bezeichnet man Meldungen über Viren oder Internetgefahren, die es gar nicht gibt. Derartige Informationen werden in der Regel per E-Mail übermittelt. In einer solchen Mail wird dann beispielsweise ein Virus als sehr gefährlich eingestuft, und als »Beweis« werden angebliche Hinweise von Firmen wie IBM, Microsoft und AOL angeführt. Ein deutliches Indiz, dass es sich um eine Hoaxmeldung handelt, ist die Aufforderung, diese E-Mail schnellstmöglich an alle Bekannten weiterzuleiten.
Fakt ist, dass alle diese Warnungen keinen ernstzunehmenden Hintergrund haben. Es handelt sich eher um ein soziologisches Phänomen. Die eigentlichen Viren sind diese Scheinwarnungen selbst, die erheblichen Schaden anrichten: Sie verunsichern Menschen, kosten Arbeitszeit und belasten das Internet durch nutzlosen Datenverkehr. Echte Viruswarnungen werden nie auf diese Weise in die Welt geschickt!
2.Auf Strich Überhockung – Die Kunst der Dichtung
Besonders schön und grauenvoll zugleich ist es, wenn man zwei Schrecken der Neuzeit miteinander kombiniert: Hoaxes und Online-Translations, also Falschmeldungen und automatische Übersetzungen. Da findet man dann Texte wie diesen:
»Mit harte Tour Termine und viel Geld auf dem Spiel steht, It’s Not Unusual Sternen für ihren Körper zu versichern. So sollte es kommen keine Überraschung zu erfahren, dass Sir Tom Jones, 67, deren mop luxuriösen lockigen braunen Haare hat und ihm ein Hit mit den Damen, hat seine Brustbehaarung versichert – für die fürstliche Summe von £ 3.5 million!
Top Haus Versicherung Lloyd’s of London war an über das Angebot und nach anfänglichen Bedenken, dass es vielleicht zu viel beweisen, der ein Risiko, ging voraus.
›Wie ein Wein-Jahrgang, Tom nur mit dem Alter besser wird‹, sagt unsere Körperbehaarung Maulwurf.
›Selbst in den großen Alter von 67, die Damen lieben seine Hip-Stichwaffe bewegt und holt ein hinterhältigen Höhepunkt seiner berühmten robuste Brust Haar.‹«
Das ist der Pressetext zur Falschmeldung, der britische Sänger Tom Jones hätte bei Lloyd’s seine Brustbehaarung für 3,5 Millionen Pfund versichert.
Es ist eine neue Art der Unterhaltung, der ich mich seit ein paar Wochen mit wachsender Begeisterung hingebe: Man ruft eine beliebige Seite im Internet auf und lässt sie automatisch übersetzen. Der Spaßfaktor ist hoch, und man lernt obendrein viel über die Fallstricke lingualer Automatisierung. Zum Beispiel beim transparenten Fisch:
»Anknüpfend an meine Post vor drei Monaten über ›invisible brasilianischen fish‹ sieht es aus wie Wissenschaftler haben ein echtes transparent Fisch. Es ist nicht ganz eine unsichtbare Fisch, weil die inneren Organe sind sichtbar, aber es liegt nahe. Der Telegraph berichtet: Dr. White erstellt die transparente Fisch Paarung von zwei bestehenden Rassen. Zebrafisch haben drei Pigmente in der Haut reflektierend, schwarz und gelb. Dr. White tisches einer Rasse, die nicht reflektierende Pigment, genannt ›roy orbison‹, dass nicht mit einem schwarzen Pigment, genannt ›Perlmutt‹. Die Nachkommen hatten nur gelb Pigment in der Haut, vor allem klare Aussagen. White Namen der neuen Rasse ›casper‹, nach dem Geist. Wenn in einem Schaufenster, diese transparent Fische ziehen könnte wahrscheinlich so groß wie eine Menge Reichenbach ist unsichtbar Fisch.«
Besonders der letzte Satz ist ebenso kryptisch wie voller Poesie, aber man sollte daran denken, dass ganz viele Menschen auf dieser Erde den Text noch viel unverständlicher übersetzen würden. Irgendwann wird sie sicher funktionieren, die fast perfekte Übertragung jeder Sprache in jede andere – aber solange es noch nicht so weit ist, freuen wir uns doch an der Dämlichkeit des Status quo. Wobei nichts gegen Dämlichkeit zu sagen ist, aber wenn sie als Service angeboten wird, sollte sie schon den Mindestanforderungen eines Kindergartenabgängers entsprechen.
Man kann auch (bebend zwar, aber immerhin) hehre Texte durch die Online-Wurstmaschine laufen lassen. Shakespeare auf Deutsch hört sich dann so an:
»Sein oder nicht sein – das ist hier die Frage:
Ob’tis edleren in den Köpfen zu leiden
Die Schlingen und Pfeilen unverschämte Glück
Oder, um Arme gegen ein Meer von Problemen
Und durch die gegnerische Ende. Zu sterben, zu schlafen – –
Nicht mehr – und durch einen Schlaf zu sagen, dass wir Ende
Der Kummer und die tausend natürlichen Schocks
Das Fleisch ist Erbin. ’Tis ein Zustandekommens
Andächtig werden wollte. Zu sterben, zu schlafen – –
Zu schlafen – vielleicht zum träumen: ay, hier ist der Haken,
Für die in diesem Schlaf des Todes, was Träume kommen können
Wenn wir gemischt aus diesem sterblichen Spule,
Müssen uns Pause. Es ist der Respekt
Das Unglück macht so eine lange Lebensdauer.
Denn wer würde das Peitschen und verachtet der Zeit,
Th ’Unterdrücker falsch ist, der stolze Mann’s Hohn
Die Schmerzen der verachtet Liebe, das Gesetz der Verzögerung,
Die Unverfrorenheit des Büros, und die verschämt
Das Verdienst des Patienten th ’unwürdig ist,
Als er sich seinem Ende machen könnte
Mit einem nackten bodkin? Wer würde fardels tragen,
Um grunzen und Schweiß unter einem müden Leben,
Aber, dass die Furcht vor etwas nach dem Tode,
Das unentdeckte Land, von dessen bourn
Kein Paar zurück, das Rätsel wird,
Und macht uns vielmehr tragen diese Übel haben wir
Fliegen als andere, die wir nicht kennen?
So macht Gewissen Feiglinge von uns allen,
Und damit auch die native Auflösung des Farbtons
Ist sicklied o’er mit der blasse Besetzung des Denkens,
Und Unternehmen von großer Tonhöhe und Zeit
Mit dieser Hinsicht ihre Ströme schalten krumm
Und verlieren Sie den Namen der Aktion. – – Soft Sie jetzt,
Der Fair Ophelia! – – Nymphe, in deinem orisons
Werden alle meine Sünden erinnert.«
Sorry, William, aber das ist einfach zu gut. Hätte dir sicher auch Spaß gemacht. Man kann natürlich auch mit deutscher Literatur arbeiten. Ein kleines, bestens bekanntes Eichendorff-Gedicht ließ ich jüngst durch den Babelfish-Automaten wandern – nur einmal die Strecke Deutsch-Englisch und wieder zurück, und schon hatte ich diese charmante Variation:
»Wenn ein Lied in allen Sachen schläft,
träumt dort weg und weg,
und die Weltheber an zum zu singen,
treffen Sie nur das magische Wort.«
Das geht aber noch besser. Wenn man etwa den Umweg Deutsch-Englisch-Niederländisch-Französisch-Deutsch wählt, nähert sich das Ganze langsam der konkreten Poesie:
»Wenn ein Lied in jedem Sacheschlaf,
den Träumen dort Teile und Teile
und der Welt aufheben,
nur begegnet Sie das magische Wort zu singen.«
Das ließe sich endlos fortsetzen, aber es reicht, wenn man einmal über Portugiesisch geht und wieder zurück:
»Wenn Sie und Teile verlassen, entfernen Sie hier ein Lied in jedem Schlaf von,
was, die Träume und die Welt,
wenn Sie nur dem magischen Wort getroffen werden,
zum zu singen.«
Von der Deppenlyrik zum Werbeslogan
Mit seiner eigenen Muttersprache geht man weltweit sorgsam um. Es gibt keinen Bereich, in dem so schnell klar wird, ob es sich bei dem Gegenüber um einen Dummkopf oder einen wenigstens mittelmäßig gebildeten Menschen handelt, wie bei der Sprache. Man empfindet es als Bloßstellung, wenn man als Stolperer in der eigenen Sprache erscheint, man findet es aber fast ebenso schrecklich, wenn man gedrucktes Gestammel in der Muttersprache liest. Früher war es zum Beispiel üblich, dass »Traveller« (ja, so nannte man Menschen im Reisefieber schon vor der Globalisierung) in kleinen Restaurants und Cafés in Kreta, Tunesien, Indonesien, Kambodscha für ein kostenloses Abendessen die Speisekarten übersetzten. Und zwar mit Hingabe. Da gab es kein »halbes Hunchen gebackt aufs Reisbrett« oder »Nudelen mit Haselmaus« (weil »Moscardini« gleichzeitig auch eine besondere Art der Tintenfische meint). Heute macht man das per Internet, und die Übersetzungen sehen danach aus.
Vielleicht machen sich die Leute auch einen Spaß daraus, aber wahrscheinlicher ist, dass sie die globalisierte Serviceeinstellung übernommen haben, die da lautet: Es ist scheißegal!
Doch das sind ja nur sogenannte Gebrauchstexte; bei Werbetexten sollte man etwas mehr Intelligenz voraussetzen. Schlimm wird es, wenn Humor ins Spiel kommt. Zwanghaft lustig sind Werbeleute anscheinend immer, wenn der Etat besonders klein ist. Dann texten sie für die Vollkornbäckerei Mahlzahn: »Korn to be wild« und für Pennys Toilettenpapier: »Happy End« oder »Danke«.
Bei größeren Etats geben sie sich lyrisch-kreativ – und veranstalten oft dieselbe Lachnummer, jedoch ungewollt.
»Feinste Schweizer Schokolade. Nestlé Die Weiße macht es vor! Entdecken Sie das cremige Geheimnis weißer Schokolade, die jeden Genießer zum Schmelzen bringt. Und nun stellen Sie sich vor, Sie sitzen auf einem Gipfel in den Schweizer Alpen, die Sonne scheint und Sie lassen Nestlé Die Weiße auf Ihrer Zunge zergehen. So lecker und cremig kann weiße Schokolade sein.«
Nicht nur Schokolade, vor allem aus dem »Premium-Segment«, zergeht auf der Zunge, auch all die hochtoupierten Wortschaumkronen sind köstliches Lesefutter und treiben mir die Tränen in die Augen. Etwa dieser Beipackzettel einer »Komposition aus der Schell-Schokoladenmanufaktur«:
»Edelste Lagenschokoladen mit 42% Arriba Nacional-Bohnen aus dem Flussgebiet Rio Huimbi in Ecuador, kombiniert mit den feinen weißen Salzkristallen von SalMartins Selecção, dem aromatischen Flor de Sal, der Salzblume aus Portugal. Süß und salzig gehen eine spannende Symbiose ein. Die kräftigen Malz- und Karamellaromen der Schokolade, eine dezente Zitrusnote und die feinen Geschmacksnuancen naturbelassenen Salzes aus dem Atlantik ergeben eine faszinierende Schokoladen-Komposition.«
Mit derselben flotten Schreibe, mit der man die Geschmackspapillen umschmeichelt, kann man natürlich auch einen Schwangerschaftstest bewerben: »Die beste Innovation, auf die ein Urinstrahl treffen kann!«
Besonders global wird es, wenn kreative Texter international werden. Tautologie? Eigentlich ist das dasselbe – warum hat man das schöne Wort »international« bloß durch »global« ersetzt? Vielleicht, weil es politisch etwas anrüchig war, jedenfalls für Turbokapitalisten, die dabei immer an die Internationale denken. Ein deutscher Turnschuh schämt sich für seinen Namen und wird zum Sneaker, zum Outdoor-Schuh. Outdoor? Wohin geht man denn sonst in Schuhen? Stimmt, indoor. Aber das sind ja Hausschuhe.
Alle haben sich lustige amerikanische Slogans zugelegt, die zum Beispiel beweisen sollen, dass man auch in Herzogenaurach prima Englisch spricht: »Impossible is nothing«, meint Adidas, und man versteht schon, was die Franken gemeint haben. Obwohl jeder Englischlehrer dafür ein Mangelhaft geben würde. Aber die anderen »global players« sind nicht unbedingt besser:
Benq: Enjoyment matters
Burger King: Have it your way
DaimlerChrysler: Answers for questions to come
Davidoff: The more you know
Degussa: Creating essentials
Diesel: For successful living
Fujifilm: Inspired by your dreams
FujitsuSiemens: We make sure
Hasbro: Making the world smile
Hitachi: Inspire the next
Levi’s: Engineered Jeans
Lipton: Can do that
O2: O2 can do
Saab: Move your mind
SEG: Life inspires
Shell: Waves of change
Vodafone: Make the most of now
Seltsam hohl und holprig klingende Sprüche sind das, mit einem Erkenntnisgewinn nahe null. Aber sie klingen immerhin international, pardon – global. Sie sehen, es ist gar nicht nötig, »Come in and find out« von Douglas zu zitieren, den Kultslogan, der mit »Kommen Sie herein und finden Sie wieder heraus« kongenial übersetzt wurde. Es ist nicht nötig, aber es macht trotzdem Spaß.
Wenn wir schon beim Grauen der Werbesprüche sind, muss man zugeben, dass durchgestylte Werber auch auf Deutsch schönen Unsinn zustande bringen:
Amnesty International: Du kannst. Du darfst.
Aspirin: Etwas weniger Schmerz auf dieser Welt.
Biskin: Schließt alle Poren und hält den Saft zurück.
Bundeswehr: Eine starke Truppe. Hauptfach: Denken.
Deutsche Bank: Vertrauen ist der Anfang von allem. Die Zukunft kann kommen.
Deutsche BA: Die Zeiten ändern sich.
Deutsche Post: Fünf ist Trümpf.
Deutsche Telekom: Zukunft wird aus Ideen gemacht. Wir verbinden.
Die Bahn: Die Bahn kommt.
Du darfst: Ich will so bleiben, wie ich bin.
Vodafone: Alles bleibt besser.
Mein absoluter Liebling ist jedoch die Süddeutsche Klassenlotterie mit der unschlagbaren Erkenntnis: »SKL – Geld macht reich.«
Es reicht nicht, wenn etwas gut, bekömmlich und preiswert ist – es muss auch noch »Style« haben. Bei Mode, Handys, Schuhen und Unterhaltungselektronik kann ich das noch nachvollziehen – aber bei Wasser? Doch, das geht. Bei der Feinkostkette Plus gibt es das »Viva Vital Aqua Fresh Fitnesswasser Pfirsich« mit dem diätetischen Hinweis: »Die enthaltenen Kohlehydrate empfehlen sich für den bewussten Umgang mit Zucker.« Wow! Da können sich die hochnäsigen Delikatessläden in Hamburg-Pöseldorf warm anziehen, vor allem, nachdem der gute alte Fischmarkt aufgestylt wurde. Der heißt jetzt »Hamburg Food Market«, und dort kriegt man Althamburger Leckereien wie »Labskaus unplugged« und »Funky Pannfisch«. Ein weiterer Beweis, dass sich Regionalküche und Globalisierung aufs beste vertragen.
Die Globalisierung rasiert jede Sprache
Englisch ist auf dem Vormarsch. Die Globalisierung kennt anscheinend keine andere Sprache. Manager, Medienmenschen, Werber und »Kreative« reden untereinander und mit ihren Kunden Englisch, um zu beweisen, dass sie hip und global ganz vorne sind. Nur: Die Erde ist rund, und auf einer Kugel gibt es kein Vorne und Hinten. Aber zwei Extreme gibt es: die globalen Labertaschen und die deutsche Sprachpolizei, angeführt von einer strammen Phalanx von pensionierten Philologen. Beides extrem grauenhaft, so wie die meisten Extreme eben.
Wer kein Deutschlehrer und trotzdem gegen die Amerikanisierung der deutschen Sprache ist, steht automatisch als Globalisierungsgegner da. So sind etwa »Denglisch« und »Engleutsch« keineswegs Begriffe, die von fröhlichen Sprachpanschern stammen, sondern von ihren Gegnern. So auch BSE (Bad Simple/Silly English – schlechtes schlichtes Englisch), die vielleicht drastischste Bezeichnung innerhalb der linguistischen Kampfzone, denn immerhin weist sie besagte Mischformen als »Sprachkrankheiten« aus.
BSE ist eben doch ansteckend, nicht nur unter Rindern. Besonders gefährdet sind deutsche Manager. Die lieben es, sich in »Kick-off-Runden« gegenseitig in den Hintern zu treten. Nein, sie meinen damit natürlich Besprechungen, in denen Entscheidungen getroffen werden. Warum man sie nicht »K.o. Rounds« nennt oder wenigstens »K.o. Meetings«, ist mir unverständlich. Da sollte ich mal einen »Research« machen und nach dem »Scoring« ein »Ranking« zusammenstellen, wie ich mein »verbales Portfolio« optimal zusammenstellen kann. Firmen werden immer öfter rein verbal modernisiert, weil inhaltliche oder organisatorische Änderungen komplizierter wären. Ex-Siemenschef Klaus Kleinfeld wollte seinen Konzern mal »downsizen« (Personalabbau), und die Metro-Gruppe verpackte die Idee zu wachsen in den schönen Begriff »Rollout-Phasen«. Merke: Mit BSE wächst man besser.
Kein Wunder, dass mitunter drastisch gegen die vermeintliche Verunglimpfung der deutschen Sprache polemisiert wird. Aber ein interessanter argumentativer Kern liegt dieser Auseinandersetzung doch zugrunde, denn im Wesentlichen wird behauptet, dass schlechtes Englisch in all seinen Ausprägungen kein organisches Zufallsprodukt ist, sondern eine künstlich »hervorgerufene« Sprachgattung. Bei der Begründung verweist man gerne auf Platon, der sagte, Sprache sei nicht physis (Natur), sondern nomos (Vereinbarung, Konvention). Auch Jacob Grimm wird gerne herangezogen, denn bei ihm lesen wir: »Alles verbürgt uns, dass die Sprachen Werk und Tat der Menschen sind.« Das ist alles wahr, aber angesichts der jahrtausendelangen Entwicklung hochelaborierter Sprachen ist die Verdünnpfiffung schon etwas peinlich. Und sie lässt viel vom gedanklichen Tiefgang derer erahnen, die so sprechen.
Pen-ek Ratanaruang, ein thailändischer Regisseur, allerdings sieht einen kreativen Ansatz bei der »schlechten Sprache«: »Die Welt ist einfach so. Ich lebe so. Ich lebe in Bangkok, und trotzdem spreche ich die Hälfte des Tages schlechtes Englisch mit meinen Freunden. Und auch auf den Filmfestivals spreche ich schlechtes Englisch.« Für ihn ist schlechtes Englisch nicht nur eine charmante, sondern auch eine ganz neue Sprache, die er seine Schauspieler zu sprechen ermutigt hat, ohne vorher viel zu üben und ohne einen Sprachcoach zu konsultieren.
Für einen Regisseur wie Ratanaruang zeigt schlechtes Englisch, wie sich weltweit neue Identitäten bilden. Das ist die andere Seite: Man kann dem Deppen-Englisch auch philosophische Erkenntnisse abgewinnen, wenigstens soziologische.
3.Vorsicht, Lesen kann verrückt machen! – Packungsaufschriften, Gebrauchsanleitungen und Sicherheitshinweise
Wer lesen kann und gerne liest, wird leicht frustriert, wenn er zu viel liest. Oder das Falsche. Wer es einmal gelernt hat, Buchstaben schnell zu Wörtern zusammenzusetzen, Wörter zu Sätzen, Sätze zu sinnhaften Gedankengängen, der kann im Alltag schnell verzweifeln. Wenn er etwa Packungsaufschriften liest, Gebrauchsanleitungen oder Werbeslogans.
Packungsaufschriften zu lesen ist nicht ungefährlich. Es wundert mich, dass es die EU noch nicht durchgesetzt hat, dass vor jeder Packungsaufschrift dieser Pflichttext zu stehen hat: »Vorsicht. Wenn Sie diese Packungsaufschrift lesen, kann sich dadurch Ihre emotionale Befindlichkeit dramatisch ändern! Legen Sie nicht jedes Wort auf die Goldwaage, und glauben Sie nur die Hälfte. Welche, ist von Fall zu Fall leider unterschiedlich. Gewohnheitsmäßige 9Live-Seher sind von dieser Warnung ausgenommen.«
Ein paar dieser Gebrauchsanleitungen zeigen deutlich, was die Verfasser von der Intelligenz ihrer Leser halten:
Anweisung auf der Erdnusstüte einer US-Fluggesellschaft: »1. Päckchen aufreißen. 2. Nüsse verzehren!«
Hinweis auf einer Seifenverpackung: »Wie gewöhnliche Seife benutzen.«
Die Schachtel eines Fotoapparates belehrt: »Funktioniert nur mit eingelegtem Film.«
Ein Hersteller von Fieberthermometern empfiehlt: »Wenn dieses Thermometer rektal eingesetzt wird, sollte anschließend keine Messung im Mund durchgeführt werden.«
Ein amerikanischer Tamponhersteller erinnert seine Kundinnen in der Gebrauchsanweisung: »Letzter Schritt: Ziehen Sie nach dem Einführen des Tampons Ihren Schlüpfer wieder hoch.«
Bedienungsanleitungen
Natürlich ist es ein alter Hut, dass es keine speziellen Lektoren für Bedienungsanleitungen gibt. Wahrscheinlich gibt es nicht einmal Übersetzer dafür. Jedenfalls kann ich mir nicht vorstellen, dass alle Übersetzungen für die vielen Sammelbände lustiger Übersetzungsfehler getürkt werden. Nein, das hat System, und das System heißt: Es ist völlig egal – sie kaufen’s schon. Oder: Sie kriegen die Bedienungsanleitungen sowieso erst zu sehen, wenn sie das Zeug schon gekauft haben.