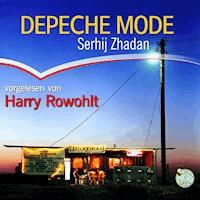12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der literarische Feuerwerker Serhij Zhadan verwandelt in seinem Roman das Industrierevier Donbass im Osten der Ukraine in eine fantastische Landschaft. Hier, am Rande Europas, wird der Traum von der Freiheit noch einmal ganz anders geträumt: als Suche nach Heimat inmitten der Grenzenlosigkeit.
Herman, ein junger Werbeunternehmer, wird von einem ominösen Anruf aufgeschreckt: Sein Bruder, der am Rande der Steppe eine Tankstelle betreibt, ist spurlos verschwunden. Am Ort des Geschehens trifft Herman auf die Angestellten seines Bruders, verliebt sich in Olha, die eigenwillige Buchhalterin, und versucht, die Tankstelle vor den Attacken eines einheimischen Oligarchen zu retten. Dabei wird ihm klar, dass weit mehr auf dem Spiel steht: nämlich das Glück und der Sinn des Lebens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Hermann, ein junger Werbeunternehmer, wird von einem Anruf aufgeschreckt: Sein Bruder, der am Rand der Steppe eine Tankstelle betreibt, ist spurlos verschwunden. Jemand muss dafür sorgen, dass die Geschäfte weiterlaufen. Am Ort des Geschehens, unweit der großen Straße vom Kohle- und Stahlrevier Donbass nach Charkiw, trifft Hermann auf die Angestellten seines Bruders. Er verliebt sich in Olga, die eigenwillige Buchhalterin, und versucht, die Tankstelle vor den Attacken eines örtlichen Oligarchen zu retten.
Die Gegend um die verstaubte Fabrikstadt, die einmal Woroschilowgrad hieß, wird in vielen Episoden des spannenden Romans poetisch aufgeladen. In einer seltsam surrealen Industrielandschaft, bevölkert von Kosaken und Tataren, nimmt auch die traumatische jüngere Geschichte Geistergestalt an. Zhadan entwirft ein Gegenbild zu Andruchowytschs Mitteleuropa-Mythos: sein versunkenes Atlantis ist der sowjetische Süden, die Kornkammer, die Steppe. Dieses letzte Territorium erweckt er zum Leben, aber nicht als Melancholiker, sondern als Anarchist: »die große Leere diesseits von Stalingrad« − das ist ein Raum grenzenloser Freiheit.
Serhij Zhadan, 1974 in Starobilsk/Gebiet Luhansk geboren, gilt als der wichtigste ukrainische Dichter seiner Generation. Er promovierte über den ukrainischen Futurismus und gehört zu den Akteuren der alternativen Kulturszene in Charkiw. Seit 1995 publizierte er zahlreiche Gedichtbände, seit 2005 auch Prosa. Bei Suhrkamp erschien zunächst seine in Wien entstandene Lyriksammlung Geschichte der Kultur zu Anfang des Jahrhunderts (2006). Es folgten die Romane Depeche Mode und Anarchy in the UKR (beide 2007), Hymne der demokratischen Jugend (2009) sowie der Prosaband Big Mäc (2011). Zuletzt erschien die von ihm zur EURO 2012 herausgegebene Anthologie Totalniy Futbol (Sonderdruck edition suhrkamp). Zhadan lebt in Charkiw.
Serhij Zhadan
Die Erfindung des Jazz im Donbass
Roman
Aus dem Ukrainischenvon Juri Durkot und Sabine Stöhr
Suhrkamp Verlag
Die Originalausgabe erschien 2010
unter dem Titel Vorošilovgrad bei Folio in Charkiw.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2012
© Suhrkamp Verlag Berlin 2012
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das der Übersetzung, des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
Umschlagfoto: Beat Schweizer/Anzenberger
ERSTER TEIL
1
Telefone existieren, um unangenehme Dinge mitzuteilen. Telefonstimmen klingen kalt und offiziell, mit offizieller Stimme lassen sich schlechte Nachrichten leichter überbringen. Ich weiß, wovon ich rede. Mein ganzes Leben habe ich gegen Telefonapparate gekämpft, aber ohne Erfolg. Immer noch werden in aller Welt Telefongespräche mitgehört und die wichtigsten Wörter und Ausdrücke auf Karteikärtchen notiert, und in Hotelzimmern liegen Bibeln und Telefonbücher – damit niemand vom Glauben abfällt.
Ich schlief angezogen. In Jeans und ausgeleiertem T-Shirt. Ich wachte auf, ging durchs Zimmer, stolperte über leere Limonadenflaschen, Gläser, Dosen und Aschenbecher, ketchupverschmierte Teller, Schuhe, zertrat mit bloßen Füßen Äpfel, Pistazien und fette Feigen, die Kakerlaken glichen. Wer möbliert mietet und in fremden Sachen wohnt, lernt mit Dingen achtsam umzugehen. In meiner Bude gab es allen möglichen Plunder, wie auf dem Flohmarkt, unter dem Sofa steckten Grammophonplatten und Hockey-Schläger, von irgendwem vergessene Frauenkleider und irgendwo aufgefundene große Verkehrsschilder aus Blech. Wegschmeißen konnte ich nichts, weil ich nicht wusste, was mir gehörte und was fremdes Eigentum war. Vom ersten Tag an, seit ich hier eingezogen war, lag der Telefonapparat mitten im Zimmer auf dem Boden, und sein Läuten und sein Schweigen schürten meinen Hass. Vorm Schlafengehen stülpte ich einen großen Pappkarton darüber, den ich morgens wieder zurück auf den Balkon brachte. Jetzt lag der teuflische Apparat mitten im Zimmer und ließ aufgeregt vibrierend wissen, dass mich jemand sprechen wollte. Donnerstag, fünf Uhr morgens.
Ich schälte mich aus der Decke, nahm den Pappkarton ab und ging mit dem Telefon auf den Balkon. Im Hof war es still und leer. Durch die Seitentür der Bank trat der Wachmann zu einer morgendlichen Zigarettenpause. Um fünf Uhr morgens angerufen zu werden bedeutet nichts Gutes. Ich unterdrückte meinen Ärger und hob ab. So hat alles angefangen.
– Kumpel. – Ich erkannte Kotscha sofort. Seine Stimme klang verraucht, als hätte man ihm alte gerissene Boxen implantiert.
– Harry, Freund, schläfst du? – Die Boxen ächzten und spuckten Konsonanten aus. – Harry, hallo.
– Hallo, – sagte ich.
– Freund, – fügte Kotscha mit mehr Bass hinzu. – Harry.
– Kotscha, es ist fünf Uhr früh. Was willst du?
– Harry, hör zu. – Kotscha verfiel in zutrauliches Fiepen. – Ich hätte dich nicht geweckt. Aber hier ist so ein Schlamassel, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Gestern hat dein Bruder angerufen.
– Und?
– Er ist weggefahren, Hermann. – Kotscha am anderen Ende hielt den Atem an.
– Weit weg? – An die Dynamik seiner Stimme konnte ich mich nur schwer gewöhnen.
– Weit weg, Hermann. – Wenn Kotscha einen neuen Satz anfing, schepperte es. – Nach Berlin oder nach Amsterdam, ich hab es nicht richtig verstanden.
– Vielleicht über Berlin nach Amsterdam?
– Vielleicht, Harry, vielleicht, – rasselte Kotscha.
– Und wann kommt er wieder? – Ich war erleichtert. Eine Routineangelegenheit, er wollte mir einfach Neuigkeiten aus der Familie mitteilen.
– Wie’s aussieht, nie, Harry. – Wieder schepperte der Hörer.
– Wann?
– Nie, Harry, nie. Er ist für immer weggegangen. Gestern hat er angerufen und mich gebeten, es dir auszurichten.
– Wie – für immer? – Ich verstand nicht. – Alles klar bei euch?
– Alles klar. – Kotscha zerriss es auf den hohen Tönen. – Alles klar. Nur dass dein Bruder mir alles vor die Füße geschmissen hat, kapiert?! Und ich, Harry, ich bin alt, ich pack das nicht allein.
– Wie – hingeschmissen? – Ich verstand immer noch nicht. – Was hat er gesagt?
– Dass er in Amsterdam ist, dass ich dich anrufen soll. Und dass er nicht zurückkommt.
– Und die Tankstelle?
– Und die Tankstelle hat er mir vor die Füße geschmissen, Harry. Nur pack ich das nicht allein. – Kotschas Krächzen wurde zutraulicher. – Ich schlafe schlecht. Siehst du, fünf Uhr morgens, und ich kann nicht schlafen.
– Ist er schon lange fort? – unterbrach ich ihn.
– Schon eine Woche. Ich dachte, du wüsstest Bescheid. Und jetzt so ein Schlamassel.
– Aber warum hat er mir nichts davon erzählt?
– Weiß nicht, Harry, keine Ahnung, Kumpel. Er hat niemandem was erzählt, ist einfach auf und davon. Wollte vielleicht nicht, dass jemand was spitzkriegt.
– Was spitzkriegt?
– Dass er abhaut, – erklärte Kotscha.
– Und wen interessiert das?
– Keine Ahnung, Harry, – wand sich Kotschas Stimme, – keine Ahnung.
– Kotscha, was liegt an?
– Harry, du kennst mich doch, – zischelte Kotscha, – ins Business hab ich mich nie eingemischt. Und er hat mir nichts erzählt. Ist einfach auf und davon. Vielleicht kommst du her und klärst alles an Ort und Stelle? Ich pack das nicht allein.
– Was soll ich denn klären?
– Weiß nicht, vielleicht hat er dir ja was gesagt.
– Kotscha, ich hab ihn seit einem halben Jahr nicht gesehen.
– Also, ich weiß nicht – Kotscha steckte jetzt endgültig in der Sackgasse. – Harry, Kumpel, komm, allein pack ich das hier nicht, versteh mich doch.
– Kotscha, laber nicht rum, – sagte ich schließlich. – Sag einfach, was Sache ist.
– Alles okay, Harry. – Kotscha hustete, – alles okey-dokey. Du weißt Bescheid, schau selbst. Ich muss jetzt, hab Kundschaft. Bis denn, Kumpel, bis denn. – Kotscha legte auf.
Kundschaft, dachte ich. Um fünf Uhr früh.
*
Wir hatten uns in zwei Zimmern einer alten, verlassenen Komunalka eingemietet, im Zentrum, in einem stillen, mit Linden bewachsenen Hof. Lolik wohnte im Durchgangszimmer, näher am Flur, und ich dahinter, mit Balkon. Die übrigen Zimmer der Komunalka waren fest verschlossen. Niemand wusste, was sich hinter den Türen verbarg. Die Zimmer hatte uns ein alter, störrischer Rentner vermietet, der frühere Inkassobeamte Fjodor Michailowitsch. Ich nannte ihn Dumbolewski. In den Neunzigern wollten er und seine Frau emigrieren, und Fjodor Michailowitsch frisierte seine Dokumente. Doch als er die neuen Papiere in Händen hielt, überlegte er es sich plötzlich anders und beschloss, dies sei der richtige Zeitpunkt, ein neues Leben zu beginnen. Also emigrierte seine Frau allein, und er blieb in Charkiw, angeblich um die Wohnung zu hüten. Infiziert von der Freiheit, vermietete Fjodor Michailowitsch uns die Zimmer und hauste selbst in irgendwelchen konspirativen Wohnungen. Küche, Flur und sogar das Bad dieser baufälligen Unterkunft waren vollgestopft mit Vorkriegsmöbeln, abgegriffenen Büchern und Stößen der Zeitschrift Ogonjok. Auf Tischen, Stühlen und auf dem nackten Fußboden türmten sich Geschirr und verschiedenfarbige Altkleider, an denen Fjodor Michailowitsch sehr hing und die wegzuwerfen er uns nicht erlaubte. Wir warfen nichts weg, und so gesellte sich zu dem fremden Plunder auch noch unser eigener. Schränke, Regale und die Schubladen des Küchentischs standen voll mit dunklen Flaschen und Einweckgläsern, in denen Öl und Honig glänzten, Essig und Rotwein, in dem wir unsere Kippen löschten. Über den Tisch hüpften Walnüsse und Kupfermünzen, Kronkorken und Knöpfe von Armeemänteln, Fjodor Michailowitschs alte Krawatten hingen an der Deckenlampe. Wir hatten Verständnis für unseren Vermieter und seine Piratenschätze, Leninfiguren aus Porzellan, schwere Gabeln aus falschem Silber, schmutzige Vorhänge, durch die buttergelb die Sonne brach und Staub und Luft aufwirbelte. Abends in der Küche lasen wir die Inschriften an den Wänden, die Telefonnummern, Adressen, Busrouten, die Fjodor Michailowitsch mit Filzstift direkt auf die Tapete gemalt hatte, wir betrachteten die an die Wand gepinnten Kalenderblätter und Porträts unbekannter Verwandter. Die Verwandten sahen streng und feierlich aus, im Unterschied zu Fjodor Michailowitsch selbst, der ab und zu in seinem warmen Nest auftauchte, in quietschenden Sandalen und geckenhaftem Käppi, er sammelte unsere leeren Flaschen ein, nahm sein Geld in Empfang und verschwand im Hof zwischen den Linden. Es war Mai, das warme Wetter hielt sich, und im Hof wucherte das Gras. Manchmal stahlen sich nachts Paare von der Straße herein und liebten sich auf der mit alten Flickenteppichen bedeckten Bank. Manchmal traten gegen Morgen die Sicherheitsleute heraus, setzten sich und drehten Joints, lang wie die Maimorgendämmerung. Am Tag kamen die Straßenköter, erschnupperten die Spuren der Liebe und rannten erregt zurück – auf die Hauptstraße der Stadt. Die Sonne ging direkt über unserem Haus auf.
*
Als ich in die Küche kam, drückte sich Lolik schon beim Kühlschrank herum. Er hatte seinen Anzug an – dunkler Blazer, graue Krawatte und unförmige Hosen, die an ihm herunterhingen wie eine Fahne bei Windstille. Ich öffnete den Kühlschrank und musterte die leeren Fächer.
– Hi, – sagte ich und ließ mich auf einen Stuhl fallen. Nervös setzte Lolik sich mir gegenüber, die Milchtüte fest in der Hand. – Weißt du was, lass uns zu meinem Bruder fahren.
– Wozu? – fragte er verständnislos.
– Einfach so. Mal nach dem Rechten sehen.
– Und was ist mit deinem Bruder, irgendwelche Probleme?
– Quatsch, alles okay. Er ist in Amsterdam.
– Du willst ihn in Amsterdam besuchen?
– Nicht in Amsterdam. Daheim. Vielleicht am Wochenende?
– Weiß nicht, – Lolik zögerte, – am Wochenende wollte ich das Auto in die Werkstatt bringen.
– Mein Bruder arbeitet doch in einer Werkstatt. Fahren wir!
– Weiß nicht, – Lolik war noch nicht überzeugt. – Ruf ihn doch lieber an. – Und fügte, als alles ausgetrunken war, hinzu: – Los, wir sind spät dran.
*
Im Laufe des Tages versuchte ich mehrmals, meinen Bruder anzurufen. Niemand nahm ab. Am Nachmittag wählte ich Kotschas Nummer. Genauso erfolglos. Komisch, dachte ich, mein Bruder nimmt vielleicht einfach nicht ab, wegen Roaming. Kotscha aber sollte bei der Arbeit sein. Ich wählte nochmal, wieder vergeblich. Abends rief ich unsere Eltern an. Mutter nahm ab. – Hallo, – sagte ich, – hast du mal wieder was von Juri gehört? – Nein, – antwortete sie, wieso? – Nur so, – antwortete ich und wechselte das Thema.
*
Am nächsten Morgen im Büro sprach ich wieder mit Lolik.
– Was ist, – sagte ich, – fahren wir?
– Ach was, – nölte Lolik, – hör auf, das Auto ist alt, das geht noch kaputt auf der Strecke.
– Lolik, – bedrängte ich ihn, – mein Bruder wird dein Auto generalüberholen. Komm, ich kann doch schlecht den Bummelzug nehmen.
– Und die Arbeit?
– Mach dich locker, morgen ist Samstag.
– Weiß nicht, – sagte Lolik wieder, lass uns mit Borja reden. Wenn der nichts dagegen hat . . .
– Gut, reden wir, – sagte ich und zog ihn ins andere Büro.
Borja und Ljoscha – Lolik und Bolik – waren Cousins. Ich kannte sie von der Uni, wir hatten zusammen Geschichte studiert. Sie hatten nicht die geringste Ähnlichkeit miteinander: Borja war ganz Funktionärssöhnchen, schlank und frisiert, trug Kontaktlinsen, ich glaube sogar, dass er sich die Nägel manikürte. Ljoscha war grobschlächtig und irgendwie zurückgeblieben. Er trug billige Bürokleidung, ging selten zum Friseur und hatte eine Brille mit Metallgestell auf der Nase, weil er für Kontaktlinsen zu geizig war. Borja wirkte gepflegter, Ljoscha zuverlässiger. Borja war ein halbes Jahr älter und fühlte sich für seinen Cousin verantwortlich. Eine Art Bruderkomplex. Er stammte aus einer angesehenen Familie, sein Vater hatte beim Komsomol gearbeitet, dann in irgendeiner Partei Karriere gemacht, war Leiter der Kreisverwaltung, später bei der Opposition. Seit ein paar Jahren hatte er einen Posten beim Gouverneur. Ljoscha hingegen entstammte einer einfachen Familie. Seine Mutter war Lehrerin, sein Vater wurstelte sich irgendwo in Russland durch, schon seit den Achtzigern. Sie wohnten in einem kleinen Ort in der Nähe von Charkiw, und so war Lolik eben der arme Verwandte, wofür ihn, wie er glaubte, alle liebten. Nach der Uni trat Borja gleich ins Geschäft seines Vaters ein, während Lolik und ich versuchten, selbst auf die Beine zu kommen. Wir arbeiteten in einer Werbeagentur, bei einem Anzeigenblättchen, in der Pressestelle des Nationalistenkongresses und betrieben sogar unser eigenes Wettbüro, das im zweiten Monat seiner Existenz pleiteging. Vor einigen Jahren begann Borja sich wegen unseres Herumkrebsens Gedanken zu machen, er erinnerte sich an unsere sorglose studentische Jugend und bot uns Arbeit bei sich, in der Verwaltung, an. Sein Vater hatte einige Jugendorganisationen auf seinen Namen registrieren lassen, über die verschiedene Fördergelder hereinkamen und regelmäßige kleine Summen gewaschen wurden.
Unsere Arbeit war schräg und stets unvorhersehbar. Wir redigierten Reden, leiteten Seminare für junge Führungskräfte, führten Wahlbeobachterschulungen durch, entwarfen Programme für neue politische Parteien, hackten Holz auf der Datscha von Boliks Vater, traten in Talkshows auf, wo wir die demokratische Wahl verteidigten, und wuschen, wuschen, wuschen Zaster, der durch unsere Bücher lief. Auf meiner Visitenkarte stand »Unabhängiger Experte«. Nach einem Jahr kaufte ich mir einen supergeilen PC und Lolik sich einen havarierten VW. Wir mieteten uns gemeinsam die Wohnung. Borja kam oft zu Besuch, saß in meinem Zimmer auf dem Fußboden und rief die Nutten an. Unter Kollegen. Lolik mochte seinen Cousin nicht und mich vermutlich auch nicht. Aber wir lebten schon seit ein paar Jahren Tür an Tür, unser Verhältnis war friedlich, sogar vertrauensvoll. Ich lieh mir Kleider von ihm, er sich Geld von mir. Mit dem Unterschied, dass ich die Kleider immer zurückgab. In den vergangenen Monaten hatten die Cousins irgendwas Neues gefunden, ein neues Familienbusiness, aus dem ich mich heraushielt, denn es handelte sich um Parteigelder, und keiner wusste, wie das enden würde. Meine Ersparnisse, ein Bündel Grüne, hielt ich von ihnen fern und bewahrte sie im Regal zwischen den Seiten eines Hegel-Bandes auf. Eigentlich vertraute ich ihnen. Andererseits wusste ich, dass es höchste Zeit war, mir eine normale Arbeit zu suchen.
*
Borja saß am Tisch über irgendwelchen Papieren. Vor ihm lagen Ordner mit Umfrageergebnissen. Als er uns sah, schaltete er schnell auf die Website der Gebietsadministration um.
– Ah, ihr seid es, – sagte er munter, wie es sich für den Chef gehört. – Na wie geht’s?
– Borja, – begann ich, – wir wollen zu meinem Bruder fahren. Du kennst ihn, oder?
– Ich kenne ihn, – antwortete Bolik und musterte seine Nägel.
– Morgen liegt doch nichts an?
Bolik überlegte, betrachtete wieder seine Nägel und faltete dann hastig die Hände hinter dem Rücken.
– Morgen ist frei, – antwortete er.
– Dann lass uns fahren, – sagte ich zu Ljoscha und ging zur Tür.
– Wartet, – stoppte mich Bolik. – Ich fahre mit.
– Wirklich? – fragte ich ungläubig.
Ich hatte keine Lust, ihn mitzunehmen. Soweit ich sah, war auch Lolik nicht begeistert.
– Ja, – versicherte Bolik, – lasst uns zusammen fahren. Ihr habt doch nichts dagegen?
Lolik schwieg mürrisch.
– Borja, – fragte ich ihn, – und was hast du davon, wenn du mitfährst?
– Einfach so, – antwortete Bolik. – Ich stör euch auch nicht.
Offenbar war auch Lolik von der Aussicht genervt, mit seinem Cousin zu fahren, der ihn immer an der kurzen Leine führte und keinen Moment aus den Augen lassen wollte.
– Aber wir fahren früh los, – versuchte ich den Befreiungsschlag, – so um fünf.
– Um fünf? – fragte Lolik.
– Um fünf! – stieß Bolik aus.
– Um fünf, – wiederholte ich und ging zur Tür.
Das sollen die ruhig unter sich ausmachen, dachte ich.
*
Im Laufe des Tages rief ich mehrmals bei Kotscha an. Keiner nahm ab. Vielleicht ist er tot, – dachte ich. Nicht ganz ohne Hoffnung.
*
Abends saßen Lolik und ich in der Küche. Hör mal, – begann er plötzlich, – vielleicht fahren wir besser nicht? Vielleicht rufst du nochmal an? Ljoscha, – antwortete ich bestimmt, – wir fahren doch nur für einen Tag. Am Sonntag sind wir zurück. Mach dir nicht ins Hemd. Mach dir selber nicht ins Hemd, – sagte Lolik. Okay, – antwortete ich.
Aber was hieß hier okay? Ich war 33 Jahre alt und lebte schon seit einer Ewigkeit glücklich allein, meine Eltern sah ich selten, zu meinem Bruder unterhielt ich eine normale Beziehung. Ich verfügte über einen Studienabschluss, der niemand interessierte. Arbeitete als wer weiß was. Mein Geld reichte für das, was ich gewohnt war. Für neue Gewohnheiten war es zu spät. Mir passte alles so, wie es war. Was mir nicht passte, blendete ich aus. Vor einer Woche war mein Bruder verschwunden, ohne Bescheid zu sagen. Das Leben war völlig in Ordnung.
*
Der Parkplatz war leer, und wir wirkten irgendwie verdächtig. Borja verspätete sich. Ich schlug vor zu fahren, aber Lolik wollte nicht, er ging zum Supermarkt, um sich einen Kaffee aus dem Automaten zu holen, er schloss Bekanntschaft mit den Wachleuten, die hier wohnten, direkt neben dem großen beleuchteten Gebäude. In der Morgenluft glommen die Schaufenster gelblich. Der Supermarkt glich einem havarierten Dampfer. Von Zeit zu Zeit überquerte ein Rudel Hunde den Parkplatz, sie schnüffelten misstrauisch am nassen Asphalt und drehten die Köpfe der Morgensonne zu. Lolik lümmelte sich in den Fahrersitz, rauchte eine nach der anderen und schnappte sich nervös sein Handy, um seinen Cousin herauszuklingeln. In letzter Zeit telefonierten sie überhaupt ziemlich oft, sie stritten sich ständig. Als ob sie sich nicht vertrauten. Der Cousin nervte Lolik, er wollte ihn in was hineinziehen. Ich riet Lolik, standhaft zu bleiben, aber die Aussicht auf leicht verdientes Geld machte ihn wehrlos. Seine finanziellen Machenschaften beobachtete ich mit Nachsicht und war froh, dass ich mich rausgehalten hatte.
Ich holte mir ebenfalls einen Kaffee, unterhielt mich mit den Wachleuten, fütterte die Hunde mit Kartoffelchips. Zeit loszufahren. Aber ohne seinen Cousin konnte Lolik nicht.
*
Er kam um die Ecke gebogen, schaute sich verzweifelt um und versuchte, die Hunde zu verscheuchen. Lolik hupte, Borja sah uns und rannte zum Auto. Die Hunde rannten ihm nach, die räudigen Schwänze eingezogen. Er machte die hintere Tür auf, sprang hinein. Er trug Anzug und Krawatte und ein grünes, ziemlich zerknittertes Hemd.
– Borja, – sagte Lolik, – was soll die Scheiße?
– Fuck, Ljoscha, – antwortete darauf Bolik, – halt deinen Rand.
Nachdem er auch mich begrüßt hatte, holte Bolik ein paar CDs aus der Jackentasche.
– Was ist das? – fragte ich.
– Ich hab uns ein bisschen Musik gebrannt, – sagte Bolik. – Für unterwegs.
– Aber ich hab meinen eigenen Player, – antwortete ich.
– Kein Problem, dann hören eben Lolik und ich.
Ljoscha verzog das Gesicht.
– Lolik, – lachte ich, – was ist, entscheidet jetzt schon dein Cousin, was für Musik du hörst?
– Er entscheidet überhaupt nichts, – antwortete Lolik beleidigt.
– Was ist es denn? – erkundigte ich mich.
– Parker.
– Nur Parker?
– Ja. Zehn CDs. Hab sonst nichts Gutes gefunden, – erläuterte Bolik.
– Arschloch, – sagte Lolik darauf, und wir fuhren los.
*
Der VW erzitterte von der Musik wie eine Konservenbüchse, auf die man mit einem Stecken schlägt. Borja auf dem Rücksitz lockerte den Knoten seiner Krawatte und musterte angestrengt die Plattenbauten. Nachdem wir das Traktorenwerk und den Basar hinter uns gelassen hatten, kamen wir endlich auf die Umgehungsstraße und verließen die Stadt in südöstlicher Richtung. Am Kontrollpunkt standen Verkehrspolizisten. Einer schaute träge in unsere Richtung und wandte sich, als er nichts Interessantes entdecken konnte, wieder seinen Kollegen zu. Ich versuchte, uns mit seinen Augen zu sehen. Ein schwarzer VW, Geschäftsfreunden abgekauft, Anzüge von der Stange, Schuhe aus der Kollektion des vergangenen Jahres, Uhren aus dem Ausverkauf, Feuerzeuge, die einem die Kollegen zum Geburtstag geschenkt hatten, Sonnenbrillen aus dem Supermarkt: solide, günstige Sachen, nicht zu abgetragen, nicht zu bunt, nichts Überflüssiges, nichts Besonderes. Keine Lust, solchen Heinis einen Strafzettel zu verpassen.
*
Rechts und links der Straße erhoben sich grüne Hügel, der Mai war warm und windig, Vögel flogen von Feld zu Feld und tauchten als schreiende Schwärme in die Luftströme ein. Vor uns am Horizont leuchteten helle Hochhäuser, über denen rot die Sonne brannte wie ein heißer Basketball.
– Wir müssen tanken, – sagte Lolik.
– Gleich kommt eine Tankstelle, – antwortete ich.
– Und was trinken, – ergänzte Boliks Stimme.
– Frostschutzmittel, – schlug sein Cousin vor.
An der Tanke gingen Borja und ich in den Laden und holten Kaffee, und während Lolik tankte, setzten wir uns draußen an einen der Plastiktische. Hinter dem Maschendraht begann ein Maisfeld. Das Maigrün, satt und klebrig, stach ins Auge und verätzte die Netzhaut. Auf dem Parkplatz drängten sich ein paar Laster, deren Fahrer offenbar gerade ein Nickerchen machten. Borja trat an den äußersten Tisch, nahm einen Plastikstuhl, wischte ihn mit einem Papiertüchlein ab und setzte sich vorsichtig. Ich setzte mich auch. Kurz darauf kam Lolik.
– Alles okay, – sagte er, – wir können fahren. Wie weit noch?
– Knapp zweihundert Kilometer, – antwortete ich. – In ein paar Stunden sind wir da.
– Was hörst du? – fragte Lolik und zeigte auf meinen Player, den ich auf den Tisch gelegt hatte.
– Alles Mögliche, – antwortete ich. – Warum kaufst du dir nicht auch so einen?
– Ich hab einen im Auto.
– Dann hör eben, was dein Cousin so mitbringt.
– Die Musik, die ich mitgebracht habe, ist okay, – erklärte Bolik beleidigt.
– Ich höre lieber Radio, – fügte Ljoscha von sich aus hinzu.
– An deiner Stelle würde ich mich nicht auf seinen Musikgeschmack verlassen, – sagte ich zu Lolik. – Man muss die Musik hören, die man wirklich mag.
– Ach Quatsch, Hermann, – widersprach Bolik. – Man muss sich aufeinander verlassen. Stimmt’s, Ljoscha?
– Mhm, – antwortete Lolik unsicher.
– Gut, – sagte ich, – meinetwegen. Ihr könnt hören, was ihr wollt.
– Du bist zu misstrauisch, Hermann – fügte Bolik hinzu. – Vertraust deinen Partnern nicht. Das geht nicht. Aber egal – auf uns kannst du dich verlassen. Wohin fahren wir?
– Nach Hause, – antwortete ich. – Vertrau mir.
*
Borja schob mir die Parker-CDs hin. Folgsam legte ich eine nach der anderen ein. Parker zerschnitt mit seinem Alt die Luft. Sein Saxophon explodierte wie eine Chemiewaffe, die das feindliche Heer vernichtet. Parker atmete durch sein Mundstück und stieß eine goldene Flamme gerechten Zorns aus, seine schwarzen Finger stießen in die offenen Wunden der Luft und zogen Kupfermünzen und Trockenfrüchte hervor. Die abgehörten CDs warf ich in meinen schäbigen Lederrucksack. Nach einer Stunde erreichten wir das nächste Städtchen, ließen das Zentrum hinter uns, kamen zur Brücke und gerieten in ein Verkehrschaos.
Mitten auf der Brücke stand ein Laster und blockierte den Verkehr in beide Richtungen. Autos fuhren auf die Brücke in eine gekonnt aufgestellte Falle – vorwärts ging nichts, rückwärts genauso wenig, die Fahrer hupten, und diejenigen, die nahe dran waren, stiegen aus, um nachzusehen, was los war. Es handelte sich um einen alten Geflügeltransporter, verklebt mit Federn und Laub und bis oben hin beladen mit Käfigen voller Geflügel. Es waren hunderte Käfige, in denen sich große, schwerfällige Vögel drängten, die mit Flügeln und Schnäbeln um sich schlugen. Offenbar hatte der Fahrer die eiserne Absperrung gerammt, die die Fahrbahn vom Fußweg trennte, der Geflügeltransporter hatte sich quer gestellt und versperrte die Durchfahrt. Die oberen Käfige waren auf dem Asphalt zerschellt, und jetzt staksten hier verwunderte Hühner umher, hüpften auf die Motorhauben der Autos, hockten auf dem Brückengeländer und legten Eier zwischen die Räder der Lastwagen. Der Fahrer des Geflügeltransporters war sofort vom Ort des Geschehens verschwunden. Noch dazu mit den Schlüsseln. Zwei Polizisten umkreisten den Transporter, ohne zu wissen, was sie tun sollten. Voller Hass verscheuchten sie die Hühner und versuchten, von den Zeugen irgendetwas über den Fahrer zu erfahren. Doch die Aussagen waren widersprüchlich. Die einen versicherten, er sei von der Brücke ins Wasser gesprungen, andere hatten gesehen, dass er ins Fahrerhäuschen eines Lasters gestiegen war, und wieder andere versicherten flüsternd, der Transporter sei ganz ohne Fahrer gefahren. Die Polizisten rangen verzweifelt die Hände und versuchten, über Funk Verbindung zur Wache herzustellen.
– Puh, das wird dauern, – sagte Ljoscha, nachdem er mit den Polizisten gesprochen hatte und wieder zu uns ins Auto gestiegen war. – Sie wollen irgendwo einen Abschleppwagen herbekommen. Nur dass Wochenende ist, fuck.
Hinter uns hatte sich eine Schlange gebildet, die immer länger wurde.
– Können wir nicht einen anderen Weg nehmen? – schlug ich vor.
– Wie denn? – antwortete Ljoscha mürrisch. – Jetzt kommen wir hier nicht mehr raus. Wär’n wir bloß daheimgeblieben.
Plötzlich hüpfte uns ein schweres, gemästetes Huhn auf die Motorhaube. Es machte vorsichtig ein paar Schritte und erstarrte.
– Ein Todesbote, – sagte Bolik . – Ob es hier wohl Geschäfte mit Kühlschränken gibt?
– Willst du dir einen Kühlschrank kaufen? – fragte sein Cousin.
– Ich will was Kaltes trinken, – erklärte Bolik.
Ljoscha hupte, der Vogel schlug mit den Flügeln, flog über das Geländer und stürzte ins Nichts. Vielleicht lernen sie anders nicht fliegen.
– Okay, – sagte ich ungeduldig, – ihr fahrt zurück, und ich gehe zu Fuß weiter.
– Wohin willst du gehen? – fragte Lolik verständnislos. – Bleib sitzen. Gleich wird das Ding hier abgeschleppt, wir drehen um und fahren nach Hause.
– Fahrt allein. Ich gehe zu Fuß rüber und lass mich dann von jemandem mitnehmen.
– Warte doch, – sagte Lolik nervös, – keiner wird dich mitnehmen.
– Doch, – sagte ich. – Morgen komme ich zurück. Fahrt vorsichtig.
Die Polizisten flippten aus. Einer schnappte sich ein Huhn, hielt es an den Beinen und gab ihm eins auf den Schnabel. Das Huhn erhob sich in die Luft wie ein Fußball, überflog ein paar Autos und verschwand unter den Rädern. Ein anderer Bulle packte wütend ein anderes Stück Geflügel, warf es hoch und schlug es mit der Rechten in den Maihimmel. Ich sprang über die Absperrung, umrundete den Geflügeltransporter, schlängelte mich durch die Fahrer, überquerte die Brücke und marschierte die morgendliche Landstraße entlang.
*
Dann stand ich lange unter dem warmen Himmel, an der leeren Landstraße, die der nächtlichen Metro glich – ähnlich hoffnungslos war alles ringsumher, ähnlich lang erschienen die hier verbrachten Minuten. Hinter der Kreuzung, an der Ortsausfahrt, befand sich eine von unbekannten Passanten akribisch verwüstete Bushaltestelle: die Wände mit schwarzen und roten Mustern bemalt, der erdige Boden dick und gleichmäßig mit Glasscherben übersät, aus der Ziegelmauer wuchs düsteres Gras, in dem Eidechsen und Spinnen hausten. Ich konnte mich nicht entschließen hineinzugehen, stellte mich in den Schatten, den die Wände warfen, und wartete. Und ich musste lange warten. Einzelne Laster fuhren Richtung Norden und ließen Staub und Hoffnungslosigkeit hinter sich zurück, aber in die Gegenrichtung fuhr überhaupt niemand. Mein Schatten lief mir langsam aus den Füßen. Ich wollte schon fast umkehren und überlegte, wie lange ich brauchen würde, wo meine Freunde wohl jetzt wären, als plötzlich, irgendwo von der Seite, aus dem Schilf- und Ufergürtel des Flusses, verzweifelt mit dem Auspuff trötend ein blutroter Ikarus-Bus die Böschung der Landstraße erklomm. Ruckelnd kam er auf seinen vier Rädern zu stehen wie ein Hund, der sich das Wasser abschüttelt, holte tief Atem, schaltete und kroch auf mich zu. Ich war starr vor Überraschung und glotzte das ungeheure, staubumwehte, blutverklebte und ölbeschmierte Verkehrsmittel an. Der Bus rollte langsam zur Haltestelle und hielt mit allen Teilen quietschend an. Die Türen öffneten sich. Aus den Autobus-Innereien wehten mich Tod und Nikotin an. Der Fahrer, nackt bis zum Gürtel und nass geschwitzt, wischte sich die Stirn und schrie:
– Was ist, Söhnchen, willst du mit?
– Ja, – antwortete ich und kletterte hinein.
Freie Plätze gab es keine. Der Bus war besiedelt von einem schläfrigen unbeweglichen Publikum. Es gab Frauen in BH und Trainingshosen, mit grellem Make-up und langen künstlichen Fingernägeln, Männer mit Herrenhandtäschchen und Tätowierungen, ebenfalls in Trainingshosen und chinesischen Turnschlappen, Kinder mit Baseballkappen und Trainingsanzügen, Knüppel und Schlagringe in den Händen. Sie alle schliefen oder versuchten zu schlafen, so dass mich niemand beachtete. Über allem hing indische Musik, zitternd wie ein Schwarm Kolibris, der durch den Bus flatterte und dem süßen Seelenverkäufer zu entrinnen versuchte. Aber die Musik störte niemanden. Ich ging durch den Gang auf der Suche nach einem freien Platz, fand keinen und kehrte zum Fahrer zurück. Die Frontscheibe vor ihm war dicht mit orthodoxen Ikonen beklebt und vollgehängt mit buntem Sakraltand, was das Gefährt offenbar davor bewahrte, komplett auseinanderzufallen. Plüschbären hingen neben Tonskeletten mit gebrochenen Rippen, Halsketten aus Hühnerköpfen und Manchester-United-Wimpeln, mit Tesafilm waren Pornobildchen, Stalinporträts und fotokopierte Darstellungen des heiligen Franziskus angeklebt. Und auf der Ablage vor dem Fahrer staubten Straßenkarten vor sich hin, Hustler-Hefte, mit denen er die Mücken totschlug, Taschenlampen, blutverschmierte Messer, Äpfel, aus denen die Würmer krochen, und kleine Holzikonen mit den Antlitzen der großen Märtyrer. Der Fahrer schnaufte schwer, seine eine Hand umklammerte das Lenkrad, in der anderen hielt er eine große Flasche Wasser.
– Was ist, Söhnchen, – fragte er, – alles voll?
– Mhm.
– Bleib bei mir stehen, sonst schlaf ich auch noch ein. Die haben’s gut – haben einen Platz gekriegt und schlafen. Und ich bin verantwortlich.
– Für was verantwortlich?
– Für die Ware, Söhnchen, für die Ware, – erklärte er mir, als gehörte ich dazu.
Es waren Händler aus dem Donbass, ganze Familien von Kleinhändlern. Vor zwei Tagen hatten sie sich in Charkiw mit Ware versorgt – Trainingsanzüge, chinesische Turnschlappen und anderer Mist. Und ab nach Hause. Aber kaum lag die Stadt hinter ihnen, da ging der Bus hoffnungslos kaputt, das Fahrwerk, Söhnchen, das Fahrwerk, seine letzte Werkstatt hat der Bus hier vor den Olympischen Spielen in Moskau gesehen! Die erste Nacht verbrachten sie auf der Landstraße. Der Fahrer kroch wie eine Blindschleiche zwischen den Rädern herum, und sie hielten Wache, nährten bis zum Morgen das Lagerfeuer, spielten Gitarre und sangen dazu. Das gefiel ihnen sogar. Am Morgen ging der Fahrer ins nächste Dorf und brachte Bauern auf Traktoren mit. Die Bauern schleppten sie ins nächste Eisenbahndepot. Dort verbrachten sie den Tag und eine weitere Nacht. Die Händler weigerten sich zu schlafen, sie bewachten die Ware, spielten Gitarre und sangen, nur einmal gingen sie zum Bahnhof, um Alk und neue Saiten zu besorgen. Dem Fahrer gelang es schließlich, das Fahrwerk zu reparieren, er nahm die Händler an Bord und setzte den bitteren Heimweg fort. Als er den Stau bei der Brücke sah, überlegte er nicht lange, schlug einen riesigen Haken und gelangte auf Umwegen und mithilfe alter Bretter ans linke Ufer. Jetzt konnte ihn nichts mehr aufhalten. Behauptete er.
Der Autobus fuhr auf einen Hügel und hustete schwer. Vor uns lag ein breites, sonniges Tal, mit hellgrünen, von goldenen Rinnen durchzogenen Maisfeldern. Der Fahrer preschte entschlossen vorwärts. Schaltete den Motor aus und entspannte sich. Der Bus wälzte sich bergab, wie eine von den unvorsichtigen Schreien japanischer Touristen ausgelöste Schneelawine. Der Wind pfiff um die warmen Ecken, Käfer zerschellten an der Frontscheibe wie Mairegentropfen, wir flogen, nahmen Fahrt auf, und um uns und über uns erklangen die Stimmen der indischen Sänger und kündeten von langen Freuden und einem schmerzlosen Tod. Nachdem er ins Tal gerollt war, erklomm der Autobus mit Schwung auch den nächsten Hügel, wo der Fahrer den Motor neu zu starten versuchte. Der Ikarus schüttelte sich, man hörte das laute Knirschen von Eisen auf Eisen, und das Gefährt stand still. Der Fahrer schwieg verzweifelt. Es wäre mir unangenehm gewesen, ihn etwas zu fragen. Schließlich ließ er den Kopf aufs Lenkrad sinken und verstummte, nur ab und zu zuckten seine Schultern. Erst dachte ich, er weine, es war ein irgendwie rührender Anblick. Doch als ich lauschte, verstand ich schließlich, dass er schon im Traum zuckte. Alle anderen, die Passagiere dieses Gespenster-Ikarus, schliefen ebenfalls. Und keiner kam auch nur auf die Idee, die Ware zu bewachen. Ich durchstreifte wieder den Gang und linste aus dem Fenster. Der Wind wiegte den jungen Mais, tiefe Stille ringsum, und die Sonne fraß sich in den Tag wie ein Fettfleck in Stoff. Plötzlich berührte jemand meine Hand. Ich schaute mich um. Ganz hinten waren Vorhänge, dunkelbraun und lange nicht gewaschen. Ich hatte gedacht, hinter den Vorhängen wäre nichts mehr, nur die Wand oder ein Fenster oder so. Aber dort wurde eine Hand herausgestreckt, die mich packte und hineinzog. Ich folgte, glitt durch einen unsichtbaren Eingang und befand mich in einem kleinen Zimmer. So eine Art Chill-out, ein Ort für Meditation und Liebe, eine von Geistern und Schatten bewohnte Zelle. Die Wände des Zimmerchens waren mit chinesischen Synthetiktüchern verhängt, die wundersame Ornamente und Malereien zeigten, Hirschjagden, Teezeremonien und »Die Pioniere der Stadt Peking begrüßen den Genossen Mao«. An den Wänden standen zwei kleine Sofas. Und darauf saßen drei Neger und eine Negerin. Die Neger trugen weißliche Unterwäsche, und die Negerin graue Sportsachen. Um ihren Hals baumelten schwere Ketten mit Schädelchen dran, und statt eines Kamms steckte ein Federmesser in ihrem Haar. Auf ihren Knien hielt sie eine Thermoskanne. Die Augen der Neger flackerten gierig in der Dämmerung, und die gelblichen Augäpfel brannten in der Dunkelheit wie Bernstein. Die Negerin aber schaute mich fest an und fragte, ohne meine Hand loszulassen:
– Wer bist du?
– Und wer bist du? – fragte ich, während ich die Wärme ihrer Hand und die Schwere der Silberringe an ihren Fingern spürte.
– Ich bin Karolina, – sagte sie und entzog mir plötzlich ihre Hand. Einer der Neger schielte zu mir herüber und flüsterte seinem Nachbarn etwas ins Ohr, und der lachte kurz auf. – Wohin fährst du? – fragte Karolina und musterte mich im Halbdunkel.
– Nach Hause, – antwortete ich.
– Und wer wartet dort auf dich? – Sie zog das Messer aus ihrer Frisur, und das dichte Haar fiel herab und verbarg ihre Augen.
– Niemand.
Karolina lachte jetzt auch.
– Warum fährst du hin, wo niemand auf dich wartet? – fragte sie, holte einen Granatapfel hervor und schnitt ihn in der Mitte durch.
– Was spielt das für eine Rolle? – fragte ich verständnislos. – Ich war einfach lange nicht da.
– Hier, nimm, – sie streckte mir den halben Granatapfel hin. – Was wirst du dort machen, wo niemand auf dich wartet?
– Ich bleibe nicht lange. Morgen fahre ich wieder zurück.
– Hast du solche Angst, dorthin zurückzukehren? – Karolina lachte wieder und knabberte an ihrer Granatapfelhälfte.
– Warum denkst du das?
– Du bist noch nicht mal angekommen und willst schon zurück. Du hast Angst.
– Ich muss arbeiten, – erklärte ich ihr. – Also kann ich nicht länger bleiben.
– Kannst du wohl, – sagte sie. – Wenn du willst.
– Nein, – wiederholte ich genervt, – kann ich nicht.
– Ich denke, du haust so schnell wieder ab, weil du vergessen hast, wie es dort war. Wenn du dich erst erinnerst, wirst du nicht so einfach wieder wegfahren können. Hier, bitte.
Sie reichte mir eine Tasse, in die sie etwas aus der Thermoskanne gegossen hatte. Das Gebräu roch nach Baldrian und Zimt. Ich probierte. Es schmeckte bitter und scharf. Ich trank aus, und es haute mich sofort um.
*
Um den Flugplatz erstreckten sich Weizenfelder. Näher an der Startbahn wuchsen giftig-grelle Blumen, über denen wie über Leichen träge Wespen kreisten. Morgens wärmte die Sonne den Asphalt und trocknete das Gras, das durch die Betonplatten brach. Am Rand, über der Fluglotsen-Bude, flatterten in Fetzen die Fahnen, etwas weiter, hinter dem Verwaltungsgebäude, erstreckten sich Bäume, von Spinnennetzen umwoben und vom scharfen Morgenlicht entzündet. In den Weizenfeldern hausten seltsame Winde, die jede Nacht aus der Finsternis den grünen Lichtern der Fluglotsen-Bude zustrebten und sich am Morgen wieder zwischen die Halme verzogen, um sich vor der brennenden Junisonne zu verstecken. Aufgeheizt reflektierte der Asphalt das Sonnenlicht und blendete die Vögel, die über der Startbahn kreisten. Am Zaun standen Tankwagen und ein paar Laster, leere Garagen dunkelten vor sich hin, aus denen es süßlich nach Brackwasser und Öl roch. Etwas später tauchten die Mechaniker auf, zogen ihre schwarzen, löchrigen Overalls an und krochen in ihre Maschinen. Über dem Flugplatz hing der Frühjunihimmel, entfaltete sich im Wind wie ein frisch gewaschenes Laken, erhob sich tönend und fiel herab bis auf den Asphalt. Immer zur selben Zeit, gegen acht, schälte sich aus den Tiefen der Atmosphäre das eifrige Knattern eines Motors und rollte langsam näher. Das Flugzeug war hinter der Sonne noch nicht zu sehen, aber sein Schatten zog schon über das Weizenfeld und scheuchte Vögel und Füchse auf. Die Himmelsoberfläche bekam einen Sprung wie Porzellan, und die gute alte AN-2, Maisfliegen-Mörder und Stolz der sowjetischen Luftfahrt, überflog die geschorenen Schädel der Mechaniker und setzte selbstbewusst zur Landung an. Sie betäubte den Morgen mit ihrem vorsintflutlichen Motor, überflog das schläfrige Städtchen und weckte es aus seinem leichten und trügerischen Sommerschlaf. Die Piloten betrachteten die landwirtschaftlichen Parzellen, die dick mit Sonnenhonig übergossenen Felder, das frische Grün der Senken und Eisenbahndämme, das Gold des Sandes am Fluss und das Tafelsilber der kalkigen Ufer. Die Stadt mit ihren Fabrikschloten und der Eisenbahn blieb zurück, das Flugzeug setzte zur Landung an, Licht durchflutete die Kabine und leuchtete kalt auf dem Metall. Die Maschine hoppelte über die Landebahn, hüpfte mit ihren harten Reifen auf dem löchrigen Asphalt. Die Piloten sprangen auf die Erde und halfen den Frachtarbeitern beim Ausladen der großen Segeltuchsäcke mit regionaler und republikanischer Presse, Briefen und Päckchen, und wenn sie alles ausgeladen hatten, gingen sie zu den Baracken und ließen das Flugzeug sich in der Sonne wärmen.
Meine Freunde und ich wohnten auf der anderen Seite der Weizenfelder, am Stadtrand, in weißen Plattenbauten, um die herum hohe Kiefern wuchsen. Gegen Abend verließen wir unser Viertel, durchstreiften den Weizen, versteckten uns vor den wenigen Autos, bewegten uns in großen Sprüngen am Zaun entlang, legten uns ins staubige Gras und beobachteten die Flugapparate. Die AN-2 mit ihrem Metallrumpf und den leinenbespannten Flügeln erschien uns wie eine jenseitige Maschine, in der Dämonen herangeflogen kamen, um den Himmel über uns mit Benzin und Blei zu entzünden. Götterboten saßen in ihrem Innern, und der mächtige Propeller durchschlug das himmlische Eis und trieb den Pappelflaum ins Jenseits. Erst nachts kehrten wir heim, durchstreiften wieder den dichten, heißen Weizen und dachten an die Luftfahrt. Wir wollten Piloten werden. Die meisten von uns wurden Loser.
Manchmal träume ich von Piloten. Jedes Mal müssen sie in Weizenfeldern notlanden, ihre Flugzeuge fallen schwer in das dichte Korn, im roten Abendlicht zerplatzt die Leinenbespannung, die Halme verfangen sich im Fahrgestell, und die Flugapparate stecken tief in der schwarzen, ausgetrockneten Erde. Die Piloten kullern aus den brennend heißen Kabinen, fallen in den Weizen, der sich sogleich um ihre Beine wickelt, stehen auf und versuchen, am Horizont etwas zu erkennen. Aber am Horizont gibt es nichts, außer Weizenfeldern, die sich unendlich hinziehen, so dass es hoffnungslos ist, sich aus ihnen befreien zu wollen. Die Piloten lassen ihre Maschinen zurück, die in der Abenddämmerung allmählich auskühlen, und gehen nach Westen, der Sonne nach, die schnell erlischt. Die Halme sind hoch und undurchdringlich, die Piloten können sich nur schwer ihren Weg bahnen, müssen eine unsichtbare Wand vor sich eindrücken ohne jegliche Chance, irgendwohin zu gelangen. Sie tragen Lederhelme mit Brillen und schwere Handschuhe und schleppen geöffnete Fallschirme hinter sich her, die sie nicht abkoppeln wollen, schleppen sie hinter sich her wie schwere Krokodilschwänze.
*
Ich erwachte vom gleichmäßigen Brummen des Motors. Auf der Sitzbank neben mir schliefen die drei Neger, Karolina war nicht da. Ich spähte in den Salon. Es war schon ziemlich spät, rechts vor dem Fenster ergoss sich die Abendsonne in rotem Flackern. Wieviel Uhr es wohl war? Ich trat zu einem der Händler, der friedlich schlief, nahm seinen Arm und schaute auf die Uhr. Halb zehn. Verdammt, dachte ich, hab ich verschlafen? Ich ging zum Fahrer. Der begrüßte mich wie einen alten Freund, ohne die Augen von der Straße zu nehmen. Ich schaute durch die Scheibe. Gleich kam die Abzweigung, wenn man hier nicht abböge, sondern weiterführe, käme nach ein paar Kilometern genau der Ort, wo ich hinmusste. Aber an der Abzweigung bremste der Fahrer.
– Väterchen, komm, – sagte ich zu ihm, – bring mich bis zur Tankstelle. Das sind nur ein paar Kilometer.
– Ist das oben? – fragte der Fahrer.
– Mhm.
– Beim Sendeturm?
– Ja.
– Nein, – entschied er. – Wir biegen ab.
– Warte, – begann ich zu handeln. – Du hast doch Probleme mit dem Fahrwerk. Mein Bruder hat eine Werkstatt. Er macht dir eine Generalüberholung.
– Söhnchen, – sagte der Fahrer fest und bestimmt. – Dort ist eine Stadt. Und wir können in keine Stadt. Wir haben Ware geladen.
*
Ich stieg aus dem Bus. Kaum war die Sonne untergegangen, wurde es kühl. Ich zog die Jacke über und folgte der Straße. Nach zwanzig Minuten erreichte ich die Tankstelle. Die Fenster der Werkstatt nebenan waren dunkel. Nirgends brannte Licht. Kein Kotscha weit und breit. Alles dunkel und leer. An der Tür der Werkstatt baumelte ein Schloss. Ich entschied mich zu warten und ging zur Baracke. Zwischen Gras und Himbeersträuchern stand ein vorsintflutlicher Bauwagen, dahinter stapelten sich ein paar alte Schrottautos. Der Bauwagen, Kotschas Zuhause, war ebenfalls verschlossen. In der Dämmerung näherte ich mich einer einsamen KAMAZ-Fahrerkabine. Kletterte hinein und streifte die Turnschuhe ab. Oben hing der Mond. Die Landstraße kühlte ab. Direkt vor mir, im Tal, lag die Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen war. Ich nahm den Rucksack, legte ihn mir unter den Kopf und schlief ein.
2
Argwöhnisch strich der sumpfschwarze Hund durchs hohe Gras. Er näherte sich leise, geduckt, um unbemerkt zu bleiben, schob mit kampfbereiten Pfoten die Halme auseinander und verdeckte die morgendliche Sonne. Die Morgenstrahlen vergoldeten seinen Schädel mit den glasigen Augen, in denen sich bereits mein Abbild spiegelte. Er machte einen federnden Schritt, dann noch einen, hielt für einen Augenblick inne und streckte langsam sein Maul in meine Richtung. Seine Augen blitzten in hungrigem Glanz, das Gras hinter seinem Rücken schloss sich als smaragdgrüne Welle und verbarg den blutigen Sonnenklumpen. Instinktiv reagierte ich im Traum auf seine Bewegung und wehrte ihn mit der geballten Faust ab.
– Harry, Kumpel!
Ich strampelte gegen das verbeulte Blech und riss mich von meinem Traum los.
– Harry! Freund! Da bist du ja! – Kotscha beugte sich vor und wollte mich packen, wobei er mit den langen hageren Armen wedelte und seinen kahlen Schädel hin und her drehte. Aber es gelang ihm nicht, sich durch das ausgeschlagene Seitenfenster der Fahrerkabine zu zwängen. Er stand gegen die Sonne, die bereits aufgegangen war und nun mit Leichtigkeit zu der ihr genehmen Höhe emporstieg, und blinkte mit seiner großen Brille. – Na, was liegst du da rum! – krächzte er und streckte seine Pfoten nach mir aus. – Kumpel!
Ich versuchte mich aufzurichten. Nach dem Schlaf auf dem harten Sitz wollte der Körper nicht gehorchen. Ich zog die Beine an, verlor das Gleichgewicht und fiel Kotscha direkt in die Arme.
– Freund! – offenbar freute er sich, dass ich da war.
– Hi, Kotscha, – antwortete ich, und wir drückten uns lange die Hände, klopften dem anderen mit den Fäusten auf Schultern und Rücken und zeigten auf jede erdenkliche Weise, wie toll es war, dass ich diese Nacht in dem leeren Fahrerhäuschen verbracht und er mich danach um sechs Uhr morgens geweckt hatte.
– Bist du schon lange hier? – fragte Kotscha, als sich seine erste Begeisterung gelegt hatte. Meine Hand ließ er allerdings nicht los.
– Seit gestern Nacht, – antwortete ich und versuchte mich zu befreien, um endlich die Schuhe anzuziehen.
– Warum hast du denn nicht angerufen? – Kotscha machte keine Anstalten, meine Hand loszulassen.
– Kotscha, du Arsch, – ich hatte mich endlich befreit und wusste nun nicht wohin mit meiner Hand. – Ich habe zwei Tage lang versucht, dich zu erreichen. Warum hebst du nicht ab?
– Wann hast du denn angerufen? – fragte Kotscha.
– Tagsüber. – Endlich schaffte ich es, meine Turnschuhe aus dem Fahrerhaus zu fischen.
– Da war ich am Pennen, – sagte er. – In letzter Zeit hab ich Schlafprobleme. Ich schlafe am Tag, und nachts geh ich zur Arbeit. Aber nachts kommen keine Kunden. – Er trat von einem Fuß auf den anderen und versuchte, mich irgendwohin zu ziehen. – Vor allem aber – unser Telefon ist tot, abgestellt, weil wir die Rechnungen nicht bezahlt haben. Gestern bin ich in die Stadt gefahren und komme eben zurück. Los, ich zeig dir alles.
*
Er ging voran. Ich folgte. Vorbei an einem demolierten Moskwitsch mit abgebrannten Rädern, an einem Haufen Schrott, an Teilen von Flugzeugen, Kühlkammern und Gasherden stapfte ich hinter Kotscha her zu den Zapfsäulen. Die Tankstelle lag etwa hundert Meter von der Landstraße entfernt, die nach Norden führte. Unten, etwa zwei Kilometer weiter, lag in einem warmen Tal das Städtchen. Am südlichen Stadtrand, hinter dem Fabrikgelände, begannen Felder, die auf der anderen Talseite endeten, und im Norden wurde die Stadt von einem Fluss umarmt, der vom russischen Territorium in Richtung Donbass floss. Das linke Ufer war flach, am rechten jedoch erhoben sich steile Kreideklippen, von Beifuß und Dorngebüsch bewachsen. Auf der höchsten Anhöhe ragte für das ganze Tal sichtbar ein Sendeturm empor. Und ganz in der Nähe des Turms, auf der nächsten Erhebung, lag die Tankstelle. Erbaut worden war sie in den Siebzigern. Damals hatte die Stadt ein Öltanklager bekommen und zwei Tankstellen gleich dazu – eine an der südlichen, die andere an der nördlichen Ausfahrt. In den Neunzigern ging das Öltanklager pleite und mit ihm eine der beiden Tankstellen, aber diese hier, an der Straße nach Charkiw, überlebte. Mein Bruder hatte schon Anfang der Neunziger, als das Öltanklager noch vor sich hin vegetierte, hier angeheuert und übernahm später das Geschäft. Die Tankstelle selbst machte keinen guten Eindruck – vier alte Zapfsäulen, das Kassenhäuschen, ein leerer Mast, an dem man bei Bedarf jemanden aufknüpfen konnte. Etwas weiter weg stand ein unbeheizter Schuppen, vollgestopft mit Metallkram – mein Bruder investierte nicht in die Entwicklung der Infrastruktur, sondern in die Verbesserung des Service und schleppte von überall Werkzeuge und Maschinen an, mit deren Hilfe er alles reparieren konnte. Er selbst wohnte in der Stadt, kam jeden Morgen hier herauf und fuhr erst spät abends wieder ins Tal hinunter. Ein Wahnsinnsteam arbeitete mit ihm zusammen; Kotscha und Schura der Versehrte, zwei urwüchsige Ingenieurstalente, die in ihrer Karriere mehr als einer Karre das Leben gerettet hatten, worauf sie auch stolz waren. Auch Schura der Versehrte wohnte irgendwo in der Stadt, Kotscha aber hatte keine eigene Wohnung und hing immer bei der Tankstelle rum; er schlief im Bauwagen, der nach allen Regeln des Feng-Shui eingerichtet war. Neben der Tankstelle hatte man einen asphaltierten Platz mit Montagegrube angelegt, ein Stück weiter, unter den Linden, ein paar Metalltische in den Boden gerammt. Direkt hinter der Tankstelle begannen die Apfelplantagen, die sich die Kreidehügel entlangzogen, und nach Norden öffnete sich die Steppe, aus der ab und zu landwirtschaftliche Maschinen hervorlärmten. Hinter dem Bauwagen war ein Schrottplatz für lädierte Technik entstanden, Skelette zerlegter Autos und ein Haufen alter Reifen. Daneben verbarg sich in Himbeersträuchern das KAMAZ-Fahrerhäuschen, aus dem sich der Blick auf das sonnendurchflutete Tal und die schutzlose Stadt öffnete. Aber es ging nicht um die Infrastruktur und die alten Zapfsäulen. Es ging um die Lage. Das war meinem Bruder sehr wohl bewusst gewesen, als er sich seinerzeit diese Tankstelle ausgesucht hatte. Tatsächlich lag der nächste Ort, wo man Benzin bekam, etwa siebzig Kilometer weiter nördlich, und die Straße führte durch zwielichtige Gegenden ohne staatliche Kontrolle und reguläre Bevölkerung. Angeblich gab es weiter nördlich nicht mal Mobilfunkempfang. Die Fahrer wussten das und versuchten deshalb bei meinem Bruder zu tanken. Außerdem arbeitete hier Schura der Versehrte, der beste Automechaniker weit und breit, der Gott der Kardanwellen und Getriebe. Kurzum, es war eine Goldgrube.
*
Neben den Zapfsäulen, am Ziegelhäuschen mit dem Kassenapparat, standen zwei Autositze, die zum Relaxen hierhergestellt worden waren. Sie waren mit schwarzem Fell mir unbekannter Tiere überzogen, die Federn sprangen in alle Richtungen daraus hervor, und an dem einen Sitz war ein sonderbarer Hebel angebracht, gut möglich, dass es sich um einen Schleudersitz handelte. Kotscha ließ sich erschöpft hineinfallen, holte seine Zigaretten aus der Tasche, zündete sich eine an und gestikulierte: Setz dich, Kumpel. Was ich auch tat. Die Sonne wurde warm, wie Steine am Ufer, und der Himmel wölbte sich wie ein Segel im Wind. Sonntag, Ende Mai, genau der richtige Moment, um von hier zu verschwinden.
– Wie lange bleibst du? – fragte Kotscha mit pfeifender Stimme.
– Heute Abend geht’s zurück, – antwortete ich.
– Warum so hastig? Bleib ein paar Tage. Wir können angeln gehen.
– Kotscha, wo ist mein Bruder?
– Hab ich dir doch gesagt. In Amsterdam.
– Warum hat er nicht Bescheid gegeben, dass er wegfährt?
– Keine Ahnung, Harry. Er hatte nicht vor wegzufahren. Und dann hat er plötzlich alles hingeschmissen. Und gesagt, dass er nicht wiederkommt.
– Gab’s Probleme mit dem Business?
– Was heißt hier Probleme, Harry? – Kotscha regte sich plötzlich auf. – Hier gibt’s weder Probleme noch Business, nur Tränen. Schau’s dir doch an.
– Und was sollen wir jetzt machen?
– Keine Ahnung. Mach, was du willst.
Kotscha drückte seine Kippe aus und warf sie in einen Eimer mit der Aufschrift »Rauchen verboten«. Wandte sein Gesicht der Sonne zu und verstummte. Scheiße, dachte ich, was geht bloß in seinem Schädel vor, was heckt er aus? Bestimmt verschweigt er mir was, sitzt da und heckt was aus.
*
Kotscha war knapp fünfzig. Für sein Alter ziemlich unstet, ziemlich kahl und sozial nicht abgesichert. Auf seinem Kopf sträubten sich um die Glatze herum die Reste seiner einst prächtigen Mähne, an die ich mich aus meiner Kindheit gut erinnern konnte. Genauso wie an Kotscha selbst – nach meinen Eltern, Nachbarn und Verwandten war er das erste Wesen, das sich meinem Bewusstsein eingeprägt hatte. Ich wuchs heran, Kotscha kam in die Jahre. Wir wohnten in Nachbarhäusern, in einem neuen Viertel, an dem die ganze Zeit weiter gebaut wurde, so dass ich praktisch auf einer Baustelle groß wurde. In den Häusern lebten vorwiegend Arbeiter aus den kleinen umliegenden Fabriken – Großbetriebe gab es in der Stadt keine, außerdem Eisenbahner, Lumpenakademiker (Lehrer oder Büroangestellte), aber auch Militärs (wie mein Vater) und selbstverständlich Komsomolkader, die jugendlichen Hoffnungsträger sozusagen. Wenn ich mich recht erinnere, zog Kotscha später ein, doch hatte er wohl schon immer in diesem Stadtteil gelebt. Er gehörte zu den jugendlichen Hoffnungsträgern, wuchs ohne Eltern auf, bekam schon in der Schule Probleme mit der Miliz und entwickelte sich allmählich zum Schrecken des ganzen Viertels. Es war damals, in den Siebzigern, gerade erst im Entstehen, weshalb Kotschas wilde Jugendjahre mit dem intensiven Ausbau der kommunalen Infrastruktur zusammenfielen. Kotscha plünderte neue Gastronom-Geschäfte, raubte die soeben eröffneten Zeitungskioske aus, stieg nachts ins halb fertige Standesamt ein, kurzum, er ging mit der Zeit. Die Strafverfolgungsorgane zeigten sich vollkommen hilflos und übergaben ihn dem Komsomol zur Aufsicht. Irgendwie gelangte der Komsomol zu dem Schluss, dass Kotscha für die kommunistische Jugend noch nicht ganz verloren war, und machte sich daran, ihn umzuerziehen. Zuerst steckte man ihn in die Berufsschule. Aber in der zweiten Woche ließ Kotscha eine Drehbank mitgehen und wurde rausgeschmissen. Nachdem er ein oder anderthalb Jahre in unserer Gegend abgehangen hatte, wurde er in die Armee eingezogen. Er diente im Baubataillon bei Schytomyr, kehrte jedoch mit Tätowierungen der Luftlandetruppen nach Hause zurück. Das war seine Sternstunde. Kotscha lief in Schulterklappen durchs Viertel und schlug jeden nieder, den er nicht kannte. Wir Jungs waren von ihm begeistert, er war uns ein schlechtes Vorbild. Der Komsomol unternahm einen letzten kläglichen Versuch im Kampf um Kotschas Seele und schenkte ihm eine Einzimmerwohnung in unserem Nachbarhaus. Kotscha bezog die Wohnung und verwandelte sie in einen Hort der Sünde. Anfang der Achtziger ging die gesamte progressive Jugend des Viertels durch seine Wohnung – die Jungs sammelten hier Mut, die Mädels Erfahrung. Kotscha selbst begann immer mehr zu trinken, so dass er den Zerfall des Landes gar nicht mitbekam. Als Ende der Achtziger in der Stadt ein Serienkiller sein Unwesen trieb, verdächtigten die Behörden und die Miliz Kotscha. Sie trauten sich aber nicht, ihn zu verhaften, weil sie Angst vor ihm hatten. Auch die Nachbarn waren fest davon überzeugt, dass es Kotscha war, der in duftenden Sternennächten Molkereimitarbeiterinnen vergewaltigte und sie danach mit einem spitzen Metallgegenstand abstach. Die Männer achteten ihn dafür, den Frauen gefiel er. Anfang der Neunziger, als es den Komsomol nicht mehr gab, mussten die Strafverfolgungsbehörden das Heft wieder in die Hand nehmen. Als Kotscha einmal in einem langen, ausgelassenen Rausch die Reklame einer neu gegründeten Aktiengesellschaft anzündete, war der letzte Tropfen Geduld aufgebraucht. Er wurde in seiner Wohnung festgenommen. Als man ihn abführte, bildete sich eine kleine Protestdemo. Wir, damals schon erwachsene Kerle, unterstützten Kotscha. Doch niemand hörte auf uns. Er bekam ein Jahr, das er irgendwo im Donbass absaß. Im Knast lernte er Mormonen kennen, die Kotscha mit ihren Broschüren und, auf seine Bitte, auch mit Rasierwasser zum Trinken und Zigaretten zum Rauchen versorgten. Nach einem Jahr kehrte er als Held heim. Nach einiger Zeit kamen die Mormonen, um seine Seele zu holen. Es waren drei junge Aktivisten in billigen, aber korrekten Anzügen. Kotscha ließ sie herein, hörte sie an, holte dann unter dem Sofa eine Knarre hervor und trieb sie ins Bad. Dort hielt er sie zwei Tage gefangen. Am dritten Tag beschloss er unvorsichtigerweise, sich zu waschen, öffnete die Tür, und die Mormonen büxten aus. Auf dem Revier wollten sie Anzeige erstatten, doch die Miliz kam zu dem weisen Schluss, dass es besser wäre, die Mormonen selbst zu isolieren, und sperrte sie bis zur Klärung ihrer Identität in eine Zelle. In den nächsten paar Jahren versuchte Kotscha vergebens, vernünftig zu werden, er ließ sich dreimal scheiden, immer von derselben Frau. Aber mit dem Privatleben wollte es einfach nicht klappen, und Kotscha feierte weiterhin Abschied von seiner Jugend. Erst Ende der Neunziger, als er mit abgebissenem Finger und durchstochenem Bauch ins Krankenhaus eingeliefert wurde, war der Abschied vollzogen. Den Finger hat ihm seine Frau im Streit abgebissen, wer ihm den Bauch durchstochen hatte, dazu schwieg Kotscha hartnäckig. Ungefähr zu dieser Zeit fing mein Bruder an, ihm zu helfen, schanzte ihm gelegentlich Arbeit zu, gab ihm Geld und unterstützte ihn überhaupt. Etwas aus ihrem früheren Leben, irgendeine Geschichte, muss die beiden verbunden haben, mein Bruder hat sie ein paar Mal andeutungsweise erwähnt, wollte aber nicht ins Detail gehen, er hat einfach gesagt, dass man Kotscha vertrauen könne, der würde einen im Ernstfall nicht hängen lassen. Vor einigen Jahren wurde Kotscha von seinem Zigeunerclan vor die Tür gesetzt und übersiedelte an die Tankstelle. Er wohnte im Bauwagen, führte ein gemächliches Leben, schwärmte nostalgisch von der Vergangenheit, aber zurück in seine Wohnung wollte er nicht. Kotscha sah ziemlich schräg aus, seine Glatze hatte einen zarten Rosateint, und mit Brille glich er einem irren Chemiker, der gerade ein alternatives, umweltfreundliches Kokain erfunden und bereits erfolgreich an sich selbst ausprobiert hat. Er lief im orangefarbenen Overall und in Militärstiefeln herum, hatte überhaupt viele Military-Klamotten aus Secondhandläden und besaß sogar ausländische Armeesocken: Auf dem rechten stand ein »R«, auf dem linken ein »L«, damit man sie nicht verwechselte. Seine Handgelenke waren mit Tüchern und blutigen Binden umwickelt, Gesicht und Hände waren ständig voller Kratzer oder Schnittwunden. Er sah aus wie einer, der Pizza direkt aus dem Karton mampft.
*
Nun räkelte er sich in der Sonne und redete wirres Zeug.
– Schon gut, – sagte ich, – wenn du nicht willst, dann sag eben nichts. Wer hat denn bei euch die Buchhaltung gemacht?
– Buchhaltung? – Kotscha klappte die Augen auf. – Was willst du mit der Buchhaltung?
– Sehen, wie viel Kohle ihr habt.
– Na super, Harry, Kohle haben wir nen ganzen Arsch voll. – Kotscha lachte nervös auf. – Du musst mit Olga reden. Dein Bruder hat mit ihr gearbeitet. Sie hat eine Firma in der Stadt.
– Ist das etwa seine Schnalle?
– Was für eine Schnalle denn? – Kotscha war beleidigt. – Ich hab doch gesagt, er hatte geschäftlich mit ihr zu tun.
– Und wo hat sie ihr Büro?
– Du willst doch nicht etwa gleich zu ihr?
– Soll ich vielleicht weiter hier mit dir herumsitzen?
– Heute ist Sonntag, Harry, da hat alles zu.
– Und morgen?
– Was – morgen?
– Ist sie morgen im Büro?
– Weiß nicht, vielleicht.
– Okay, Kotscha, kümmere du dich um die Kundschaft, – sagte ich und warf einen Blick auf die leere Landstraße. – Ich will schlafen.
– Dann ab in den Bauwagen, – sagte Kotscha. – Und schlaf gut.
*
Licht drang durch den Vorhang, füllte den Raum mit Flecken und Sonnenstaub. Heiße Streifen zogen sich über den Fußboden wie verschüttetes Mehl. Über der Tür war ein selbst gebastelter Vorhang aus Tonbändern angebracht. Kotscha musste lange daran gearbeitet haben. Ich ging hinein, ohne die Tür zuzumachen, und schaute mich um. Die Zugluft berührte die Tonbänder, sie raschelten leise wie Maisblätter. An den Wänden standen zwei durchgelegene Diwane, rechts war eine Küche eingerichtet, mit Herd, einem uralten Kühlschrank und diversen Utensilien an der Wand, links in der Ecke stand ein Schreibtisch bedeckt mit verdächtigem Müll, in dem zu wühlen ich keinen Bock hatte. Ein merkwürdiger Geruch stand in der Luft. Ich war davon überzeugt, dass es dort, wo Freund Kotscha wohnte, eigentlich stinken müsste. Wonach? Nach allem Möglichen: Blut, Sperma, Benzin. In Kotschas Bauwagen roch es jedoch nach gepflegtem Männeralltag, ein seltsamer Geruch, wie er auch in Witwerwohnungen zu finden ist, aber – wie soll ich mich ausdrücken – in den Wohnungen von Witwern, die mit sich im Reinen sind, bei denen das Selbstwertgefühl stimmt. Bei Kotscha stimmt das Selbstwertgefühl offenbar, dachte ich und ließ mich auf die Couch fallen, die mir sauberer und weniger durchgelegen erschien. Ließ mich fallen, trat mir die Turnschuhe von den Füßen, und plötzlich überwältigte mich die ganze Verworrenheit dieser Reise, die ganze Fahrerei, die Zwischenstopps und die Reisegefährten, ich erinnerte mich an Karolina und ihren süßen Trunk, an den schwarzen Himmel über dem Himbeergestrüpp und den Geschmack des Metalls, wenn man darauf schläft. Irgendwie fand dieser Morgen kein Ende, als ob etwas in den Mechanismen, die mich antrieben, kaputtgegangen wäre. Irgendetwas funktionierte nicht. Es war, als stünde ich in einem großen, leeren Raum, in den man fremde Leute gelassen und dann das Licht ausgeschaltet hatte. Und obwohl ich den Raum kannte, machte mich die Anwesenheit der Leute beklommen, sie standen herum und schwiegen, als verheimlichten sie mir etwas. Keine Panik, dachte ich beim Einschlafen, wenn was ist, kannst du ja jederzeit heimfahren.