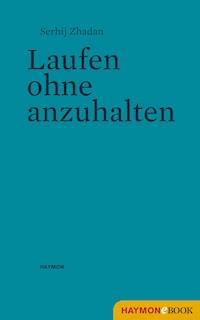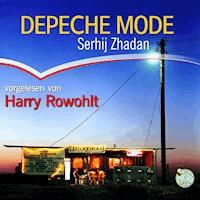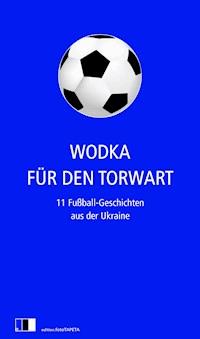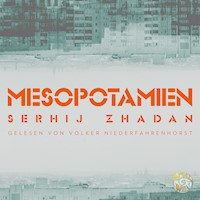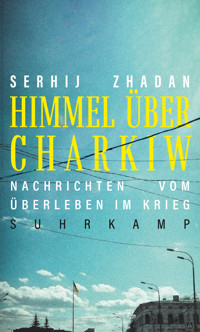13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
»Der Wert eines Gedichts steigt im Winter / Vor allem in einem harten Winter. / Vor allem in einer leisen Sprache. / Vor allem in unberechenbaren Zeiten.«
Was kann und soll die Literatur, wenn Krieg ist? Auf welche Sprache greifen die Dichter zurück? Taugen ihre Instrumente, um dem zum Ausdruck zu verhelfen, »was Angst macht«? Seit vor sechs Jahren die Kämpfe in der Ostukraine begannen, hat Serhij Zhadan die Bewohner in unzähligen Auftritten zu Mut und Resilienz ermutigt und sich mit sozialen Projekten engagiert. Er, der populärste ukrainische Schriftsteller, hat keine existentielle Herausforderung gescheut, um sich eine starke lyrische Stimme zu erarbeiten, die in langen, songhaften Gedichten das vermeintlich Unsagbare in rätselhaft schöne Bilder fasst. In seinem neuen Buch gedenkt er auch seines verstorbenen Vaters, er findet einen Ton, um über die Unvermeidlichkeit des Todes und den Schmerz der Liebe zu sprechen, und über die Trauer, »die auch hell sein kann«, weil sie uns auf einen verborgenen Sinn verweist.Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 81
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Serhij Zhadan
Antenne
Gedichte
Aus dem Ukrainischen von Claudia Dathe
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Das Telefonverzeichnis der Toten
Erster Teil Schiffsverzeichnis
Seid ihr bereit?
Zusammenkommen und reden
Das himmlische Reich
Warum rede ich ständig über die Kirche?
Ich preise dich, Gott, ich preise dich
Und davon eben will ich erzählen
Genau das eben
Unser Lehrer steht vor uns
So stellt man sich zum Familienfoto auf
Lasst uns mutig sein in diesem Sommer
Einfach loslegen und die paar Sätze schreiben
Es geht vor allem um Einsamkeit
Und erst als ich hierhergeraten bin
Vielleicht das Wichtigste
Zwischen dem, was wir schon verloren haben
Die großen Dichter der traurigen Zeiten
Und was macht dieser Mann
Wie oft musstest du hören
Doch
Als hätte es diesen Winter
… der Winter hingegen
Niemand möchte
Zu viel Politik
Später dann kein Wort mehr
Neue Rechtschreibung
Ein Gedicht, das aus Schweigen und Stille besteht
Und wenn es auch nicht
Zweiter Teil Antenne
I
Liebesgeschichten beginnen morgens
Tabakfabriken
Wie schreibt man Gedichte
Und irgendwann geraten sie in Streit
Und nach zwei Jahren Schweigen
Jeden Morgen
Die paar Wochen
Lange stehen sie auf dem Bahnsteig
Kalte Morgenluft
Noch ein Gedicht
II
Wenn der Mond größer wird
Warum hat sie bloß
So, und jetzt reden sie nicht
Den ganzen Tag
Am Morgen ist die Haltestelle
Heiße Sommerluft
Der Sommer beginnt
Sonntagsschule
Und auch dieser Sommer
In den zweitausend Jahren
III
Seit drei Jahren reden wir über den Krieg
Ein Bekannter hat sich freiwillig gemeldet
Seit drei Jahren reden wir über den Krieg
So eine Familie sind sie jetzt
In den zwei Jahren, die er fort war
Sonnenschein, eine Terrasse, viel Grün
Eine Frau läuft die Straße entlang
Noch so eine merkwürdige Geschichte
Auf der Dorfstraße
Die Verleihung zieht sich hin
»Dafür weiß ich jetzt«, sagt er
IV
Die ganze Ewigkeit liegt vor uns.
Unbedingt den Kälteeinbruch erleben
Die tiefe Welt der Freude und Bäume
Ich schreibe, wie versprochen
In den warmen Charkiwer Winter
Milizschule. September 2014
Und wer soll ihnen sagen, dass alles vorbei ist
Ich weiß, wie schwer es für euch alle ist
Inzwischen
Solange aus alldem noch keine Gedichte entstanden sind
Editorische Notiz
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Das Telefonverzeichnis der Toten
1
In den Morgenstunden rief mein Neffe an. Jemand ist gestorben, war mein erster Gedanke, als ich die vertraute Nummer aufleuchten sah, es muss jemand gestorben sein. Sonst würde Igor doch nicht mitten in der Nacht anrufen. Doch wer? Vater oder Mutter? Ein paar Sekunden nur. Ein paar Sekunden, um sich auf das Schlimmste gefasst zu machen. Aber was war in diesem Fall eigentlich das Schlimmste?
Mein Vater hatte Tagebuch geführt. Irgendwann Ende der Nullerjahre hatte ich das mitbekommen. Und mich gewundert: Dass mein Vater Tagebuch führte, hatte mich mehr als erstaunt. Er las keine Bücher (auch meine nicht), schrieb keine Briefe und war natürlich auch nicht in sozialen Netzwerken aktiv. Soziale Netzwerke? Vollkommen abwegig, er besaß ein altes Nokia und sprach so laut hinein, dass er sich das Telefonat im Grunde genommen hätte sparen können. Zumindest für die Gespräche mit den Nachbarn. Aber er las Zeitung. Schon seit Sowjetzeiten. Jeden Tag kaufte er sich irgendein Boulevardblatt, las es von vorn bis hinten durch und legte es in eine Schublade. Wenn ich zu Besuch kam, las ich in seinen zehn Jahre alten Zeitungen. Auch so eine Art Tagebuch. Ein trauriges Tagebuch der abgerissenen Kommunikationen, Zeitungspoesie aus Politik und Kreuzworträtseln. Aber ein Tagebuch? Wieso, warum?
Seine Einträge machte er auf Notizblöcken. Die er nicht geheim hielt. Im Gegenteil, bereitwillig schob er einem die Notizen zu und gewährte Einblick. Merkwürdige Aufzeichnungen waren das. Geschrieben von einem Menschen, der in seinem Leben so gut wie nie einen Stift in die Hand nahm. Die Schrift eines Menschen, der sich überhaupt keine Gedanken über seine Handschrift machte. So eine Art Chronik der vergehenden Zeit im engeren Umfeld, ein Festhalten vertrauter Details – wo er gewesen war, was er gesehen, gehört hatte, wofür er sein Geld ausgegeben, wer ihn angerufen hatte. Er notierte alle Geldbeträge, die ich ihm gab (was mich sehr beeindruckte), vermerkte die Lufttemperatur. Trockene, kühle Fakten. Wenig Bewertungen, ein Minimum an Gefühlen. Als wollte er etwas sagen und traute sich nicht.
Das Schreiben verrät uns, es personifiziert uns. Aber es entpersönlicht uns auch. Wenn wir keine Erfahrung haben und nicht richtig damit umgehen, uns das Schreiben nicht dienstbar machen können, verlieren wir einfach unsere Intonation, verlieren wir unsere Stimme, wir fabrizieren Buchstaben, fügen sie zu Wörtern, bilden daraus Sätze, bilanzieren die Zeit, die bis auf das Wetter keine Anhaltspunkte bietet. Und so tappte auch mein Vater, als er sich ans Schreiben machte, in diese Falle und wusste nicht, wie er sich befreien sollte – er versuchte, über Wichtiges zu sprechen, versuchte, das Wesentliche festzuhalten, schrieb über uns alle mit einer fremden Schrift, der Schrift eines uns unbekannten Menschen.
Es kommt recht häufig vor, dass Menschen, die sich im normalen Leben ihrer Alltagssprache bedienen, Menschen, die Sicherheit oder Zweifel, Freude oder Verzweiflung empfinden, Menschen ohne »flotte Schreibe« plötzlich in einen gestelzten Ton verfallen, wenn sie sich vornehmen, jemandem brieflich etwas mitzuteilen. Sie schreiben so, wie sie sich den Brief vorstellen – in einer farblosen toten Sprache unter Verwendung ungebräuchlicher Wörter und unnützer Wendungen. Schreiben ist wie ein Fluss – längst nicht jeder, der ins Wasser steigt, macht eine gute Figur.
In seinen Tagebüchern war mein Vater ungewohnt wehrlos. Der Versuch, über wichtige Dinge zu schreiben, gab sofort all seine wunden Punkte preis. Die wunden Punkte waren natürlich wir alle. Er hat uns geliebt, sich Sorgen um uns gemacht, uns gedankt. All das in einer trockenen, ungelenken, irgendwie buchhalterischen Sprache, die trotz allem seine Gefühle verriet – Gefühle von Zärtlichkeit und Sorge, die er im normalen Leben nie gezeigt hätte. Ich musste seine Einträge zum Wetter lesen, um zu verstehen, wie wichtig wir ihm waren. Die große Magie des Schreibens besteht darin, selbst mit Zahlen Freude und Trauer ausdrücken zu können.
Es war Weihnachten. Die Nacht war lang und feucht. Ich wollte mich einfach wieder hinlegen und weiterschlafen. Um wenigstens eine Weile nicht daran denken zu müssen. Das tat ich auch – ich schaltete das Telefon aus und versank im Dunkel. Irgendwann wachte ich auf, und sofort fiel mir ein, dass er gestorben war. Hätte ich lieber nicht geschlafen, dachte ich, dann wäre mir das Erinnern erspart geblieben.
2
Diese Angewohnheit schon als Kind: über alles zu schreiben, was ich sehe, über alles, woran mein Auge hängenbleibt. Das Auge ist nötig, um hängenzubleiben. Du beobachtest die menschliche Welt wie der Kinderarzt die Knirpse im Park – mit Liebe und mit der Bereitschaft, eine Diagnose zu stellen. Ist das schlimm? Ja, auf jeden Fall. Wieso eigentlich? Nein, natürlich nicht.
Das ist der Reiz des Schreibens: die Welt wie einen potenziellen Text zu behandeln, sie als Material zu nutzen, sich abzugrenzen, herauszutreten. Du kannst über alles Mögliche schreiben, die Literatur lässt dich gewähren, ohne etwas von dir zu fordern. Die Poesie des Lebens ist identisch mit der Poesie des Todes. Die Stimmen der Menschen werden zu den Stimmen der Figuren. Es ist eine merkwürdige Beschäftigung, auf die Jagd nach Intonationen zu gehen, indem du aus der fremden Rede einzelne, besonders markante Wörter zu filtern versuchst, ihnen nachjagst wie ein Vogelfänger und in dieser ganzen dissonanten Vielstimmigkeit die Anfänge des großen Gesangs ortest, der die Fundamente der Weltordnung, die Laufbahn der Sonne und die Mechanik des Sterbens erklärt, ein Gesang, der den Tod vielleicht nicht rechtfertigt, aber immerhin lehrt, ihn anzunehmen.
Wir setzen ja im Grunde all unsere literarischen Mittel ein, um zu lernen, wie wir über das sprechen, was uns am meisten Angst macht. Die Literatur lässt uns Synonyme finden für die schlimmsten Dinge und macht sie dadurch ein wenig erträglicher, ein wenig verständlicher. Indem wir unsere Schmerzen und Ängste benennen, zähmen wir sie, domestizieren wir sie und wagen uns in ihre Nähe. Das Unvermeidliche bleibt unvermeidlich, aber dank der Versprachlichung, dank des Aussprechens können wir Bitterkeit und Trauer zulassen. Und Trauer, die kann ja auch hell sein, sie kann auf etwas verweisen, zum Beispiel darauf, dass gar nicht alles so schlecht ist und dass in allem, was passiert, ein verborgener Sinn liegt, dass es für alles eine Rechtfertigung oder doch zumindest eine Erklärung gibt.
Im Schreiben kannst du Dinge vermitteln, die sich mit gewöhnlichen Worten nicht fassen lassen, du kannst die kleinsten Lichtblitze des kindlichen Gedächtnisses einfangen, kannst diese »normalen« Wörter fallenlassen, die nichts transportieren, die angesichts aller Rätsel und Geheimnisse des Lebens die Kraftlosigkeit deiner banalen Alltagssprache zeigen. Womit fängt das alles an? Mit dem intuitiven Erspüren, welchen Schwankungen die Sprache unterliegt, mit dem Empfinden, wie die Intensität des Redeflusses sich ändert, wie die Sprache zusammengepresst wird und zerfällt, wie sie schneller und langsamer, dicht oder durchlässig wird, je nachdem, wovon du sprichst. Die Erkenntnis, dass die Sprache, mit der du über einen Baum im Frühling sprichst, eine völlig andere ist als die, mit der du über einen Baum im Herbst sprichst. Die Erkenntnis, dass von diesem Unterschied alles abhängt – dein Zeitempfinden, deine Raumwahrnehmung, deine Satzmelodie.