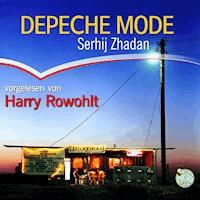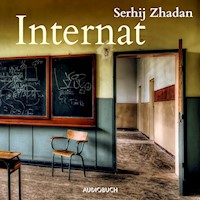
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In Bildern von enormer Eindringlichkeit schildert Serhij Zhadan, wie sich die vertraute Umgebung in ein unheimliches Territorium verwandelt. Mindestens so eindrucksvoll ist seine Kunst, von trotzigen Menschen zu erzählen, die der Angst und Zerstörung ihre Selbstbehauptung und ihr Verantwortungsgefühl entgegensetzen. Seine Auseinandersetzung mit dem Krieg im Donbass findet mit seinem Roman Internat ihren vorläufigen Höhepunkt.
Ein junger Lehrer will seinen 13-jährigen Neffen aus dem Internat am anderen Ende der Stadt nach Hause holen. Die Schule, in der seine berufstätige Schwester ihren Sohn „geparkt“ hat, ist unter Beschuss geraten und bietet keine Sicherheit mehr. Durch den Ort zu kommen, in dem das zivile Leben zusammengebrochen ist, dauert einen ganzen Tag.
Der Heimweg wird zur Prüfung. Die beiden geraten in die unmittelbare Nähe der Kampfhandlungen, ohne mehr sehen zu können als den milchigen Nebel, in dem gelbe Feuer blitzen. Maschinengewehre rattern, Minen explodieren, öfter als am Tag zuvor. Paramilitärische Trupps, herrenlose Hunde tauchen in den Trümmern auf, apathische Menschen stolpern orientierungslos durch eine apokalyptische urbane Landschaft.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Titel
Serhij Zhadan
Internat
Roman
Aus dem Ukrainischen von Juri Durkot und Sabine Stöhr
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2018
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2018.
© Suhrkamp Verlag Berlin 2018Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlaggestaltung: Hermann Michels und Regina Göllner
eISBN 978-3-518-75718-5
www.suhrkamp.de
Internat
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
Erster Tag
Zweiter Tag
Dritter Tag
Informationen zum Buch
»Fahr und hol ihn«, brüllt der Alte.
»Ist doch ihr Sohn«, brüllt Pascha zurück, »soll sie ihn doch selbst holen.«
»Er ist dein Neffe«, erinnert ihn der Alte.
»Na und?«
»Mein Enkel.«
Und das alles, ohne den Fernseher auszuschalten. Den Fernseher schaltet er nicht einmal nachts aus. Der Fernseher ist bei ihnen das Ewige Feuer: leuchtet weniger zur Freude der Lebendigen als zur Erinnerung an die Toten. Der Alte schaut die Wettervorhersage, als müsse dort sein Name erwähnt werden. Wenn die Vorhersage vorbei ist, sitzt er noch eine Weile und verdaut erst einmal, was er gehört hat. Pascha schaut nicht fern, vor allem im letzten Jahr nicht mehr, seit die Nachrichten nur noch Angst machen. Er sitzt in seinem Zimmer, am Tisch mit den Schulbüchern, hält es nicht mehr aus, erhebt sich von der Couch, verlässt die Wohnung. Der Alte dreht sich nach dem Geräusch um, denn die Federn der Couch knacken wie trockene Zweige im Pfadfinderlagerfeuer. Die Möbel daheim sind alt, aber zäh; sie werden die gegenwärtigen Bewohner bestimmt überleben. Seine Schwester hatte vorgeschlagen, wenigstens die Sessel neu zu beziehen, aber Pascha winkte nur ab. Warum neu beziehen, sagte er, das, sagte er, sei wie mit siebzig ein Lifting machen. Klar geht das, aber besser, man nimmt gleich Schmerzmittel. Seine Schwester taucht in der letzten Zeit sowieso kaum mehr auf, also spricht auch niemand mehr von neuen Bezügen.
Pascha mag dieses Haus, er wohnt hier schon sein ganzes Leben lang und hat vor, auch weiter hier zu wohnen. Es wurde von deutschen Gefangenen gebaut, gleich nach dem Krieg. Ein ziemlich geräumiges Gebäude, für zwei Familien. Die zweite Straße vom Stationsbahnhof, dicht besiedelter Privatsektor, in dem vor allem Eisenbahner wohnen. Die ganze Siedlung wurde um die Station herum errichtet: die Station gab Arbeit, sie gab Hoffnung — ein vom Dampflokqualm schwarzes Herz, das Blut in die umliegenden Talsenken und Waldgebiete pumpte. Sogar jetzt, wo das Depot leer steht wie ein Schwimmbecken, aus dem man das Wasser abgelassen hat, und höchstens noch Schwalben und Landstreicher in den Werkshallen wohnen, hängt das Leben an der Eisenbahn. Nur dass es keine Arbeit mehr gibt. Irgendwie geht die Arbeit in den Arbeitersiedlungen immer zuerst zur Neige. Die Werkshallen wurden geschlossen, und alle gingen ihrer Wege, versteckten sich in den engen Höfen mit den vom sengend heißen Sommer ausgetrockneten Brunnen und den Erdkellern, deren Vorräte noch vor Weihnachten erschöpft sind.
Pascha allerdings steht sich nicht schlecht — immerhin ist er Staatsangestellter. Ja, denkt Pascha, als er aus dem Haus tritt und die mit Hospitaldecken gepolsterte Tür hinter sich schließt, immerhin ein Staatshaushalt, immerhin Staatsangestellter. Der Schnee im Hof ist blau-rosa, er spiegelt die westliche Sonne und den Abendhimmel, dunkelt aus tiefen Poren. Scharf anzufassen ist er, schmeckt nach Märzwasser, bedeckt die feuchte schwarze Erde, so dass man keinen Wetterbericht braucht: Der Winter wird lange dauern, alle werden sich daran gewöhnen, werden leiden und sich gewöhnen. Und erst wenn sie es gewohnt sind, beginnt etwas Neues. Vorerst aber gleicht die Welt einem Schneeklumpen in warmen Händen: Er taut, gibt Wasser ab, aber je länger, desto kälter werden die Hände, desto weniger warme Bewegung in ihnen, desto mehr eisige Erstarrung. Das Wasser, wenn auch getaut, bleibt tödlich, die Sonne versinkt im komplizierten System der Wasserspiegel und Reflexionen, und es ist unmöglich, sich an ihr zu wärmen; gleich nach Mittag, nach dem feuchten Signalton, der über der Station hängenbleibt, beginnt die Dämmerung, und sofort verschwindet das Gefühl von Tauwetter, die Illusion von Wärme.
Pascha umrundet das Haus und stapft über den durchweichten Pfad zwischen den Bäumen. Ihr ganzes Leben haben sie das Haus mit einem Bahnarbeiter geteilt. Die eine Hälfte gehörte ihm, die andere Paschas schrecklich netter Familie: Vater, Mutter, Pascha und seiner Schwester. Vor ungefähr fünfzehn Jahren, als sie noch alle zusammenwohnten, brannte die Bahnarbeiterhälfte ab. Das Feuer konnte gelöscht werden. Aber wiederaufbauen wollte der Bahnarbeiter nicht — er ging zum Stationsbahnhof, bestieg einen Zug in östliche Richtung und verschwand für immer aus ihrem Leben. Sie rissen die abgebrannte Hälfte des Hauses einfach ein, tünchten die Mauern weiß und lebten weiter. Von außen sieht das Haus aus wie ein halbes Brot auf dem Regal im Laden. Der Alte verlangt das immer — ein halbes, um nicht zu viel zu kaufen. Und nicht zu viel übrig zu lassen. So hat es ihn das Leben an der Station gelehrt.
Schwarze Bäume im Schnee, scharfe Äste vor rotem Himmel — hinter dem Zaun beginnt die Straße, weiße Nachbarhäuschen, vereinzelt die gelben Apfelsinen elektrischer Lampen, Gärten, Zäune, Kamine, aus denen Rauch steigt, als stünden dort müde Männer, unterhielten sich in der Kälte und stießen warmes Januarleben aus ihren Lungen. Die Straße ist leer, niemand zu sehen, nur an der Station rumpeln manchmal die Waggons beim Rangieren, Metall auf Metall, als verrücke jemand eiserne Möbel. Und von Süden, von der Stadt her, hört man den ganzen Tag, seit dem Morgen, schwere Explosionen — mal mehr, mal weniger. Der Donner verteilt sich hoch in der Luft, im Winter ist die Akustik komisch, schwer auszumachen, woher sie geflogen kommen und wo sie einschlagen. Frische Luft, der feuchte Baumgeruch, angespannte Ruhe. So ruhig ist es nur, wenn alle verstummen, um zu lauschen. Pascha zählt bis hundert, dann kehrt er um. Zehn. Vorigen Abend waren es sechs. Im selben Zeitraum. Was sie wohl in den Nachrichten sagen?
Er trifft den Alten in der Küche. Über den Tisch gebeugt, packt er seine alte Sporttasche.
»Wo willst du hin?«, fragt Pascha.
Was für eine Frage: Natürlich den Jungen holen. Demonstrativ packt er die Zeitung ein (wozu bloß eine ausgelesene Zeitung lesen? das ist doch wie ein gelöstes Kreuzworträtsel lösen), seine Brille (Pascha schimpft immer mit ihm wegen dieser Brille — dickes Glas, verzerrtes Bild, dann trag doch lieber gleich Sonnenbrille, wenn du sowieso nichts siehst), den Rentenausweis (wenn er Glück hat, fährt er kostenlos), das Handy, abgeschliffen wie ein Kiesel am Strand, ein frisches Taschentuch. Seine Taschentücher wäscht und bügelt der Alte selbst, belastet seine Tochter nicht damit, das will er nicht. Einmal im Monat stellt er sich ans Bügelbrett und fährt behutsam über die mit der Zeit ergrauten Taschentücher, wie man entwertete Banknoten trocknet. Pascha kauft ihm immer Papiertücher, aber der Alte benutzt weiter seine Stofftücher, eine Gewohnheit noch aus der Zeit, als er auf der Station im Kontor gearbeitet hat und es noch keine Taschentücher aus Papier gab. Und andere auch nicht. Das Handy kann der Alte eigentlich gar nicht bedienen, schleppt es aber dauernd mit sich herum — zerstoßenes Gehäuse, abgenutzter grüner Knopf. Pascha lädt ihm die Karte immer wieder auf, er selbst weiß gar nicht, wie das geht. Jetzt packt er also, kramt in der Tasche, schweigt beleidigt: er wird immer schwieriger, lässt nicht mit sich reden, trotzig wie ein Kind. Pascha tritt an den Herd, trinkt direkt aus dem Teekessel. Seit die Brunnen im Sommer ausgetrocknet sind, ist es gefährlich, aus dem Kran zu trinken: Wer weiß schon, was da heutzutage in den Röhren haust. Daher kochen sie das Wasser ab und meiden die Tümpel. Der Alte antwortet ihm nicht, durchwühlt seine Tasche.
»Also gut«, sagt Pascha, »ich fahr und hole ihn.«
Aber so schnell kann der Alte nicht einlenken. Er nimmt die Zeitung aus der Tasche, faltet sie auf, faltet sie wieder zusammen, macht sie klein und steckt sie zurück. Seine gelben trockenen Finger zerknüllen dabei nervös das Zeitungspapier, Pascha schaut er gar nicht an, beugt sich über den Tisch, will Recht behalten, befindet sich mit der ganzen Welt im Krieg.
»Hast du gehört?«, sagt Pascha. »Ich fahr und hole ihn.«
»Nicht nötig«, antwortet der Alte.
»Ich hab doch gesagt, dass ich ihn hole«, wiederholt Pascha genervt.
Da nimmt der Alte demonstrativ seine Zeitung aus der Sporttasche und geht hinaus. Öffnet resolut die Tür zum Wohnzimmer — ein Streifen weichen Fernsehlichts fällt in den dunklen Flur. Dann schließt er sie geräuschvoll, und es ist, als zöge er von innen die Tür eines leeren Kühlschranks zu.
Erster Tag
Der Januarmorgen ist lang und unbeweglich wie die Warteschlange in der Ambulanz. Morgenkälte in der Küche, bleiernes Morgengrauen vor dem Fenster. Pascha tritt an den Herd und spürt den süßlichen Gasgeruch. Er assoziiert ihn immer mit munterem morgendlichem Erwachen. Ein Arbeitstag, Schülerhefte und Lehrbücher in die Aktentasche, dann in die Küche, das süße Gas atmen, starken Tee trinken, dazu Schwarzbrot, sich einreden, dass man etwas gemacht hat aus seinem Leben, und wenn man es sich genug eingeredet hat — auf zur Arbeit. Dieser Geruch begleitet ihn schon sein ganzes Leben lang, er hat nicht mal Appetit, wenn er woanders als zu Hause aufwacht, da fehlt ihm dann sein morgendlicher Herd, der nach angekokelten Kochmulden riecht. Pascha schaut zum Fenster hinaus, betrachtet den schwarzen Schnee und den schwarzen Himmel, setzt sich an den Tisch und schüttelt den Kopf, versucht, richtig wach zu werden. Sechs Uhr morgens, Januar, Montag, ein weiterer Tag ohne Arbeit.
Er nimmt ein paar Hefte vom Fensterbrett, blättert sie durch, legt sie gleich wieder zurück, steht auf, geht durch den Flur, schaut ins Wohnzimmer. Der Alte sitzt im Sessel, vom Bildschirm herab versucht einer, der blutüberströmt ist, ihm etwas zuzurufen, aber umsonst: Der Alte hat schon in der Nacht den Ton abgestellt, er ist jetzt nicht zu erreichen, da kannst du schreien, wie du willst. Pascha hält einen Moment inne und sieht auf das Blut. Der, der schreit, schaut jetzt Pascha an und schreit ihm zu: nicht ausschalten, hör mich an, es ist wichtig, es geht auch dich an. Aber Pascha nimmt schnell die Fernbedienung, drückt den großen roten Knopf, als presse er die letzte Zahnpasta aus der Tube, legt die Fernbedienung auf den Tisch und geht hinaus, schließt vorsichtig, um den Alten nicht zu wecken, die Tür hinter sich. Aber die Tür knarrt trotzdem alarmiert im Morgengrauen, der Alte im Zimmer wacht sofort auf, greift nach der Fernbedienung und schaltet schweigend den Fernseher wieder ein, in dem etwas Entsetzliches geschieht, etwas, das alle angeht. Aber da ist Pascha schon fast beim Stationsbahnhof.
*
Irgendwas stimmt nicht, denkt er, irgendwas stimmt nicht. Keine Menschenseele, kein Laut. Nicht einmal Lokomotiven sind zu hören. Keine Händler. Aus dem dunkelblauen Schnee sickert das Wasser, es hat um die null Grad, aber der Himmel hängt voller Wolken, und die Feuchtigkeit in der Luft verwandelt sich ab und zu in kaum spürbaren Regen, Nebel steht hinten über den Gleisen, und in diesem Nebel sind weder Stimmen noch Schritte zu hören. Ist halt noch früh, denkt Pascha angespannt, es ist einfach noch früh. Im Süden, wo die Stadt beginnt, steht dieselbe verdächtige Stille, keine Explosionen, keine zerfetzte Luft. Um die Ecke biegt ein Autobus. Pascha atmet auf: der öffentliche Nahverkehr funktioniert, alles in Ordnung also. Es ist einfach noch früh.
Er grüßt den Fahrer, der ängstlich den Kopf in den Kragen seiner Lederjacke zieht. Geht durch den leeren Bus, setzt sich links ans Fenster. Dann überlegt er es sich anders und wechselt nach rechts. Der Fahrer verfolgt das im Spiegel, als fürchte er, etwas Wichtiges zu verpassen. Als sich ihre Blicke treffen, dreht sich der Fahrer weg, lässt den Motor an, zieht den Schalthebel. Eisen knirscht beleidigt, der Autobus fährt los, der Fahrer dreht eine Ehrenrunde im leeren Nebel, die Station bleibt zurück. In solchen Bussen werden Tote transportiert, kommt Pascha in den Sinn. In speziellen Bussen mit einem schwarzen Streifen. Ob es dort wohl auch Sitze für die Passagiere gibt? Oder muss die Witwe auf dem Sarg Platz nehmen? Und wohin bringt mich dieser Katafalk?
Der Bus passiert eine leere Kreuzung, dann die nächste. Danach müsste der Straßenmarkt kommen, wo die Rentnerinnen Tiefgefrorenes verkaufen. Der Bus biegt ab, doch da sind keine Rentnerinnen, keine Passanten. Pascha wird langsam klar, dass wirklich etwas nicht stimmt, dass etwas passiert ist, aber er tut weiter so, als wäre alles in Ordnung. Bloß keine Panik. Der Fahrer weicht weiter seinem Blick aus und jagt den Katafalk durch Nebel und Wasser. Vielleicht hätte ich doch Nachrichten schauen sollen, denkt Pascha nervös. Vor allem diese Stille, nach all den Tagen, an denen der Himmel im Süden, über der Stadt, einer im Feuer erhitzten Eisenstange glich. Still und leer, als hätten alle den Nachtzug bestiegen und sich davongemacht. Nur Pascha und der Fahrer sind noch da, aber auch sie fahren, an den beiden auf Sand gebauten Hochhäusern vorbei, passieren das Busdepot und verlassen die Siedlung. Eine lange Pappelallee führt zur Landstraße, die Pappeln lugen aus dem Nebel hervor wie Kinder hinter den Schultern ihrer Eltern. Irgendwo dort oben bewegt sich schon die Sonne auf ihrer Bahn, irgendwo dort muss sie sich schon erhoben haben, zwar nicht zu sehen, aber zu spüren. Sonst ist nichts zu spüren. Pascha blickt wachsam in die Feuchte ringsum und versucht zu verstehen, was er verpasst hat, was der blutüberströmte Typ im Fernsehen ihm wohl mitteilen wollte. Der Fahrer umfährt vorsichtig die kalten Schlaglöcher, erreicht die Landstraße, biegt rechts ab. Der Bus rumpelt zur Haltestelle und stoppt wie gewohnt, denn hier steigt eigentlich immer jemand zu. Aber heute offenbar nicht. Eher aus Gewohnheit bleibt der Fahrer eine Zeitlang mit geöffneten Türen stehen, schaut sich dann nach Pascha um, wie um Erlaubnis heischend, die Türen schließen, und der Bus fährt weiter, nimmt Fahrt auf und wäre fast in die Straßensperre gerast.
»Fuck«, entfährt es dem Chauffeur.
An der Straßensperre ein Haufen Soldaten. Sie stehen hinter den Betonblöcken, unter zerfetzten Staatsflaggen, und blicken schweigend in Richtung Stadt. Wie oft hat er diese Stelle im vergangenen halben Jahr passiert, seitdem nach kurzen harten Kämpfen die Staatsmacht hierher zurückgekehrt ist? Auf dem Weg in die Stadt oder zurück nach Hause, zur Station, musste man jedes Mal Ausweiskontrollen fürchten, besser gesagt: Unannehmlichkeiten. Obwohl man Pascha meistens schweigend durchwinkte, ohne Fragen: ein Einheimischer, ordentlich gemeldet, der Staat hat ihm nichts vorzuwerfen. Pascha hat sich an die gleichgültigen Blicke, die gemessenen, mechanischen Bewegungen der Soldaten gewöhnt, an ihre schwarzen Fingernägel, daran, den Ausweis mit dem Meldeeintrag abzugeben und zu warten, bis sich das Vaterland einmal mehr von seiner Gesetzestreue überzeugt hatte. Die Soldaten gaben die Papiere schweigend zurück, Pascha stopfte den Ausweis in die Tasche und versuchte, allen Blicken auszuweichen. Die Staatsflaggen wurden vom Regen ausgewaschen, die Farben verblassten, lösten sich in der grauen Herbstluft auf wie Schnee im warmen Wasser.
Pascha schaut aus dem Fenster und sieht, wie ein mit Eisen gepanzerter Jeep am Bus vorbeizieht und vor ihnen zum Stehen kommt. Aus dem Jeep springen drei Typen mit Maschinengewehren. Ohne den Linienkatafalk zu beachten, rennen sie in die Menschenansammlung weiter vorne. Die Soldaten stehen da, rufen sich etwas zu, reißen sich die Ferngläser aus den Händen, beobachten die Landstraße, strengen die von Rauch und Schlafmangel roten, von tiefen Falten umrahmten Augen an. Aber die Landstraße ist leer, beängstigend leer. Normalerweise ist dort immer jemand unterwegs. Obwohl die Stadt schon lange fast völlig eingeschlossen ist und der Belagerungsring immer enger gezogen wird, fuhr doch dauernd jemand über diese eine Straße in die Stadt und zurück. Vor allem Soldaten, die Munition in die Stadt brachten, oder freiwillige Helfer, die ebenfalls ständig von hier, aus dem Norden, dem friedlichen Gebiet, allen möglichen Kram ankarrten, wie warme Kleidung oder Schnupfenmittel. Wer braucht in einer Stadt, die mit schwerer Artillerie beschossen wird und kurz vor der Kapitulation steht, eigentlich Schnupfenmittel? Aber das hinderte niemanden: Auch weiterhin brachen ganze Kolonnen vom Mutterland zu den Eingeschlossenen durch und gerieten dabei regelmäßig unter Beschuss. Obwohl doch kein Zweifel bestand, dass die Stadt aufgegeben werden würde, dass die staatlichen Truppen gezwungen sein würden, sich zurückzuziehen und die Fahnen von Paschas Land mitzunehmen, dass die Frontlinie sich so oder so nach Norden, Richtung Station verschieben und der Tod also einige Dutzend Kilometer näher rücken würde. Aber wen interessierte das schon? Auch die Zivilisten fassten sich ein Herz und drängten über den zerbrochenen Asphalt in die Stadt. Die Soldaten rieten ihnen ab, aber keiner hier hatte groß Vertrauen zu den Soldaten, jeder hielt sich selbst für klüger. Und setzte sich wegen irgendeiner Pensionsbescheinigung dem Granathagel aus. Wenn man zwischen Tod und Bürokratie wählen muss, ist der Tod ja wirklich manchmal die bessere Wahl. Die Soldaten wurden ärgerlich, schlossen manchmal den Übergang einfach, aber kaum verstummten die Explosionen für einen Moment, bildete sich vor der Sperre eine Schlange. Und man musste die Leute passieren lassen.
Heute aber ist die Landstraße völlig leer. Offensichtlich geht dort in der Stadt wirklich etwas Schlimmes vor, etwas, das sogar die Minibusfahrer und Spekulanten abhält. Und ein Haufen unrasierter Männer, wütend vor Schlaf- und Ausweglosigkeit, steht zwischen Betonblöcken und Stacheldraht, und alle schreien sich an, lassen ihre Wut aneinander aus. Da löst sich ein großer hagerer Soldat aus der Menge und kommt auf sie und ihren Bus zu, stumpfe Augen unter dem übergroßen Helm, stumpf und weit aufgerissen, wahrscheinlich vor Angst. Er winkt gebieterisch in ihre Richtung, stehen bleiben und keine Bewegung, heißt das. Wobei sie sich sowieso nicht bewegen — stehen starr und halten den Atem an. Im Bus wird es plötzlich eng und die Luft so dünn, dass man beinahe erstickt, so viel man auch nach ihr schnappen mag. Der Soldat erreicht die Tür und schlägt tönend mit der Faust gegen die Metallhaut. Der Bus erklingt wie ein versunkenes U-Boot, und der Fahrer öffnet hastig die Tür.
»Wohin, fuck?«, schreit ihn der Soldat an und klettert gebückt ins Innere. Er muss sich krümmen, der Helm rutscht ihm über die Augen, und Pascha kommt es vor, als kenne er ihn, aber woher bloß? denkt Pascha. Der Soldat schaut misstrauisch, tritt näher, richtet den Helm, wischt sich die Augen und schreit Pascha ins Gesicht: »Ausweis! Deinen Ausweis, fuck!«
Pascha durchwühlt seine Taschen, und Taschen hat er plötzlich so viele, dass er sich darin verliert und nichts mehr finden kann, nur verschiedenen Müll zutage fördert: die feuchten Tücher, mit denen er morgens in der Schule seine Schuhe abwischt, den Ausdruck seines Stundenplans, eine Benachrichtigung, dass auf der Post ein Päckchen abzuholen ist. Ach ja, denkt Pascha, während er dem Soldaten angstvoll ins Gesicht blickt, ich muss das Päckchen noch abholen, das Päckchen, das Päckchen. Vergessen, denkt er, und seine Haut wird plötzlich feucht und kalt, als hätte man ihn selbst mit einem feuchten Tuch abgewischt.
»Wird's bald?«, schreit der Soldat und kommt ganz nah.
Vor allem aber hat Pascha keinen Schimmer, in welcher Sprache der andere redet. Denn die Worte entfahren ihm so harsch und abgehackt, dass sie weder Akzent noch Intonation enthalten, er schreit einfach etwas heraus, als huste er eine Erkältung ab. Er müsste eigentlich die Staatssprache sprechen, denkt Pascha panisch, die Staatssprache, vor einem Monat stand hier doch eine Einheit aus Shytomyr, die haben sich noch lustig gemacht, wie er von einer Sprache in die andere stolperte. Sind das noch dieselben oder nicht? überlegt Pascha fieberhaft, während er in die aufgerissenen Augen schaut, in denen sich seine ganze Furcht spiegelt.
»Vergessen«, antwortet Pascha.
»Was?«, fragt der Soldat ungläubig.
Der Fahrer fährt hoch, weiß nicht, ob er fliehen soll oder bleiben. Pascha weiß auch nicht, was tun, und denkt, wie konnte mir das bloß passieren, wie bloß?
Da ertönt draußen ein Schrei, so grell und durchdringend, dass der Soldat zusammenzuckt, sich umdreht, den Fahrer zur Seite stößt und aus dem Bus springt. Der Fahrer sinkt in seinen Sitz zurück, kommt aber schnell wieder auf die Beine und springt dem Soldaten hinterher. Auch Pascha springt hinaus, und alle laufen sie in Richtung der Menschenmenge, die ganz plötzlich verstummt und sich auflöst. Von Süden her, von hinterm Horizont, aus Richtung der belagerten Stadt, wie aus einem unsichtbaren Luftloch, strömen Männer. Einzeln, zu zweit, in Gruppen überwinden sie die Horizontlinie und kommen hierher, auf die Menschenmenge zu, die schweigend steht und wartet. Dort am Horizont werden sie kaum merklich größer, wachsen wie Schatten am Nachmittag. Noch schaut niemand durchs Fernglas und niemand schreit, als fürchteten alle, die Prozession zu erschrecken, die langsam die Landstraße füllt und sich bereits mehrere hundert Meter ausgedehnt hat. Die Männer gehen gemessen, als hätten sie es nicht eilig, aber dann wird klar, dass sie einfach nicht schneller können: Sie sind zu erschöpft, zu schwer fallen ihnen diese letzten paar hundert Meter. Aber gehen müssen sie, also gehen sie, ohne stehen zu bleiben, nähern sich stetig, bewegen sich auf ihre Fahne zu, steigen aus der Senke zur Straßensperre auf, wie Passagiere, die man wegen Schwarzfahrens aus dem Fernbus geworfen hat. Es ist, als beschleunige sich die Zeit, und alles geschieht so schnell, dass keiner Gelegenheit hat, sich zu fürchten oder zu freuen. Die Ersten erreichen schon die farbbeschmierten Betonblöcke, aber dort am Horizont tauchen immer neue auf und steigen in die Senke hinab, streben nach Norden, zu ihren Leuten. Und je näher sie kommen, je deutlicher man ihre Gesichter erkennen kann, desto stiller wird es. Denn jetzt kann man die Augen derer sehen, die da kommen, und in diesen Augen ist nichts Gutes zu erkennen — nur Erschöpfung und Frost. Ihr Atem ist so kalt, dass er an der Luft nicht einmal kondensiert. Vor Schmutz schwarze Gesichter, leuchtende Augäpfel. Helme, schwarze zerschlissene Kappen. Halstücher, grau vom Schutt. Gewehre, Riemen, leere Taschen, auf dem Rücken Säcke, schwarz vom Schmieröl an den Händen. Von Ziegelstaub und Schwarzerdeklumpen verdreckte Stiefel. Die Ersten, die kommen, schauen vorwurfsvoll und ungläubig, als ob alle, die hier stehen und sie erwarten, an irgendetwas schuld seien, als müsste alles eigentlich umgekehrt sein: sie, die kommen, müssten hier unter dem tiefhängenden Januarhimmel stehen und nach Süden blicken, hinter den Horizont, wo nichts ist als Schmutz und Tod. Als der Erste die Befestigung erreicht, reckt er plötzlich die Faust gen Himmel und schreit los, als schelte er die Götter für ihr schlechtes Benehmen. Er flucht, droht, wütet, die Tränen rinnen ihm übers Gesicht, das dadurch sauberer wird. Die Menge tritt noch weiter auseinander, und die Ankommenden vermischen sich mit denen, die dastehen, so wie sich schmutziges Fluss- mit dem sauberen Meerwasser vermischt. Die Menge passt schon nicht mehr zwischen die kalten Blöcke, aber der, der zuerst angekommen ist, steht immer noch da und kreischt etwas von Ungerechtigkeit und Rache, dass die Stadt aufgegeben wurde, ihrem Schicksal überlassen mit allen, die dort wohnen, dass man sie in fremde Hände hat fallen lassen, nicht standgehalten hat, abgerückt ist, aus der Falle geschlüpft. Gut für die, die rausgeschlüpft sind, aber was ist mit den Zurückgebliebenen dort in den zerbombten Straßen? Was wird aus denen? Wer holt sie dort raus? Wieso bloß, schreit er, ohne die Fäuste sinken zu lassen, haben wir die Stadt aufgegeben, sind geflohen, aus der Stadt abgehauen? Wie kann das sein? Wer wird dafür geradestehen? Olescha, schreit er, Olescha, mein Kamerad, nicht mal verscharren konnte ich ihn; hab's nicht geschafft, ihn in den Schnee zu schleifen, verbrannt ist er, an der Tankstelle liegen geblieben. Wem habe ich ihn überlassen? Wer bringt ihn weg? Wer? schreit er und droht den Regenwolken mit der Faust. Bis einer, der später kam, sich an ihn heranschiebt und ihm einfach eins auf den Schädel gibt, halt's Maul, uns geht es auch so schon dreckig. Auf einmal reden alle gleichzeitig: fragen, antworten, die einen sollen sich aufwärmen, andere werden in alte, angesengte Decken gewickelt. Da erreicht eine neue Gruppe die Sperre, eine Bahre auf den Schultern, und auf der Bahre liegt jemand, der so zerfetzt und blutig ist, dass Pascha die Augen abwendet, ein Offizier befiehlt, den Notarztwagen zu rufen, aber welchen Notarztwagen denn? Die Bahre wird von denen übernommen, die mehr Kraft haben, und zum Bus gebracht, los, schreien sie dem Fahrer zu, lass den Motor an, bring ihn zur Station. Pascha überlegt, dass das sowieso am besten ist — heimzufahren, und macht einen Schritt Richtung Bus, aber an der Tür steht jetzt ein Soldat und stößt Pascha weg, ohne ihn auch nur anzublicken. Pascha sieht nur, wie man die Bahre vorsichtig hineinreicht, bemerkt das verklebte Haar und die zuckrige Weiße des Knochens, als habe man eine Honigmelone aufgeschnitten und ihre süßen Innereien nach außen gekehrt, bemerkt die verkrampfte Hand, die sich an die Bahre klammert, so fest, wie man sich sonst nur an das Leben klammert.
Der Bus versucht zu wenden, aber um ihn herum wogt die Menge, alle schreien und stören, stören und schreien, vor allem schreien sie, man solle nicht stören. Schließlich gibt einer ein Kommando, die Menge gerät in Bewegung und schwappt zur Seite, der Bus wendet und verschwindet hinter der Biegung. Pascha wird an den Straßenrand gedrängt, vergeblich versucht er wegzukommen, da ruft jemand hinter ihm. Gib mir ne Zigarette, sagt ein Soldat ohne Helm mit schmutzigem Silberhaar. Hab keine, antwortet Pascha. Was hast du denn? Der Soldat lässt nicht locker. Pascha greift automatisch in die Tasche und zieht seinen Ausweis heraus.
*
Pascha steht am von Kettenfahrzeugen und Lastwagenrädern aufgewühlten Straßenrand und versucht sich zu erinnern, wo er solche Finger schon einmal gesehen hat. Verkrampfte, taube Finger, die sich ans Leben klammern. Da fällt es ihm ein: vor einer Woche, der letzte Schultag. Erst eine Woche her, alles war wie jetzt: frischer Wind, blasse Januarsonne. Jemand ruft ihn in den Schulkorridor, er tritt hinaus, die anderen Lehrer scheuchen die Kinder zurück in die Klassenzimmer, wo sie sofort ans Fenster stürzen, um zu sehen, was draußen vorgeht. Auch Pascha dreht sich zu seinen Schülern um, also, schreit er, Ruhe, ich komme gleich wieder, aber niemand hört auf ihn. Die Direktorin läuft wankend an Pascha vorbei mit ihrem schweren kranken Körper. Pascha läuft ihr nach, sie erreichen den Vorplatz und bleiben stehen. An der Schule steht ein Jeep mit Soldaten, statt einer Nummer — eine kämpferische Losung, weiß auf schwarz, Pascha versteht nicht viel von solchen Losungen, daher weiß er auch nicht, was das für Leute sind. Vielleicht ein Freiwilligenverband, vielleicht die Nationalgarde. Die Fahne auf dem Jeep ist dieselbe wie über ihrer Schule. Die Macht ist also nicht in andere Hände übergegangen.
Die Soldaten rennen geschäftig hin und her, einer telefoniert, der Anführer tritt zur Direktorin, hakt sie fest unter, führt sie beiseite und setzt ihr mit unbeteiligter Stimme etwas auseinander. Pascha kann nur Bruchstücke verstehen, der Soldat fragt nicht um Erlaubnis, eher schon stellt er Bedingungen. Nein, sagt der Soldat, unmöglich, nirgendwo anders, hier, zu Ihnen, wir verteidigen Sie schließlich, rufen Sie an, wo Sie wollen, bis nach Kiew. Die Direktorin versinkt in ihr schwarzes offizielles Kostüm, ihr Gesicht wird grau, und sofort erscheint sie älter. Sie will widersprechen, wagt es aber nicht. Sieht sich nach Pascha um, als bitte sie ihn um Unterstützung, aber der Soldat klopft Pascha nur auf die Schulter, als er an ihm vorbeigeht, und von diesem Klopfen rieselt aus Paschas Lehrerjackett krümelige Schulkreide.
Dann fährt ein alter brauner Krankenwagen an der Schule vor, von der Farbe aufgeweichter Haushaltsseife, und man beginnt, Verwundete auszuladen. Man trägt sie auf dem Rücken wie Säcke, Bahren gibt es offenbar keine, schwer steigen sie die Treppen hinauf und stapfen durch den leeren, hallenden Korridor. Biegen rechts ab, stoßen mit ihren lehmverkrusteten Stiefeln die erste Tür auf. Die Tür zum Fachsaal Ukrainisch. Also Paschas Saal. Dem Saal, wo Pascha unterrichtet. Die Verwundeten legen sie einfach auf dem Boden ab, zwischen die Pulte. Pascha kommt hinterher, entlässt sofort die Kinder, die erschrocken über das frische Blut steigen und sich dann im Korridor herumdrücken. Pascha geht auch in den Korridor und treibt die Klasse schreiend auseinander: Los, heim, schreit er, hier gibt's nichts herumzustehen. Er schreit auf Russisch, wie immer im Korridor, außerhalb des Unterrichts. Dann schließt er ängstlich die Tür. Im Klassenzimmer riecht es nach Schmutz und Blut, Schnee und Erde. Die Soldaten bringen Decken, warme Sachen, ziehen die Pulte auseinander, tragen die Verwundeten in verschiedene Ecken.
Ein weiterer Soldat betritt das Klassenzimmer, Maschinengewehr über der Schulter, Zigarette im Mundwinkel. Schwarze Haare, dunkle und daher misstrauische Augen, Staub hat sich in die Falten seines Gesichts gefressen, Pascha kennt so etwas sonst nur von Bergarbeitern, die gerade aufgefahren sind. Unbeteiligt betrachtet der Soldat die Verwundeten, bemerkt Pascha, nickt, grüßt, spricht mit kaukasischem Akzent. Er verwechselt die Sprachen, versucht aber freundlich zu reden, als lege er Wert darauf, dass Pascha ihm glaubt. Einige Wörter übersetzt er direkt aus dem Russischen ins Ukrainische, strengt sich an wie beim Examen. Alles gut, du, Lehrer, sagt er, keine Angst, du, wir geben deine Schule nicht auf, wir verteidigen, sagt er. Wirst weiter unterrichten.
»Und wer ist das?« Der MG-Mann nickt zu den Porträts.
»Dichter«, antwortet Pascha unsicher.
»Gute?«, fragt der MG-Mann.
»Tote«, sagt Pascha für alle Fälle.
»Richtig so«, lacht der MG-Mann, »guter Dichter ist toter Dichter.«
Behutsam öffnet er das Fenster und postiert das Maschinengewehr auf dem Fensterbrett. Als wolle er es lüften. Pascha klaubt die Hefte von seinem Tisch, stopft sie in den Rucksack, aber im Hinausgehen bleibt sein Blick an einem Verwundeten hängen, der unter dem gestrichenen Heizkörper liegt: zwei raue Decken mit angetrockneten Blutflecken, darüber ein abgewetzter alter Schlafsack, das Gesicht zur Wand, so dass nur das lang nicht gewaschene Haar und der lang nicht rasierte Hals zu sehen sind; da liegt der aufgeschnittene Ärmel der Armeejacke, zwischen den Verbänden schaut schmutzige, mit winzigen Schnitten übersäte Haut hervor, die entblößte linke Hand drängt aus dem Schlafsack. So wie ein Passagier dritter Klasse morgens die Hand unter der Eisenbahndecke hervorschiebt, die seinen schläfrigen, unbeweglichen Körper bedeckt und die angewinkelten Knie und die Vertiefung des Bauches nachzeichnet wie das Grabtuch den Körper Christi, so dass die Nacktheit des verbrauchten Männerkörpers sich scharf abzeichnet vor dem Hintergrund der Säcke und der warmen Kleidung auf der Nachbarbank. Pascha erscheint diese hagere, blasse, von spärlichen Haaren bedeckte Hand im Hier und Jetzt ganz unnatürlich, angesichts des im Sommer gestrichenen Schulfußbodens, der Pulte und Tafeln; die Hand aber klammert sich an den Schlafsack, klammert voller Angst, ihn loszulassen — als sei der Schlafsack das Einzige, was sie noch mit dem Leben verbindet. Pascha kann für einen Moment den Blick nicht losreißen von den langen schwarzen, zerschnittenen und zerschlagenen Fingern mit dem hellblauen Benzinton, dann aber weht von draußen ein frischer Winterwind herein und bewegt den Fensterflügel, der MG-Mann kann ihn gerade noch festhalten, Pascha fällt ein, wo er sich befindet, er tritt rasch in den Schulkorridor hinaus und läuft der Direktorin direkt in die Arme.
»Pawlo Iwanowytsch, Pawlo Iwanowytsch«, weinend packt sie ihn am Ärmel, »das geht doch nicht! Sagen Sie ihnen, dass sie verschwinden sollen.«
Sogar ihr Weinen ist falsch, denkt Pascha unwillkürlich. Sie kann überhaupt nicht weinen, begreift Pascha, weiß gar nicht, wie das geht. Und lachen kann sie auch nicht.
»Sagen Sie es ihnen«, immer noch siezt sie Pascha, wie den Schaffner in der Straßenbahn, »sagen Sie, sie sollen verschwinden.«
»Ist gut«, beruhigt Pascha sie, »ich sag's ihnen, ganz bestimmt.«
Er führt sie zum Direktorenzimmer, hilft ihr, sich zu setzen, geht hinaus und schließt die Tür. Bleibt noch eine Zeitlang an der Tür stehen, hört, wie sich die Direktorin augenblicklich wieder fasst, die Nase hochzieht, zum Telefon greift, irgendwo anruft und in den Hörer zetert.
»Ohne mich«, flüstert Pascha und geht nach Hause.
Die Soldaten stehen auf dem Vorplatz und rauchen. Wenn sie das Schulgebäude betreten, putzen sie sich die Stiefel achtsam an einem frischen Lappen ab. Das Blut lässt sich nur schwer abputzen. Aber es geht.
*
In der Feuchte nimmt man die Gerüche besonders deutlich wahr. Diejenigen, die von Süden gekommen sind, verströmen Brandgeruch, als hätten sie lange am Lagerfeuer gesessen. Die Luft füllt sich sofort mit dem schweren Geruch feuchter Kleider. Es werden immer mehr, manche gehen gleich weiter Richtung Station, andere klettern in den Jeep, wieder anderen wird auf die Ladefläche eines LKW geholfen. Es ist eng, im Vorbeigehen bleibt einer der Soldaten mit seiner kugelsicheren Weste an Pascha hängen, Pascha macht sich klein, tritt einen Schritt zurück, an den Straßenrand, dann noch einen — sein knöchelhoher Halbschuh zerstampft Schnee gemischt mit gelbem Lehm — dann noch ein Schritt und noch einer.
»Ich würde da lieber nicht hineintreten«, hört Pascha.
Er dreht sich zu der Stimme um. Neben ihm steht ein Mann, dunkle Jack-Wolfskin-Jacke, Bergstiefel, Laptop-Rucksack, eigens rasierter Drei-Tage-Bart — er schaut ironisch, fast schon herablassend. Spricht selbstbewusst, doch bei genauerem Hinsehen bemerkt man das etwas zu kleine Kinn, die launischen Fältchen um den Mund, offensichtlich trägt er den Bart, um brutaler zu wirken. Er ist um die fünfzig, behandelt Pascha entsprechend wie einen Rangniedrigeren. So behandeln Passagiere, die vom Startbahnhof an dabei sind, die Zugestiegenen: zwar verfügen alle über eine Fahrkarte, aber die schon im Abteil verbrachten Stunden verleihen einen unbegreiflichen Vorrang. Er heiße Peter, sagt er, »Pie-ter« — in annehmbarem Russisch, aber ohne den Akzent zu verleugnen.
»Gehen Sie dort besser nicht hin«, sagt er und deutet in Richtung Straßenrand, »sonst haben Sie bald keine Beine mehr. Und lassen Sie uns überhaupt verschwinden, die knallen sich hier gleich gegenseitig ab vor Wut.«
Er dreht sich um und schiebt sich durch die Menge. Pascha schaut, sieht den breiigen Schnee unter seinen Füßen und beschließt, Peter zu folgen.
Nachdem sie sich von der Straßensperre weggearbeitet haben, wird die Menge spärlicher, Peter umgeht klug eine Gruppe von Soldaten, die sich wütend gegenseitig etwas beweisen wollen, steigt über Verwundete, die einfach auf der Straße auf Decken und alten Zivilmänteln abgelegt wurden. Pascha folgt ihm, Schritt für Schritt, und versucht, keinem der Soldaten in die Augen zu schauen. Als Kind ist er so an den Straßenhunden vorbei: Hauptsache, ihnen nicht in die Augen sehen, sonst wittern sie sofort das Fremde. Pascha kann sich einfach nicht an die Soldaten gewöhnen, hat sie in den letzten Monaten immer gemieden. Wenn sie sich ihm bei der Station in den Weg stellten und ihn ausfragten, antwortete er knapp, den Blick über die Schulter seines Gesprächspartners in die Ferne gerichtet. Hier aber gibt es unglaublich viele, und von ihnen geht ein so undefinierbarer Geruch aus — nach Schmutz und Eisen, Tabak und Pulver. Ängstlich umrundet Pascha die nächste Gruppe, spürt, wie misstrauisch ihn die Soldaten beäugen, beschleunigt den Schritt und holt Peter ein. Der tritt zu einem von Soldaten umringten dunkelblauen alten »Ford«. Die Soldaten haben auf der Motorhaube eine selbstgebastelte Karte mit von Hand eingezeichneten Pfaden und rot markierten Anhöhen ausgebreitet. Die Karte ist im Regen zerlaufen und erinnert an eine weinübergossene Tischdecke in einem Bahnhofsrestaurant. Peter drängelt sich zwischen die Soldaten, klopft einem auf die Schulter, drückt einem anderen die Hand, ohne den Blick von der Karte abzuwenden, fängt gleich Streit an, fährt mit dem kurzgeschnittenen rosa Nagel über die verlaufene Karte, schreit vor Erregung. Aber die Soldaten schreien auch und fahren mit ihren schwarzen und durchgefrorenen Fingern ebenfalls über die Karte, sind anderer Auffassung. Endlich spuckt einer von ihnen aus, offensichtlich der Anführer, klein, kräftig gebaut, mit grauem Igelschnitt, zieht sich eine schwarze Sportmütze über den großen Schädel, wirft die Maschinenpistole über die Schulter und gibt das Kommando zum Aufsitzen. Ein großer alter Soldat, abgemagert und gebeugt, greift sich die Karte und setzt sich ans Steuer. Neben ihn setzt sich der Grauhaarige in seiner Sportmütze. Der ganze Rest zwängt sich auf die Rückbank. Irgendwie gelingt es Peter, sich mit dazuzuquetschen, obwohl ihn, soweit man erkennen kann, niemand dazu eingeladen hat, trotzdem drängt er sich hinein und versucht sogar, die Tür hinter sich zuzuziehen, doch plötzlich fällt ihm etwas ein und er lehnt sich hinaus und ruft Pascha zu:
»Was ist, fahren Sie mit? Wie lange sollen wir denn noch auf Sie warten? Steigen Sie ein!«
Erschrocken läuft Pascha zum »Ford«. Aber hinten sitzen schon vier Soldaten, und in ihren kugelsicheren Westen wirken sie besonders breit und massiv. Dann natürlich noch Peter, der auch Platz braucht, und dass sie dort alle hinpassen, grenzt an ein Wunder. Pascha tänzelt unentschlossen auf dem Asphalt hin und her, aber Peter insistiert:
»Auf, auf«, ruft er und klopft sich einladend auf die magere, von schwarzem Jeansstoff umhüllte Hüfte.
Und so fahren sie dann: vorne der bucklige Fahrer und der Kommandeur, der unverdrossen versucht, etwas auf den Fetzen der Karte zu erkennen, hinten die Soldaten in ihren kugelsicheren Westen, Peter mit Pascha auf dem Schoß. Pascha sitzt unbehaglich, er hat noch nie einem Fremden auf dem Schoß gesessen, höchstens als Kind. Die Soldaten fühlen sich auch unbehaglich, aus Solidarität mit Pascha. Stille tritt ein, und nur das klopfende dumpfe Geräusch der aneinanderschlagenden Schutzwesten ist zu hören.
Der »Ford« rollt langsam über die Landstraße, überholt die endlose Kette der Soldaten, die von der Straßensperre Richtung Station ziehen. Viele schauen hoffnungsvoll auf das Auto, wenden aber enttäuscht die Köpfe ab, als sie die Zahl der Passagiere sehen. Sie fahren nicht lange, bei der Einfahrt in die Siedlung biegt der Fahrer rechts ab, drückt aufs Gas, und der Ford landet, tiefe Radspuren wie Schnitte im gelben Schnee hinterlassend, auf dem Parkplatz des Motels. Pascha schiebt sich als Erster hinaus, dahinter gelangt der Rest der Passagiere an die feuchte Luft.
Ein einstöckiges Gebäude mit dem Schild »Paradise« über dem Haupteingang. Im rechten Flügel ein Café, im linken eine Autowaschanlage, in der Mitte der Zugang zur Rezeption. Die Fenster im ersten Stock wurden von einer Explosionswelle weggefegt, die Besitzer haben die ausgeschlagenen Scheiben durch Folie ersetzt. Oben auf dem Dach erhebt sich eine Satellitenschüssel, an einer Stelle von einem Granatsplitter durchbohrt, sie gleicht einer Sonnenblume am Morgen, ausgerichtet nach Osten.
Der Parkplatz steht voller Autos und Militärtechnik: schwere KRAS-Lastwagen, nicht verzollte PKW mit polnischen Nummernschildern, ein Haufen zerbeulter und verschrammter Fahrzeuge — ohne Fenster, mit durchsiebten Türen und weggerissener Motorhaube. In der Nähe ein richtiger Panzer, vollgepackt mit schmutzigen, verschiedenfarbigen Sachen. Auf der Panzerung liegen verschnürte Decken und Schlafsäcke, Taschen, Bergrucksäcke, jemand hat sogar ein Feldbett an die Seite geklemmt. Beim Café steht ein Haufen Soldaten — rauchend, schreiend, streitend. Die, mit denen Pascha gekommen ist, stoßen zu der Gruppe. Peter betrachtet skeptisch das Firmenschild.
»Paradies«, sagt er lachend. »Eher der erste Kreis der Hölle. Na, kommen Sie?«, fragt er Pascha und schließt sich ebenfalls der Gruppe an.
Pascha fällt nichts Besseres ein, als ihm zu folgen. Warum folge ich ihm? denkt er im Gehen. Warum mache ich überhaupt, was er sagt? fragt er sich, während er versucht, in der Menge Peters absichtlich schlecht geschnittenen Schopf nicht aus dem Blick zu verlieren. Er drängt sich durch die Soldaten und betritt das Café.
Ein paar Tische, der Tresen, darüber Jagdtrophäen: ein ausgestopfter Fasan, ein Hirschgeweih, sogar ein abgehackter Kopf. Pascha kommt er vor wie ein Hund, aber vielleicht irrt er sich auch. Neben der Tür das Klo, auf der anderen Seite an der Wand ein Plasmabildschirm. Die Plätze an den Tischen sind alle belegt, die Soldaten sitzen da und schauen sich selbst im Fernsehen an. Hinter dem Tresen steht eine Frau und beobachtet die Gäste mit Abscheu, aber ihr Abscheu ist irgendwie müde, und auch sie selbst irgendwie lädiert und ungeschminkt, ihre Haare sind gelb mit schwarzem Ansatz, wie frisches Gras, das auf dem Feld durch die letztjährigen verbrannten Stängel wächst. In den Regalen hinter ihr Cola und Berge von Schokoriegeln. Auf der Theke dunkelt getrockneter Fisch. Alles Wichtige aber holt die Frau aus der Tiefe hervor, unter der schweren Theke voller Fisch. Holt es hervor und schenkt ein. Alle reden gleichzeitig, hören kaum zu und unterbrechen sich dauernd, und der Geruch nach getrocknetem Fisch steht so dicht, als halte man hier schon den dritten Tag Leichenschmaus.
Peter schiebt sich selbstbewusst Richtung Tresen, nickt der Frau zu, die bemüht lächelt und dabei weiter einschenkt. Peter fragt sie etwas, die Frau nickt zustimmend — ohne ihren Abscheu zu verbergen, beobachtet sie weiter aufmerksam den Saal. Peter öffnet eine Seitentür, Pascha schlüpft ihm hinterher und betritt den Nachbarraum. Auch hier stehen Tische, auch hier alles voller Soldaten, es ist genauso laut, die Stimmen vereinigen sich zu einem bedrohlichen Strom, aber am anderen Ende, unter der Treppe, die in den ersten Stock führt, befindet sich ein kleines Tischchen für zwei, Peter steuert darauf zu, grüßt beiläufig einen Soldaten. Ganz schwarz vor Rauch und Alkohol, winkt er Peter zu, ohne aufzuschauen, und sagt etwas, und als Peter weitergeht und sich in den Plastikstuhl fallen lässt, redet der Soldat immer noch und nickt, als unterhalte er sich mit einem Unsichtbaren. Pascha setzt sich neben Peter, sofort werden irgendwoher Fisch und Alkohol in Plastikbechern gebracht. Peter hebt lässig seinen Becher und stößt mit einem anderen Plastikbecher an. Einwegknistern des Plastiks, Einwegschütten des Alkohols in die Kehle. Peter hält seinen Becher fröhlich in die Luft und gießt dann mit kaum merklicher Bewegung den Inhalt unter den Tisch, auf den kalten Steinboden. Woraufhin er aus einer kleinen, kaum sichtbaren Tasche einen ebenso kleinen, mit braunem Leder überzogenen Flachmann holt, aufschraubt und sich etwas Gutes einschenkt. Pascha bietet er nichts an — Pascha führt seinen Becher an die Lippen und schüttet sich die bittere, brennende Flüssigkeit lokaler Herstellung in die Gurgel, muss husten, jemand steckt ihm ein Stück Fisch direkt in den Mund, und Pascha kaut gewissenhaft darauf herum, bekämpft den Geruch des Fusels mit dem toten Geruch des Fischs. Peter schaut mit fasziniertem Abscheu zu, wobei unklar bleibt, was den Abscheu hervorruft — Pascha oder der Fisch. Aber er fasst sich rasch wieder und lächelt, schreit etwas in die Menge als Antwort auf eine Frage, kommentiert etwas, was er am Nachbartisch gehört hat. Nippt an seinem Trunk und wendet sich Pascha zu.
»Und was machen Sie eigentlich?«, fragt er.
Pascha überlegt, in welcher Sprache er antworten soll. Schließlich antwortet er auf Russisch.
»Ich bin Lehrer«, sagt er knapp.
»Aha!«, lacht Peter.
Er greift in die Tasche und holt nacheinander zwei Päckchen Zigaretten hervor: ein neues, mit Billigen, Starken, und ein angebrochenes, mit Leichten, fast ohne Nikotin. Die Billigen steckt er wieder ein, nimmt zwei Leichte und reicht eine davon Pascha. Als Pascha ablehnt, fummelt Peter die überzählige Zigarette sorgfältig wieder in das angebrochene Päckchen, die andere fasst er nachlässig mit den Lippen, holt aus einer versteckten Tasche ein nagelneues Zippo, öffnet mit dem Daumen der linken Hand geschickt die Klappe, steckt sich die Zigarette an, lässt das Feuerzeug wieder verschwinden und nimmt einen tiefen Zug. Dabei macht er ein so schmerzverzerrtes Gesicht, überlegt Pascha, als rauche er ein Kraut aus dem Garten.
»Und wo sind Ihre Schüler?«, fragt Peter weiter und bläst dabei den Rauch aus, seine Stimme wird brüchig und zutraulich.
»In den Ferien«, erklärt Pascha.
Peter nickt zustimmend.
»Aha«, sagt er, »in den Ferien. Die Schule wurde wegen der Ferien erfunden«, sagt er. »Ich bin in den Ferien immer mit meinem Alten zum Angeln gefahren.«
»An den Fluss?«, fragt Pascha.
»An den Ozean«, sagt Peter.
»Welchen Ozean?«
»Den Stillen.«
Pascha weiß nicht, was er darauf antworten soll.
»Wohin wollten Sie eigentlich?«, fragt Peter, ohne eine Antwort abzuwarten.
»In die Stadt.« Pascha kauert nervös in seinem Stuhl. Peter spricht so leutselig, dass man einfach misstrauisch werden muss.
»Aha«, freut sich Peter wieder. »Geschäfte?«
»Geschäfte«, stimmt Pascha nach kurzem Überlegen zu. »Mein Neffe ist dort im Internat. Ich will ihn heimholen. Über die Feiertage.«
»Sie haben hier jeden Tag Feiertag, wie ich sehe.«
Pascha findet, dass es dazu nichts zu sagen gibt.
»Vielleicht hole ich ihn ein anderes Mal«, fügt er hinzu, nachdem er geschwiegen hat.
»Aha«, stimmt ihm Peter zu, »in zwei Monaten vielleicht.«
»Was in zwei Monaten?«, fragt Pascha verständnislos.
»Na, sobald sich die neue Frontlinie etabliert hat, sobald ein neuer Checkpoint errichtet ist«, erklärt Peter. »Warum haben Sie ihn denn nicht früher geholt, wenn Sie schon Ferien haben? Lesen Sie denn keine Nachrichten?«
»Nein«, gibt Pascha ehrlich zu.
»Ich auch nicht«, gesteht Peter. »Ich schreibe sie«, fügt er nach einer zu kurzen Pause hinzu, lacht und verströmt in alle Richtungen Tabakrauch.
»Was tun?«, fragt Pascha verzweifelt. »Er hat Probleme mit der Gesundheit, ich mache mir Sorgen um ihn.«
»Holen Sie ihn jetzt«, rät ihm Peter lächelnd, »der Rückzug wird noch ein paar Tage dauern, und die«, er zeigt auf die Soldaten ringsum, »die haben jetzt anderes im Kopf, als sich um Sie zu scheren. In der Stadt wechselt die Macht. Wer weiß, was aus dem Internat wird. Die neuen Machthaber«, er zeigt mit dem Kopf in die Richtung, wo seiner Ansicht nach jetzt die neuen Machthaber sitzen, »haben mit Internaten nichts am Hut. Sie werden die Stadt säubern, nachdem Ihre Leute abgezogen sind.«
Dieses »Ihre Leute« stößt Pascha sauer auf. Aber er beherrscht sich und widerspricht nicht.
»Dort wird sicher geschossen?«, vermutet Pascha.
»Eben«, stimmt ihm Peter zu. »Ich würde meine Ferien nur ungern unter Beschuss verbringen.«
Pascha überlegt fieberhaft. Aber es fällt ihm nichts Besseres ein, als seinen Alten anzurufen. Er nimmt das Nokia und wählt.
»Netz wird es auch erst in ungefähr zwei Monaten wieder geben«, kommentiert Peter. »Und auch nur, wenn Ihre Regierung sich anstrengt.« Wieder betont Peter das Wort »Ihre«. »Bisher hat sie sich nicht angestrengt«, fügt er hinzu.
Pascha schaut auf sein Display — er hat wirklich kein Netz. Obwohl doch gestern Nacht noch alles in Ordnung war.
»Die stören es absichtlich«, erklärt Peter, »damit Ihre Leute«, er zeigt auf die um sie herum, »nicht erfahren, wie die Lage ist. Keiner weiß etwas, keiner vertraut dem anderen. Mittelalter«, fügt er hinzu und löscht seine halb gerauchte Zigarette vorsichtig an der zum Aschenbecher umfunktionierten Bierdose. »Sie unterrichten nicht zufällig Geschichte?« Dabei sieht er Pascha durchdringend an.
»Nein«, antwortet Pascha, »nicht Geschichte.«
»Gut so«, lobt ihn Peter, »in Ihrem Land ist Geschichte unterrichten wie Angeln: man weiß nie, was man rausholt. Obwohl mir Ihre Liebe zur Geschichte gefällt«, sagt Peter, holt eine neue Zigarette hervor, klappert wieder mit dem Zippo und bläst wieder Rauch an die Decke, »alles richtig, Sie versuchen aufzuklären, Interessantes zutage zu fördern, prima. Was ich Ihnen diesbezüglich raten würde«, fährt Peter fort und lehnt sich plötzlich im Stuhl zurück, wobei er die Zigarette fest mit zwei Fingern packt; Pascha hört ihm gespannt zu, da bemerkt er, wie vier Soldaten in den Saal stürmen, ihre Gesichter besonders dunkel, die Hände schwer und nervös, die Augen rot vor Wut und Rauch, sie lassen den Blick durch den Raum schweifen, erkennen gleich, genau und untrüglich zwischen den Soldaten zwei Zivilisten — Pascha und Peter — und steuern auf sie zu, umrunden zielstrebig die Tische. An den Tischen fällt diese Bewegung jetzt auf, die Gespräche verstummen, alle blicken den vieren nach, die sich auf sie zubewegen, sind erstarrt und angespannt, nur Peter hat sich so an seinen eigenen Worten berauscht, dass er nichts merkt, er sitzt mit dem Rücken zum Saal, beobachtet Pascha hinter den Rauchschwaden und spricht mit so wichtigtuerischen Pausen, als lausche er seiner eigenen Stimme. »Ich würde Ihnen raten, vorsichtig mit der Geschichte umzugehen. Geschichte, das ist etwas, das …«, er verstummt für einen Moment, legt sich im Kopf etwas Kluges zurecht, bemerkt plötzlich die allgemeine Stille und starrt Pascha an, Pascha hat keine Ahnung, was er von ihm will, dann aber geht ihm auf, dass er, Peter, auf seine Brille schaut und dort die Spiegelbilder jener vier erkennt, die in seinem Rücken stehen, für einen Moment überzieht Panik sein Gesicht, die Mundwinkel zittern nervös, und die Vene an seinem Hals pulsiert vor krampfhaftem Verlangen sich umzudrehen, aber Peter beherrscht sich meisterhaft und zieht an seiner Zigarette, ein bisschen nervös zwar, aber er zieht, zieht, bläst ruhig den Rauch aus und beendet seinen Satz: »… das Ihnen niemand nehmen kann!«
»Wer seid ihr?«, sagt ihm der Erste direkt in den Nacken. Pascha betrachtet gebannt seine Stiefel — abgestoßene Spitzen, verklebt mit Gras vom vergangenen Jahr, genauso abgestoßene Knieschützer, schwere Seitentaschen voll scharfen Eisens, die Kalaschnikow im Arm wie einen Säugling, der einfach nicht einschlafen will, eine Sturmweste mit mehreren Ersatzmagazinen, Stücke farbigen Klebebands an den Ärmeln und vor allem — das Messer, das aus einer speziellen Tasche in der Herzgegend ragt, mit schwarzem Griff und tiefen Einkerbungen. Gegen seinen Willen beginnt Pascha, die Kerben zu zählen, als der Soldat wiederholt:
»Wer seid ihr?«
Nummer zwei und drei stehen zu beiden Seiten des Tischs, um mögliche Fluchtwege zu versperren. Aber was für eine Flucht denn? denkt Pascha verzweifelt. Was für eine Flucht? Nummer vier schaut dem Ersten über die Schulter, so misstrauisch, dass Pascha die Brille abnimmt, wie um sie zu putzen, tatsächlich aber um all das nicht mehr sehen zu müssen. Peter blickt sich mit sorglosem Lächeln nach der Stimme um:
»Presse«, sagt er und versenkt die Hand in einer tiefen Tasche, offensichtlich um den Presseausweis zu zeigen, alle vier sind sofort alarmiert, aber da zieht Peter die Hand schon wieder heraus und reicht ihnen die nötigen Dokumente. »Alles in Ordnung«, sagt er bemüht locker und cool, »Presse. Hier ist mein Ausweis.«
Der Erste nimmt den Ausweis und gibt ihn, ohne hineinzusehen, über die Schulter an Nummer vier weiter. »Hans«, sagt er, »schau nach, ob's stimmt.« Hans nimmt ihn und lässt seine roten erfrorenen Finger mit der schwarzen Erde unter den Nägeln über die Zeilen wandern. Peter streckt lächelnd die Hand aus, gib ihn mir zurück, soll das heißen, wir unterhalten uns hier, stört uns nicht. Und Hans zögert, will ihm fast schon den Ausweis zurückreichen. Stoppt die Bewegung jedoch und schaut sich das Dokument noch einmal an.
»Wann bist du eingereist?«, fragt er plötzlich.
»Vor einem Monat«, sagt Peter nach einer Pause.
»Soso«, meint Hans zweifelnd. »Ich bin schon seit Herbst hinter dir her.«
»Ach was«, antwortet Peter herausfordernd.
»Wenn ich es sage«, gibt Hans genauso herausfordernd zurück und reicht Peters Ausweis an den Ersten. Der betrachtet Peter schweigend.
»Hört zu«, sagt Peter und steht auf, was die vier wieder in Alarmbereitschaft versetzt. »Im Herbst war ich auch schon hier. Da, mein Pass, mit allen Stempeln.«
Er zieht seinen Pass heraus und drückt ihn dem Ersten in die Hand. Der reicht ihn schweigend über die Schulter, ohne Peter aus den Augen zu lassen. Peter versucht sich zu beruhigen, greift in die Tasche, was wieder alle alarmiert, und holt seine Zigaretten heraus.
»Wollt ihr?«, fragt er und lässt die Augen von einem zum anderen wandern.
Schweigen. Hans blättert den Pass durch, gibt ihn dann dem Ersten, beugt sich hinab und flüstert ihm etwas ins Ohr. Der Erste nickt und gibt Peter seine Papiere zurück.
»Was ist eigentlich das Problem?«, fragt Peter demonstrativ.
Der erste Soldat schweigt lange und betrachtet Peter. Als der es nicht mehr aushält und den Blick abwendet, sagt er:
»Das Problem ist«, sagt er, »dass uns einer anscheißt. Und zwar bestimmt einer von den Zivilisten.«
»Wieso ein Zivilist?«, lächelt Peter.
»Weil wir die anderen alle kennen«, antwortet der Soldat. »Jemand scheißt uns an. Weißt du vielleicht, wer das sein könnte?«, fragt er Peter plötzlich.
Die vier haben Peter jetzt umringt. Der erbleicht.
»Nein«, sagt er, »weiß ich nicht.«
»Sicher?«, fragt ihn der Soldat.
»Sicher«, antwortet Peter, ohne zu zögern.
»Na gut«, sagt darauf der Soldat, »du kannst gehen«, dann dreht er sich unversehens zu Pascha um. »Und jetzt zu dir.«
Pascha rückt sich unsicher die Brille auf der Nase zurecht, wühlt in seinen Taschen, findet den Ausweis und gibt ihn dem Ersten. Dabei spürt er, dass das nicht genügt, dass er sie irgendwie beruhigen muss, im Sinne von alles okay, kein Problem, mit mir, Pascha, gibt's kein Problem.
»Wir gehören zusammen«, sagt er panisch und dreht sich nach Peter um.
Doch Peter ist nicht mehr da, er hat es geschafft zu verschwinden, sich in Luft aufzulösen. Nur das frische Päckchen starke Zigaretten liegt noch auf dem Tisch.
*
Pascha sitzt in einem geräumigen kalten Zimmer mit Computer und einem schwarzen Safe — offensichtlich die Buchhaltung. Das Türschild hat er nicht gelesen, als Hans ihn die Treppe hinaufgeführt und in die graue Dämmerung des Korridors gedrängt hat — sanft, aber nachdrücklich, damit er gar nicht auf die Idee käme, sich zu widersetzen. Obwohl er ohnehin nicht auf diese Idee gekommen wäre. Er durchquerte den dunklen Korridor fast blind, reagierte auf den Befehl in seinem Rücken, stoppte. Hans trat an die Tür, versuchte sie zu öffnen, die Türklinke knirschte, die Tür gab nicht nach. Worauf er sich mit der Schulter dagegenwarf und ins leere Zimmer stolperte. Er sah sich um, betrachtete skeptisch den verschlossenen Safe, beschloss, ihn in Ruhe zu lassen.
»Hinsetzen«, schrie er in Paschas Richtung. »Sitzen bleiben!«
»Lange?«, fragte Pascha für alle Fälle.
»So lang wie nötig«, antwortete Hans scharf. »Sobald wir dich überprüft haben, kannst du gehen.«
Pascha durchquerte das Zimmer, setzte sich auf einen der drei Stühle an der Wand. Überlegte es sich und setzte sich auf einen anderen. Hans schaute zu, schwieg aber.
»Bleib hier«, sagte er schließlich. »Lass dir bloß nicht einfallen abzuhauen.«
»Ist gut«, stimmte Pascha sofort zu.
Hans ging hinaus und schloss sorgfältig die aufgebrochene Tür hinter sich.