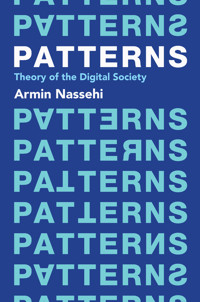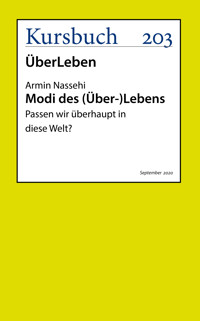Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Murmann Publishers
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Armin Nassehi beschreibt die Generationslage der in den 1960er-Jahren Geborenen als eine Generationslage, die sich entlang der Nutzung digitaler Technik nacherzählen lässt, und macht einen theoretischen Ausflug in den Generationenbegriff.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 32
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Benutzerhinweise
Dieser Artikel enthält Anmerkungen, auf die die Anmerkungszahlen im Text verweisen. Durch einfaches Klicken auf die Anmerkungszahl wechselt das E-Book in den Anmerkungsteil des Artikels, durch Klicken auf die Anmerkungszahl im Anmerkungsteil wieder zurück zum Text.
Armin Nassehi
Die erste digitale Generation
Eine kontraintuitive Diagnose
Ich wurde nicht 1964 geboren, sondern 1960 – das macht, selbst in den schnellen heutigen Zeiten, keinen großen Unterschied. Wie soll ich nun diese Generation beschreiben? Meine erste Intuition, als ich darüber nachgedacht habe, war eine zunächst unplausible Idee – nämlich die in der ersten Hälfte der 1960er-Jahre Geborenen als erste digitale Generation zu beschreiben – das ist kontraintuitiv deshalb, weil man das Digitale wohl eher den Jüngeren zuspricht. Und trotzdem, wir sind die erste digitale Generation, ohne es zunächst gemerkt zu haben. Ich fange deshalb eher biografisch an.
Frühe Technologieschübe
Ich habe 1979 in Gelsenkirchen mein Abitur abgelegt und danach in Münster studiert – Erziehungswissenschaften, parallel auch Philosophie, jeweils mit dem Nebenfach Soziologie. Ich habe im Studium viel schreiben müssen – wie es sich für ein Studium gehörte und gehört. Zunächst hatte ich eine mechanische Schreibmaschine von meinen Eltern, sehr mühsam zu bedienen, mit großen Zwischenräumen zwischen den Tasten, was bei unsachgemäßem Gebrauch dazu führte, dass meine Finger immer wieder zwischen den Tasten festgeklemmt sind, mit bisweilen durchaus schmerzhaften Folgen. Ich weiß nicht mehr, wann genau es war – vielleicht in meinem dritten Semester –, als mein Studium einen ersten Technologieschub erfahren hat. Ich habe mir eine gebrauchte Robotron 202 gekauft, eine elektrische Schreibmaschine aus DDR-Produktion, aus dem VEB Robotron Buchungsmaschinenwerk in Karl-Marx-Stadt. Diese Maschine robust zu nennen, wäre eine eklatante Untertreibung. Sie war sehr schwer, das Gehäuse geradezu verschwenderisch aus bestimmt zwei Millimeter dickem Metall. Der Motor der Maschine wurde sicher nicht für Schreibmaschinen entwickelt – man hätte damit auch feststofflichere Kulturgüter mobilisieren können als philosophische, pädagogische und soziologische Hausarbeiten, Exzerpte usw. Die Maschine war – sicher keine Überraschung – sehr laut. Das galt für den Motor ebenso wie für die Typenhebel, die mit einer enormen Kraft auf Papier und Walze trafen. Ich erinnere mich noch genau, wie der Wagenrücklauf den Beistelltisch neben meinem Schreibtisch in wankende Bewegungen versetzte. Und noch genauer erinnere ich mich daran, dass jeder Fehler bei der Benutzung der Tastatur unmittelbar, zeit- und wertkontinuierlich sich auf das Geschriebene auswirkte – und zwar so gut wie nicht rückholbar. Es ist genau das, was man eine Analogtechnik nennt, also eine Technik, die so etwas wie eine Eins-zu-eins-Übertragung von Ursache und Wirkung, Signal und Reaktion, Steuerung und Umsetzung vorsieht. Selbst die Fehlerkorrektur mit Tipp-Ex-Streifen war im Nachhinein sichtbar – das beschriebene Papier hatte zwar einen geheilten Text, aber die Narben blieben sichtbar.