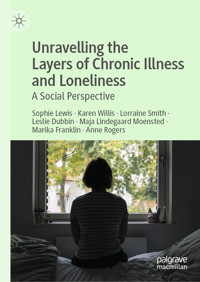16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Was, wenn die Familie nicht der einzige Ort ist, an dem man sich sicher, geliebt, umsorgt und akzeptiert fühlen kann? Sophie Lewis legt ein leidenschaftliches Plädoyer für kollektive Care-Arbeit vor. Wer Glück hat, findet in der Familie Liebe und Fürsorge. Häufig ist sie jedoch Ursprung von Schmerz, Missbrauch und Gewalt. Selbst in so genannten »glücklichen« Familien ist das Zusammenleben harte Arbeit. In ihrem scharfsinnigen Essay »Die Familie abschaffen« fordert Sophie Lewis: Sowohl die Sorgenden als auch die Umsorgten haben Besseres verdient! Von Plato über Marx bis zu queeren Theorien der Gegenwart – Lewis zeichnet die Geschichte von Ideen und Bewegungen nach, die unsere klassischen Familienkonzepte hinterfragt haben, und räumt mit Missverständnissen über die Abschaffung der Familie auf. Eine feministische Kritik des idealisierten Konzepts Familie und ein Plädoyer für kollektive Care-Arbeit, das zeigt: Nur wenn wir beginnen, über die Familie hinauszudenken, können wir uns ausmalen, was danach kommen könnte. »Niemand bringt den Feminismus aktuell so radikal, so umwerfend brillant und couragiert auf den Punkt wie Sophie Lewis.« Eva von Redecker
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sophie Lewis
Die Familie abschaffen
Wie wir Care-Arbeit und Verwandtschaft neu erfinden
Über dieses Buch
Wer Glück hat, findet in der Familie Liebe und Fürsorge. Häufig ist sie jedoch Ursprung von Schmerz, Missbrauch und Gewalt. Selbst in so genannten »glücklichen« Familien ist das Zusammenleben harte Arbeit. In ihrem scharfsinnigen Essay »Die Familie abschaffen« fordert Sophie Lewis: Sowohl die Sorgenden als auch die Umsorgten haben Besseres verdient!
Von Plato über Marx bis zu queeren Theorien der Gegenwart – Lewis zeichnet die Geschichte von Ideen und Bewegungen nach, die unsere klassischen Familienkonzepte hinterfragt haben, und räumt mit Missverständnissen über die Abschaffung der Familie auf. Eine feministische Kritik des idealisierten Konzepts Familie und ein Plädoyer für kollektive Care-Arbeit, das zeigt: Nur wenn wir beginnen, über die Familie hinauszudenken, können wir uns ausmalen, was danach kommen könnte.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Sophie Lewis ist Autorin und unabhängige Wissenschaftlerin. Sie lehrt soziale und kritische Theorie am Brooklyn Institute for Social Research und ist Gastdozentin am Feminist, Queer and Transgender Studies Center der Universität von Pennsylvania. Ihre Texte erscheinen in der »Boston Review«, der »New York Times«, der »Feminist Theory« und der »London Review of Books«. Sophie Lewis lebt in Philadelphia.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die englische Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Abolish the Family. A Manifesto for Care and Liberation« bei Verso. Copyright © Sophie Lewis 2022
© 2023 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Büro KLASS, Hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491740-5
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
1 Aber ich liebe doch meine Familie!
2 Welche Familie abschaffen?
3 Eine kurze Geschichte des Familien-Abolitionismus
Charles Fourier
Queer, indigen und »maroon«: Das 19. Jahrhundert
Die Epoche des Kommunistischen Manifests
Alexandra Kollontai und der frühe bolschewistische Utopismus
Shulamith Firestone, revolutionärer Feminismus und die Grenzen des Kibbuz
Die Schwulen- und Lesbenemanzipation – und die Kinderemanzipation
Löhne für Hausarbeit und die National Welfare Rights Organization
Trans Marxismus des 21. Jahrhunderts
4 Genoss:innen gegen die Verwandtschaft
Danksagung
Weiterführende Literatur
Ich, der Besen, widme dieses Buch der Friedhof-Kommune West Philadelphia.
1Aber ich liebe doch meine Familie!
»Es gibt andere Möglichkeiten, einander als Verwandte zu benennen.«
Tiffany Lethabo King[1]
Die Familie abschaffen? Wir könnten genauso gut die Schwerkraft oder Gott abschaffen. Also gut! Nun versuchen die Linken auch noch, uns unsere Oma wegzunehmen und Kinder zu beschlagnahmen, und das soll fortschrittlich sein? Geht’s noch?!
Viele Menschen verspüren eine solche Reaktion, wenn sie zum ersten Mal davon hören, dass die Familie »abgeschafft« werden soll. Und das ist in Ordnung. Die brisante emotionale Aufladung dieses Slogans werde ich weder abstreiten noch vor ihr zurückschrecken. Um sicherzugehen: Mir geht es dabei ein Stück weit darum, die vielen möglichen Entsetzen auslösendenMissverständnisse aufzuklären und zu korrigieren, die allzu leicht über die Abschaffung der Familie entstehen können. Dazu gehört zum Beispiel die falsche Annahme, es ginge darum, Menschen gewaltsam voneinander zu trennen. Letztendlich möchte ich aber nicht leugnen, dass diese politische Forderung einer Abschaffung der Familie etwas »Beängstigendes« (psychologisch Anspruchsvolles) hat. Meiner Meinung nach wohnt dieses Beängstigende jeder echten revolutionären Politik inne. Unsere Beklemmung ist eine reflexartige Reaktion auf die Vorahnung einer Abschaffung des Selbst.[2] Wir alle – auch diejenigen unter uns, die nichts besitzen, denen keine Pflege garantiert wird, für die der Imperialismus, das Weißsein, das Cis-Hetero-Patriarchat und die Klassenunterschiede eine besondere Gefahr darstellen –, wir alle werden im Zuge unserer kollektiven Befreiung irgendetwas aufgeben müssen. Wenn die Welt von Grund auf erneuert werden soll, dann sollte der Mensch dazu ebenfalls bereit sein. Das spüren wir. In dieser Zeit ist es schwer oder vielleicht sogar unmöglich, sich vorzustellen, nicht vom privaten Haushalt der Kleinfamilie und der ödipalen Familiengeschichte (Mutterfigur, Vaterfigur, Kind) produziert zu werden. Dass die Menschen aber nicht immer so hervorgebracht wurden, bedeutet, dass es auch anders ginge, wenn wir nur wollten. Fürs Erste solltest du wissen: Falls deine automatische Reaktion auf die Worte »Die Familie abschaffen« die Antwort »Aber ich liebe doch meine Familie« ist, hast du ganz viel Glück gehabt. Und das gönne ich dir. Aber meinst du nicht, dass wir alle so viel Glück haben sollten?
Die Menschen in der eigenen Familie zu lieben, steht wohlgemerkt nicht im Widerspruch zum Engagement für die Abschaffung der Familie. Ganz im Gegenteil. Ich wage eine Definition der Liebe: Einen Menschen zu lieben bedeutet, sowohl für die Autonomie dieses Menschen zu kämpfen als auch dafür, dass er oder sie mit Fürsorge überhäuft wird – insofern Letzteres überhaupt möglich ist in einer Welt, die vom Kapital erstickt wird. Wenn man dem folgt, ist die Beschränkung der Anzahl der Mütter (egal welchen Geschlechts), die einem Kind zur Verfügung stehen, einzig und allein aufgrund des Konzepts »echter Mutterschaft«, nicht unbedingt eine Form der Liebe, die diesen Namen verdient hat. Wenn du in einer Kleinfamilie aufgewachsen bist, hast du es vielleicht im Stillen bemerkt, als du sehr jung warst: Wer auch immer in deinem Haushalt die Mutterrolle übernommen hat, bekam eine besonders einschränkende Funktion zugeteilt. Du hast ihre Einsamkeit gespürt. Dich überkam ein Anflug solidarischen Mitgefühls. Meiner Erfahrung nach sind es gerade Kinder, die es besser als die meisten anderen verstehen: Wenn wir jemanden lieben, macht es einfach keinen Sinn, eine soziale Technologie zu unterstützen, die diese Person isoliert, ihre Lebenswelt privatisiert, ihren Wohnort, ihre Klasse und sogar ihre Identität willkürlich durch Gesetze definiert und ihre Sphäre intimer Abhängigkeitsbeziehungen drastisch eingrenzt. Aber ich greife voraus.
Die meisten Familien-Abolitionist:innen lieben ihre Familien. Natürlich engagieren sich gewöhnlich diejenigen für den Sturz eines sozialen Systems, die schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht haben und dieses System gerade nicht lieben. Doch trotz einer »schwierigen Kindheit« Liebe für die eigene Familie zu empfinden, ist für die potenzielle Familien-Abolitionistin ziemlich typisch. Sie mag zum Beispiel intuitiv spüren, dass sie und ihre Familienmitglieder einander einfach nicht guttun, und sie dabei trotzdem lieben und ihnen alles Gute wünschen – wohl wissend, dass es auf dieser Welt wenige oder keine Alternativen gibt, wenn es darum geht, die Zuwendung aufzubringen, die alle Personen so sehr brauchen. Ehrlich gesagt, kann die Liebe zur eigenen Familie für jede:n zum Problem werden. Sie kann einer Überlebenden häuslicher Gewalt beim Versuch zu entkommen zusätzliche Fesseln um die Fußgelenke schließen (zumal der Kapitalismus diejenigen, die kommodifizierten Wohnverhältnissen entfliehen wollen, wirtschaftlich bestraft). Sie kann ein trans Kind oder ein Kind mit Behinderung davon abhalten, medizinische Dienste in Anspruch zu nehmen. Sie kann Menschen davon abbringen, eine Schwangerschaft abzubrechen.
Kaum jemand würde dieser Tage bestreiten, dass reproduktive Rechte – geschweige denn reproduktive Gerechtigkeit – bestimmten Bevölkerungsgruppen fortwährend verweigert werden. Austeritätspolitik sorgt absichtlich dafür, dass es sich das Proletariat nicht leisten kann, Kinder zu kriegen, selbst wenn zwei oder drei oder vier Erwachsene zusammenarbeiten. Hausarbeit wird geschlechtsspezifisch definiert, rassifiziert und (außerhalb der Haushalte der Reichen) nicht bezahlt. Unter diesen globalen Bedingungen überrascht es nicht, dass zahlreiche Menschen ihre Familien nicht lieben oder nicht lieben können. Die Gründe reichen von einfacher Unverträglichkeit, verschiedenen Phobien, Ableismus oder sexueller Gewalt bis zu Vernachlässigung.
Ich verrate dir ein Geheimnis: Leute werden schrecklich wütend, wenn du ihnen nahelegst, dass sie etwas Besseres verdient hätten, als sie in ihrer Kindheit bekommen haben. Mir ist aufgefallen, dass viele Menschen mit besonderer Vehemenz mit »Aber ich liebe doch meine Familie« reagieren, direkt nachdem sie mir in einem langen Gespräch offen erzählt haben, welche Belastungen, Tragödien, Erpressungen und verzweifelte Sehnsucht nach Fürsorge Teil ihrer »biologischen« Erziehung waren. Wie ich bemerkt habe, wird der wütende Widerstand gegen die Vorstellung, dass alles anders sein könnte, wenige Momente nach dem Wunsch geäußert, dass unsere Verwandten weniger allein gewesen wären, von der Pflegeverantwortung weniger belastet und weniger gefangen. Jene Leute sind doch eine ganz andere Angelegenheit, scheint dieser defensive Reflex zu sagen: Ich selbst brauche keine Abschaffung der Familie! Nein, danke! Klar mag die Familie eine disziplinierende knappheitsbasierte Trauma-Maschine sein, aber sie ist MEINE disziplinierende knappheitsbasierte Trauma-Maschine.
Hör zu. Ich verstehe das schon. Du machst dir nicht einfach nur Sorgen, dass dein Vater die Fassung verliert, wenn er dich mit diesem Buch sieht. Dir geht es um die existenzielle Angst einflößende Vorstellung, unsere geordnete Armut zugunsten eines Reichtums aufzugeben, den wir noch nie gekannt haben und erst strukturieren müssen.
Was ist die Familie? Die Vorstellung, dass sie ein exklusiver Ort ist, an dem Menschen geborgen sind, von dem Menschen herkommen, an dem Menschen gemacht werden und zu dem Menschen gehören, sitzt so tief, dass wir sie nicht einmal mehr als Vorstellung wahrnehmen. Versuchen wir also, sie zu entwirren.
Die Familie ist der Grund für das Gefühl, zur Arbeit gehen zu wollen, der Grund, warum wir zur Arbeit gehen müssen, und der Grund, warum wir zur Arbeit gehen können. Im Kern ist sie unsere Bezeichnung für die Tatsache, dass Pflegearbeit in unserer Gesellschaft privatisiert ist. Und weil »Familie« ein Synonym für Pflegearbeit zu sein scheint, ist sie für pflichtbewusste Bürger:innen die Raison d’Être schlechthin: Ein vermeintlich nichtindividualistisches Credo und ein selbstloses Prinzip, dem man sich freiwillig verpflichtet, ohne darüber nachzudenken. Und welche Alternative könnte es überhaupt geben? Die ökonomische Annahme, hinter jedem »Brotverdiener« müsse es irgendeine Art Ehefrau geben, eine Person oder mehrere, derentwillen es sich lohne, ausgebeutet zu werden (also eine Person, die wahrscheinlich auch Brotverdiener:in ist, die das verdiente Brot »freiwillig« schmiert oder jemanden anderen dafür bezahlt, die die Krümel wegwischt und die Reste einfriert, so dass morgen mehr Brot verdient werden kann): Diese Vorstellung klingt für viele wie eine Beschreibung der »menschlichen Natur«.
Wer oder was übernimmt die Verantwortung für das Leben der nicht Erwerbstätigen, für die Kranken, die Jungen und die Senior:innen, wenn es keine Familie gibt? Das ist ein schlechter Einwand. Selbst in Anbetracht der Tatsache, dass die möglichen Lebensräume von nichtmenschlichen Tieren immer weiter schrumpfen und sie sich an die missbräuchliche Pflege im Zoo gewöhnt haben, zögern wir nicht zu sagen, dass es ihnen außerhalb des Zoos besser geht. Ähnlich verhält es sich mit der Abkehr von der Familie: Nein, der Übergang wird nicht einfach sein. Aber die Familie bietet keine gute Pflege, und wir alle haben etwas Besseres verdient. Die Familie steht den Alternativen im Wege.
»Was ist die Alternative?« Diese schwindelerregende Frage kommt zum Teil auf, weil es zumindest in der Theorie nicht nur die Arbeiter:innen (und ihre Arbeit) sind, die die Familie jeden Tag gebärt. Die Familie ist gleichzeitig auch die gesetzliche Absicherung, dass ein Baby, ein neugeborener Mensch, ein Werk der familiären romantischen Dyade ist. Dieser Akt der Autor:innenschaft gewährt den Autor:innen Eigentumsrechte an »ihren« Nachkommen – Elternschaft. Er bürdet ihnen aber auch quasi exklusive Verantwortlichkeit für das Leben des Kindes auf. Die nahezu komplette Abhängigkeit des jungen Menschen von diesen Erziehungsberechtigten wird nicht als das grausame Glücksspiel dargestellt, das es wahrheitsgemäß ist, sondern als »natürlich«, ohne Bedarf nach sozialer Milderung, ja sogar als ein schönes Erlebnis für alle Beteiligten. Es wird davon ausgegangen, dass Kinder davon profitieren, nur zwei Eltern und im besten Fall ein paar weitere »sekundäre« Bezugspersonen zu haben. Es wird angenommen, dass Eltern angesichts der Romantik dieser isolierten Intensität nichts als Freude empfinden. Trotz ständiger Hinweise auf die höllische Welt vollkommener Erschöpfung, die Eltern bewohnen, wird ihre Lage bis zum Äußersten sentimentalisiert: Es gilt geradezu als Tabu, Elternschaft zu bereuen. Viel zu selten wird sie als absurd ungerechte Arbeitsverteilung oder als despotische Verteilung der Verantwortung für jüngere Menschen und der Macht über sie erkannt. Eine Verteilung, die verändert werden könnte.
Wie ein Mikrokosmos des Nationalstaats brütet die Familie Chauvinismus und Konkurrenzdenken aus. Wie eine Fabrik mit einer Milliarde Zweigstellen stellt sie »Individuen« her, die eine kulturelle und ethnische Identität haben, eine binäre Geschlechtsidentität, eine Klassenzugehörigkeit und ein racial consciousness. Wie eine unendlich erneuerbare Energiequelle leistet sie unbezahlte Arbeit für den Markt. Wie ein »organisches Element historischen Fortschritts«, so schreibt Anne McClintock in Imperial Leather, nutzte sie dem Imperialismus als Bild der Hierarchie-in-der-Einheit, das »unentbehrlich« wurde, um »Ausschluss und Hierarchie« im Allgemeinen zu legitimieren.[3] Aus all diesen Gründen fungiert die Familie als Grundeinheit des Kapitalismus oder wie Mario Mieli schreibt, als »Zelle des sozialen Gewebes«.[4] Wie ich anderswo ausgeführt habe, mag es einfacher sein, sich das Ende des Kapitalismus vorzustellen, als das Ende der Familie. Trotzdem generieren alltägliche utopische Experimente Fäden eines völlig anderen sozialen Gewebes: Mikrokulturen, die wachsen könnten, wenn die Bewegung für eine klassenlose Gesellschaft die Prämisse ernst nehmen würde, dass Haushalte sich frei formen und demokratisch organisiert werden können; das Prinzip, dass keinem Menschen Nahrung, Unterkunft oder Pflege vorenthalten werden dürfen, nur weil er oder sie nicht arbeitet.
Familienwerte sind bürgerliche Ökonomie im Kleinen. Wie Melinda Cooper zeigt, haben Neoliberale und Neokonservative ab den späten siebziger Jahren im Zeichen der Familie die Sozialhilfe nach den Prinzipien des elisabethanischen »Armenrechts« im Grunde neu erfunden: Für die Armen wurden statt der Gesellschaft die Verwandten verantwortlich gemacht. Auch in der ursprünglichen Gesetzgebung von vor vierhundert Jahren wurden Konzepte wie »Marktfreiheit«, »Das liberale Individuum« und Schulden langsam auf den Sockeln von Verwandtschaftsverpflichtungen und Familienbanden errichtet. Kurz gesagt: Ohne Familie kein bürgerlicher Staat. Die Familie hat die Funktion, die Sozialhilfe zu ersetzen und für Schuldner:innen zu bürgen. Als Wahl, Werk und Wunsch der Individuen getarnt, ist sie eine Methode, die Reproduktion der Arbeitskraft der Nation zum billigen Preis zu organisieren und die Rückzahlung von Schulden zu sichern.
Aber Moment mal! Die Familie ist doch in Gefahr! – So heißt es zumindest immer wieder. Die jungen Menschen heutzutage, die wollen keine Kinder bekommen, die kümmern sich nicht um ihre Verwandten, die wohnen zu Hause, die rufen nicht zu Hause an, die streben gar nicht nach einem Eigenheim, die wollen nicht heiraten, die stellen die Familie nicht an erste Stelle und die gründen auch gar keine Familie. Stell dir das einmal vor! Die Familie war schon immer vom Aussterben bedroht. Wie Cooper im ersten Satz von Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism schreibt: »Die Geschichte der Familie ist eine Geschichte der ständigen Krise.«[5] Drohender Zerfall ist ein wesentlicher Bestandteil der Sache. Wenn man sich aber umsieht, wird schnell klar, dass die Berichte über den Tod der Familie stark übertrieben haben. Für die liberaldemokratische Politik ist es genauso undenkbar wie immer, die Familie anzugreifen. Nirgendwo im parteipolitischen Spektrum finden sich Vorschläge, die Familie zu entthronen, ihren Untergang zu beschleunigen oder auch nur ihre Zentralität in der Politik zu hinterfragen.
Familienwerte und Politik werden schon seit langem synonym gebraucht. Margaret Thatcher, die »Milchdiebin« der achtziger Jahre, hat (leider) mit ihrem Spruch »So etwas wie die Gesellschaft gibt es nicht, es gibt einzelne Männer und Frauen, und es gibt Familien« weniger einen Streit gegen Familiengegner:innen gewonnen, als vielmehr eine kapitalistische Realität explizit gemacht. Das, was unter den Begriff »sozial« falle, sei nicht nur rentabilitätsfeindlich, sondern auch familienfeindlich, so ihre Schlussfolgerung. Die Familie – das heißt der Familienbetrieb oder das Familien-Startkapital – ist die große antisoziale Institution. Und tatsächlich kann es sich in einer Landschaft, die von thatcheristischer antisolidarischer Politik verwüstet worden ist, so anfühlen, als gäbe es nur Familien oder ethnisch definierte Gruppen (Makrofamilien), die miteinander auf Kriegsfuß oder im besten Fall in Konkurrenz stehen.[6] Steuern, Sozialhilfe, Testamente, Urkunden, Lehrpläne, Gerichte und Renten sind überall als Technologien der Familie am Werk. Sogar auf architektonischer Ebene wird ein:e Fremde:r zu Besuch in einem solchen Land mit einem endlosen Meer aus Haustüren konfrontiert, die jeweils fein säuberlich mit einer Hypothek sowie mit einem (tatsächlichen oder impliziten) Schild – »Privatgrundstück« – versehen sind. Hinter jeder Tür verbirgt sich eine Mikrosammlung individueller, selbstverwaltender Konsument:innen-Unternehmer:innen. Die meisten öffentlichen Bereiche und Gemeinschaftsräume sind nicht nur für die kommerzielle Freizeit bestimmt, sondern bewusst dafür konzipiert, Pärchen oder Kleinfamilien anzusprechen.
Trotzdem: Auch wenn die Familie als Form der Herrschaft eine brutale wirtschaftliche Tatsache ist, bleibt die Familie als gelebte Erfahrung eher eine Erfindung. Nicht sehr viele Menschen leben wirklich in einer Familie – und/aber das ist egal. Millionen von uns leben mit anderen in improvisierten, seltsamen, kreativen, institutionellen, gezwungenen oder zum Teil gemeinschaftlichen Formen; weitere Millionen und Abermillionen leben völlig allein. Diese Tatsache macht aber keinen Unterschied, weil die Familie zwar als Wahl und als Option dargestellt wird, aber alle, die außerhalb von ihr leben, der sozialen Unlesbarkeit überlassen werden. Wir alle werden von der Familie verführt oder zumindest diszipliniert. Wir können ihr nicht entkommen, auch wenn wir sie persönlich ablehnen. Und selbst wenn wir sie ablehnen, machen wir uns Sorgen, dass ihr vielbeschworener Zerfall etwas Schlimmeres ankündigt.
So verlieren alle. In jeder Hinsicht, mit Ausnahme der Kapitalakkumulation, bleibt das Versprechen von Familie erbärmlich weit hinter den Erwartungen zurück. Daran trägt per se oft niemand »Schuld«: Es wird einfach zu viel von zu wenigen verlangt. Andererseits finden gerade in der Familie die meisten Vergewaltigungen und die meisten Morde statt. Niemand wird dich mit höherer Wahrscheinlichkeit ausrauben, drangsalieren, erpressen, manipulieren, schlagen oder ungewollt anfassen als die Familie. Folgerichtig sollte die Ankündigung, jemanden »wie Familie« zu behandeln (die viele Fluggesellschaften, Restaurants, Banken, Läden und Arbeitsplätze verbreiten) als Drohung verstanden werden. Von jemandem metaphorisch als »Familie« gesehen zu werden, zeichnet das Bild einer Beziehung, die eigentlich ziemlich … unfamiliär ist: das Bild einer Beziehung, die Anerkennung, Solidarität, ein offenes Versprechen von Hilfe, Freundlichkeit und Fürsorge hochhält.
Natürlich organisiert das administrative System der Familie die (gesetzlich geregelte) Beschaffung von bestimmten Hilfsformen. Das hat allerdings nichts mit Solidarität zu tun. Die Familie – die auf der Privatisierung der Dinge beruht, die Gemeinschaftseigentum sein sollten, sowie auf den besitzergreifenden Konzepten Paar, Blut, Gen und Samen – ist eine staatliche Institution und kein populärer Organismus. Sie ist zugleich eine normative Bestrebung und ein letztes Mittel: Eine Erpressung, die sich als Schicksal ausgibt, ein beschissener Vertrag, der so tut, als sei er eine biologische Notwendigkeit. Denk daran, dass es (im Fernsehen oder in deinem eigenen Leben) oft ein grausamer und repressiver Schachzug ist, an Familienbande und -verpflichtungen zu erinnern. Denk daran, wie Loyalität und Liebe gegenüber der »Familie« in Mafia-Filmen durch Strafen erzwungen werden, die schlimmer sind als der Tod – und das scheint nur eine gangsterhafte Übertreibung der allgemeinen, bürgerlichen Logik der Familie zu sein. Denk an die britische königliche Familie und die tödlichen Mechanismen der Eugenik, der Lieblosigkeit und der Verherrlichung des Eigentums, die ihre internen Angelegenheiten steuern, während sie gleichzeitig als weltweiter Prototyp der Familie hochgehalten und für ein internationales Publikum in der aktuellen Netflix-Serie The Crown exotisiert (wenn auch kritisiert) wird. Denk an Ehrenmorde, Femizide und den Tod von Kindern wie dem sechsjährigen Briten Arthur Labinjo-Hughes, dessen Mörder sich, wie Richard Seymour schreibt, »für seine Opfer hielten«.[7]
Wie kann es trotz allem sein, dass die Familie immer noch als Standard für alle anderen möglichen Beziehungen gilt? Ich weiß es nicht. Vielleicht, um wieder Seymour zu zitieren, weil die Familie, »auch wenn sie dieses Versprechen nicht zwangsläufig erfüllt, das Herz in einer herzlosen Welt sein kann«.[8] Ich vermute, dass die Religion der Familie sich um die glühende Hoffnung dreht, dass diese Vorstellung irgendwann wahr wird. Wir greifen nach der Möglichkeit einer garantierten Zugehörigkeit, nach Vertrauen, Anerkennung und Erfüllung. Der Traum der Familie ist unser Traum von einem Zufluchtsort – das genaue Gegenteil von Hunger oder Zwangsjacken. Idiomatisch will die Formel »wie Familie« mit allem Nachdruck vermitteln: »Wir gehören zueinander, ich liebe dich. Für mich sind unsere Schicksale miteinander verbunden.« Wir haben keine stärkere Metapher! Warum aber gerade diese benutzen?
Bekannterweise eröffnete Leo Tolstoi den Roman Anna Karenina