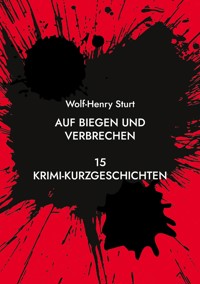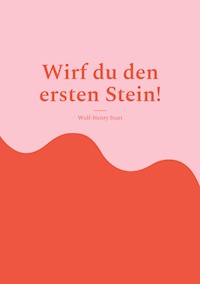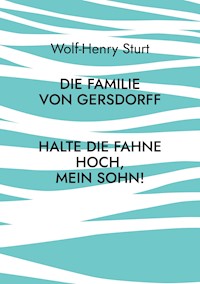
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine bewegende Familiengeschichte aus einer dunklen Zeit, in der dennoch versteckt und unscheinbar eine kleine Pflanze blüht: Sie heißt Hoffnung!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wo das LEBEN seinen Anfang nimmt und die LIEBE niemals endet…
Eine bewegende Familiengeschichte aus einer dunklen Zeit, in der dennoch versteckt und unscheinbar eine kleine Pflanze blüht: Sie heißt Hoffnung!
Autor: Wolf-Henry Sturt
Wolf-Henry Sturt wurde 1952 auf dem Gut seines Onkels südlich von Kassel geboren. Er wuchs in Darmstadt und Hannover zusammen mit drei Brüdern auf. Nach Abitur und Bundeswehr studierte er an der Universität Hannover Anglistik, Geographie und Pädagogik für das Lehramt an Gymnasien. Von 1982 bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2016 unterrichtete er die Fächer Englisch und Erdkunde in Daun in der Eifel. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter und drei Enkelkinder.
Für meinen Enkel Jannis
Jannis:
Opa, was soll ich tun?
Opa:
Labore et Honore!
Jannis:
Opa, wie werde ich glücklich?
Opa:
Labore et Honore!
Jannis:
Was ist das Ziel?
Opa :
Labore et Honore!
Jannis:
Was bedeutet das?
Opa:
Das erklären dein Papa und ich dir beizeiten.
Jannis:
Boaah!
Opa:
Komm, jetzt kauf ich dir erst einmal ein
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Die folgenden Seiten handeln von Blut, Trauer und Tränen, aber auch von einer Sehnsucht, die daraus erwächst. Ich habe versucht, die hier beschriebenen Geschehnisse aus der Sicht der damals lebenden Personen zu schildern und nicht aus der Perspektive einer moralische Bewertungen suchenden Nachwelt. Dem Leser, der nur letztere Perspektive im Blick hat oder nur Erbauliches in der Literatur sucht und ausschließlich in einem seichten, genuss- und glücksorientierten Hier und Jetzt leben möchte, rate ich deshalb, das Buch beiseite zu legen. Es würde ihn verstören.
Wer aber vor Geschehenem nicht die Augen verschließen will und die Hoffnung auf eine bessere. lebenswerte Zukunft nicht aufzugeben bereit ist, sollte weiterlesen. Er wird entdecken, dass die Hoffnung nicht alleine steht, sondern von ihrer Schwester, der Nachdenklichkeit, unterstützt wird und dass auch ihr kleiner Bruder, der schelmenhafte Frohsinn, hin und wieder unter ihrem weiten Rock hervorlugt.
1
An einem Spätsommermorgen erblickte Freya das Licht dieser Welt. Die Eltern, Gerhard v. Gersdorff und seine Frau Anna-Luise, geb. Freiin v. Kettler, hatten mit Sorge diesem Ereignis entgegen geschaut, denn Anna-Luise war während der Schwangerschaft an Röteln erkrankt, was für das noch nicht geborene Kind gefährlich sein konnte. Der Arzt hatte gemeint, man müsse abwarten. In vielen Fällen ginge es gut.
Es war ein großes Kind, es sah gesund aus und schrie nach Leibeskräften. Die Mutter war erleichtert und glücklich. Der Vater hatte sich nach den beiden Töchtern Christlen und Rotraut und dem Sohn Wolf um der familiären Symmetrie willen noch einmal einen Jungen gewünscht. Aber als er das Baby im Arm hielt, drückte auch sein Gesicht Zufriedenheit und Stolz aus.
Er war ursprünglich Berufsoffizier gewesen, war dann jedoch mit einem zerschossenen Arm aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt, was eine weitere Verwendung beim Militär ausschloss. Sein älterer Bruder, der gleich nach Kriegsausbruch von seiner Weltreise eiligst in die Heimat zurückgekehrt war, um sich als Freiwilliger bei einem Schlesischen Regiment zu melden, hatte noch weniger Glück. Er fiel schon nach drei Monaten in Russland.
Beide hatten das in ihrer Familie übliche nationale Pflichtgefühl besessen. Sie waren allerdings der Meinung gewesen, der Kaiser und die deutsche Regierung hätten mehr diplomatisches Geschick an den Tag legen können, um einen Krieg zu vermeiden. Für die allgemeine Begeisterung der breiten Masse hatten sie wenig übrig. Insbesondere Gerhard wusste aus seinem Berufsleben, was ein Krieg bei dem derzeitigen Stand der Technik bedeutete. Gleichwohl war ihm natürlich klar, dass Begeisterung am Anfang eines Krieges besser als etwa Kleinmütigkeit ist, will man den Krieg für sich entscheiden.
Als er im Lazarett in Trier lag, besuchte eines Tages Prinzessin Victoria Luise von Preußen die Verwundeten. Neben Gerhard lag ein junger Leutnant Stuart, dem ein Auge ausgeschossen worden war. Die Prinzessin blieb am Bett des jungen Offiziers stehen und sagte, wohl um ihn zu trösten, sein Opfer wäre nicht umsonst gewesen, er hätte es für Kaiser, Volk und Vaterland gebracht. Die Antwort des Leutnants lautete: „Jawohl, euer Durchlaucht, ich habe es für mein Volk und mein Vaterland gebracht.“ Die Prinzessin schien eine Spur verwirrt zu sein, ging dann aber wortlos weiter.
Später fragte Gerhard seinen Bettnachbarn, warum er den Kaiser in seiner Erwiderung ausgelassen hätte und ob er kein Monarchist sei. Doch, das sei er sehr wohl. Sonst wären ja die vier Jahre in der Kadettenvoranstalt in Naumburg und die fünf Jahre in der Hauptkadettenanstalt in Berlin-Lichterfelde für die Katz gewesen, meinte dieser, aber das Volk und das Land seien viel wichtiger als der jeweilige, gerade herrschende Kaiser. Im Übrigen sei seine Mutter Russin aus einer verarmten adligen Familie und sein Vater ein halber Engländer. Er sei von seinen mittellosen Eltern mit zehn Jahren in das Kadettenkorps gesteckt worden und das sei im Laufe der Zeit seine Familie geworden. Dort sei er zu einem stolzen Preußen erzogen worden und werde es immer bleiben. Die Antwort machte Gerhard nachdenklich. Im Lazarett hatte jeder viel Zeit zum Nachdenken.
Im Gegensatz zu seinem gefallenen Bruder, der wie sein Vater vor ihm Jurist werden wollte, fühlte sich Gerhard nach seinem Ausscheiden aus dem Deutschen Heer nicht zu einem akademischen Studium berufen. Er beabsichtigte, zunächst bei einem entfernten Verwandten in dessen Firma eine kaufmännische Lehre zu durchlaufen. Da jedoch ein Vetter, der ursprünglich als einziger Sohn seiner Familie das noch im Besitz der Gesamtfamilie Gersdorff verbliebene Majoratsgut Alt-Seidenberg übernehmen sollte, ebenfalls im Krieg geblieben war, war Gerhard v. Gersdorff nun der nächste erbberechtigte Nachkomme. Also entschloss er sich eine landwirtschliche Ausbildung zu absolvieren und an Stelle des Vetters das Gut zu bewirtschaften.
Man erzählte sich, dass die weit verzweigte Familie Gersdorff in grauen Vorzeiten einst an die zweihundert Güter in der Lausitz besessen hätte - kleine, von denen eine Familie allerdings mehrere besitzen musste, um davon leben zu können, mittlere und große - und damit mehr Land ihr eigen nannte als die sechs dort befindlichen Städte Görlitz, Bautzen, Kamenz, Löbau, Zittau und Lauben zusammen. Das war einmal! Die Güter waren nach und nach verkauft oder in Spielkasinos verspielt worden. Wenn nur Töchter in der Familie vorhanden waren, hatten diese die Güter geerbt und mit deren Verheiratung änderte sich der Name der Besitzer. Der lautete dann zum Beispiel v. Studnitz, v. Gellhorn, oder v. Richthofen. Die Gersdorffs waren nun in der Regel Beamte, Offiziere, Ingenieure oder Kaufleute.
Aber jeder von ihnen hatte im Kopf, dass es noch dieses eine Majoratsgut gab, ein Gut am Rande des Riesengebirges mit Feldern, Wald, Wiesen und Tieren. Im Grunde waren es drei Höfe: der Oberhof sowie der Niederhof, die selber zu bewirtschaften waren, und das Steinvorwerk, welches verpachtet wurde.
Das Nutzungsrecht für seinen Wald hatte Gerhard ebenfalls an einen Jagdpächter übertragen. Zum einen wäre sein beschädigter Arm bei der Jagd hinderlich gewesen, zum anderen liebte er es mehr, Tiere zu beobachten und nicht zu schießen. Dafür saß er nächtelang mit einem Fernglas auf den an Lichtungen aufgestellten Hochsitzen.
Natürlich sah er den Sinn einer waidgerechten Jagd ein, dennoch hatte er im Laufe der Jahre einen zunehmenden Widerwillen gegen das Schießen und Töten entwickelt. Als ganz junger Mann hatte er möglicherweise anders darüber gedacht. Doch jetzt mit fünfunddreißig Jahren glaubte er, genug geschossen und vermutlich sogar getötet zu haben. Auf ihn selbst war ebenfalls geschossen worden und er war schwer verletzt aus dem Krieg heimgekehrt. Das reichte für den Rest seines Lebens!
Darüber hatte er bei einem Schnaps auch mit seinem Jagdpächter diskutiert. Der war der Meinung, dass das Schießen auf Wild in Friedenszeiten und das Schießen auf Menschen in Kriegszeiten überhaupt nicht vergleichbar seien. Dem konnte und wollte Gerhard nicht widersprechen. Trotzdem würde er das Jagen aus persönlichen, rein gefühlsmäßigen Gründen lieber den dazu Berufenen überlassen.
Leider war das eigentliche Gutshaus in der Mitte des 19. Jahrhunderts einem Brand zum Opfer gefallen, so dass man im ehemaligen Verwalterhaus wohnte. Nachdem man den Speicher auch noch zu Wohnzwecken ausgebaut hatte, war das Haus jedoch geräumig genug, um einer Familie mit vier Kindern und zwei Hausangestellten Platz zu bieten. Über dem Eingang brachte man das Gersdorffsche Wappen an.
Von den Erlösen der Landwirtschaft konnte ein ordentliches, wenn auch keineswegs feudales Einkommen erzielt werden. Dazu waren allerdings eine haushälterische Denkweise, Fleiß und eine nicht allzu anspruchsvolle Ehefrau notwendig, denn die Böden waren nur mittelmäßig bis mäßig ertragreich. Alle drei Dinge konnte Gerhard vorweisen. Er stand morgens in aller Frühe auf, teilte die Arbeit ein, kontrollierte tagsüber, ob diese erledigt wurde, packte wenn nötig auch selber mit an, und verkörperte Verwalter, Buchhalter und Schreibkraft in einer Person. Den einzigen wirklichen Luxus, den sie sich gönnten, war ein BMW. Den wollte Anna-Luise unbedingt haben. Da ihr Mann wegen seiner körperlichen Beeinträchtigung den Wagen nur schlecht steuern konnte, war sie normalerweise die Fahrerin. Ein bisschen Eitelkeit durfte schon sein. Dafür aß man gerne ein ums andere Mal zu Mittag Pellkartoffeln mit Quark.
Neben der Landwirtschaft gab es noch in der nicht weit entfernten Stadt Bautzen ein Stadthaus, welches ebenfalls dem Familienverband Gersdorff gehörte. Im Obergeschoss befanden sich zwei vermietete Wohnungen und im Erdgeschoss das Familienarchiv, eine kleine Bibliothek und zwei Zimmer, die immer dann in Anspruch genommen wurden, wenn ein Gersdorff gerade in Bautzen weilte. Dieses Haus zu verwalten, war auch eine Verpflichtung des jeweiligen Majoratsherren auf Alt-Seidenberg.
2
Als Freya etwa sechs Monate alt war, geschah dem Kindermädchen ein Missgeschick. Diese hatte sich für einen Moment nach hinten gedreht, um eine neues Windeltuch aus der Kommode zu nehmen, als das Baby eine unvorhergesehene Drehung zur Seite machte und vom Wickeltisch fiel. Der dumpfe Aufprall des kleinen Körpers auf dem Parkettboden, der entsetzte Schrei des Mädchens und das augenblicklich einsetzende Brüllen des Säuglings veranlassten die Mutter, die im Nähzimmer an einer Stickerei saß, diese fallen zu lassen und in das Kinderzimmer zu laufen. Dort sah sie, wie die junge Frau mit vor Aufregung rotem Gesicht am Boden saß und dem Säugling den Mund zuhielt. Sie wurde auf der Stelle entlassen, obwohl sie beteuerte, das Baby hätte sich bei ihr vorher noch nie selbständig gedreht. Der eilends herbeigerufene Arzt konnte jedoch, abgesehen von einer Beule an der linken Stirnseite, zur Erleichterung aller keine weiteren Verletzungen des Kindes feststellen.
Im ersten Jahr fiel der Familie kein irgendwie außergewöhnliches Verhalten des kleinen Mädchens auf, außer dass es manchmal etwas langsame Reaktionen zeigte. Als jedoch nach dem zweiten Lebensjahr Freya noch keinerlei Anstalten machte, Papa und Mama zu sagen, begann der Arzt die Stirn zu runzeln. Am Ende des dritten Jahres diagnostizierte er dann eine nicht mehr zu übersehende Entwicklungsverzögerung. Ab dem fünften Geburtstag von Freya war schließlich für alle Familienangehörigen deutlich, dass das Kind zwar äußerlich nett anzuschauen, aber geistig leicht behindert war.
Nichtsdestotrotz rannte und tobte Freya mit ihren Geschwistern und den Kindern der Angestellten und Arbeitern auf dem Gutshof herum, wie es Kinder in dem Alter nun einmal tun. Dabei strahlte sie, wenn das Leben sie anlachte und weinte, wenn das Leben Schatten warf, genauso wie ihre Freunde auf dem Hof auch. Besonders gerne war sie mit Albert, dem Sohn des Schweizers, zusammen. Sie spielten mit Vorliebe Hochzeit, wobei Freya als Brautkleid eine Gardine um den Körper gewickelt hatte und Albert den viel zu großen Zylinder seines Großvaters auf dem Kopf trug.
Allerdings richteten die Eltern immer ein besonderes Augenmerk auf Freya, da sie mögliche Gefahren und Probleme immer etwas später erkannte als andere. Auch die Geschwister wurden angewiesen, auf die Jüngste Acht zu geben und, wenn ihr jemand Ärger bereiten sollte, sie in Schutz zu nehmen. Das taten diese dann auch sehr gewissenhaft. Wenn einer der Spielkameraden ihre Schwester hänselte, dann bekam dieses Kind den geballten Unmut der drei anderen Gersdorff-Kinder zu spüren und durfte mindestens anderthalb Wochen nicht mehr mit in das Gutshaus kommen, um dort Kakao zu trinken. Zanken taten sie sich mit Freya so gut wie nie, dafür aber untereinander umso leidenschaftlicher. Dann konnte es passieren, dass sie eine gewisse Zeit vom „Du“ auf das „Sie“ umschwenkten. „Christa-Helene, (die Langform des Rufnamens Christlen stand ansonsten nur in der Geburtsurkunde) würden Sie mir gefälligst mal das Schäufelchen reichen.“ „Aber natürlich Rotraut von Gersdorff, hier haben Sie es und das Eimerchen noch gleich dazu.“ Die jüngste Schwester hingegen wurde immer liebevoll geduzt.
Bei den gelegentlichen Familienfeiern der engeren Familie, zu denen Onkel und Tanten auf dem Gut zusammenkamen, wurde Freya viel gelobt und auch sonst freundlich behandelt. Auch auf den Treffen aller Gersdorffs, die seit Urzeiten regelmäßig meist in Schlesien stattfanden und zu denen immer hundert Menschen und mehr von nah und fern anreisten, kannte man das Mädchen. Man erwähnte ihr nettes Äußeres, schenkte ihr Süßes und erkundigte sich eingehend nach ihren Freunden und Lieblingsspielen. Ihre Behinderung war ihr in diesem frühen Stadium nur vage bewusst, sie hatte ein unbeschwertes Leben und fühlte sich glücklich.
Einmal, mitten im Winter, ereignete sich folgender Vorfall; Der Vater hatte einen erkrankten Nachbarn besucht. Er war den Weg zu Fuß dorthin gegangen. Auf dem Rückweg durch ein Waldstück glitt er auf dem Eis unter der dünnen Schneedecke aus. Da er nur einen gesunden Arm hatte, konnte er sich nicht richtig mit den Händen auf dem gefrorenen Boden abfangen und brach sich den rechten Oberschenkel. Die Familie wunderte sich, dass er so lange unterwegs war, begann dann aber ohne ihn mit dem Abendbrot. Plötzlich behauptete Freya, sie würde Hilferufe hören. Man öffnete das Fenster und lauschte, doch kein anderer konnte etwas wahrnehmen. Freya hingegen beharrte darauf, Hilferufe zu hören, jetzt sogar noch lauter. Die Mutter zog sich ihren Mantel über, klopfte an der Tür der Schweizerfamilie und gemeinsam, sie selbst, der Schweizer und Freya in der Mitte, gingen sie in die Winternacht hinaus. Das Kind gab die Richtung an, aus der sie angeblich die Rufe hörte. Und so fanden sie nach fünfzehn Minuten den Vater, der hilflos im Schnee lag. Der eilends herbeigerufene Vorarbeiter und der Schweizer trugen den Verunglückten ins Gutshaus. Der Bruch heilte aus, die starke Erkältung ging ebenfalls vorüber, doch Herr v. Gersdorff wusste, dass er möglicherweise sein Leben der jüngsten Tochter zu verdanken hatte, die zwar über keinen scharfen Verstand, dafür aber über ein außerordentlich scharfes Gehör verfügte.
3
Die Ehe der Eltern hingegen war nicht besonders harmonisch, sie stritten sich oft. Man versuchte jedoch, dies nach außen hin zu verbergen. Die vordergründig heile Welt sollte vor den Kindern keine unnötigen Risse bekommen. Dennoch bekamen diese natürlich einiges mit, vor allem dann, wenn sie die laute, tiefe Stimme ihres Vaters hinter der verschlossenen Schlafzimmertür hörten.
Einmal fuhr ihre Mutter nach einem heftigen Ehekrach kurzentschlossen mit den beiden jüngsten, noch nicht schulpflichtigen Kindern, Wolf und Freya, sowie Gerda, dem neuen Kindermädchen, für ein paar Tage an die Ostsee, um auf andere Gedanken zu kommen. Dort wohnten sie in einer kleinen Pension, die sie bei einem der wenigen Familienurlaube schon vorher einmal kennengelernt hatten. In derselben Pension logierte auch ein Herr mittleren Alters mit seiner 10-jährigen Tochter. Herr Praetorius war früh Witwer geworden und verbrachte in Kolberg seinen Jahresurlaub. Man kam ins Gespräch und Anna-Luise erfuhr, dass er in Berlin wohnte, wo er als Chemiker bei der Firma Siemens arbeitete. Sie unterhielt sich gerne mit ihm, denn er war charmant, gutaussehend und humorvoll. Er erzählte ihr von Berlin, den vielfältigen kulturellen Angeboten der Stadt, seinem schönen Haus in Grunewald und auch davon, dass er gerne wieder heiraten wolle.
Am letzten Tag des Aufenthalts in dem Seebad war das Kindermädchen mit ihren beiden Schützlingen sowie der Tochter des Herrn aus Berlin nach dem Mittagessen an den Strand gegangen. Frau v. Gersdorff wollte im schattigen Garten der Pension noch einen Brief schreiben, dann aber nachkommen. Als sie dort an der Hauswand auf einer Bank saß, Briefpapier und Füllfederhalter vor sich, gesellte sich Herr Praetorius dazu. Das zuerst nur belanglose, freundliche Gespräch wurde nach einer halben Stunde immer persönlicher und intimer. Das führte dazu, dass der Herr die Hand der Dame ergriff, welche sich nicht dagegen sträubte. Schließlich legte er den Arm um sie. So saßen sie einige Minuten und blickten sich in die Augen oder auf die Rosensträucher vor ihnen. Dann küsste er sie. Auch hier war eine Gegenwehr nicht erkennbar.
In dem Moment inniger Zweisamkeit kam Gerda mit Freya an der Hand um die hintere Hausecke. Die anderen Kinder waren bereits durch die Vordertür in die Pension hineingegangen. Der Grund für die vorzeitige Rückkehr war, dass zwei der Kinder plötzlich ein menschliches Bedürfnis verspürten, jedoch nicht auf die unsauberen Strandtoiletten gehen mochten. Das Kindermädchen drehte sich sogleich um und wollte Freya hinter sich herziehen. Doch es war zu spät. Den Blick der fünfjährigen Freya sollte Anna-Luise ihr ganzes Leben nie wieder vergessen. In den Augen des Kindes spiegelten sich kurz hintereinander Erstaunen, dann Traurigkeit und schließlich so etwas wie Enttäuschung. Sofort schob sie den Mann von sich, stand auf und ging durch die Terrassentür in das Speisezimmer der Pension. Später am Nachmittag nahm sie Freya in ihre Arme und flüsterte in ihr Ohr: „Morgen fahren wir alle wieder nach Hause zu Papa, mein Schatz.“
Als sie am folgenden Tag am Bahnsteig standen, sah sie deprimiert und irgendwie gealtert aus. Gerda, die aus einer gesunden, schlesischen Bauernfamilie kam und für ihr Alter schon über eine gute Portion Lebensweisheit