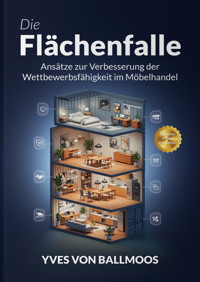
5,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Der stationäre Möbelhandel steckt in einer strukturellen Krise. Viele Möbelhändler befinden sich in der sogenannten „Flächenfalle“: Rückläufige stationäre Umsätze und sinkende Erträge pro Quadratmeter Verkaufsfläche können durch das wachsende Online-Geschäft nicht mehr ausgeglichen werden. Zugleich verstärken Digitalisierung und eine veränderte Customer Journey den Druck auf traditionelle Geschäftsmodelle. Die Folgen sind Umsatzrückgänge, Marktkonsolidierungen und immer häufiger Filialschliessungen. Dieses praxisorientierte Fachbuch liefert eine fundierte Bestandsaufnahme dieser Krise und präsentiert konkrete Ansätze zu ihrer Bewältigung. Basierend auf aktuellen Markt- und Forschungsdaten sowie der langjährigen Branchenerfahrung des Autors zeigt es, wie Möbelhändler ihr Geschäftsmodell an die neuen Realitäten anpassen können – von der Digitalisierung, der Generierung neuer Touchpoints in der Customer Journey über innovative Store-Konzepte bis zum effektiven Zusammenspiel von Online- und Offline-Kanälen. Klar, prägnant und sachlich geschrieben, bietet „Die Flächenfalle“ einen hohen praktischen Nutzen. Statt theoretischer Modelle liefert das Buch konkrete Handlungsempfehlungen, um die Transformation im Möbelhandel erfolgreich zu gestalten. Damit ist es ein wertvoller Leitfaden für Möbelhändler und Führungskräfte im Einzelhandel, die ihr Unternehmen zukunftsfähig aufstellen wollen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
1
2
Die Flächenfalle
Ansätze zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Möbelhandel
3
© 2025 Yves von Ballmoos
Website: www.yvb.ch
Verlag: Furniture Advisory Services GmbH (www.furniture-advi-sory.com)
Druck und Distribution im Auftrag des Verlags: tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutsch-land
Das Werk, einschliesslich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Verlag verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfol-gen im Auftrag des Verlags, zu erreichen unter: Furniture Advisory Services GmbH, Lärchenstrasse 1, 8421 Dättlikon, Schweiz
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
4
Inhaltsverzeichnis
1Einleitung ................................................................................................ 7
2Blick zurück: Vom Tischler zum Möbelhändler ...................................... 11
3Die Herausforderungen der Gegenwart ................................................. 16
3.1 Die Flächenfalle droht! Eine Bestandsaufnahme .................................. 16
3.2 Warum gehen gerade in der Schweiz die Umsätze zurück? .................. 22
3.3 Megatrends, die den Markt verändern ................................................ 27
3.4 Die veränderte Customer-Journey im Möbelhandel ............................. 33
3.5 E-Commerce und seine Limitationen ................................................... 38
3.5.1 Stärken ........................................................................................ 38
3.5.2 Limitationen ..................................................................................... 40
3.6 Die Krux mit der Beratung ................................................................... 41
3.7 Geschäftsmodelle auf dem Prüfstand .................................................. 44
4Integrale Konzeption zur Lösung der Flächenfalle.................................. 55
4.1 Framework .......................................................................................... 55
4.2 «Warum» Veränderung unvermeidlich ist............................................ 56
4.3 Das Geschäftsmodell neu denken (Was) .............................................. 60
4.4 Veränderungen erfolgreich umsetzen (Wie)......................................... 66
4.4.1 Organisation ..................................................................................... 67
4.4.2 Technologie ...................................................................................... 68
4.4.3 Mitarbeiter und Führungskräfte ....................................................... 71
5
4.4.4 Verkaufskanäle ................................................................................. 73
4.4.5 Kultur ........................................................................................ 79
4.4.6 Sortiment ........................................................................................ 81
4.4.7 Implementierung ............................................................................. 82
4.4.8 «Wo» – das Controlling .................................................................... 84
4.4.9 Zusammenfassung des Frameworks zur Bewältigung der
Flächenfalle ...................................................................................... 85
4.5 Deep Dive «Customer-Journey» .......................................................... 87
5Operative Handlungsempfehlungen ...................................................... 89
5.1 Angebotsgestaltung / Value-Proposition .............................................. 89
5.2 Digitalisierung ..................................................................................... 91
5.3 Nachhaltigkeit ..................................................................................... 92
5.4 POS-Gestaltung und neue Filialaufgaben ............................................. 94
6Fazit ....................................................................................................... 96
7Wesentliche Quellen ........................................................................... 100
6
1Einleitung
Als kleiner Junge lief ich voller Faszination durch die lauten Produkti-onshallen der Möbelfabrik meines Grossvaters am Bodensee. Er fer-tigte mit seinem mittelständischen Betrieb Massivholzmöbel an. Wohnwände, Tische, Stühle, Betten und auch Kleiderschränke wurden vorwiegend für die Schweiz produziert und zu einem guten Teil auch direkt vertrieben. Nach der Heirat meiner Eltern begann mein Vater im Unternehmen seines Schwiegervaters zu arbeiten. Er weitete den Han-del aus, nahm neue, ausländische Hersteller ins Sortiment auf und ex-pandierte nach Zürich. Nicht allen gefiel das.
So gab es Streit in der Familie und mein Vater musste das Unterneh-men verlassen. Er kaufte einen der damals renommiertesten Händler für skandinavisches Design in Zürich, der mitten in einer Nachfolgekrise war. Die Produktion am Bodensee überlebte keine zehn Jahre mehr und auch der darauffolgende reine Handel war nicht von Dauer. Zingg-Lamprecht hingegen blühte nach der Übernahme durch meinen Vater auf und wuchs in der Folge kontinuierlich.
Als ich Anfang der Nullerjahre operativ ins Unternehmen eintrat, boomte das Geschäft. Die Besucherfrequenzen stiegen kontinuierlich und, ganz ehrlich, wir wussten nicht warum! Dann aber kamen die ers-ten Krisen des neuen Jahrhunderts: Die Dotcom-Blase platzte, dann 9 – 11, gefolgt von der Swissair-Krise in der Schweiz. Alte, erfolgreiche Rezepte kamen auf einmal unter Druck. E-Commerce kam auf und wir
7
E i n l e i t u n g
glaubten, das könne schnell viel verändern. Wir eröffneten einen der ersten Online-Shops für Designmöbel, liessen uns bereits Anfang der Nullerjahre auf die Nachhaltigkeit ein, entwickelten Strategien und liessen uns zertifizieren. Wir waren der Zeit voraus, denn der Möbel-handel bzw. die Konsumenten waren noch nicht so weit. Es war zu der Zeit eine verlorene Liebesmühe, aber nicht für nichts. Wir konnten uns den Ruf als ein sehr fortschrittliches Unternehmen aufbauen, was bei unserer Privat- wie auch Firmenkundschaft sehr gut ankam. Wir wuch-sen weiter, eröffneten neue Filialen und überstanden auch die folgen-den Krisen (Euro-Krise, Finanzkrise etc.), die v. a. aufgrund des immer stärker werdenden Schweizer Frankens zu einer Herausforderung für die Branche wurden.
Irgendwann Anfang der Zehnerjahre glaubte ich, alle meine Ideen im Design-Möbelhandel umgesetzt zu haben, oder zumindest diejenigen, die ich mit meinem über hundertjährigen Unternehmen umsetzen konnte. Auch war mir bewusst, dass die Zeiten des stationären Einrich-tungshandels, so wie wir ihn kannten, bald vorbei sein würden. Ich be-schloss, mein Unternehmen zu verkaufen.
Nach etwas Familienzeit und einer Weiterbildung gelangte ich zur Mig-ros, dem grössten Arbeitgeber der Schweiz. Ich wurde Leiter der Sorti-mentierung (Range-Management) und war für die Innovationen der zwei Einrichtungshäuser Interio und Micasa zuständig, die konzernin-tern gerade unter ein Management genommen wurden. Der Fokus lag
8
E i n l e i t u n g
auf der Neupositionierung von Interio. Wir entwarfen ein neues Laden-layout, zusammen mit Werner Aislinger. Er brachte 2017 bereits ein, dass Online- und Offline-Handel sich verschmelzen müssten und ein zukunftsfähiger Point of Sale (POS) nicht nur inspirieren solle, sondern dem Kunden auch Komfort, Haptik und gute Beratung vermitteln müsse. Es schien damals wie eine Vision von einem anderen Stern zu sein und trotzdem arbeiteten wir in diesem Geiste ein neues Konzept aus. Zudem wurden Eigensortimente entwickelt, die Edition Interio mit namhaften internationalen Designern, automatisierte Online-Bera-tung und eine Augmented-Reality(AR)-App etc. Mit dem Rückenwind der grossen Migros gelangen uns viele wahrhaftige Innovationen, die alle in das neue Format von Interio einflossen. Dann eröffneten wir den ersten neuen Store und brachten das neue Konzept auf den Markt. Drei Monate später, im Herbst 2018, kündigte die erste Migros-Genossen-schaft (eine der Eigentümerinnen) eine von zehn Filialen der Interio, da sie keinen langfristigen Mietvertrag mehr eingehen wollte. Ab dem Punkt ging es nur noch bergab. Der Turnaround schien intern wie auch extern gescheitert zu sein. Es wurde nicht mehr investiert. Kurzfristige Erfolge mussten her und es wurde drei Monate nach dem Relaunch alles infrage gestellt. Im Frühjahr 2019 war für mich klar, dass Interio so nicht mehr zu retten sein würde. Ich wollte mir die Beerdigung die-ses tollen Brands nicht antun und verliess das Unternehmen, um mich als Berater selbstständig zu machen.
9
E i n l e i t u n g
Mir war basierend auf meiner gesamten Erfahrung klar, dass die Her-ausforderungen im Möbelhandel im Wesentlichen in der Digitalisie-rung liegen würden. E-Commerce wuchs schon vor der Corona-Pande-mie stark an und die Besucherfrequenzen in den Läden gingen seit Mitte der Nullerjahre zurück. Die Digitalisierung führte zu immer bes-ser informierten Konsumenten, die sich gut auch ohne Läden inspirie-ren konnten. Wofür wird es also Einrichtungshäuser oder -paläste, wie wir sie in Deutschland kennen, überhaupt noch brauchen? Es ist eine Frage, die mich letztlich schon seit vielen Jahren in der einen oder an-deren Form umtrieb.
Dieses Buch basiert im Wesentlichen auf meiner Dissertation (Integrale Konzeption zur Lösung der Flächenfalle, 2024). Hinzu kamen persönli-che Erfahrungen und Meinungen, die ich im Rahmen einer akademi-schen Arbeit nicht hätte einfliessen lassen können. Dieses Buch ist denn auch keine akademische Arbeit, sondern ein handlungsorientier-tes Werk für Praktiker und interessierte Forschende, die sich mit den wichtigen Zukunftsfragen im Möbelhandel auseinandersetzen und diese auch gestalten wollen. Viele Erkenntnisse lassen sich in den Non-Food-Einzelhandel übertragen.
In diesem Sinne habe ich mir auch erlaubt, nicht nach Forschungs-grundsätzen zu zitieren und damit den Lesefluss und das Leseerlebnis nicht zu beeinträchtigen. Trotzdem sind die relevantesten Quellen am Ende des Buchs aufgeführt.
10
2Blick zurück: Vom Tischler zum Möbelhändler Bis weit ins 19. Jahrhundert wurden Möbel direkt von Handwerksbe-trieben an die Endkundschaft verkauft. Tischler, Schlosser und Dekora-teure richteten die Wohnungen und Häuser ihrer Kunden in Ein-zelstückfertigung ein. Die stilistische Vielfalt wurde dabei zuletzt durch den Zeitgeist des Historismus eingeschränkt. Man richtete sich ein, wie «man» sich einrichtete. In Deutschland entsprach das dem Stil der deutschen Renaissance oder einer anderen Ausdrucksform des Histo-rismus, möglichst verziert und verschnörkelt. Der war im Schweizer Bürgertum ebenfalls stark verbreitet und wurde nur gelegentlich durch bunte Bauernmöbel aufgebrochen, die mehr zum Gebrauch denn zur Repräsentation dienten.
Der Einzug des Individualismus fand im deutschsprachigen Raum erst um die Jahrhundertwende statt. Die Bewohner sollten sich fortan in der Einrichtung ihrer Wohnung spiegeln, wie dies der populäre Einrich-tungsratgeber «Die Kunst im Hause» Jakob Falkes empfahl, der als Buch 1871 veröffentlicht wurde. Es war die Zeit, in der «form follows function» als moderner Grundsatz im Produktdesign aufkam, zurück-gehend auf den US-amerikanischen Architekten Louis Sullivan (1896). Dieser Wandel führte zu einer deutlich grösseren Vielfalt bei Angebot und Nachfrage von Einrichtungsgegenständen. Es bildete sich ein ei-genständiger Möbelhandel mit grösseren und kleineren Geschäften heraus, welcher der Forschung von Maren-Sophie Fündrich (2019) zu-folge das gestiegene Beratungsbedürfnis befriedigen konnte. Das
11
B l i c k z u r ü c k : V o m T i s c h l e r z u m M ö b e l h ä n d l e r
Angebot umfasste nun nicht mehr nur Möbel, sondern auch Tapeten, Stoffe und Dekorationsgegenstände. Nebst den aufkommenden Mö-belhäusern, wie beispielsweise 1882 Möbel Pfister in Basel, schufen auch die neuen Kaufhäuser zu dieser Zeit Möbelabteilungen, beschäf-tigten Einrichtungsratgeber und präsentierten ganze Zimmereinrich-tungen. Ende der 1880er-Jahre kamen die ersten deutschsprachigen Wohnzeitschriften auf und Handwerksverbände organisierten Woh-nungsausstellungen.
Im Zuge der Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts, die in Ver-bindung mit aufkommender Schlichtheit im Möbeldesign stand, fand ein Übergang von der handwerklichen Fertigung von Tischlern und Schreinern hin zur Serienfertigung statt. Anstatt der Herstellung von einzelnen Möbelstücken auf Bestellung wurde nun auf Vorrat und für einen anonymen Kundenkreis produziert. Die Preise sanken und eine «grossbürgerliche Einrichtung» wurde auch dem Mittelstand ermög-licht.
Durchsetzen konnte sich die Serienmöbelfertigung erst kurz vor dem Ersten Weltkrieg, indem nun Typenmöbel aus standardisierten Einzel-teilen angeboten wurden, deren Qualität nahe an die von Hand gefer-tigten Möbel kam. Erstmals kamen auch Sperrholzplatten und Bugholz zum Einsatz – Materialien und Fertigungsart, die 1859 bereits von der Wiener Stuhlmanufaktur Thonet und zwanzig Jahre später von der Schweizer Möbelfabrik Horgenglarus eingesetzt wurden. Thonet gilt
12
B l i c k z u r ü c k : V o m T i s c h l e r z u m M ö b e l h ä n d l e r
heute als die älteste Möbelmarke der Welt, Horgenglarus als die äl-teste Stuhl- und Tischmanufaktur der Schweiz.
Die nachfolgende Bauhaus-Zeit gilt als die Geburtsstunde des moder-nen Möbeldesigns. Sie geht in ihrer Entstehung auf das Architektur-büro von Peter Behrens zurück, in welchem vor dem Ersten Weltkrieg Ludwig Mies van der Rohe, Le Corbusier und insbesondere Walter Gropius zusammenarbeiteten. Dieser war es denn auch, der 1919 in Weimar die Kunstschule «Bauhaus» gründete.
Der Kauf von gesamten Zimmereinrichtungen war bis in die Sechzi-gerjahre im deutschsprachigen Raum weit verbreitet. Entsprechend wurden «Aussteuern» beworben und in den Ausstellungen der Möbel-häuser präsentiert. Die enorme Bautätigkeit der Nachkriegsjahre brachte auch veränderte Kaufgewohnheiten mit sich. Die Aussteuer für das Leben wurde nun bei steigendem Einkommen durch teurere Ein-zelstücke, aber auch seriell produzierte Billigmöbel ersetzt. Vorreiter war nicht zuletzt IKEA.
Auch wenn der Katalog-Versandhandel bereits Ende des 19. Jahrhun-derts aufkam, fand er bei Möbeln kaum Anwendung. Dies war nicht zuletzt auf logistische Probleme zurückzuführen, waren die Möbel doch schwer und sehr anfällig für Transportschäden. Ingvar Kamprad erkannte das Problem und begann zwölf Jahre nach der Gründung 1943 von IKEA, Möbel selbst zu entwerfen und zu bauen. Dabei konnte
13
B l i c k z u r ü c k : V o m T i s c h l e r z u m M ö b e l h ä n d l e r
er die besonderen Anforderungen des Versandhandels berücksichti-gen. 1956 kam es zur Einführung von zusammenbaubaren Möbeln in flachen Paketen. Eine Revolution im Möbelhandel und die Grundlage eines disruptiven Geschäftsmodells, auf dessen Basis sich fünfzig Jahre später der E-Commerce für Möbel begründete. Mit der Einführung der ersten Selbstbedienungs- und Selbstabholungsfiliale von IKEA 1965 wurde ein weiteres neues Kapitel im Möbelhandel aufgeschlagen, wel-ches die Möbelwelt revolutionieren sollte. Die Eröffnung der ersten IKEA-Filiale ausserhalb Skandinaviens (1973 in Spreitenbach bei Zürich) internationalisierte IKEAs Geschäftsmodell. Es folgte eine beispiellose weltweite Expansion, die IKEA zur klaren Nummer eins im Möbelhan-del machte. Die Grundlage der weiteren Unternehmensentwicklung legte Ingvar Kamprad 1976 mit «Das Testament eines Möbelhändlers», einem auf die Sortiments- und Preisphilosophie ausgerichteten Leit-bild. Die strikte Kundenzentrierung wird dabei genauso herausgeho-ben wie die Notwendigkeit, stets mit gutem Beispiel selbst voranzuge-hen. Bemerkenswert ist insbesondere auch diese Aussage: «Wir wei-gern uns, etwas nur deshalb so zu machen, weil es so schon immer gemacht wurde. Dadurch kommen wir weiter.» Dieser radikale Innova-tionsgedanke verlieh IKEA eine Unternehmenskultur, die neuen Ideen stets offen gegenübersteht, sie austestet, anpasst, ausrollt oder gege-benenfalls wieder einstellt – im Zeitalter der Digitalisierung ein un-schätzbarer Unternehmenswert.
14
B l i c k z u r ü c k : V o m T i s c h l e r z u m M ö b e l h ä n d l e r
Während IKEA seine Erfolgsgeschichte weltweit weiterschrieb, erlebte der Möbelhandel in den Achtziger- und Neunzigerjahren insgesamt goldene Jahre. In Deutschland kam mit der Wende ein grosser neuer Markt hinzu, den es zu erschliessen galt. Hier stiegen die Umsätze von 8.43 Mrd. Euro 1980 auf 24.3 Mrd. Euro 2010! In der Schweiz betrug das Marktvolumen Ende der Achtzigerjahre rund 4 Mrd. CHF (Woh-nungseinrichtungsmarkt) und stieg auf 5.85 Mrd. CHF 2010, den vor-läufigen Höchststand, während in Deutschland der Höchststand 2020 mit 33.44 Mrd. Euro erreicht wurde.
15
3Die Herausforderungen der Gegenwart
3.1Die Flächenfalle droht! Eine Bestandsaufnahme
Grosse Ausstellungsflächen galten lange als Garant für Erfolg im Mö-belhandel. Geräumige Einrichtungshäuser mit umfassender Sorti-mentskompetenz ermöglichten es, Kunden ein breites Angebot «zum Anfassen» zu präsentieren. Dieses Erfolgskonzept hat sich in den letz-ten Jahren ins Gegenteil verkehrt. Die Verkaufsfläche wird zur Kosten-falle.
Tendenz
Verkaufsflä-Verkaufsflä-
Land 2015–Besondere Faktoren
che 2015 che 2025
2025
Sehr hohe Flächendichte, seit 2015 kaum
Deutsch-ca. 25 Mio. ca. 22–23 Stagna-Wachstum. Die Top-10-Händler dominie-land m2Mio. m² tion ren die Hälfte des Marktes. Zunehmende
Konzentration und Omnichannel.
Conforama baute 42 Einrichtungshäuser
keine An-
modera-ab, was im Gesamtmarkt zu einer deutli-
Frank-gabe, niedri-leicht gerin-
ter Rück-chen Flächenreduktion führte. But & Con-
reich ger als ger als 2015
gang forama fusionierten, was die Konzentra-
Deutschland
tion erhöhte.
Sehr viele Schliessungen besonders auch
keine An-
deutlich ge-von kleinen Händlern. Mercatone Uno
gabe, verteilt deutlicher
Italien ringer als schloss 2019 infolge Insolvenz 55 grosse
auf 18’000 Rückgang
2015 Filialen. Das stationäre Netz dünnte stark
Shops
aus.





























